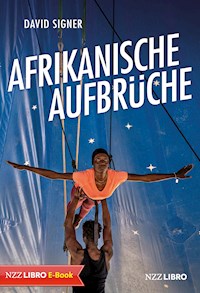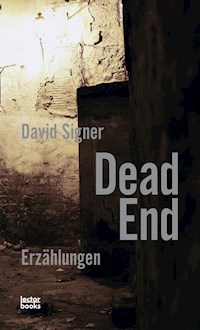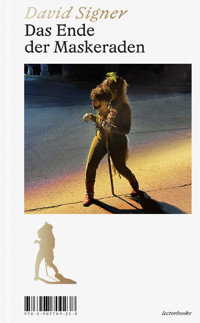
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: lectorbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mordverdacht in Guinea-Bissau. X., ein unfassbarer Trickster, ist tot. Sein Freund Erich blickt auf X.' ungewöhnliches Leben voller Identitätswechsel, Exzesse und Abenteuer zurück. X. war ein ruheloser Suchender, mit rätselhaften Beziehungen und undurchsichtigen Beschäftigungen, sei es in Paris, Kambodscha, New Orleans oder Westafrika. War er ein Lebenskünstler oder ein Getriebener, unaufhörlich auf der Flucht vor seinen Dämonen und sich selbst? Erichs Erinnerungen zeichnen ein Bild, das zunehmend Risse bekommt: ein wissbegieriger Autodidakt, ein Freund, der sich immer wieder neu entwarf, aber auch entzog, ein unsteter Vater. Sein plötzlicher Tod wirft Fragen auf: War es ein Unfall, ein Verbrechen oder die Folge eines Lebensstils voller dubioser Aktionen, gefährlicher Kontakte und Drogen? Schließlich kommt Erich selbst ins Visier der Ermittlungen. Seine Chronik ist nicht nur eine Hommage, sondern auch der zunehmend zweifelhafte Bericht einer ambivalenten Freundschaft, geprägt von Bewunderung, Neid und Verrat. »Das Ende der Maskeraden« ist eine fesselnde Erzählung über ein unkonventionelles Leben und einen beunruhigenden Tod, in der Wahrheit und Lüge, reale Identität und Masken oft kaum auseinanderzuhalten sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 124
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
David Signer
Das Ende der Maskeraden
Verlag und Autor danken der
Stiftung Pro Innerrhoden
für die Unterstützung dieser Publikation.
David Signer
Das Ende der Maskeraden
lectorbooks GmbH, Zürich
www.lectorbooks.com
Umschlagbild: David Signer
Buchgestaltung: Fabian Frey, Samara Keller, Christian Knöpfel
Satz: Peter Löffelholz
Lektorat: Patrick Schär
Gesamtherstellung: CPI books GmbH
1. Auflage 2025
© 2025, lectorbooks GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Eine Nutzung dieses Werks zum Training von KI-Technologien ist untersagt.
eISBN 978-3-907709-23-8
ISBN 978-3907709-24-5
Printed in Germany
Verantwortliche Person (Verlagsauslieferung in der EU):
Kontaktdaten des Verlags:
GVA Gemeinsame Verlagsauslieferung
lectorbooks GmbH
Göttingen GmbH & Co. KG
Dialogweg 7
Postfach 2021 37010 Göttingen
8050 Zürich
E-Mail: [email protected]
E-Mail: [email protected]
Telefon: (+49) 551-384 200 0
Von seinem Vater erzählte er nie. Von seiner Mutter erwähnte er eine einzige Begebenheit. Er muss etwa fünfzehn gewesen sein. Sie saß in ihrem Schlafzimmer, in ihrem blauen Stuhl.
Er sagte: »Ich gehe jetzt.«
»Wohin?«, fragte sie.
»Ich gehe. Vielleicht nach Paris. In zwei Stunden fährt der Zug.«
»Was machst du dort?«
»Ich weiß es nicht. Das ist das Schöne daran.«
Ihre Stimme versagte. Aber sie versuchte nicht, ihn zurückzuhalten. Sie wusste, dass er sowieso ging.
Er verließ das Zimmer, ohne zurückzuschauen.
Inhalt
1. Teil: X.' Leben
Erinnerungen an X.
Die panische Kindheit
Das Weite suchen in Paris
Im Raumschiff ins Burgund
Nullpunkt im Bauernhaus
Flavia, verschwommen
Der gefährliche Sog in Kambodscha
Mardi Gras und Nahtod in New Orleans
Mit Gautier in Bujumbura
Seelentausch in Abidjan
Wie man ein Alter Ego aufbaut
Post und Diebstähle in Dakar
Probleme mit den Frauen
Der Bumerang und der überlistete Tod
2. Teil: X.' Tod
Die Polizei ruft an
Die Kunstwerke
Am toten Punkt
Angst vor der Welt
Die Kinderfrage
Der zerstörte Fetisch
Der Rasensprenger
Ein klaffendes Loch
Der Stellvertreter und das Eis im Auge
Die abwesenden Frauen
Ihm hinterherstolpern
Die Hausdurchsuchung
Juristische Beratung
Stalking in Dakar
Der Anwalt hat eine Menge Fragen
Die Tropfen vom Fetischmarkt, nochmals
Ein Brief aus Bissau
Wie ich mir X.'s Tod erkläre
1. Teil: X.' Leben
Erinnerungen an X.
Vor zwei Monaten ist X. gestorben, im Alter von neunundvierzig Jahren. Man fand seine Leiche neben der Straße zum Flughafen von Bissau, der Hauptstadt des westafrikanischen Narco-Staats Guinea-Bissau. Wahrscheinlich wurde er ermordet. Warum? Keine Ahnung. Er war der freieste Mensch, dem ich je begegnet bin. Er ist schon so oft gestorben und als ein anderer wieder aufgetaucht, dass ich seinen Tod erst gar nicht ernst nahm. Er wechselte seine Identitäten, wann immer es ihm passte. Nicht, weil er Wert gelegt hätte auf sein Ich. Im Gegenteil. Er war ein Gambler, ein Trickster, ein Zauberer. Dabei wich er Problemen nicht aus. Er liebte sie.
Ich erinnere mich, wie er auf der Insel Gorée, als wir das Schiff zurück aufs Festland verpassten und kein Geld für ein zweites Ticket hatten, lachend ausrief: »Jetzt beginnen die Schwierigkeiten! Das Leben wird intensiver und kreativer angesichts von Hindernissen.«
Ja, aber dieses Mal waren sie keine Chance für Neues. Dead end, kein Spielraum mehr.
Einigen Leuten ist X. als Künstler bekannt. Wenn Galeristen Geld für seine Aktionen und Installationen bezahlten, so war ihm das recht, aber er definierte sich nicht als Künstler. Er versuchte, sich überhaupt nicht zu definieren, und schon gar nicht über Vergangenes.
Man hätte ihn einen Lebenskünstler nennen können, aber das lässt einen an Originale und Freaks denken, die sich betont nonkonformistisch geben. Er mochte keine Rolle spielen, auch nicht die des bunten Vogels. Ihm war jede Show zuwider. Auf den ersten Blick wirkte er fast unsichtbar. Er war zurückhaltend, ein wenig geheimnisvoll – ein Fremder. Seine Intensität spürte man erst, wenn man ihn kennenlernte. Eher Glut als Feuer. Er war kein Selbstdarsteller, nicht einmal eine »Persönlichkeit«. Es langweilte ihn, über sich selbst zu sprechen. Lieber tauchte er ins Leben anderer ein. Faszinierend war er durch sein Außer-sich-Sein, sein Interesse für andere, sein Fasziniertsein.
Das begann früh. Pablo, ein Mitschüler von ihm, erzählte mir, X. habe seinen Lehrer zur Weißglut getrieben, indem er dauernd Fragen stellte. Der Lehrer ertrug es nicht, einen Schüler zu haben, der sich wirklich für den Stoff interessierte.
Eigentlich war sein Name Xaver. Aber schon in seiner Jugend nannten ihn alle nur X. Ich selbst hieß Erich und heiße immer noch so.
X. lernte ich in den Achtzigerjahren in Zürich kennen. Ich studierte damals Betriebswirtschaft. Er besuchte ebenfalls hie und da Vorlesungen: Kriminalistik, Ägyptologie, Jura, Botanik, Psychologie, Ethnologie und manchmal auch Ökonomie. Eine Matura hatte er wohl nicht, er besuchte die Vorlesungen einfach so. Er wohnte in Biel, einer Schweizer Stadt an der deutsch-französischen Sprachgrenze. Was ihn dorthin führte, weiß ich nicht mehr, aber die Zweisprachigkeit gefiel ihm wohl. Leben in der Übergangszone. Er hatte sich vorher ein Jahr lang in Paris herumgetrieben und verspürte wie viele Autodidakten einen chaotischen Hunger nach Wissen. Nach meinem Uni-Abschluss fand ich eine Anstellung bei der Security-Versicherung und ging für meinen Arbeitgeber ebenfalls nach Paris, wenn auch unter anderen Umständen als X., der dort unter Punks und Clochards gelebt hatte. Dann wechselte ich in die Münchner Zentrale, während sich X. in Asien und Afrika aufhielt. Dank meiner Französischkenntnisse und meiner Vertrautheit mit dem französischen Versicherungswesen besuchte ich beruflich immer wieder Länder in Westafrika, wo ich X. gelegentlich wiedersah.
Heute wohne ich wieder in Zürich; ich habe noch promoviert, aber zu einer grandiosen Karriere reichte es nicht. Ich arbeite immer noch bei der Security, in der Abteilung Risk Management.
Manchmal lagen lange Pausen zwischen unseren Begegnungen. Wenn ich ihn wiedersah, hatte ich oft das Gefühl, einen neuen Menschen kennenzulernen. Einen Mann mit vielen Gesichtern und vielen Namen. Ich selbst bin stabiler und auch langweiliger; aber etwas verband uns, sonst hätte unsere Freundschaft nicht Jahrzehnte überdauert.
Nach X.' Tod empfand ich das Bedürfnis, mit Weggefährten von ihm Erinnerungen auszutauschen. Beim Wühlen in alten Dokumenten las ich einige Briefe und E-Mails wieder. Ich habe versucht, aus diesen Reminiszenzen eine Gedenkschrift zusammenzustellen, einen ausführlichen Nachruf, den ich seinen Bekannten und Verwandten zukommen lasse. Es ist meine Trauerarbeit nach diesem unfassbaren Tod.
Ich fand die federleichte Prinzipienlosigkeit von X. immer cool. Aber manche fühlten sich durch diesen Schlawiner provoziert oder reagierten empört auf seine Unmoral, die jedoch eher Amoral war, mit viel Amor und jenseits von Gut und Böse.
In Abidjan lernten wir eines Abends Valérie kennen, seine spätere Frau, mit der er zwei Kinder hatte, Fabian und Joy. Es war eine On-off-Beziehung, oft wusste man nicht, ob sie noch ein Paar waren oder nicht. Am längsten lebten sie in Dakar zusammen. Ansonsten waren die Kinder zeitweise bei ihm, zeitweise bei ihr. Auch wenn er ihr nicht treu war, so war er ihr doch immer verbunden und loyal. Das galt für alle wichtigen Menschen in seinem Leben, sogar wenn sie bereits tot oder verschwunden waren wie seine frühere Freundin Flavia oder die Gelegenheitsbekanntschaft Sten. Er zitierte gerne einen Satz aus Der kleine Prinz, den er von seinem Vater hatte: »Du bist ewig für das verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast.« Es ist seltsam, dass ihm sein Vater, der meist abwesend gewesen war und nie in X.'s Erzählungen vorkam, ausgerechnet diese Ermahnung mitgegeben hatte.
Auch ich fühlte mich X. immer verbunden, selbst wenn wir uns jahrelang nicht sahen. Ich frage mich allerdings rückblickend, ob es für ihn ebenfalls so war oder ob er mir vielleicht wichtiger war als ich ihm.
In den letzten Jahren hatte ich engeren Kontakt zu Valérie als zu X., auch weil sie, Fabian und Joy inzwischen wieder in der Schweiz lebten, so wie ich. Ich bat sie letzte Woche um ein Statement zu X., für mein Erinnerungsalbum. Dies war ihre Antwort:
Ein Tausendsassa, der eine Wand voller Ordner in einem Taschentuch verschwinden lassen konnte. Einige sagen, man habe ihn zuletzt auf dem nassen Pier am Hafen von Bissau gesehen, wie er im Nebel verschwand. Vielleicht hatte er sich mit Kokainschmugglern eingelassen, neben dem verrosteten, halb versunkenen Kahn an der glitschigen Mole. Andere sagen, er sei von den labyrinthischen Gassen in Ngor verschluckt worden, an einem Novemberabend an der senegalesischen Küste, mit einem Äffchen an der Leine, dem er folgte. Kann es wirklich sein, dass der Houdini dieses Mal nicht mehr entkam? Ich vermisse ihn.
Die panische Kindheit
X. wurde im Vorfrühling geboren, der Zeit der Schneeglöckchen. Ein Anfänger, so sah er sich sein Leben lang. Kompetenz misstraute er. Mit seinem spanischen Sandkastenfreund Pablo wollte er einen Stollen durch die Erde bohren, bis nach Australien oder Neuseeland. Aber dann bekam er ein grünes Dreirad zum Geburtstag, und das Unternehmen verlief im Sand.
Etwas später nahmen sie ein gegenteiliges Projekt in Angriff: Aus Styroporplatten bauten sie eine Rakete. Sie schrieben an die NASA, um sie über die Fortschritte ihrer Konstruktion auf dem Laufenden zu halten. An der Seite war ein mit Wasser gefüllter Ballon befestigt. Falls die Rakete in Brand geriete, würde das Feuer den Ballon zum Platzen bringen und sich so von selbst löschen. Sie boten der NASA an, ihr die geniale Idee zu verkaufen, aber sie erhielten nie eine Antwort.
Fünfzehn Jahre später explodierte die Raumfähre Challenger. Hätte man doch auf sie gehört.
Mir liegt das Tagebuch vor, das X. mit dreizehn schrieb. Darin findet sich der Satz: Vielleicht ist die Welt eine Nebensache. Er spricht wie ein Außerirdischer, der diesen idiotischen Planeten von fern betrachtet. Ein zufälliger Besucher, der nicht allzu viel Zeit hat, sich mit dem Nonsens hier zu beschäftigen. Er hat Wichtigeres zu tun, zum Beispiel, sich eine Rakete zu bauen, um so rasch wie möglich wieder abzuhauen.
Zwei der frühesten Träume, an die er sich erinnert: Einmal flüchtete er aus einem Gefängnis, ein anderes Mal von einer Sklavereiplantage.
Da das Raketenprojekt scheiterte, musste er wohl oder übel hierbleiben und sich mit den herrschenden Verhältnissen arrangieren. Zu jener Zeit bekam er eine Brille verschrieben. Im Tagebuch äußert er die Angst, eines Tages zu erblinden, weil ihm die Außenwelt so gleichgültig ist.
Mit Pablo und ein paar weiteren Freunden gründete er eine Detektei. Sie beschatteten verdächtige Individuen. Ein italienischer Bauarbeiter, an einer Renovation in seinem Stadtviertel beteiligt, war offenbar in Wirklichkeit ein Mafioso. Sie überwachten die Zielperson in Schichten rund um die Uhr und realisierten, dass sie einer gigantischen Verschwörung auf der Spur waren.
Die Mitgliedschaft in der Detektei war geheim und unterstand dem Schweigegebot. Eine verschworene Gemeinschaft. Sie operierte im Untergrund, in einem verstaubten, schummrigen Keller, genannt »das Laboratorium«. Dort trafen sich die Jäger des Bösen jeweils nach Mitternacht, nachdem sie von zu Hause weggeschlichen waren.
Einen richtigen Verbrecher konnten sie zwar nie dingfest machen. Aber sie wälzten Kriminalistik-Fachbücher – meistens waren es einfach Krimis – und lernten, Fingerabdrücke zu nehmen oder jemanden raffiniert zu verhören. Sogar mit Foltertechniken beschäftigten sie sich, zumindest theoretisch. Es war eine Übung, sagten sie sich, wenn sie sich gelegentlich ihre mageren Resultate eingestanden. Sie bereiteten sich auf den Ernstfall vor, auf den Showdown, der nicht mehr allzu lange auf sich warten ließ, da waren sie sich sicher.
Ein paar Wochen lang brauten sie Zaubertränke. Sie füllten sie in Fläschchen ab und verkauften sie. Sie behaupteten, mithilfe der Flüssigkeiten könne man unsichtbar oder ein anderer werden. Oder sie würden übermenschliche Kräfte verleihen, wie die Fähigkeit zu fliegen. Am Anfang lief das Geschäft gut, aber dann sprach sich herum, dass die Zaubertränke nicht wirkten, und der Markt brach zusammen.
Warten und Hoffen, schrieb X. in sein Tagebuch. Er fühlte sich wie in der Verbannung; wusste, dass er ausharren musste. Wie lange?, fragte er sich panisch. Vielleicht für immer. Oder eher: bis zum jähen Ende, wenn es zu spät war.
Das Weite suchen in Paris
Immer wieder versuchte er, sich abzusetzen. Mit fünfzehn schaffte er es nach Paris. Die einsamen Nächte rund um Les Halles. Es war düster dort – damals, als die Märkte schon abgerissen waren, aber das Einkaufszentrum Forum und der Bahnhof Châtelet noch nicht standen. Alles war chaotisch, zwischen Abbruch und Aufbau. Es wimmelte von Dealern, Obdachlosen, Huren, Süchtigen und Kleinkriminellen. In einer Seitengasse gab es einen schummrigen, muffig riechenden Sexshop. Die Besitzerin, eine korsische Vettel, ließ ihn manchmal dort schlafen, wenn er zugleich als Nachtwächter fungierte. Damit niemand die aufblasbaren Gummipuppen klaute oder heimlich benutzte. Sie war früher Prostituierte auf der Rue Saint-Denis gewesen und veranstaltete noch gelegentlich Senioren-Sexpartys im Keller ihrer billigen Wohnung in der Banlieue. Da konnte X. sich als nackter Butler ein paar Francs verdienen. Für einige Stunden war er everybody's darling und fühlte sich wie ein Revuegirl vom Moulin Rouge aus einem Bild von Toulouse-Lautrec. Wenn er später Leuten davon erzählte, waren sie schockiert und sprachen von Missbrauch Minderjähriger und Traumatisierung. Sein Problem damals waren jedoch nicht diese Eskapaden, sondern die langen Pausen dazwischen, die Langeweile, die Leere.
Es gab ein beheiztes Antiquariat, in dessen Untergeschoss er Nachmittage verbrachte und ganze Romane las, versteckt zwischen den Regalen. In den Straßen fühlte er sich fremd unter den Straßenkindern und den alten Pennern. Nach Wochen der Desorientierung lernte er ein paar Punks kennen. Einige von ihnen stammten aus Berlin. Sie lebten in besetzten Häusern, tickten ähnlich wie er und kannten die Bäckereien, wo abends unverkaufte Brötchen und Croissants in Plastiktüten vor die Hintertür gelegt wurden. Nachts tranken sie Hustensirup, um sich warm zu halten. Es war das erste Mal, dass er diese Art High erlebte. Sie hörten Jimi Hendrix. Batteriebetriebene Kassettengeräte. Manchmal verfingen sich die dünnen, schmalen Bänder im Magnetkopf und man musste sie sorgfältig herausklauben, ohne sie zu zerreißen. Purple Haze war einer seiner Lieblingssongs. »Excuse me while I kiss the sky.« So fühlte er sich unter dem Kodein. Als würde er den Himmel küssen, in purpurnen Dunst gehüllt. Himmelstürmende Euphorie. Er erzählte mir, dass er einmal, unter dem Einfluss des Opiats, angestrengt versuchte, einen negativen Gedanken oder ein schlechtes Gefühl an sich heranzulassen. Es gelang ihm nicht, sosehr er sich auch Mühe gab. »Das Seltsame war«, sagte er, »dass mich dieser extreme Glückszustand irgendwann langweilte. Ich fand es anstrengend und wartete darauf, wieder normal zu werden. Vom Himmel oder der Decke wieder auf den Boden herunterzukommen.« Das bewahrte ihn wohl davor, wie die meisten seiner Squatter-Kollegen dem Heroin zu verfallen.
X. war im Februar nach Paris gekommen und überlebte die Kälte nur knapp. Dann folgte der Sommer, den er im wolkenlosen Himmel verbrachte. Als im Oktober bereits wieder Schnee fiel, zog er zuerst mit den Vögeln Richtung Süden, aber dann ließ er die Kiebitze, Rauchschwalben, Hausrotschwänze und Graureiher ohne ihn weiterfliegen, kaufte mit dem letzten Geld einen königsblauen Wollpullover und fuhr per Autostopp in die Schweiz zurück.
Im Raumschiff ins Burgund
Es muss Mitte der Achtzigerjahre gewesen sein, wir waren Anfang zwanzig, als ich X. in seiner Wohnung in Biel besuchte.
Gegen Mitternacht sagte er: »Ich habe da noch ein paar Pilze.« Er zerkleinerte sie und mischte in zwei Gläsern ein braunes Gebräu an. Jeder leerte ein Glas, wartete ein bisschen, und dann dachten wir beide ans Burgund. Herbstbäume, alte Schlösser mit Weinkellern, Nebel über dem Kanal, Laubfeuer, Dijon-Senf. Wir gingen wortlos die Treppe hinunter, setzten uns in seinen alten crèmefarbenen Mercedes und fuhren los. Une escapade.