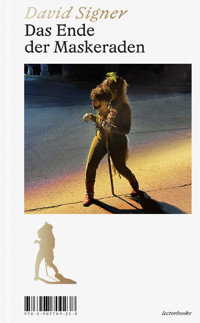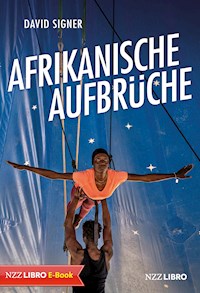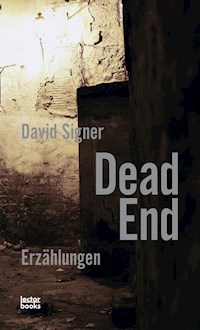Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Peter Hammer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
David Signer ist der Hexerei in Jahren der Feldforschung in Westafrika sehr nahegekommen; in engem Kontakt mit Heilern ist er zu der Einsicht gekommen, dass die Hexerei im sozialen, ökonomischen und politischen System eine höchst normative, konservative Funktion übernimmt. Aus Angst vor den Folgen der Zauberei verzichtet der potenzielle Aufsteiger zugunsten der Unauffälligkeit auf seine Ambitionen. Er verteilt das Erworbene unaufhörlich und bringt es so zu keinem ökonomischen Wachstum. Oder er verlässt seine Heimat und schützt sich gegen die Neider durch Feticheure und Opfer. Eine Entwicklung der Gesellschaft in Westafrika wird so effektiv verhindert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 808
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
David Signer
Die Ökonomie der Hexerei
oderWarum es in Afrika keine Wolkenkratzer gibt
Publiziert mit Unterstützung des Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung
EDITION TRICKSTER IM PETER HAMMER VERLAG
Inhalt
EINLEITUNG
Worum es geht
Seltsame Zugänge
Was steckt dahinter? Die Frage der Hexerei
EXPEDITIONEN MIT ZAUBERERN
Eine erste, persönliche Annäherung
Die Geisterpriesterin
Der Féticheur
Verwirrung als Erkenntnismittel
Übertretungen des Bischofs – Stärke
Übertretungen des Agronomiestudenten – Sex
Übertretungen des Schweizers – Sparen
Übertretungen des Ego – Distanz
In Coulibalys WeltDer Féticheur aus Mali
Der Mann, der mit bloßen Worten ein Huhn töten konnte
Coulibaly sagt wahr
Potenz und Grenzen
Eine Zeichnung, die dich reich macht
Im Netz. Die Textur des Analphabeten
Immer wieder: Kauris, Geister, Opfer und Gris-Gris
Das Geheimnis des Fetischs
Bei der Polizei und am Wasser
Die Reise nach Tiengolo
In den Dörfern Bélédougous: Zwillinge, Schlangen und der blinde Peul
Größenwahn und Liebe
In den Brei schreiben
Träume in Mopti
Warum muss man bis zu den Dogon reisen, um zu erfahren, wie viele Kinder man hat?
Rückkehr an die blaue Lagune
Rechnungen begleichen
Baba, die Familie und das WortDie Griots aus Burkina Faso
Jäger, Schmiede und Griots
Als ob die Zeit stehen bliebe
Die Reise nach Koumbara (Baba, Bobo, Bwaba, Bubu)
Auf dem Dorf: Begrüßung, Schenkung, Segnung (oder Verhexung)
Ist der Vater immer noch nicht zufrieden?
Big Brother is watching you
Clémentines GeisterTrance und Besessenheit in Abidjan
Ein aufmüpfiger Fahrer und eine rachsüchtige Schlange
Vielschichtiger Lebenslauf
Eine Beziehung etablieren
Die Stimme der Geister
Abermals: Wie sie Féticheuse wurde
Liebesübersetzer, Bluttrommel, Gris-Gris-Kraft
Eine afrikanische Kassandra
Eine Waschung mit Rum und Hölzern
Das Opfer: Hühnerblut, Rum, Kaolin und Hirse
Die jährliche Opferzeremonie für die Geister
Die Geister um Erlaubnis für Filmaufnahmen fragen
Die Heilzeremonie in Bonoua
Die Lackmusprobe der Trance
Die Ankündigung einer zweiten Initiation
Eine geisterhafte Besucherin von weit her
Die neu geweihte Féticheuse zeigt sich
Die jährliche Opferzeremonie auf dem Dorf
Wahn-, Warn- und WahrträumeVorahnungen und Wunder in Guinea und Senegal
Kribi und verkohltes Küken gegen Aids
Ein neuer Fetisch
Ein erster Eindruck von Guinea
Falsche Frauen und zwei weise Marabouts
Die Malinké-Wahrsager: Tote Frau, erfreulicher Brief
Wenn die Féticheure ihr Netz auswerfen
Die Vorahnung des ausgehobenen Loches
Hatte Coulibaly von Siguiri und dem Alten auch bloß geträumt?
Sand in die Augen gestreut
Ein Fetisch, der (nicht) spricht
Wasser und Feuer
Coulibaly auf der Fährte eines unheimlichen Großvaters
Der Elefantenfetisch gibt etwas von sich
Geht der Tod der Großmutter auch auf das Konto des Großvaters?
Aufstieg auf unbestimmte Zeit verschoben
Die Traumungeheuer sind in Wirklichkeit die Hexer
Der Tod des Onkels
Magischer Geleitschutz
Regen rufen und Kopf abbeißen
Odysseus, Eulenspiegel und Baron von Münchhausen in Afrika
Die Rivalen pulverisiert
„Es soll dir nicht besser ergehen als mir“
Ist Geld etwas Reales? (Die Geldverdoppler-Marabouts)
Geld als (uneinnehmbares) Luftschloss
Das Dosenwunder von Ferkessédougou
Initiation in die Kunst des Heilens und Krankmachens
Ich soll lernen, Hexen und die Zukunft zu sehen
Eine Vorahnung von Bösem
Die Welt der Kauris
Der Heiler und das Unheil
Eine Konsultation in Abwesenheit des Betroffenen
Lesen im Sand
Ein Versuch, die Welt zu ordnen
Das zufällige Reale strukturieren
Wie die Zeichen heilen
Coulibaly und Prof. Gueye im Vergleich
Tropischer Hyperhumanismus
Die persönliche Parksäule
Des Menschen Hörigkeit
Nanette oder Warum es in Afrika keine Wolkenkratzer gibt
Die hinterhältige Stiefmutter
Humanismus als Humus für Hexerei
Steckt hinter dem Herzinfarkt die neidische Tante?
Hänsel und Gretel bei den Mauren
Das Rätsel des Sechsten Sinns
„SIE LASSEN DICH NICHT WACHSEN“
Die Ökonomie der Hexerei
Der tödliche Neid
Die Hölle, das sind die andern – aber ohne sie wäre man nichts
Den Bruder oder gar den Vater überholen
Die Entwertung der greifbaren Realität
Hexerei versus Entwicklung („Arbeiten bringt nichts“)
Der afrikanische Autoritarismus
Der freigebige Chef
Magischer Schutz vor Hexerei
Opfer und Gewalt
Allgegenwart der Opferlogik
Neid, Sündenbock, Opfer
Die unsichtbare Gewalt
Die Hexerei als Teil der Kultur
Die Unantastbarkeit des Gegebenen
Bitte – Drohung – Hexerei (Eingeforderte Gaben)
Kredit und Schulden
Korruption und Nepotismus
Vermeidung von offenen Konflikten
Selbstlosigkeit
Liebe und Sexualität
Geiz ist schlimmer als Verschwendung
Eine zirkuläre und hierarchische Zeitauffassung
Die Hexerei als Fluchtpunkt
Literatur
Einleitung
Die afrikanischen Heiler waren für mich geradezu der Inbegriff des Geheimnisvollen und Fremden, und damit dürfte ich in unserer Kultur kaum alleine dastehen.
Schon als Kind faszinierten mich Geschichten über Zauberer, Medizinmänner, Schamanen, Geisterbeschwörer und Wundertätige. Als Jugendlicher sah ich „Der Exorzist“, mit der Passage, wo nach all den fehl geschlagenen Versuchen, das besessene Mädchen zu beruhigen, ein Priester geholt wird, von dem man munkelt, er hätte viele Jahre im Busch verbracht, wo er von den Afrikanern in ihre geheimen Riten eingeweiht worden sei. Später hielt ich mich ein Jahr in Ostafrika auf, kam jedoch nie wirklich in die Nähe eines nganga oder witchdoctor, wie sie dort genannt werden.
Als ich 1994 dann zum ersten Mal in der Elfenbeinküste zu einer Féticheuse gebracht wurde, ging für mich damit ein langer Traum in Erfüllung, und erst recht, als ich später Coulibaly, einen Heiler aus Mali, auch persönlich kennen lernte. Endlich konnte ich in diesen so lange verschlossenen Raum eintreten und mich in dieses Andere versenken. Während dreier Jahre hatte ich Gelegenheit, mich mit der Gedankenwelt, dem Leben, den Methoden und der Umgebung der Heiler und Heilerinnen in Westafrika vertraut zu machen. Und obwohl mir diese Welt heute in gewisser Weise vertrauter ist als beispielsweise die Schweizer Bankenwelt (die Struktur des Sandorakels ist mir klarer als jene der Börse), ist sie in anderer Hinsicht auch immer rätselhafter geworden.
Denn im Prinzip hat ein afrikanischer Heiler denkbar wenig mit einem Arzt in unserem Sinne zu tun. Wenn man sich bloß auf die traditionellen Pflanzenmedizinen konzentriert, die verschrieben werden, dann hat man von der Welt, die den Patienten und den Heiler verbindet, wenig wahrgenommen und verstanden. (Und deshalb spreche ich im Folgenden auch nicht vom Heiler, sondern vom Féticheur, um diese Andersheit sogleich zu signalisieren.) Für uns ist ein Arzt ja eine Art Feinmechaniker, der den Körper gewissermaßen als eine weiche Maschine auffasst, die irgendwo eine Störung aufweist, die aufgefunden und repariert werden muss. Sucht in Afrika jemand aufgrund von Problemen einen Spezialisten auf, so wird dieser (abgesehen von den bloßen Herbristen) die Konsultation nicht etwa durch eine Befragung und Untersuchung des Patienten beginnen, sondern im Allgemeinen gleich zum Orakel übergehen, auf dessen Offenbarungen er dann sowohl die Diagnose wie die Therapie stützen wird. Das kann in Form von Kaurischnecken geschehen, die geworfen werden, wobei ihre Konstellation interpretiert wird. Vielleicht zeichnet der Féticheur auch Muster in den Sand, die dann verbunden und „gelesen“ werden. Handelt es sich um einen islamischen Marabout, kennt er vielleicht Techniken, die Steinchen seiner Gebetskette abzuzählen, um die resultierenden Zahlen sodann in Aussagen zu übersetzen. Oder handelt es sich um eine Geisterpriesterin, wird sie von diesen besessen und gibt dann in Trance deren Aussagen wieder. Aber immer handelt es sich um Methoden der Wahrheitsfindung, die wir kaum als rational, empirisch oder überprüfbar betrachten.
Meist weist die afrikanische Diagnose jedoch auf Ursachen hin, die unseren Tests und Instrumenten entgehen würden. Ursachen, die aus der „anderen Welt“ kommen, jener der Hexerei und der Geister. Auch die Behandlung ist entsprechend vor allem auf jene ausgerichtet. Natürlich spielen Medikamente eine Rolle; aber auch diesen wird erst Wirksamkeit zugeschrieben in Verbindung mit einer vorgängigen rituell-magischen Behandlung (die Pflanzen müssen zum Beispiel „besprochen“ werden). Wichtiger sind die verschriebenen Opfer (in Mali zum Beispiel oft ein bestimmtes Huhn und eine bestimmte Anzahl bestimmter Kolanüsse) sowie die Maßnahmen zur künftigen Abwehr des Bösen (zum Beispiel die gris-gris, in Leder eingenähte Schutzobjekte).
Wie man sieht, ist der afrikanische Féticheur zugleich weniger und mehr als unser Arzt. Er ist ebenso Psychologe, Familientherapeut, Seelsorger, Priester, Schiedsrichter, Zeremonienmeister, eine Art Performance-Künstler und last but not least eine Art Ökonom, Spezialist für Fragen der Lastenverteilung, Lastenumverteilung, Kosten, Schulden, Rückzahlung, Ausgleich. Dieser ökonomische Aspekt seiner Analysen und Behandlungen hängt zusammen mit Vorstellungen von Hexerei, die wiederum viel mit dem Problem des Neides zu tun haben. Ein großer Teil der Störungen, die zum Aufsuchen eines Heilers führen, wird mit den Phänomenen des zu schnellen Wachstums, der raschen Bereicherung, des überraschen Erfolgs und des überraschenden Sturzes in Verbindung gebracht, mit Fragen des Gebens und Verteilens beziehungsweise der Weigerung, genug abzugeben und den Folgen der daraus erwachsenden Missgunst. Opfer sind unter diesem Blickwinkel Geschenke des Wiedergutmachens, eine archaische Besteuerung, ein Wiedereinkauf ins Soziale.
Und damit ist man bereits im Herzen des afrikanischen Psycho- und Sozialsystems.
Worum es geht
Im Oktober 1994 führte ich in Man, einer Stadt im Westen der Elfenbeinküste, ein sehr interessantes Gespräch mit einem jungen Mann namens Jean-Claude.
„Hexerei“, sagte er mir, „ist das größte Hindernis für Entwicklung in Afrika.“
Ich fragte: „Meinst du Hexerei oder den Glauben an die Hexerei?“
„Hexerei. Hexerei ist eine Realität. Immer wenn jemand aufsteigt, Erfolg hat, überdurchschnittlich ist, riskiert er, verhext zu werden. Der Neid ist so allgegenwärtig. Das führt zu Angst, Entmutigung, Lähmung jeder Initiative. Hexer essen am liebsten Erfolgreiche, Diplomierte, Studenten, junge hoffnungsvolle Talente. Und am liebsten einen aus der eigenen Familie. Sie verteilen ihn in ihrer Gruppe, und das nächste Mal ist ein anderer dran, jemanden aus seiner Verwandtschaft zu offerieren. So geht das immer weiter. Hast du einmal mitgegessen, stehst du in ihrer Schuld. Opferst du dann nicht jemanden von den Deinen, geht’s dir selbst an den Kragen. In meiner Familie zum Beispiel ist es ein Bruder meines Vaters, der alle Erfolge verhindert. Seine eigenen Söhne reüssieren, aber alle anderen stranden. Ich selbst war ein guter Schüler; bis zur Abschlussprüfung, da versagte ich. Ich weiß selbst nicht warum. Deshalb konnte ich nicht weitermachen mit der Schule. Mir bleibt nur noch, auf einen Erfolg in der Lotterie zu hoffen!“
Jean-Claude ist ein Yacouba. Doch ich habe in den folgenden Jahren ähnliche Beschreibungen in den verschiedensten Regionen und bei unterschiedlichsten Leuten der ganzen Elfenbeinküste, aber auch in andern Ländern Westafrikas gehört.
Wie man aus meiner Frage heraushört, verstand ich Jean-Claudes Gedankengang, dass „Hexerei“ entwicklungshemmend sei, weil es den Ehrgeiz einschüchtert. Aber ich tendierte zu jener Zeit noch dazu, Hexerei als einen Aberglauben zu betrachten. Wäre Hexerei bloß eine Angelegenheit des Glaubens, wäre es für den Einzelnen prinzipiell möglich, das Problem zu überwinden. Heute stehe ich Jean-Claudes (oder der „emischen“) Sicht näher: Hexerei ist eine Realität, auch wenn ich vielleicht einschränken würde: eine soziale Realität. Das heißt: Auch wenn wir den Glauben an Versammlungen, wo die hoffnungsvollsten Familienmitglieder verzehrt werden, nicht teilen, so ist doch die Feststellung der zerstörerischen Kraft des Neides in der afrikanischen Gesellschaft nicht zu leugnen. Diese Kraft ist aber etwas anderes als eine Angelegenheit des individuellen (Irr-)Glaubens. Sie betrifft die Ebene der sozialen Tatsachen und Strukturen, der Soziologie. Dass es nicht einfach um (Individual-)Psychologisches geht, zeigt schon der Sachverhalt, dass jemand wie Jean-Claude das Problem haarscharf erfasst und ihm trotzdem nicht entkommt.
Offizielle Hexereianklagen können heute nicht mehr erhoben werden, Ordale sind in den meisten afrikanischen Staaten verboten. Der Hexereidiskurs ist inoffiziell geworden, dadurch aber auch entgrenzter, diffuser und allgemeiner. Seine Domänen sind heute, neben dem Psychischen (den Vermutungen und Ängsten) das Gerücht, das Geschwätz und die Behandlungszimmer der traditionellen Heiler. Aber die Weltsicht, die in der Hexerei zum Ausdruck kommt (die impliziert, dass individueller Erfolg und sozialer Aufstieg gefährlich sind, weil sie – potenziell tödliche – Neider anziehen), ist immer noch allgegenwärtig, auch wenn das Wort „Hexerei“ dabei gar nicht verwendet wird. Ich möchte das an einem weiteren kleinen Fallbeispiel veranschaulichen:
Abou ist ein junger Mann aus der Gegend von Odienné, der in Bouaké eine cabine téléphonique bedient. Eines Tages sagte er mir:
„Es ist besser nicht zu arbeiten, als zu arbeiten.“
„Warum?“, fragte ich.
„Weil es auf dasselbe rauskommt. Jeden Tag kommen zehn Leute, um mich anzupumpen. Weitere zehn kommen, um auf Kredit zu telefonieren. Ils me fatiguent jusqu’à ce que j’accepte. Es ist so viel Bargeld in der Schublade, ich kann nicht sagen, ich hätte nichts. Und ich kann auch nicht abhauen. Sie können mich den ganzen Tag bearbeiten, bis sie kriegen, was sie wollen. Und Ende des Monats habe ich zwar gegessen, aber ich stehe ohne einen Sou da, genau so wie die, die mich angepumpt haben und selber nicht arbeiten. Ich möchte nach London gehen. Du siehst mich seit zwei Jahren jeden Tag hier arbeiten, aber ich bin keinen Zentimeter vorwärtsgekommen. Ich muss weg.“
Wie zur Illustration dieser Situation hat Abou zwei Sprüche auf die Wand hinter sich geschrieben:
„L’enfer c’est les autres“ („Die Hölle, das sind die andern“) und „L’homme n’est rien sans l’homme„ („Der Mensch ist nichts ohne den Menschen“).
Man kann das afrikanische Dilemma wohl kaum prägnanter ausdrücken. Abou hat eigentlich alle Voraussetzungen und alles getan, um weiterzukommen. Er zeigt Initiative. Neben seinem Job in der Kabine unterhält er einen Kleinhandel mit allem Möglichem. Er ist intelligent, sprachgewandt und recht gebildet. Er ist aufgeklärter Muslim. Er hat die Provinz verlassen, um in die Großstadt zu kommen, wo er nicht mehr den engen Beschränkungen und Verpflichtungen der Familie untersteht. Trotzdem hat er nicht alle Verbindungen gekappt. Er wohnt bei seinem Onkel und geht von Zeit zu Zeit ins Dorf auf Besuch. Er ist umgänglich, gesprächig, allseits beliebt. Er ist weder verschwenderisch noch geizig. Er ist ledig und hat noch keine Kinder zu unterhalten. Er trinkt nicht und raucht nicht. Mit andern Worten: In einem friedlichen, recht prosperierenden Land wie der Elfenbeinküste müsste ein Mann wie er eigentlich weiterkommen. Warum kommt er auf keinen grünen Zweig? Er sagt es selber: Es liegt an der Art der herrschenden Sozialbeziehungen, und zwar vor allem, insofern sie Ökonomisches betreffen, konkret: an der Pflicht zu teilen und der Unmöglichkeit zu sparen.
Um die Unterschiede zum europäischen System noch schärfer herauszuarbeiten, muss man sich fragen, was denn passieren würde, verweigerte Abou Kredite und Geschenke. „On va trop me fatiguer“, sagt er selbst. „Man wird mich ermüden, fertig machen.“ Das ist buchstäblich zu nehmen. All die selbst ernannten petits-frères würden den lieben langen Tag in seiner Kabine sitzen und ihn mit ihrem Gejammer an den Rand des Nervenzusammenbruchs treiben. Er kann ja nicht weg, er ist ihnen ausgeliefert! „On va gâter mon nom“, sagt er auch. „Man wird meinen Namen in den Schmutz ziehen.“ Das hieße, die Kunden blieben aus. Es gibt genug andere Kabinen in der Umgebung.
Aber vor allem kann einen jemand, den man erzürnt hat, verhexen.
„Die Hexen sind überall, du kannst ihnen nicht entfliehen. In Windeseile fliegen sie von hier nach Paris.“
„Was kann man dagegen tun?“
„Vor allem musst du freundlich sein mit allen. Wenn dich jemand um einen Gefallen bittet, solltest du ihn nicht ausschlagen. Du musst immer daran denken, dass es dir besser geht als vielen anderen. Vor allem in der Familie. Die Leute, die Angst vor Hexen haben, sind vor allem Junge, die in die Stadt gekommen sind und sich seit Jahren nicht mehr im Dorf haben blicken lassen. Jetzt schämen sie sich. Man muss für die ärmeren Verwandten sorgen, sonst tun sie dir etwas an. Ich schütze mich auch mit einem Koranvers, den mir mein Onkel gegeben hat. Manchmal schreibe ich auch Koranverse auf die Tafel, wasche sie ab und trinke das Wasser. Es ist schwierig, hier vorwärts zu kommen. Ich kenne einen Ort, wo neunzig Prozent der Jungen ausgewandert sind. Immer will jemand etwas von dir, und wenn du es ausschlägst, machen sie dir das Leben zur Hölle. In Afrika arm geboren zu werden, heißt arm zu sterben. Der Faule ist schlauer als der Fleißige, denn beide bringen es gleich wenig weit, bloß dass der eine ein leichteres Leben hat als der andere.“
Das Schicksal Abous erinnert an jene moderne Legende, die in verschiedenen afrikanischen Ländern kursiert und von einem Mann erzählt, der Gott begegnete. Der Allmächtige versprach, ihm zu geben, was immer er begehrte – und seinem Bruder das Doppelte. Der Mann dachte an eine Frau, ein Haus, ein Auto, aber die Vorstellung, dass sein Bruder zwei davon hätte, war ihm unerträglich. Schließlich bat er Gott: „Stich mir ein Auge aus.“
Um diese Thematik des Neids kreist – nebst anderem – die vorliegende Studie. Sie beruht auf Feldforschungen, die ich im September/Oktober 1994 in der Elfenbeinküste begann, im März/April 1996 ebenda fortführte und vom August 1997 bis Sommer 2000 in einem größeren Rahmen, der auch Mali, Burkina Faso, Guinea und Senegal umfasste, weiterverfolgte.
Hexerei ist ein fait social total. Die sozialen, ökonomischen und zum Teil auch die politischen Aspekte lassen sich tagtäglich und überall beobachten. Die religiöse Seite nicht, denn sie hat ihre genau zugewiesenen Orte, Personen und eine abgestufte Geheimhaltungspraxis. Einen großen Teil meiner Forschungszeit verbrachte ich mit den dafür zuständigen Spezialisten: Féticheur, Heiler, Priesterin, Tradi-Practicien, Komian, Marabout oder wie immer man diese Fachleute für Hexerei, Antihexerei und Geister, aber auch für Krankheiten, Heilpflanzen und Behandlungen nennen will. Die zwei Menschen, denen ich in dieser Hinsicht am meisten zu verdanken habe, sind Tiegnouma Coulibaly und Clémentine Roger.
Tiegnouma Coulibaly ist ein Bambara aus Mali, der in Abengourou im Osten der Elfenbeinküste wohnt und praktiziert. Ich glaube sagen zu können, dass wir im Laufe der Jahre, in denen wir uns kennen, zu Freunden geworden sind. Ich habe ihm Einblicke in meine Welt gegeben, aber vor allem er mir in seine und in jene von andern Féticheurs, die wir in der Elfenbeinküste, in Mali und Guinea zusammen besucht haben.
Clémentine Roger ist eine Abouré in Abidjan. Durch sie habe ich zum einen viel über die traditionellen Auffassungen der Akan über diese Dinge erfahren (insbesondere auch durch die Kontakte, die sich durch sie zu ihrem Herkunftsort Bonoua ergaben, wo ich andere Féticheusen aus ihrer Verwandtschaft kennen lernte), zum andern aber auch über die besondere Perspektive einer Frau, die, wie sie, praktizierende Féticheuse ist, zugleich jedoch gebildete Angehörige eines großstädtischen Mittelstands, und größtenteils eine ebensolche Kundschaft betreut. Auch mit ihr verbindet mich zu viel, als dass ich einfach von einer Informantin (und wäre es eine „Hauptinformantin“) sprechen könnte. Einen großen Teil meiner Forschung verbrachte ich reisend, mit Coulibaly, aber auch mit andern Heilern und mit Griots (auf die ich noch zurückkommen werde). Einen Höhepunkt in dieser Hinsicht stellte eine Reise dar, die ich mit Coulibaly in sein Heimatdorf Tiengolo im Westen Malis unternahm. Neben der Bekanntschaft mit seinem Vater, ebenfalls ein bekannter Heiler, ergaben sich Kontakte mit zahlreichen andern Féticheurs und Marabouts in den umliegenden Dörfern.
Diese Art der teilnehmenden Beobachtung – mit einem Heiler an seinen Herkunftsort zu reisen – erwies sich als äußerst fruchtbar in mehrerer Hinsicht. Erstens ist das Reisen eine zwanglose Möglichkeit, viel Zeit miteinander zu verbringen, Raum für Gespräche zu haben und Alltagsverhalten mitzuerleben. Zweitens erleichtert die Begleitung eines Heilers den Zugang zu andern Heilern (die in diesem Fall entweder mit ihm verwandt oder seine ehemaligen Lehrmeiste sind), und zudem können die beobachteten Heilmethoden nachher diskutiert werden – aufgrund der Konkurrenzsituation oft auch durchaus kritisch. Drittens stellt die Rückkehr eines Arrivierten (wie es Coulibaly gemessen an seiner Herkunft zweifellos ist) in sein Heimatdorf quasi die Verhexungssituation par excellence dar. Auf einem solchen Rückkehrer lastet die Verpflichtung, seinen gewonnenen Reichtum zu verteilen. Tut er das nicht, gilt er als Egoist, zieht Neid auf sich und also möglicherweise auch Verhexung. Viertens erlebte ich diesen sozialen Druck, der auf dem Arrivierten lastet, gewissermaßen am eigenen Leib, indem ich für diese Erwartungen als Coulibalys „Überdruckventil“ fungierte und geben musste, wenn jener nicht mehr konnte. Das eigene Involviertwerden in diese Erwartungen und die Aggressionen bei Nichterfüllung verschafften mir wohl auch manche vertieften Einsichten in die Psychodynamik von „Verhexung und Gegenmaßnahmen“. Fünftens ermöglichte die Bekanntschaft mit seiner ganzen Familie und weiteren Verwandtschaft auch eine psychologisch differenziertere Betrachtung seiner Lebensgeschichte, einer Lebensgeschichte, die von einer leidensvollen Kindheit und Jugend gezeichnet ist und die in mancher Hinsicht als typisch für viele Heilerbiografien – zumindest dieser Region – gelten kann.
Ich wiederholte diese Methode später mit dem Griot Baba Diarrasouba, einem Bwaba, mit dem ich, nachdem ich auch ihn schon länger kannte, von seinem jetzigen Wohnort Ferkessédougou im Norden der Elfenbeinküste eine Reise in sein Dorf Koumbara im Westen von Burkina Faso unternahm, die sich wiederum als äußerst aufschlussreich erwies. Auch sein Vater ist ein bekannter Heiler, der mir Kontakte zu verschiedenen andern Heilern der Umgebung ermöglichte. Darüber hinaus ist Baba Diarrasouba als Griot für das Erzählen von Familiengeschichten, Anekdoten, politischen Ränkespielen und Gerüchten prädestiniert und verfügt über ein immenses Netz von Kontakten durch alle Schichten und Landesteile, was ihn zu einem wunderbaren Reise und Gesprächspartner macht. Aber auch bei ihm stellte sich der ganze Komplex von Rückkehr, Verteilen-Müssen, Imponieren-Wollen (aber mit dem Vater und dem größeren Bruder nicht konkurrieren zu dürfen), Angst vor dem Vorwurf, unsozial zu sein usw., als äußerst konfliktreich dar.
Bei Erstkontakten mit Heilern und Heilerinnen realisierte ich rasch, dass es am einfachsten und ergiebigsten war, sich anstatt als Forscher (was meist bloß zu Missverständnissen führte) direkt als Klient einzuführen, um die praktizierten Methoden sogleich „von innen“ zu erleben. Das wird dadurch erleichtert, dass von einem Kunden gar nicht erwartet wird, dass er ein konkretes Problem präsentiert, sondern es am Heiler (der immer auch Wahrsager ist) liegt, den Grund des Kommens herauszufinden. Und erfindet auch immer etwas.
Ein „Aha-Erlebnis“ stellte für mich das Recherchieren eines Falles von Hexereiverdacht in Grand-Béréby dar. Nach einer Art Schneeballprinzip suchte ich immer neue Involvierte auf, die mich dann wiederum auf andere Beteiligte verwiesen. Das Interessante an dieser Geschichte (sie findet sich im Kapitel „Es soll dir nicht besser ergehen als mir“) ist, dass sie völlig ohne Institutionalisierung vor sich ging. Der Hexereiverdacht gegen die besagte Frau wurde eines Abends – nachdem der zugrunde liegende Konflikt sich seit einigen Wochen zugespitzt hatte – in einem Restaurant vor mehreren Gästen ausgesprochen und breitete sich in den nächsten Tagen im ganzen Ort aus, allerdings ohne dass irgendeine „offizielle“ Instanz involviert gewesen wäre. Die (gruppen-)psychologischen Faktoren des Hexereiverdachts ließen sich hier also insofern besonders gut studieren, als es eine kontinuierliche Entwicklung gab von einem „normalen“ Konflikt zu einem Konflikt, der in Begriffen der Hexerei formuliert und ausagiert wurde. Das war für mich lehrreich, weil in der klassischen ethnologischen Literatur eine Tendenz besteht, „Hexerei“ zu isolieren und zu institutionalisieren. Demgegenüber begriff ich anhand dieser an sich banalen Auseinandersetzung, dass – zumindest heute – die Relevanz der Hexerei in Afrika darin besteht, dass sie nicht so sehr einen klar abgegrenzten Sachverhalt markiert (Verdacht, Anklage, Strafe etc.), sondern eher einen kulturellen Stil, eine Struktur oder einen Aspekt bezeichnet, der praktisch alles prägt, was das Sozialleben ausmacht, auch wenn das Wort „Hexerei“ gar nicht ausgesprochen wird.
Der Hauptteil des vorliegenden Buches, die „Expeditionen mit Zauberern“, ist empirischem Rohmaterial gewidmet. Zuerst gebe ich einen Bericht wieder, den ich anlässlich meiner ersten persönlichen Begegnung mit Féticheuren verfasste. Ich hatte Letztere als Klient aufgesucht (das kann man, wie gesagt, auch ohne spezifisches Problem, etwa so, wie man hier zu einem Wahrsager geht; es ist dann an ihm, das Problem zu finden.) Das gibt einem gute Einblicke, hat aber den „Nachteil“, dass man persönlich involviert wird (etwa so, wie wenn sich ein Afrikaner, der den europäischen Psychoboom untersucht, einer Urschrei-Therapie unterzieht. Die schöne Dialektik von Eigenem und Fremdem kann dann ziemlich tumultös werden). Auch „Verwirrung als Erkenntnismittel“ handelt von Verstrickungen, um die man in einer längeren Feldforschung nicht herumkommt. Der Text ist ein Versuch, die eigene Verdunkelung für Aufklärungszwecke fruchtbar zu machen, sich ins äußere und innere Chaos zu begeben, um zu einer neuen Ordnung zu gelangen.
„In Coulibalys Welt“ porträtiert den Bambara-Féticheur Tiegnouma Coulibaly. Das Kapitel beschreibt vor allem auch die Reise in sein Heimatdorf in Mali, die ich mit ihm unternahm und die mir einige der familiären Probleme vor Augen führte, mit denen jemand konfrontiert ist, der einen Aufstieg geschafft hat, und nun einer Art verwandtschaftlicher Erpressung ausgesetzt ist: Entweder du gibst, oder du wirst verhext.
Das Kapitel „Baba, die Familie und das Wort“ behandelt eine ähnliche Problematik. Auch mit dem Bwaba-Griot Baba Diarrasouba unternahm ich eine lange Reise in sein Dorf, zu seinem Vater. Wie schon mit Coulibaly besuchten wir auch hier zahlreiche Heiler, und Baba, als Griot ein professioneller Vermittler, war für mich dabei ein unschätzbarer „Passepartout“. Aber auch für ihn war das Wiedersehen mit all den frères und sœurs nicht nur eitel Freude. Wehe, jemand hatte das Gefühl, beim großen Geschenkeverteilen übergangen worden zu sein! In der Nacht gehen die Hexen um, vor allem auf dem Dorf (sagen die Städter). Wir jedenfalls verbrachten keine einzige Nacht in Koumbara ...
Das Kapitel „Clémentines Geister“ zeichnet das Bild einer Féticheuse in der Millionenstadt Abidjan. Als Abouré-Frau gehört Clémentine Roger zur Akan-Kultur aus den Wäldern des südlichen Ghana. Damit vertritt sie auch in ihren Behandlungen einen andern Stil als die Leute aus dem Umfeld Coulibalys und Babas, die aus der Savanne im Norden kommen. Clémentine ist eine gebildete, städtische Kleinbürgerin mit Brille (tagsüber). In der Nacht, wenn sie konsultiert, ersetzt sie den Rock durch einen gelb-weißen pagne (das sind die Farben, die ihre Geister mögen). Ihre Brille legt sie ab, denn ihr Blick ist sowieso auf eine innere Ferne gerichtet, wenn sie sich das Gesicht mit Kaolin eingeschmiert hat, die Kalebasse mit dem Wasser vor ihrem Gesicht schwenkt und langsam in Trance fällt, bis der Flussgeist mit einer ganz unirdischen Stimme sich durch sie zu äußern beginnt. In solchen Séancen wird anschaulich, was die Afrikaner und Afrikanerinnen meinen, wenn sie so häufig davon sprechen, dass es neben der Tagwelt noch eine andere Ebene, eine surréalité gebe, die unsichtbar, aber an ihren Spuren auch am Morgen noch erkennbar sei, wie ein nächtlicher Föhnsturm. Für den, der Augen hat zu sehen.
In „Wahn-, Warn- und Wahrträume“ geht es vor allem um die Reisen, die ich mit Coulibaly zu Heilern in Guinea unternommen habe (ein Land, das oft als Hochburg der Féticheure bezeichnet wird, insbesondere auch, wenn es darum geht, sich gegen jemanden zu schützen, wie der Klient sagen würde; jemandem Schaden zuzufügen, wie das betroffene Opfer sagen würde). Viel Platz nehmen dabei die Schilderungen und Deutungen von Träumen ein, denen die Féticheure eine große Wichtigkeit beimessen (weil sie auch Einblicke in jene „andere Welt“ geben, in das verschlossene Studio gewissermaßen, wo der Film gedreht wird, den wir dann am Tag zu sehen bekommen und für real halten).
Das Kapitel „Initiation in die Kunst des Heilens und Krankmachens“ schildert schließlich, wie ich von Coulibaly eingeweiht wurde. Aus dieser „Innenperspektive“ werfe ich nochmals einen Blick auf die Funktion des Féticheurs als Heilers, beziehungsweise auf die Frage: Wie kann eine Therapie, die auf für uns extrem unwahrscheinlichen Annahmen basiert, Erfolg haben? Die Verfolgung dieser Frage geschieht mit Seitenblicken auf die Klinik „Fann“ in Dakar, wo mit modernen psychiatrischen Methoden gearbeitet wird, aber unter Berücksichtigung des traditionellen Krankheitsverständnisses. Möglicherweise ist ein Féticheur von der Art Coulibalys, der nie eine Schule besucht hat und den Kugelschreiber nur für seine Geheimschrift braucht, angesehener beim Durchschnittsafrikaner als der Psychiatrieprofessor mit seinen Diplomen und der Krawatte – und infolge dessen erfolgreicher, nicht nur was den Kundenandrang betrifft, sondern auch die (subjektiven) Heilresultate. Aber mit jedem Heilerfolg hat er die Vorstellungen von Hexerei und Geisterunwesen auch wieder bestätigt und perpetuiert.
Das Kapitel „Tropischer Hyperhumanismus“ schließlich kreist um das, was man den kulturellen „Humus“ des Hexereikonzepts nennen könnte: die extreme Ausrichtung auf den andern als Quelle des Glücks wie des Unglücks, die Personalisierung des Universums; man könnte auch sagen „Humanisierung“, sofern man berücksichtigt, dass damit das Leben der Afrikaner im Vergleich zu den „Weißen“ nicht nur ein Mehr an Nähe und Kommunikation aufweist, sondern auch an Personifizierung von Üblem, das „wir“ nicht unbedingt einer konkreten Einzelperson zuschreiben würden.
Seltsame Zugänge
Natürlich könnte man sich fragen, ob mit dem hier propagierten und praktizierten Zugang (der Forscher als Klient und damit zugleich Forschungssubjekt und -objekt) noch Distanz und Objektivität möglich seien. Nun, um es kurz zu machen: Man hat meist gar keine andere Wahl. Denn über das System, um das es hier geht, redet der Heiler im Allgemeinen nicht. Man redet im System – oder gar nicht. Natürlich kann man immer über irgendwelche Praktiken reden („muss man vier oder fünf Kaurischnecken vergraben“ usw.), und das war ja auch die Hauptbeschäftigung der konventionellen Ethnologie. Bloß: Ist das wichtig? Was Favret-Saada über das Hainland sagt, gilt auch für Afrika: Entzauberungsrituale zeichnen sich durch ihre Dürftigkeit und Zufälligkeit aus. „Ob dieses oder jenes Ritual angewandt wird, tut wenig zur Sache.“1 Dass der Heiler so tut, als sei es wichtig, gehört zur Funktionsweise des Systems. Hingegen haben die ausgesprochenen Worte ihre genau definierte Funktion. Das Wort im Zusammenhang der Zauberei ist Macht, nicht Information. Und deshalb kann ein Heiler auch nicht „Informant“ sein.
„Wenn in der Zauberei gesprochen wird, dann niemals, um zu informieren. Und wenn man informiert, dann nur, damit derjenige, der töten soll (der Zauberbanner), weiß, wo er zuschlagen muss. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes undenkbar, einen Ethnographen zu informieren, das heißt jemanden, der versichert, von diesen Informationen keinen Gebrauch machen zu wollen, der ganz naiv etwas wissen will, nur um es zu wissen.“2
Schlussfolgerung: Der Hexenglaube lässt sich nicht untersuchen, „wenn man nicht bereit ist, in den Situationen, in denen er sich äußert, und in der Rede, die ihn zum Ausdruck bringt, mit eingeschlossen zu werden.“3
Das heißt, es gibt also eigentlich nur zwei fruchtbare Positionen für den Ethnologen: Man beginnt als Kunde und endet als Lehrling oder Assistent (sowohl Coulibaly wie Clémentine drängten mich erst in die eine und dann in die andere Rolle).
Nochmals Favret-Saada (die ebenfalls als „Assistentin“ ihrer Informantin endete): „Wenn man einen Wahrsager hören will, gibt es also keine andere Lösung, als sein Kunde zu werden, das heißt, ihm den eigenen Wunsch zur Deutung vorzulegen. (Eine Konsultation ohne Bitte um Wahrsagung ist sinnlos, denn die Hellseherin sieht nichts, und für den Ethnographen gibt es nichts zu verstehen). Es kann bei dieser Gelegenheit nicht ausbleiben, dass der Forscher, wie jeder Einheimische – oder wie jedes wünschende Subjekt – selbst von der Verkennung betroffen wird ...“4
Diese involvierte Position impliziert ein paar Abweichungen vom ethnologischen Methodenhandbuch:
Die Verifizierung des Gesagten durch Dritte (durch unparteiische Zeugen) ist absurd, weil das Geschehen per definitionem außerhalb der Interaktion zwischen Kunde und Heiler (und „Hexer“) keine „objektive“ Realität besitzt, respektive sich erst im Behandlungszimmer konstituiert. Noch absurder wäre es, die Rede des „Verhexten“ mit jener der „Hexe“ vergleichen zu wollen. Im Prinzip ist überhaupt „Beobachtung“ (Distanz, Position der Exteriorität) von allem, was mit Hexerei und Antihexerei zu tun hat, ein Widerspruch in sich selbst. Man kommt nicht um „Partizipation“ (auch innere Partizipation, und das heißt zumindest vorübergehende Identifizierung mit dem System) und Subjektivierung (wo, wenn nicht an sich selber, erkennt man, „wie es geht“?) herum. Das schließt Theoretisierung nicht aus. Die wesentliche Rolle von Verteilen-Müssen, Verhext-Werden und Opfern ist mir erst klar geworden, als ich sie am eigenen Leib (will sagen als Klient) erfahren habe. (Ich begab mich damit den Heilern gegenüber in eine Position, die derjenigen der Heiler gegenüber ihren Verwandten auf dem Dorf glich).
„Man sieht“, schreibt Favret-Saada5, „dass es sich nicht genau um die klassische Situation eines Informationsaustauschs handelt, in der der Ethnograph hoffen könnte, dass ihm ein unschuldiges Wissen über die Vorstellungen und Praktiken des Hexenglaubens mitgeteilt wird. Denn wem es gelingt, sie kennen zu lernen, erwirbt eine Macht und hat die Folgen dieser Macht zu tragen: je mehr er weiß, desto bedrohlicher ist er und desto stärker ist er magisch bedroht.“
Das heißt, man geht durchaus eine Art von faustischem Pakt ein. Man verkauft seine Seele (lässt sich bis ins Innerste affizieren) und hofft dafür auf Wissen und vor allem, dass man irgendwann, im letzten Moment, den Kopf aus der Schlinge ziehen und ungeschoren zurück ins Studierzimmer flüchten kann.
Ich konnte in der Elfenbeinküste so sehr „klarstellen“ wie ich wollte; sobald sich irgendwo herumgesprochen hatte, worüber ich forschte, wurde ich als sorcier blanc bezeichnet, und am Ende meiner Initiation gab mir Coulibaly ein Papier, eine Art „Diplom“, das wir beide unterschreiben mussten und in dem festgehalten war, was der Ethnologe alles getan hatte „pour apprendre la sorcellerie et le fétiche, pour se libérer toute la vie et pour aider à ses enfants et ses proches“ – „Um die Hexerei und den Fetischismus zu erlernen und den Kindern und seinen Nächsten zu helfen.“
Was steckt dahinter? Die Frage der Hexerei
Ein großer Teil der Literatur über Hexerei in Afrika, insbesondere der Sechziger- und Siebzigerjahre, behandelt vor allem die Frage, unter welchen Umständen Hexerei auftaucht und wie soziale Faktoren ihre spezifische Ausprägung determinieren. Diese Werke6 sind funktionalistisch in einem doppelten Sinn: Sie untersuchen die Funktion der Hexerei im gesellschaftlichen Ganzen einer spezifischen Kultur, sie fragen aber auch danach, inwiefern die Hexerei Funktion (im mathematischen Sinne) von andern Größen ist (insbesondere solchen, die als grundlegender betrachtet werden, wie die Produktionsweise oder die Verwandschaftsorganisation).7
Diese Befunde scheiterten jedoch häufig daran, dass sich das Phänomen Hexerei als ziemlich immun (oder eigensinnig) gegen äußere Einflüsse erweist. Das wurde insbesondere in Modernisierungs- und Urbanisierungsprozessen deutlich.
Heute lässt sich einerseits feststellen, dass Hexerei – zumindest in Afrika – ein Phänomen ist, das relativ ubiquitär, unabhängig von spezifischen Konstellationen, auftaucht8, dass es andererseits aber sehr wohl über gewisse gemeinsame Charakteristika verfügt und sich mit andern Kulturelementen verbindet und so ein System bildet, das man mit dem Begriff „Hexereikomplex“ umreißen könnte (um anzudeuten, dass sich die einzelne Teile gegenseitig stützen, ohne dass man in diesem Ganzen die Hexerei als bloßen Effekt etwa von ökonomischen Gegebenheiten beschreiben könnte).
Das Ziel der vorliegenden Studie besteht also darin, das Phänomen Hexerei in der Elfenbeinküste (und Nachbarländern) mit all seinen psychischen, sozialen, religiösen, politischen und ökonomischen Implikationen auszuleuchten und herauszuarbeiten, inwiefern sich aufgrund dieser Befunde ein „harter Kern“ von Vorstellungen und sozialen Praktiken umreißen lässt, dessen Vorkommen sich mehr oder weniger über die ganze Region erstreckt.
Wenn die Verbreitung dieser spezifisch afrikanischen Hexereivorstellungen relativ unabhängig von sozialen, kulturellen, ökologischen und politischen Unterschieden ist9, stellt sich die Frage, ob und wie sich ein solches Phänomen erklären oder verstehen lässt – ein Phänomen, das uns in vieler Hinsicht als irrational, dysfunktional, anachronistisch oder entwicklungshemmend erscheint.
Die Hypothese lautet, dass sich nicht nur ein solcher formulierbarer kleinster gemeinsamer Nenner finden lässt, sondern dass die Hexerei das Kernstück eines ganzen Ensembles von Vorstellungen und Praktiken ausmacht, die zusammengehören und jenes System bilden, das Marc Augé den „Geist des Heidentums“10 nennt.
Das Theorie-Kapitel „Die Ökonomie der Hexerei“ interpretiert den Hexereiglauben in diesem Kontext vor allem als Angst vor lebensgefährlichen Neidern. Wie schon angetönt, geht es um folgende Überlegung: Wenn man, um es einmal etwas salopp auszudrücken, jedes hungrige Maul in der Familie stopfen muss (und die afrikanischen Familien dehnen sich tendenziell ins Unendliche aus, also findet sich immer irgendwo ein „Cousin“ mit Hungerbauch), weil man sonst fürchten muss, vom Zukurzgekommenen verhext zu werden, kommt man eigentlich nie dazu, etwas auf die hohe Kante zu legen. (Wer anhäuft, macht sich geradezu verdächtig.) Wie soll man so akkumulieren, investieren, längerfristig anlegen, planen, aufbauen? Was bedeutet so ein Sozial- und Ökonomiesystem – die Hexerei ist aus dieser Perspektive vor allem ein wirtschaftlicher Mechanismus – für eine kapitalistische Entwicklung, für die Modernisierung, für den Einzelnen, der es „zu etwas bringen will“? Das scheinen mir ganz nahe liegende Fragen zu sein. Sie wurden mir jedoch zum Teil übel genommen, bezeichnenderweise vor allem von gebildeten, linken Weißen. Sie witterten Neokolonialismus oder eine Art kulturellen Neorassismus. Die Afrikaner haben weniger Mühe damit. Die meisten, vor allem die Jungen, möchten sowieso bloß weg. Für sie steht es außer Frage, dass man es in Afrika auf keinen grünen Zweig bringt (wenn man nicht schon drauf sitzt). „On te laisse pasgrandir“ – „Man lässt dich nicht wachsen.“
Im Kapitel „Opfer und Gewalt“ geht um es die Frage, warum eigentlich ausgerechnet eine Opfergabe gegen Verhexung wirksam sein soll. Hält man sich vor Augen, dass das (potenzielle) Hexereiopfer vor allem jemand ist, der Neid auf sich zieht (weil er – relativ – viel hat und wenig gibt), so ist es nur logisch, dass sich die Situation beruhigt, wenn er gibt (das Opfer ist die Gabe par excellence, für niemanden und alle). Das Opfer hat daneben aber auch noch einen aggressiveren Aspekt, beispielsweise wenn einer Ziege alles Böse aufgeladen wird, bevor man ihr den Hals durchschneidet. Auch die Hexe hat diesen Aspekt des Sündenbocks, der für alles Übel stellvertretend den Kopf hinhalten muss. Anhand eines Hexereiverdachts in einem Dorf an der liberianischen Grenze wird gezeigt, wie infolge der Allgegenwart des Neides (der geradezu die Normalform des Wunsches zu sein scheint) sehr rasch praktisch jeder in den Ruf einer Hexe oder eines Hexers kommen kann. Tatsächlich zeichnen die Schilderungen von Eingeweihten (also von Leuten, die die Fähigkeit erworben haben, Hexen oder Geister zu „sehen“) das Bild einer gewissermaßen kannibalischen Gesellschaft, in der sich die Menschen unaufhörlich gegenseitig verletzen, krank machen, töten, verkaufen und „auffressen“. Der Sündenbock (als Opfer oder als Hexe) dient dazu, diese omnipräsente Gewalt zumindest einzugrenzen.
„Hexerei als Teil der afrikanischen Kultur“ folgt in den Grundzügen dem Werk L’Afrique a-t-elle besoin d’un programme d’ajustementculturel?, in dem der kamerunische Ökonom Etounga Manguelle die These vertritt, der wirtschaftliche und technische Entwicklungsrückstand des subsaharischen Afrikas hänge mit einem Gefüge von kulturellen Eigenheiten zusammen, das, wenn man es der vielleicht etwas polemisch und essentialistisch anmutenden Verwendung des Wortes „Afrika“ entkleidet und mehr als Idealtypus fasst, einiges gemeinsam hat mit Augés „heidnischer Logik“ und dem, was ich hier als Hexereikomplex bezeichne. Durch eine solche Einbettung in ein modellhaftes kulturelles System („modellhaft“ heißt: in der Realität werden kaum je alle diese sich gegenseitig stützenden Elemente in toto auftreten), versuche ich zu zeigen, dass Hexerei ein fait social total ist, das in alle Aspekte der Gesellschaft hineinreicht und kaum von heute auf morgen verschwinden dürfte, eher im Gegenteil in der Konfrontation von konservativ-traditionellen und modern-kapitalistischen Ausrichtungen sich noch verschärfen wird.
Diese Sichtweise steht etwas quer zur gegenwärtigen ethnologischen Diskurslandschaft.
Erstens sind Verallgemeinerungen, die über zwei oder drei Ethnien hinausgehen, verpönt (man kommt dann leicht in den Ruch eines Essentialisten), zweitens macht man sich bei Mutmaßungen über das Verhältnis von Kultur und Entwicklung sowohl bei den Entwicklungssoziologen verdächtig (nämlich als Kulturalist), als auch bei den Ethnologen (Religionsethnologen wollen normalerweise nichts mit so profanen Themen wie ökonomischer Entwicklung zu tun zu haben, schon gar nicht in Zusammenhang mit ihrer eigenen Domäne). Auch ist drittens das Betonen von Unterschieden heikel geworden (man macht sich verdächtig, othering zu praktizieren). Schließlich gilt das Kennzeichnen von kulturellen Praktiken als dysfunktional und entwicklungshemmend durch kulturell Außenstehende prinzipiell als politisch unkorrekt.
Nun, ich kann diese Einwände niemandem übel nehmen.
Ich selber war nämlich auch schockiert, als ich bei meinem ersten Aufenthalt im Agniland den von mir verehrten Ethnologen Jean-Paul Eschlimann kennen lernte, der von so tiefem Verständnis für die Agni zeugende Bücher geschrieben hatte, und er mir, als ich irgendwas von faszinierenden, fremden Denkformen redete, ziemlich barsch zu verstehen gab, dass die meisten Agni ihren Hexenglauben liebend gerne los würden, wenn sie nur könnten, weil er ihnen mehr Angst und kollektive Lähmung bereite als irgendwelche Einsichten in „andere Welten“. Und als ich etwas von „Entzauberung der Welt“ sagte, meinte er bloß: „Exotismus eines Neulings.“
Inzwischen gebe ich ihm völlig Recht. Man kann die magischen Denkformen faszinierend finden und soll versuchen, sie aus ihrer eigenen Sinnwelt heraus zu beschreiben, aber warum soll man, was ihre Konsequenzen beispielsweise für das ökonomische oder wissenschaftliche Leben betrifft, nicht genau so klar und kompromisslos sein, wie man es bei einer Analyse von gewissen Elementen der eigenen Gesellschaft wäre?
Wenn man mit Gellner11 davon ausgeht, dass sich soziale und logische Kohärenz umgekehrt proportional verhalten (was uns zugleich eine Möglichkeit zur Hand gibt, „soziale“ und „kognitive“ Herangehensweisen zu verknüpfen), dann sind Gesellschaften mit einem ausgeprägten Hexereikomplex solche, in denen soziale Kohärenz fast alles und logische Kohärenz fast nichts gilt. Jeder Ethnologe würde eine solche Gesellschaft in seinem Erdteil ohne Zögern als totalitär bezeichnen. Wer hingegen in bezug auf das traditionelle Afrika solche Ausdrücke verwendet, wird selber als totalitär gebrandmarkt. Das ist, gelinde gesagt, inkonsequent.
Wenn man nun versucht, gewissermaßen einen kleinsten gemeinsamen Nenner zu formulieren, so könnte man folgendes Phantombild der Hexe zeichnen, das vermutlich (das bleibt noch genauer zu überprüfen) mehr oder weniger für das ganze subsaharische Afrika gelten könnte12:
Die Hexe kann beiderlei Geschlechts sein; häufiger ist sie eine Frau. Sie verlässt nachts ihren Körper (oft in Form eines Vogels oder eines andern Tieres) und trifft sich mit andern Hexen. Die Hexen wählen ein Opfer aus der Familie einer der Hexen; diese Hexe „holt“ das betreffende Opfer, das anschließend verteilt wird. Ihr Blut wird getrunken oder ihr Fleisch gegessen (bzw. das unsichtbare „Doppel“ des Blutes oder des Fleisches); das schwächt die Person, macht sie krank und tötet sie am Ende. Jede Krankheit kann so auf Hexerei zurückgeführt werden.13
Wenn das solcherart skizzierte Phänomen der Verhexung und ihrer Gegenmaßnahmen tatsächlich eine frappante Verbreitung und Ähnlichkeit in ganz Schwarzafrika aufweist (wie erwähnte Autoren nahe legen), es sich aber andererseits nicht einfach auf gewisse spezifische soziale, ökonomische oder politische Faktoren zurückführen lässt, stellt sich die Frage, ob es denn ein allgemeineres Denk- und Wahrnehmungsmuster, eine idéo-logie im Sinne Marc Augés14 gibt, in das es eingebettet ist, und das, wenn es nicht ein Reflex der Sozialbeziehungen ist, diese vielleicht sogar im Gegenteil strukturiert. Nach Augé ist das „Heidentum“ oder die „heidnische Logik“ (womit primär einmal alle polytheistischen Glaubenssysteme zu verstehen sind, aber auch durchaus eine „heidnische“ Schicht in monotheistischen Gesellschaften und sogar Individuen15) durch folgende Merkmale charakterisiert, beziehungsweise vom Christentum und andern Monotheismen abgegrenzt:
„Es ist niemals dualistisch und stellt weder den Geist dem Körper noch den Glauben dem Wissen entgegen.“
16
„Gleichsetzung der Sinnbezüge mit den Machtbeziehungen und dieser mit jenen, die keinen Platz für einen dritten Begriff lässt, die Moral, die ihnen äußerlich wäre.“
17
„Es postuliert eine Kontinuität zwischen biologischer und sozialer Ordnung, die einerseits die Opposition zwischen dem individuellen Leben und der Kollektivität, innerhalb derer es sich abspielt, relativiert und andererseits dazu tendiert, aus jedem individuellen oder gesellschaftlichen Problem ein Lektüreproblem zu machen: Es postuliert, dass alle Ereignisse zeichenhaft und alle Zeichen bedeutungsvoll sind. Das Heil, die Transzendenz und das Mysterium sind ihm wesensmäßig fremd. Folglich nimmt es das Neue interessiert und tolerant auf; stets bereit, die Liste der Götter zu verlängern, denkt es additiv und alternativ, nicht synthetisch.“
18
„Für bestimmte Kulturen, die ich vorschlage «heidnisch» zu nennen, ist die Definition der Person untrennbar verbunden mit der Beziehung zum Andern, in Bezug auf Erblichkeit, Einfluss, Zusammensetzung und Schicksal.“
19
Etwas zugespitzt könnte man also zusammenfassen: weder eine scharfe Trennung von Geistigem (Ideellem, Seelischem, Spirituellem, Glauben) und Körperlichem (Materiellem, Wissen), noch von Moral (Sinn) und Macht, noch von Subjekt (eigenem) und anderem.20
Diese Skizzierung einer heidnischen Logik scheint mir nun einen interessanten Weg zu eröffnen, das Phänomen der Hexerei in einen größeren Kontext von kulturellen Vorstellungen und sozialen Strukturen zu stellen und es in einer nichtreduktionistischen Art in Bezug zu setzen zu Fragen der Ökonomie und der Politik.
Folgende Zusammenhänge scheinen mir in diesem Zusammenhang wichtig (und werden sich anhand des gesammelten Materials veranschaulichen lassen):
Politischer Aspekt: Während bei uns die Macht in gewisser Hinsicht immer suspekt ist und unter Legitimationsdruck steht, ist das Machtstreben, die Aufstiegsmentalität bzw. die soziale Mobilität selbst nicht erklärungsbedürftig und nicht infrage gestellt, im Gegenteil. In Afrika stellt sich das Verhältnis genau umgekehrt dar: Ein Machtträger ist im Prinzip schon dadurch legitimiert, dass er die Macht besitzt. Macht legitimiert sich gewissermaßen durch sich selbst, durch ihre Präsenz und Realität. Demgegenüber sind Statusveränderungen suspekt und werden mit Hexerei in Verbindung gebracht: Dem Aufsteiger wird magische Bereicherung unterstellt, während dem Absteiger missglückte Magie nachgesagt wird, oder aber er wird gerade wegen seines Unglücks und des damit verbundenen Ressentiments als potenzieller frustrierter Rächer und Hexer gefürchtet. Plötzlicher Misserfolg, aber noch mehr plötzlicher Erfolg werden als erklärungsbedürftig (als „Lektüreproblem“ in der Begrifflichkeit Augés) betrachtet. Der Begriff der puissance oder force ist in den emischen Theorien über Hexerei und Heilung zentral. Das wurde schon von den frühen Afrikaforschern und Missionaren erkannt, jedoch nur unter philosophisch-religiösem Gesichtspunkt („Lebenskraft“) und nicht unter seinem politischen („Macht“). Unter diesem Blickwinkel hat das System der Hexerei eine konservative, normative Funktion, die die Asozialen am oberen und unteren Rand der gesellschaftlichen Hierarchie „zurückpfeift“ (Status quo erhaltend, „kalt“ im Sinne Lévi-Strauss’): Einerseits werden Aufstieg und Kompetition verhindert (der allzu Ambitionierte oder Erfolgreiche wird der Hexerei verdächtigt oder aber ist der Angst ausgesetzt, von einem Neider verhext zu werden), andererseits werden die „Asozialen“ am unteren Rand der Gesellschaft einem integrativen, oft aber auch endgültig marginalisierenden Druck ausgesetzt (dem Erfolg- und Machtlosen wird die Schädigung des Starken aus Neidmotiven vorgeworfen – z. B. Kindstod in einer angesehenen Familie, der auf die Hexerei einer alten, kinderlosen Witwe zurückgeführt wird). Der etablierte Mächtige kann demgegenüber aus dem Ruch, über besondere, magische Kräfte zu verfügen, zusätzlich einschüchternde Legitimität beziehen (so wurden manche charismatischen Politiker wie etwa Houphouët-Boigny gelegentlich in einer bewundernd-furchtsamen Art auch als sorciers bezeichnet: man nahm an, dass Gewehrkugeln an ihm abprallen würden).
Ökonomischer Aspekt: Hexerei hat immer eine ökonomische Dimension – sie wird als pervertiertes Verhältnis von Eigen und Nicht-Eigen betrachtet. Analog zum politischen Aspekt könnte man sagen: In Afrika wird Reichtum – im Gegensatz zu unserer christlichen Kultur – nicht moralisch infrage gestellt, aber ähnlich wie bei der Macht versucht man, an ihm zu partizipieren. Wie Augé sagt: Die Moral steht weder der Macht noch dem Besitz entgegen; der „Starke“ hat das Recht auf seiner Seite. Dafür lastet der Imperativ des Teilens umso schwerer auf ihm (Position des grand-frère, Patron-Klient-Verhältnis). Kommt er dieser egalisierenden Forderung nicht nach, zieht er den Neid auf sich, und das heißt, eine drohende Verhexung. Vielleicht gerade weil der Reichtum nicht moralisch entwertet werden kann, ist der Neid umso größer, und weil die kapitalistischen psycho-ökonomischen Schranken zwischen Mein und Dein (noch) nicht wirklich aufgerichtet sind (auch als Eigenlegitimation), prallt der Neid nicht an der Indifferenz des Beneideten ab, sondern richtet dort psychisch etwas an, was in Afrika eben „Verhexung“ genannt wird.
Psychologischer Aspekt: Nun partizipiert heute in Afrika natürlich ein großer Teil der Bevölkerung sowohl an einem traditional-egalitären Wertesystem (wer sich über die Gemeinschaft bzw. seine zugeschriebene Position zu erheben versucht, wird bestraft, geächtet, beneidet, „verhext“) als auch an städtisch-kapitalistischen Erwartungen (Bildungserwerb, sozialer Aufstieg, politische Partizipation, Konkurrenz, Kapitalakkumulation). Nicht umsonst ist der häufigste Anlass einer Verhexung der Besuch eines „Aufsteigers“ in seinem Heimatdorf. Pointiert formuliert: In der Stadt wird erwartet, dass er spart, akkumuliert und langfristig investiert, auf dem Dorf wird jeder Franc, der nicht geteilt wird, als vorenthalten und asozial betrachtet und geächtet.21 Psychologisch müsste man von einer Doublebind-Situation sprechen: „Du sollst es einmal weiter bringen als dein Vater“ versus „Du darfst deinen Vater nicht überholen“; „Je weniger du (aus-)gibst, umso mehr hast du“ versus „Je mehr du gibst, umso mehr wirst du bekommen“ usw. Es fällt nicht schwer, diese paradoxen kommunikativen Prädispositionen der Verhexung aus psychologischer Sicht als pathogen oder zumindest als eminent Stress auslösend zu erkennen. Der Heiler schafft durch die Interpretation dieser Probleme als „Verhexung“ zwar individuelle Erleichterung, aber er tritt gewissermaßen als Retter von etwas auf, dessen Hauptproduzent er zugleich ist. Durch den angebotenen Schutz vor Verhexung perpetuiert er zugleich dieses System.
Hexerei ist gruppenpsychologisch nur verständlich, wenn man diesen radikalen Bezug zum andern in Rechnung stellt, wie er sich in der Neidproblematik manifestiert („das Übel kommt immer von außen“), aber auch in den traditionellen afrikanischen Vorstellungen über die Psyche als Konglomerat zwischen individuellen und kollektiven Anteilen, das die Grenzen von Ich/Nicht-Ich, Körper/Psyche, Biologie/Psychologie/Soziologie überscheitet (Problem der Ahnenseele, des „Gruppen-Ich“, der „(In-)Dividualität“, der Anwesenheit der Toten, des „Double“, des „Seelenfressers“, des Fetischs). In diesem Sinne greift es psychologisch zu kurz, Hexerei nur individualistisch als Projektion, Phantasie, Paranoia oder Regression zu interpretieren. Hexerei mag aus „materialistischer“ Sicht inexistent sein, aber sie deswegen einfach als phantasmatisch abzutun und gewissermaßen als „sozialwissenschaftlich“ nicht faßbar zu erklären, würde der afrikanischen gesellschaftlichen Wirklichkeit nicht gerecht und wäre mithin ethnozentrisch. Hexerei ist eine Realität – keine „materielle“, aber eine soziale. Als Praxis tendiert sie dazu, das zu produzieren, was sie voraussetzt, eine Wirklichkeit zu schaffen, die ihre eigenen Prämissen bestätigt, im Sinne einer zirkulären self-fulfilling prophecy. „Hexerei“ (als Befund, als verbaler performativer Akt von Wahrsagern, Féticheuren, Marabouts u. a.) ist eine nachträgliche Interpretation eines Übels, „Semiologie“, wie Augé sagt. Diese deutenden Aussagen (als eigentliches Medium, in dem „Hexerei“ soziale, d. h. kommunikative Realität besitzt) können ihr Gewicht aber nur aus der Tatsache beziehen, dass für viele AfrikanerInnen (oder für die „heidnische Logik“) die Welt an sich primär durch ihre Uneindeutigkeit, ihre Interpretationsbedürftigkeit charakterisiert ist. In gewisser Hinsicht ist die „heidnische Logik“ konstruktivistisch: Das Wirkliche ist nie gegeben, evident, sondern muss immer erschlossen, gelesen, rekonstruiert werden, und zwar im Umweg über das Abwesende, „Surreale“, Geheime, Unsichtbare. Dieses Andere ist aber nicht ein Transzendentes, Metaphysisches im abendländischen Sinne, sondern primär sozial bestimmt: So wie der andere als Patron, grand-frère oder allgemein Mächtiger/Reicher über mein Wohlergehen entscheidet, so ist es auch die Interpretationsfigur des „anderen“ in Form des Hexers, der für mein Unglück, mein Misslingen, meine Krankheit verantwortlich ist. Es handelt sich also um eine eher heteronome als autonome Auffassung der Persönlichkeit; entsprechend arbeiten die Heilerinnen gewissermassen eher mit einem systemischen bzw. gruppenpsychologischen (synchrone Analyse der Relationen und Kommunikationen) als individualpsychologischen (diachrone Analyse des Innerpsychischen) Ansatz. In diesen Zusammenhang gehört auch das „additive“ (im Gegensatz zum synthetisierenden) Denken: Die afrikanische Religion ist auch ohne die Versatzstücke von Christentum und Islam, „per se“, synkretistisch (und in diesem Sinne nie ethnisch-kulturell „rein“), sie rechnet immer mit dem „anderen“ (dem anderen Menschen, Geist, Gott, der anderen Wahrheit) und fügt ihn der eigenen Liste hinzu. In diesem Sinne ist vielleicht auch die Unterscheidung wahr/unwahr oder wirklich/unwirklich ungeeignet, sich dem Weltbild der afrikanischen Heilerinnen zu nähern. („Kein Antagonismus von Glauben und Wissen“, nach Augé.) „Wer heilt, hat Recht“, sagen sie in einer pragmatischen Wirklichkeits- und Wahrheitsauffassung.
Expeditionen mit Zauberern
Eine erste, persönliche Annäherung
Die Geisterpriesterin
September 1994, Abengourou.
An der Fassade des Umweltministeriums prangten zwei unübersehbar schöne Malereien. Das eine zeigte den Agni-König Nanan Bonzou II. in feierlichem Gewand, unter einem immensen Sonnenschirm, von einem Diener getragen, mit seinem Hofstaat und den goldenen Reliquien seiner Macht. Das andere Mauergemälde stellte eine tanzende Zauberin mit ihren Gehilfinnen dar, an einem Fluss, an dem soeben ein Schaf geopfert wird. Diese Frau auf dem Bild mit dem weißen Rock, dem roten Hut und dem kaolingepuderten Gesicht kam mir bekannt vor. Ich hätte in diesem Moment, als ich mir überlegte, ob ich das verschlafene Gebäude betreten sollte, nicht zu hoffen gewagt, dass ich sie persönlich kennen lernen sollte und dass mir dann auch wieder in den Sinn kommen sollte, woher ich ihr Gesicht kannte.
Eine Stunde später saßen wir im staubigen Büro des Regionalen Delegierten des Ministeriums, Monsieur Gbogou Gaba Mathurin, und waren in ein faszinierendes Gespräch vertieft. Diese Frau an der Hausmauer, erklärte er uns, sei Ahissia, die berühmte Fetischpriesterin und Meisterin der Schule für angehende Priesterinnen in Tengouélan. Etwa 250 Heilerinnen seien dort im Laufe der Jahre schon ausgebildet worden, die heute in der ganzen Elfenbeinküste verstreut praktizierten. Die meisten wurden in die Geheimnisse der afrikanischen Tradition von Akoua Mandodja eingeweiht, der Vorgängerin von Ahissia, die 1991 verstarb. Damals, im Oktober, kamen alle ihre ehemaligen Schülerinnen zu ihrem Begräbnis und tanzten eine Woche lang.
„Ahissia hat Kontakt mit 120 Geistern, die sie über alles unterrichten. Dank ihnen kann sie alles erfahren, sogar was jetzt gerade in der Schweiz passiert.“
„Könnte ich sie auch konsultieren?“
„Sicher. Leute aus dem ganzen Land pilgern zu ihr.“
„Was muss man machen, wenn man ihre Hilfe will?“
„Man muss ihr Gin mitbringen. Damit lockt sie die Geister an.“
Ich hatte mir alles viel komplizierter vorgestellt. Aber tatsächlich: Warum nicht einfach die Heilerin persönlich aufsuchen, anstatt die andern über sie auszufragen?!
Am übernächsten Morgen gingen wir mit Mathurin in einen Laden in Abengourou, und er zeigte uns, welcher Gin es sein musste: der kleine aus Holland in der eckigen, grünen Flasche. Ich bemerkte, es sei eigentlich seltsam, dass die Geister hier nicht den afrikanischen Gin bevorzugten.
„Auch die Geister“, sagte er, „bevorzugen das Fremde“.
Wir fuhren mit dem Buschtaxi nach Agnibilékrou, und von dort brachte uns ein anderer Fahrer nach Tengouélan. Nichts wies auf die Besonderheit dieses Dorfes und dieses Hofes hin, zu dem uns Mathurin nun führte.
Nur ein paar Kinder balgten herum. Wir setzten uns auf einen Baumstrunk.
„Die Leute sind noch in der Kirche“, sagte Mathurin, „wir müssen ein bisschen warten“.
Es war Sonntag, und die Fetischpriesterin empfing also möglicherweise gerade eine Hostie vom christlichen Priester.
Mathurin zeigte auf den großen Hof.
„Hier finden jeweils die großen Zeremonien statt. Wenn es ein gewichtiges Problem gibt, bei dem viele Leute involviert sind, dann wird das große Ritual durchgeführt. Das kostet etwa 40000 CFA (etwa 100 Schweizerfranken). Beispielsweise bei Familienstreitigkeiten, die mehrere Leute im Dorf betreffen. Dann wird auch getanzt und getrommelt. Was wir jetzt machen, ist eine ‚kleine Konsultation‘, aber du könntest im Prinzip auch eine große bestellen.“
Nach und nach setzten sich einige Kinder und Frauen zu uns. Eine Zwergwüchsige begann ausgiebig ihr Kind einzuseifen, um es anschließend so aufmerksam abzuschrubben, als müsste jede Pore einzeln gereinigt werden.
Zwischen Mathurin und einer Alten entspann sich ein Gespräch in Agni.
Er fragte, ob sie sich nicht an seinen letzten Besuch erinnern könne, als er mit dem Fotografen an der großen Zeremonie teilnahm.
Sie konnte nicht. Jetzt entrollte er endlich das Papier, das er schon den ganzen Tag sorgsam mit sich getragen hatte.
Es war das Fotoposter der tanzenden Ahissia, die Vorlage für das Bild an der Mauer des Ministeriums in Abengourou.
Mathurin erklärte, dass er das Plakat in hoher Auflage drucken und in den Verkehrs-, Fremden- und Tourismusbüros des ganzen Landes aushängen lassen wolle, als Werbung für Ahissia und die Kultur des Agnilandes. Jetzt kamen mehr Leute hinzu; sie drängten sich, um das Plakat zu sehen, und ob sie auch noch irgendwo selber im Hintergrund erkennbar seien. Jemand brachte ein Fotoalbum mit Bildern vom Begräbnis Akoua Mandodjas, der „Großmutter“ Ahissias, wie sie sie nannten, der Gründerin der hiesigen Schule und berühmtesten Heilerin der Elfenbeinküste aller Zeiten. Auf einem Bild war sie auf dem Totenbett zu sehen, prunkvoll umgeben von all den Reliquien, die inzwischen auf Ahissia übergegangen waren.
Als alle die Fotos bewundert hatten und eine kleine Pause entstand, übergab Mathurin seine Geschenkrolle feierlich der Alten und sagte:
„Schick Deinen Sohn damit in die Stadt. Er soll ein Glas kaufen und es rahmen lassen. Dann hängt es an einem schattigen Ort auf, damit es nicht verdirbt.“
Und dann erschien Ahissia selbst, die Fetischpriesterin. Ich wäre nicht auf sie aufmerksam geworden, hätte mir Mathurin sie nicht vorgestellt. Sie hatte sich erst eine Weile zwischen die andern Frauen gesetzt und das Plakat, das ja ihr galt, am teilnahmslosesten von allen angeschaut. Sie schien geistesabwesend, verschlafen, verträumt. Ein bisschen „in einer anderen Welt“, aber das sage ich natürlich jetzt, nachträglich, mit all dem Wissen um ihre Person. Sie war eine Weile da, dann begrüßten wir uns, sie war noch eine Weile da, und verschwand dann wieder. Ihre ganze Gestalt hatte etwas sehr Introvertiertes, als nähme sie die Außenwelt nur flüchtig, wie durch einen Schleier wahr und als seien ihre Augen, obwohl geöffnet, nach innen gewandt.
Ich nahm noch einmal das Fotoalbum zur Hand und suchte das Bild, auf dem sie in voller Trance bei einem Ritual zu sehen war, und verglich das Gesicht mit dem Original. Sie war fast nicht wiederzuerkennen, und trotzdem: Etwas von all den Verzückungen, Verrenkungen und inneren Reisen war als Spur auf ihrem Gesicht zurückgeblieben. Auch jetzt, hier, an diesem normalen Sonntagmorgen, erschien sie mir ein wenig drogué.
Dann erschien der Übersetzer, ein junger, großgewachsener Mann im weißen Gewand – der „Intellektuelle“ des Dorfes, denn er hatte studiert und erledigte nun alles „Schriftliche“ für die Bewohner. Er war der jüngste Sohn eines reichen und einflussreichen Vaters, eines „Noblen“ mit 72 Kindern. Später sollte er uns sein wundervolles, wenn auch heruntergekommenes Elternhaus in Tengouélan zeigen, bewohnt von einem blinden Alten, der verloren in einer dunklen Flurecke saß. Obwohl etwa dreimal so alt wie der „Intellektuelle“ war er dessen Vetter, wurde jedoch mit père heritier angeredet. Der Altersunterschied erklärte sich aus dem hohen Alter, in dem der Vater seinen Jüngsten noch gezeugt hatte; und da die Agni in der mütterlichen Linie erben, ging das Haus des Vaters auf den ältesten Sohn seiner Schwester über, und die leiblichen Kinder gingen leer aus. Sie erbten von ihrem Onkel mütterlicherseits, wo aber nicht viel zu holen war. So war dem „Intellektuellen“ nur der Stolz geblieben, nobel und gebildet zu sein, obwohl beides wenig abwarf.
„Wir haben eben das Matriarchat“, fasste er etwas resigniert zusammen.
Später führte er uns zum Grab seines Vaters, des ehemaligen Dorfältesten. Das Grab war, wie hier üblich bei wichtigen Persönlichkeiten, geschmückt mit lebensgroßen, bunt bemalten Figuren, in seinem Fall mit einem Ungehorsamen, der geköpft in einer sehr roten Blutlache lag, sein Kopf in der Hand eines Mannes hinter ihm, der mit einem Säbel bewaffnet und flankiert von zwei Polizisten, einem Löwen und einem Elefanten war.
„Es wirkt sehr lebendig“, bemerkte ich beeindruckt.
„Nun“, antwortete er, „wie einer unserer Weisen gesagt hat: ‚Die Toten sind nicht tot‘.“
Aber zurück zur Fetischpiesterin. Inzwischen hatten wir uns in einen Nebenhof bewegt und saßen dort mit dem „Intellektuellen“ vor ihrem Haus. Die Priesterin war offensichtlich mit Vorbereitungen beschäftigt. Wir sahen sie hin- und herschlurfen.
„Siehst du die Metallkettchen an ihren beiden Fesseln? Darin erkennst du die Meisterin. Die Schülerinnen, die dort am Brunnen hantieren, tragen Kettchen aus Kaurimuscheln.“
Jetzt setzte sie sich, immer noch mit ihrem dämmrigen Ausdruck, zu uns, und ich übergab ihr die Ginflasche und 10000 CFA (etwa 25 Schweizerfranken). Wir nahmen alle einen Schluck, gossen ein wenig auf den Boden, „für die Ahnen“, dann entfernte sie sich mit der Flasche.
Wenig später sahen wir einige der Frauen mit dem Gin zum – unscheinbaren, schmucklosen – Grab der „Großmutter“ hinübergehen. Sie füllten einige dort deponierte Gläschen damit.
«Sie locken jetzt die Geister an», sagte Mathurin.
Ich assoziierte: les génies, Genius, Genie, Gin, dschinn (die arabischen Geister), genièvre (Wacholder), Agni ... Ich wurde aus meinen Buchstabenträumen gerissen, als sich der Übersetzer zu uns setzte, und es entspann sich ein Gespräch über die passende Bezeichnung für Ahissia. Féticheuse ließ er nicht gelten, denn Ahissia benütze keine Objekte für ihre Wahrsagungen. Auch „Heilerin“ sei nicht zureichend. Er verwies uns auf eine andere, uralt wirkende Frau im Hof, eine Medizinfrau und „Kräuterhexe“, die später uns gegenüber von sich behauptete, sie könne jede Krankheit heilen außer Aids. Aber sie arbeitete mit nichts „Metaphysischem“, sie war einfach eine Pflanzenkennerin. Charlatan ging erstaulicherweise durch, hatte nichts Entwertendes für ihn. Ahissia selber aber nannte sich – selbstbewusst und bescheiden zugleich – prêtresse des génies.
Der geheimnisvolle Untergrund von Worten, ihre geheimen, magischen Verbindungen. Mir ging eine Passage von Hampaté Bâ durch den Kopf:
Ein einziges schlecht gebrauchtes Wort vermag einen Krieg auszulösen wie ein brennendes Zweiglein einen Flächenbrand. Ein Sinnspruch in Mali sagt: „Was bringt eine Sache in den Zustand (das heißt ordnet sie an oder arrangiert sie in vorteilhafter Weise)? Es ist das Wort. Was beschädigt eine Sache? Es ist das Wort. Was erhält eine Sache in einem guten Zustand? Es ist das Wort.“22
Plötzlich hörten wir die wimmernde Stimme Ahissias aus dem Fenster.
„Sie ist jetzt in Trance“, sagte jemand. „Die Geister sind in sie gefahren“.
Nun wurden wir also zur „Priesterin der Geister“ hereingerufen.
Wir legten im Vorraum unsere Schuhe ab. Dann setzten wir uns links in eine Art Durchgang oder Passage. Wir, das waren der Übersetzer, Nadja (meine damalige Freundin) und ich. Die Priesterin selber saß in einem dunklen Raum, von dem wir nichts sahen. Dazwischen, auf der Schwelle, saß ebenfalls eine Priestern, die „Interpretin“. Ihre Aufgabe war es, die Sprache der Geister, die sich durch Ahissia kundtaten, in die Agni-Sprache zu übersetzen. Insofern war sie nicht einfach Übersetzerin, wie der „Intellektuelle“, der das Agni dann ins Französische übersetzte, sondern eine Eingeweihte, die – eine Art Hermes – die nichtmenschliche Geheimsprache in die diesseitige Welt „transferieren“ musste.
Die unsichtbare, unkörperliche Ahissia sprach in Trance aus dem Dunkel. Die Geister existierten – für uns – nur in der Sprache, der Stimme, diesem rhythmischen Singsang. Offenbar klappte die „Übertragung“ nicht einwandfrei. Die Interpretin musste zuerst einige Male zurückfragen, bevor die Séance beginnen konnte.
„Die Geister sprechen jetzt durch sie“, erklärte der „Intellektuelle“ in der Zwischenzeit. „Sie wird sich nachher an nichts mehr erinnern können.“
„Was möchtet ihr?“, fragte sie. (Man nehme die Frage in ihrem ganzen, den Wunsch betreffenden Gewicht).
„Ich möchte etwas über die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft erfahren.“