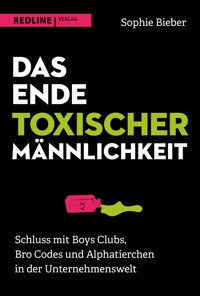
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: REDLINE Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Warum ein fauler Apfel den ganzen Obstkorb vergiften kann Work-Life-Balance, Gleichstellungsbeauftragte und Obstkörbe – glaubt man den Imagevideos, herrschen in Unternehmen und Chefetagen paradiesische Zustände. Dass dies leider nicht so ist und dort immer noch viel zu viele toxische Mitarbeitende und Führungskräfte ihr Unwesen treiben, enthüllt Topmanagerin Sophie Bieber in ihrem spannenden, aber auch schockierenden Blick hinter die Kulissen der nach wie vor männerdominierten Businesswelt. Selbst in Zeiten, in denen Gleichberechtigung und Feminismus durch Kampagnen wie #MeToo in den Fokus gerückt sind, halten sich noch immer diskriminierende Strukturen, die Minderheiten und einzelne Gruppen von Mitarbeitenden, Frauen wie Männer, systematisch benachteiligen und ausbeuten. Was sich niemand mehr gefallen lassen sollte und was den Unternehmen zudem immens schadet. Bieber beschreibt anhand von vielen anonymisierten Beispielen, wie Unternehmen und Führungskräfte zum Wohlergehen aller Mitarbeitenden handeln müssen – denn toxische Strukturen sind keine Bagatelle, sondern ein Innovations- und Wettbewerbshindernis.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Sophie Bieber
DAS ENDE TOXISCHER MÄNNLICHKEIT
Sophie Bieber
DAS ENDE TOXISCHER MÄNNLICHKEIT
Schluss mit Boys Clubs, Bro Codes und Alphatierchen in der Unternehmenswelt
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen
Originalausgabe
1. Auflage 2024
© 2024 by Redline Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Redaktion: Britta Fietzke
Umschlaggestaltung: Karina Braun
Umschlagabbildung: Shutterstock.com/ustymchuk
Satz: inpunkt[w]o, Wilnsdorf (www.inpunktwo.de)
eBook by tool-e-byte
ISBN Print 978-3-86881-965-6
ISBN E-Book (PDF) 978-3-96267-587-5
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-96267-588-2
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.redline-verlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
Für Papa und Frances.
Inhalt
Vorwort WARUM ICH DIESES BUCH GESCHRIEBEN HABE
WAS IST TOXISCHE MÄNNLICHKEIT?
WARUM TOXISCHE MÄNNLICHKEIT ALLEN GESCHLECHTERN SCHADET
TOXISCHE MÄNNLICHKEIT IM BERUF
DER WIRTSCHAFTLICHE ASPEKT: DIE KUNDEN VON MORGEN SIND DIVERS
WAS PASSIEREN MUSS
KEINE GEWINNER IM PATRIARCHAT
WAS WIR TUN KÖNNEN – EIN SCHLACHTPLAN
ABSCHLIESSENDE WORTE
ÜBER DIE AUTORIN
ANMERKUNGEN
Vorwort WARUM ICH DIESES BUCH GESCHRIEBEN HABE
Ich bin Anfang 30, privilegiert in einem Akademikerhaushalt aufgewachsen, war nie das Opfer von Rassismus und startete mit den sehr guten Voraussetzungen, die mir gegeben wurden, in ein Berufsleben, das mich überraschen sollte.
Rückblickend war ich oft naiv. Rückblickend habe ich zu spät verstanden, wie vielschichtig und versteckt sich Sexismus zeigt. Rückblickend hätte ich früher und öfter laut sein sollen.
Doch diese Naivität prägte meine ersten Berufsjahre: Ich wollte an das Gute im Menschen glauben. Ich erinnere mich an die Leiterin des Restaurants, in dem ich während meines Studiums gekellnert habe. Sie bat mich immer wieder, mir die Positivität und die Fröhlichkeit nicht nehmen zu lassen, und sagte mir, dass sie mich dafür bewundere. So richtig wusste ich nicht, was sie damit meinte. Inzwischen bin ich aber jenen Hürden und Situationen begegnet, die einen so hart auf den Boden holen, dass ich es inzwischen verstehe.
Zu Beginn meines Berufslebens als Praktikantin war es für mich vollkommen normal, dass mein Manager mich Kaffee holen schickte. Dass aber der männliche Praktikant stattdessen in Meetings saß und die Unternehmensprozesse erklärt bekam, machte mich zwar stutzig, aber in meiner Naivität glaubte ich, dass das schon Sinn ergebe und der Manager einen Plan habe. Erst mit der Zeit fiel mir auf, wie viele Missstände herrschen, und wie sehr wir durch unsere Umgebung dahingehend geprägt werden, dass wir Ungerechtigkeiten entweder gar nicht wahrnehmen oder sie kleinreden und hinnehmen.
Ich schreibe dieses Buch, um nicht nur zu verdeutlichen, dass Grenzen kontinuierlich mit einer angsteinflößenden Selbstverständlichkeit überschritten werden, sondern ich schreibe dieses Buch unter anderem auch, damit der männliche Praktikant, Kollege, Manager den Mund aufmacht, wenn er mit solchen Situationen, in denen er so privilegiert behandelt wird, konfrontiert wird. Ich wünsche mir, dass wir schädliches Verhalten identifizieren und bekämpfen, und dass wir uns gemeinsam für eine gesündere und bessere (Arbeits-) Welt einsetzen.
Toxische Männlichkeit. Ein Phänomen, das allen schadet und die Gesellschaft gegeneinander aufbringt. Und das nur besiegbar ist, wenn alle auf derselben Seite stehen – auf der, die für Gleichberechtigung, gesunde Menschen und den Niedergang des Patriarchats sorgt. Dazu möchte ich meinen Teil beitragen. Als Frau, die seit vielen Jahren im Arbeitsleben steht, weiß ich, was es heißt, diese Anfeindungen zu erleben. Darüber hinaus habe ich mir im Laufe der Jahre ein Netzwerk aufgebaut, das aus vielen Menschen besteht, die teilweise drastische, teilweise harmlos scheinende Begegnungen hatten, die die Notwendigkeit dieses Buches beweisen.
Zu Beginn meines Schreibprozesses dieses Buches wurde mehrfach angemerkt, dass die teilweise sehr skandalösen Vorkommnisse, von denen ich berichte, gegebenenfalls auf die entsprechenden Menschen zurückzuführen sein könnten. Mein Ziel hier ist es in keinem Fall, einzelne toxische Menschen zu outen und anzuprangern. Mein Ziel ist es, ein gesamtgesellschaftliches Problem aufzuzeigen und darauf hinzuweisen, dass jede:r einen Teil dazu beitragen kann und sollte, Vorfälle wie die von mir geschilderten nicht abzutun und wegzusehen, sondern als das, was sie sind, anzusprechen: ein Missstand, der die Gesellschaft und die Arbeitswelt vergiftet.
Alle hier beschriebenen Situationen sind entweder mir oder Menschen, mit denen ich im Rahmen meiner Recherche sprach, passiert. Ich habe aus genanntem Grund alle Vorfälle so anonymisiert, dass sie von Außenstehenden nicht auf Personen oder Unternehmen zurückzuführen sind. Selbstverständlich kann es aber sein, dass die Menschen, von denen die Geschichten handeln, sich selbst erkennen.
Das kann und will ich nicht vermeiden.
Es sei an dieser Stelle zudem gesagt: Wer dieses Buch aufgrund der Befürchtung liest, sich selbst in der einen oder anderen Geschichte wiederzufinden, sollte unabhängig davon, ob er/sie hier fündig wird, das eigene Verhalten überdenken, denn es scheint ja Anlass zu geben, es als negatives Beispiel aufzuführen.
Es gibt Bewegungen und Faktoren in der Gesellschaft, die zeigen, dass es an der Zeit ist, sich mit dem Thema Toxische Männlichkeit zu beschäftigen und sich bewusst zu machen, welche Änderungen notwendig sind, um künftig als Gesellschaft, aber auch als Unternehmen erfolgreich zu sein.
Die nachkommenden Generationen haben die Möglichkeit, die Rollenbilder neu zu definieren, und damit schädliche Geschlechternormen abzulehnen sowie gerechtere, integrativere Lebensweisen und Arbeitsumfelder zu etablieren.
Gleichzeitig sehen wir ein generell erhöhtes Bewusstsein für die negativen Auswirkungen toxischer Männlichkeit sowohl auf den/die Einzelne:n als auch auf die Gesellschaft als Ganzes. Es sind immer mehr Menschen bereit, über toxische Männlichkeit zu sprechen und auf eine Veränderung hinzuarbeiten. Initiativen wie die #MeToo-Bewegung rücken das weitverbreitete Problem der sexuellen Belästigung und Übergriffe ins Licht und tragen dazu bei, toxische Männlichkeit und deren Auswirkungen ins öffentliche Bewusstsein zu rufen.
Generell wird die Notwendigkeit von Veränderung immer offensichtlicher. Die Welt steht seit Jahren vor einer Vielzahl von Herausforderungen – von der COVID-19-Pandemie über Kriege bis hin zur Klimakrise. Die Auseinandersetzung mit der oftmals schädlichen Sozialisierung in unserer Gesellschaft und der Vermittlung von toxischen Rollenbildern kann dazu beitragen, eine gerechtere, widerstandsfähigere und gesündere Gesellschaft zu etablieren.
Schaffen wir gemeinsam eine neue Normalität und definieren wir Rollenbilder neu, wird dies dramatische Auswirkungen auf alle Aspekte unseres Lebens haben. Der Mann, der lieber zu Hause bleibt und auf die Kinder aufpasst, wird genauso akzeptiert sein wie die Frau, die aus vollem Herzen Hausfrau sein möchte – oder die, die weder Kinder noch Ehe möchte. Gewalt und Diskriminierung werden sich verringern. Geistige und körperliche Gesundheit werden mit neuen, nicht-toxischen Rollenbildern genauso gefördert wie die Produktivität und Innovationsfähigkeit unserer Gesellschaft. Hierfür müssen wir gesunde, produktive und gerechte Systeme schaffen, die wir nur dann erreichen, wenn wir die Missstände im Zusammenhang mit der aktuellen toxischen Sozialisierung und den Verhaltensmustern ersichtlich machen, sie ansprechen und Wege finden, sie zu überwinden.
Ich möchte anmerken, dass ich in diesem Buch primär auf Personen, die als »Mann« und »Frau« sozialisiert wurden, eingehe, da dies die Rollen sind, die ich in meiner beruflichen Laufbahn in großer Zahl beobachten konnte. Dass nicht-binäre Menschen und alle anderen Gruppen ebenfalls Gehör und Beachtung finden, ist nicht weniger wichtig. Ich möchte hier jedoch über jene Themen sprechen, über die ich aus erster Hand berichten kann. Als weiße, binäre cis Frau* schildere ich Erfahrungen, die ich persönlich gemacht oder beobachtet habe, und gehe bewusst in die Zuhörerrolle, wenn Menschen von Erfahrungen sprechen, mit denen ich aufgrund meiner Privilegien nicht konfrontiert bin. Während der Recherche zu diesem Buch habe ich genau dies getan: Ich habe zugehört. Dadurch wurde mir mehr denn je bewusst, dass diese Bühne, die ich habe, und das Bewusstsein, dass ich durch meine Privilegien immer vergleichsweise weich fallen werde, mit großer Verantwortung einhergehen. Daher möchte ich diese Bühne bewusst nutzen und die Stimme meiner Gesprächspartner sein, um exemplarisch jenen Menschen eine Bühne zu geben, die in der Gesellschaft und in Unternehmen weniger Gehör finden.
Ich berichte daher sowohl von meinen eigenen Erfahrungen aus verschiedenen Unternehmen in verschiedenen Branchen als auch von den Erlebnissen diverser Menschen, die entweder keine Bühne bekommen oder massive Konsequenzen befürchten, falls sie ihre Geschichte(n) ohne Anonymisierung bekannt machen. Einige Frauen, die mir von sexuellen Belästigungen und Übergriffen berichteten, fürchten um ihren Job. Eine Frau konkret berichtete mir, dass der Mann, dessen Avancen sie abwies, ihr sehr glaubwürdig damit drohte, dass er ihr Leben zerstören würde, wenn sie jemandem davon erzählte.
Die Namen, die ich hier verwende, sind also frei erfunden und stehen jeweils für eine Person und ihre Erfahrungen.
Wie das letzte Beispiel verdeutlicht, missbrauchen toxische Männer gerne ihre Machtposition, um ihren Opfern Angst einzujagen und einzuschüchtern. Wie effektiv dies geschieht, wurde mir im Rahmen der Recherche immer deutlicher. Und Frauen, die ebenfalls in diesem toxischen Rollenbild gefangen sind, sind nicht weniger gefährlich.
Die traurige Wahrheit ist, dass keine Person, mit der ich sprach, von meinen eigenen Geschichten wirklich überrascht war oder ihnen keinen Glauben schenkte. Ein mitfühlendes Nicken war die häufigste Reaktion, wenn ich schilderte, was ich im Laufe meiner Karriere beobachtete, meist gefolgt von einer eigenen Geschichte meines Gegenübers. Zu sehen, dass niemand in meinem Umfeld die Existenz solcher Strukturen und solchen Verhaltens anzweifelt, zeigt, dass wir nur an der Spitze des Eisberges kratzen. Und zu sehen, dass die weitverbreiteten nicht-toxischen Männer nicht weniger unter diesen Strukturen leiden als betroffene Frauen und alle anderen Gruppen, macht deutlich, dass etwas passieren muss, und wir unsere Kräfte bündeln müssen.
Toxische Männlichkeit. Der zuverlässigste Weg in eine rückwärtsgerichtete, diskriminierende und einseitige Zukunft. Für deren Verhinderung wir laut sein müssen.
* cisgeschlechtlich ist eine Bezeichnung für Menschen, deren Geschlechtsidentität mit dem Sex übereinstimmt, das ihnen bei ihrer Geburt anhand der Genitalien zugeschrieben wurde.
WAS IST TOXISCHE MÄNNLICHKEIT?
Toxische Männlichkeit nennt man das destruktive Verhalten von Männern, das ihnen selbst und anderen Schaden zuführt. Es geht um das Festhalten an veralteten, schädlichen und diskriminierenden Verhaltensweisen und Denkmustern, welche ihre Ursprünge in der Sozialisierung finden.1
Die Geschlechterrolle des Mannes wird dabei durch repressive und klischeehafte Verhaltensweisen wie Aggressivität, Gewaltbereitschaft oder Emotionslosigkeit definiert. Die stereotype Sichtweise auf Männer lebt außerdem von anderen problematischen Verhaltensweisen wie emotionaler Kälte, Kontroll- und Machtausübung, ausgeprägtem Konkurrenzdenken, einem Mangel an Empathie, starker Einzelkämpfermentalität, hoher Risikobereitschaft, Angriffslust oder auch der Abwertung vermeintlich weiblicher Eigenschaften als Schwäche.
Toxische Männlichkeit sowie die Unterdrückung von Frauen und anderen marginalisierten Gruppen sind miteinander verknüpft, sie verstärken sich zudem oft gegenseitig. Toxische Männlichkeit ist häufig durch den Glauben an männliche Überlegenheit und das Bedürfnis gekennzeichnet, andere zu kontrollieren und zu dominieren. Dies kann sich in Verhaltensweisen wie sexueller Belästigung, häuslicher Gewalt und anderen Formen der geschlechtsspezifischen Gewalt äußern, die darauf abzielen, Macht und Kontrolle über Frauen und andere Gesellschaftsgruppen zu erlangen.
Gleichzeitig kann toxische Männlichkeit auch zur Unterdrückung von Frauen beitragen, indem sie starre Geschlechternormen und Erwartungen fördert, die sowohl die Wahlmöglichkeiten von Frauen einschränken als auch ihre Chancen begrenzen. Dazu kann es gehören, dass Frauen der Zugang zu Bildung und Beschäftigung verwehrt sowie ihnen reproduktive Rechte und Autonomie verweigert werden.
Die Überschneidung von toxischer Männlichkeit und der Unterdrückung von Frauen trägt auch zu einer Kultur bei, die gewalttätiges und missbräuchliches Verhalten gegenüber Frauen normalisiert und entschuldigt. Dies kann es Frauen erschweren, über ihre Erfahrungen zu sprechen und Unterstützung und Ressourcen zu suchen.
Um Unterdrückung zu beenden und eine gerechtere Gesellschaft zu schaffen, ist es wichtig, toxische Männlichkeit infrage zu stellen und die Gleichstellung aller Geschlechter zu fördern. Dies erfordert einen ganzheitlichen Ansatz, der sich mit den Ursachen toxischer Männlichkeit und den Überschneidungen mit anderen Formen der Unterdrückung, einschließlich Rassismus, Homophobie und Transphobie befasst.
WIE ENTSTEHT TOXISCHE MÄNNLICHKEIT?
Toxische Männlichkeit entsteht aufgrund gesellschaftlicher Normen und Erwartungen in Bezug darauf, was es bedeutet, ein Mann zu sein. Diese Normen betonen oft traditionelle männliche Eigenschaften wie Härte, Dominanz und Aggression. Gleichzeitig werden Eigenschaften, die als weiblich und damit als schwach angesehen werden, wie Verletzlichkeit und Sensibilität, abgelehnt.2
Entsprechende Erwartungen werden häufig durch eine Vielzahl kultureller Institutionen wie Medien, Religion und Bildung verstärkt, die eine enge und schädliche Definition von Männlichkeit fördern. Das wiederum kann dazu führen, dass Menschen, insbesondere Jungen und Männer, diese Erwartungen verinnerlichen und sich unter Druck gesetzt fühlen, toxischen Männlichkeitsnormen zu entsprechen.3
Toxische Männlichkeit wird auch durch eine Machtdynamik aufrechterhalten, wie durch patriarchalische Systeme, die die männliche Dominanz konservieren sowie die Autonomie und Handlungsfähigkeit von weiblich gelesenen Personen einschränken. Diese Machtdynamik kann zu einer Kultur der Gewalt, Unterdrückung und Diskriminierung beitragen.
Toxische Männlichkeit ist demnach ein soziales Problem, das durch ein komplexes Zusammenspiel kultureller, gesellschaftlicher und individueller Faktoren aufrechterhalten wird. Um dieses Problem anzugehen, ist ein ganzheitlicher und differenzierter Ansatz erforderlich, der schädliche Normen infrage stellt und gesunde Ausdrucksformen von Männlichkeit fördert.
Im familiären Kontext entsteht toxische Männlichkeit durch Sozialisierung, häufig auch in der Familie durch Traumavererbung der Väter auf ihre Söhne. Doch auch Mütter und andere Familienangehörige prägen das toxische Bild des Mannes, welches Jungen oft schon in ihrer Kindheit vorgelebt wird und das sie auferlegt bekommen. Redewendungen wie »Du wirfst wie ein Mädchen«, »Sei ein Mann« oder »Echte Männer weinen nicht« sind nur die Spitze des Eisberges, der Jungen ein so gefährliches und schädigendes Idealbild beider Geschlechter vermittelt.
Wenn die Kindheit geprägt ist von Mutproben, Kräftemessen, Risikobereitschaft, Gewalt und patriarchalischen Strukturen, in denen sich die Mutter unterordnet und nicht widerspricht, während der Vater die soziale Herrschaft über die Familie innehat, entstehen strukturelle Probleme, die die Grundsteine für die nächste Generation von Menschen legen, die toxischer Männlichkeit ausgesetzt sind.
Hört man solchen Menschen zu, die in ihrer Kindheit mit toxischer Männlichkeit konfrontiert waren, wird häufig von dominanten, kontrollsüchtigen, sogar gewalttätigen Vätern gesprochen. Vorgelebt wird, dass es völlig in Ordnung ist, unsensibel, angriffslustig, beleidigend, emotionslos und sexistisch zu sein. Väter können toxische Männlichkeit in ihren Söhnen auf verschiedene Weise fördern, unter anderem durch Betonung von körperlicher Härte und Aggression. Wenn Väter einen hohen Wert auf körperliche Stärke legen und ihre Söhne zu aggressivem Verhalten ermutigen, aber gleichzeitig emotionalen Ausdruck abtun oder herabsetzen und ihren Söhnen sagen, sie sollten »hart bleiben« oder »ein Mann sein«, bringen sie ihnen möglicherweise bei, ihre Gefühle zu unterdrücken und keine Hilfe oder Unterstützung zu suchen, wenn sie sie benötigen.
Das Vorleben von respektlosem Verhalten gegenüber Frauen fördert ebenfalls die toxische Männlichkeit bei den beobachtenden Kindern. Hier wird vorgelebt, dass Dominanz und Kontrolle wichtige Bestandteile der Männlichkeit sind, und die Vorstellung, dass echte Männer immer die Kontrolle haben und andere dominieren müssen, wird gefördert. Gewalt und Aggression werden als akzeptable Mittel positioniert, um diese Männlichkeit zu behaupten. Das Versäumnis, missbräuchliches Verhalten anzusprechen, ist ein weiterer Multiplikator: Wenn Väter Mobbing, Sexismus und missbräuchliches Verhalten von anderen ignorieren oder abtun, lernt das Kind dadurch, dass es völlig akzeptabel ist, gewisse Themen unter den Teppich zu kehren. Die Resultate derartiger Prägungen beobachten wir heute täglich, unter anderem in Unternehmen.
Mütter verstärken dieses Bild unter Umständen noch, indem sie dem künstlich kreierten, patriarchalischen Rollenbild entsprechen und somit zu Komplizinnen der toxischen Männlichkeit werden. Sie leben vor, dass Männer (nur) dann Anerkennung bekommen, wenn sie keine Schwäche zeigen, und dass Mütter in der den Mann umsorgenden Rolle aufgehen und darin ihren Lebensmittelpunkt finden. Es wird eine klare Aufgabenverteilung vorgelebt, in der von der Vereinbarung der Arzttermine über die Bereitstellung aller Mahlzeiten hin zur Organisation des Privatlebens die Frauen alle »weiblichen« Aufgaben erledigen. Tun sie das dann auch für die Söhne und übernehmen jegliche Verantwortung, ohne sie zur Selbstständigkeit zu erziehen, erschaffen sie das männliche Produkt eines toxischen Elternhauses: Söhne, die Frauen danach bewerten, wie gut sie sie bemuttern.
Mütter können generell eine verstärkende Rolle bei der Sozialisierung von Jungen spielen, die toxische Männlichkeit entwickeln, aber es ist wichtig zu beachten, dass auch dies ein Ergebnis der Verinnerlichung kultureller und gesellschaftlicher Normen und Erwartungen an Männlichkeit ist. Mütter fördern toxische Männlichkeit vermutlich nicht absichtlich, sondern geben eher schädliche Überzeugungen und Verhaltensweisen weiter, die sie aus ihrer eigenen Erziehung oder ihrem kulturellen Hintergrund übernommen haben. So können Mütter Jungen davon abhalten, Gefühle auszudrücken oder sich mit Spielzeug oder Aktivitäten zu befassen, die als »weiblich« gelten, weil sie es so kennen. Dementsprechend können sie Jungen auch beibringen, Macht, Kontrolle und Dominanz zu bevorzugen sowie Frauen und Menschen mit vermeintlich weiblichen Eigenschaften als minderwertig zu betrachten.
Eine besonders ausgeprägte Form der Förderung toxischer Männlichkeit durch Mütter können wir rückblickend in den (Nach-)Kriegsgenerationen beobachten. Die Weltkriege hatten einen erheblichen Einfluss auf die Entwicklung und Aufrechterhaltung der toxischen Männlichkeit. Während ihres Verlaufs wurde von Männern zum Dienst ihres Landes und Schutz ihrer Familien Stärke, Mut und Emotionslosigkeit gefordert. Dieses Ideal des »kriegerischen Mannes« wurde in der Propaganda und der Populärkultur gefeiert und aufrechterhalten, es wurde zu einer dominanten kulturellen Norm, die mit Männlichkeit assoziiert wurde.
Kriegserfahrungen und Stress im Kampf können auch dauerhafte, schädliche Auswirkungen auf die Soldaten haben, einschließlich einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS), die zur Entwicklung oder Förderung einer toxischen Männlichkeit beitragen kann. So können Soldaten, die ein Trauma erlebt haben, beim Versuch der Traumabewältigung aggressiver und gewalttätiger werden oder zu missbräuchlichem Verhalten neigen und schädliche männliche Normen und Überzeugungen verinnerlichen, um mit ihren Erfahrungen zurechtzukommen.4
Nach dem Krieg kehrten viele Soldaten mit diesen toxischen männlichen Normen und Verhaltensweisen in das zivile Leben zurück, wo sie in der Gesellschaft durch kulturelle Institutionen wie Medien und Bildung fortgeschrieben wurden. Dies trug dazu bei, toxische Männlichkeit als dominante kulturelle Norm zu etablieren, die auch heute noch nachhaltig die Gesellschaft beeinflusst. Kriegserfahrungen und damit assoziierte kulturelle Normen dürften sich maßgeblich auf die Entwicklung toxischer Männlichkeit ausgewirkt haben.
Frauen, die den Ersten Weltkrieg und andere Konflikte überlebt haben, haben möglicherweise absichtlich oder unabsichtlich toxische männliche Normen und Verhaltensweisen an ihre Kinder weitergegeben. So spricht einiges dafür, dass von Kriegserfahrungen geprägte Frauen häufiger Schwierigkeiten entwickeln, sich ihren Kindern gegenüber geduldig, empathisch und zugewandt zu verhalten. Das wiederum wirkt sich prägend auf das Wertesystem und die Persönlichkeitsentwicklung ihrer Kinder aus. Frauen, die eine Idealisierung der toxischen Männlichkeit in der Gesellschaft erleben, dürften damit assoziierte Normen, Überzeugungen und Erziehungspraktiken mit hoher Wahrscheinlichkeit mindestens weitergeben, wenn nicht sogar verstärken. Die Einhaltung starrer Geschlechterrollen und -erwartungen sowie die Vermeidung des Ausdrucks der eigenen Gefühle oder Verhaltensweisen, die als »weiblich« galten, sind hierfür exemplarisch.
Ein weiterer nicht zu vernachlässigender Aspekt sind die Dynamiken innerhalb von Familien zu dieser Zeit. Kinder, die im Krieg Eltern oder andere geliebte Menschen verloren hatten, wurden möglicherweise unter Druck gesetzt, stark und stoisch zu sein, um ihre Familien zu unterstützen und das Andenken an ihre Angehörigen zu bewahren. Verwitwete Mütter wiederum haben ihre Söhne in ihrer eigenen emotionalen Ausnahmesituation, geprägt durch Einsamkeit, Ängste und die alleinige Verantwortung, mit erhöhter Wahrscheinlichkeit in problematische und toxische Rollen geführt. Die Söhne wurden wahrscheinlich häufiger für ein im toxischen Sinne starkes männliches Verhalten mit der Liebe ihrer Mütter belohnt.
Betrachten wir die sogenannten »Trümmerfrauen«, womit Frauen in Deutschland bezeichnet wurden, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ihre Häuser und Gemeinden wieder aufbauen mussten, sehen wir Frauen, die sich mit großen Herausforderungen konfrontiert sahen, darunter Armut, Obdachlosigkeit und die Verarbeitung der Folgen erlittener Traumata. Heute gibt es neue Erkenntnisse, die von der Autorin Leonie Treber, getrieben und veröffentlicht wurden. Das idealisierte Bild der freiwilligen und heldenhaften Taten zum Wiederaufbau des Landes nach dem Krieg entspricht laut ihren Recherchen nicht der Realität. Weder waren hauptsächlich Frauen mit der Trümmerräumung beschäftigt, noch betrachteten die Frauen ihre Taten als heroisch. Stattdessen spricht sie von Medienkampagnen, die bewusst gestellte Bilder von Frauen in Arbeitskleidung publizierten, um das Narrativ der Trümmerfrauen zu schaffen und somit eine positive Identifikationsfigur zu platzieren. Und diese Figur idealisiert besonders Eigenschaften wie Stärke, Härte und Leidensfähigkeit.5
Rückblickend wurden in der Nachkriegsgesellschaft häufig toxische männliche Normen und Verhaltensweisen von Frauen aufrechterhalten. Im Rahmen der Erziehung in einer Gesellschaft, die sich nur schwer vom Krieg erholen konnte, haben sie ihren Kindern wohl typischerweise beigebracht, sich den traditionellen Geschlechterrollen und -erwartungen anzupassen, und sie davon abgehalten, Gefühle auszudrücken oder als »weiblich« gelesene Verhaltensweisen an den Tag zu legen. Viele dieser Frauen haben zudem auf die Unterstützung ihrer Söhne gebaut, um beim Wiederaufbau ihrer Gemeinschaften zu helfen und ihre Familien zu unterstützen. Somit wurden insbesondere die Kinder dieser Generation angehalten, stark zu sein und keine Emotionen zu zeigen, um das erlebte Trauma und den erfahrenen Verlust zu bewältigen sowie den kulturellen Normen und Erwartungen an die Männlichkeit zu entsprechen.
Das Fehlen positiver männlicher Vorbilder, mit dem diese Generationen durch die im Krieg gefallenen Menschen im Besonderen konfrontiert waren, kann in mehrfacher Hinsicht zur Entwicklung einer toxischen Männlichkeit beigetragen haben. Ohne positive männliche Vorbilder herrscht ein begrenztes Verständnis von Männlichkeit. Jungen können ohne positive Modelle kaum eine Vorstellung von positiver Männlichkeit entwickeln – stattdessen entwickeln sie eher verzerrte Idealbilder. Negativbeispiele für Männlichkeit, wie gewalttätige Soldaten, waren präsent und prägten mangels Verfügbarkeit unterstützender und sorgender Männer das Bild.6
Das weitgehende Fehlen von im positiven Sinne attraktiven, souveränen, menschlichen, männlichen, echten Vorbildern verstärkt in der nächsten Generation mit hoher Wahrscheinlichkeit Probleme beim Ausdruck von Gefühlen. Ohne diese Vorbilder, die einen gesunden Gefühlsausdruck vorleben, fehlt etwas Wesentliches bei der Entwicklung von emotionaler Intelligenz und Belastbarkeit der Heranwachsenden.
Auch stellt sich die Frage, ob Jungen, denen es an positiven männlichen Vorbildern mangelte, irgendwann kompensatorisch häufiger zu missbräuchlichem Drogenkonsum, Gewalt oder anderen kriminellen Handlungen neigen. Die Überzeugung, dass Gewalt ein akzeptables Mittel zur Konfliktlösung ist oder dass Männer immer die Kontrolle innehaben, sind somit eine logische Konsequenz aus dem Fehlen empathischer Vorbilder, die eine gesunde Männlichkeit vorleben und Jungen bei der Entwicklung sowohl eines gesunden Selbstbewusstseins als auch positiver Beziehungen zu anderen unterstützen.
Neben den fehlenden Vaterfiguren in der Nachkriegszeit dominierten auch die weit verbreiteten finanziellen und emotionalen Probleme der Familien, weshalb viele Kriegsfamilien in den Söhnen eine Quelle der Unterstützung und Stabilität sahen. Dies drängte jene Söhne in Rollen, die sie in jungen Jahren noch nicht hätten erfüllen sollen, wie die des Versorgers und Beschützers, um so ihr eigenes Überleben und ihre Sicherheit zu gewährleisten. Dies bedeutete gleichzeitig, dass Kinder nicht Kinder sein konnten: Durch die Anpassungen in der Nachkriegszeit, welche unter anderem autoritäre Erziehungsweisen nahelegten, wurden Eigenschaften wie Stärke und die Fähigkeit, zu funktionieren, idealisiert. Selbsterfüllung, Achtsamkeit, Ausgewogenheit, Diskussionsfreudigkeit, Demokratie – all dies und weit mehr wurde hintenangestellt und musste hierarchischem, autoritärem Funktionieren weichen, welches letztendlich das Überleben sicherte.
In vielen Kulturen galten und gelten vermeintliche Stärke und emotionaler Stoizismus als wünschenswerte Eigenschaften von Männern und werden seit jeher mit dem Ideal des »kriegerischen Mannes« in Verbindung gebracht. Es wird in der Populärkultur, in den Medien und in der Erziehung fortgeschrieben und diente schon damals häufig dazu, Männer und Jungen zu ermutigen, angesichts von Widrigkeiten, einschließlich der mit dem Krieg verbundenen Traumata und Verluste, tapfer und emotionslos zu sein.
Heute wissen wir, dass diese kulturellen Normen und Erwartungen schädlich sind, da sie emotionale Intelligenz und die Auseinandersetzung mit der eigenen Verletzlichkeit unterdrücken, dass sie zur Entwicklung und Aufrechterhaltung einer toxischen Männlichkeit beitragen. Durch die Förderung gerechterer und gesünderer Definitionen von Männlichkeit können wir dazu beitragen, diesen Kreislauf zu durchbrechen, sowie Einzelpersonen und Familien bei der Heilung von Kriegsauswirkungen und anderer traumatischer Erfahrungen unterstützen.
Ein nicht zu vernachlässigender Faktor, der dieses gefährliche Männerbild ebenfalls bestärkt und füttert, ist das weitere soziale Umfeld, sprich die Peergroup der Heranwachsenden. Dies können sowohl Menschen ähnlichen Alters, als auch Interessensgruppen sein. Die Dynamiken, die sich in diesen Freundes- und Bekanntenkreisen abspielen, formen nachhaltig unsere Entwicklung. Wie der Umgang untereinander ist und welches Verhalten bestärkt oder belächelt wird, hat einen maßgeblichen Einfluss auf unser Selbstbild. Werden Gewaltbereitschaft, fehlende Empathie und soziale Kälte mit Applaus belohnt, ist es kein Wunder, dass eben diese Eigenschaften vermehrt gezeigt werden. Die emotionale, einfühlsame oder auch verletzliche Seite der Männer wird dabei oftmals gezielt verdrängt und kleingehalten.7
Durch Peergroups, die toxisch männliches Verhalten verinnerlicht haben und entsprechend auftreten, lernen Jungen also, dass sie hart, emotionslos und dominant sein sollten, um in ihrer Peergroup Anerkennung zu gewinnen. So bekommen sie vergleichsweise häufig und intensiv schädliche Verhaltensweisen wie Mobbing, Drogenmissbrauch, Aggression und Gewalt vorgelebt. Gleichaltrige können eine Kultur schaffen, in der Verletzlichkeit und Gefühlsausdruck stigmatisiert werden. Das entmutigt die Jungen, wodurch es ihnen erschwert wird, eine gesunde emotionale Intelligenz und Konfliktfähigkeit zu entwickeln. Auch das Vorleben von respektlosem und schädlichem Verhalten gegenüber Mädchen und Frauen kann sie lehren, Frauen als minderwertig zu betrachten. Und durch das Gefühl des Wettbewerbs und des Konformitätsdrucks wird jedes schädliche oder aggressive Verhalten bestärkt.
Wie man deutlich sieht, gibt es eine Vielzahl von Faktoren, die schädliches Verhalten hervorbringen und bestärken. Auf diese Weise entsteht eine Art Teufelskreis aus toxischer Männlichkeit, die nur durch eine bewusste Entscheidung durchbrochen werden kann, mit den alten Idealen abzuschließen und neue Werte für sich und die kommenden Generationen zu etablieren. Leben wir als Gesellschaft weiterhin Männern vor, dass sie nur durch diese vermeintlich männlichen Eigenschaften Respekt verdienen, wird toxische Männlichkeit weiterhin allgegenwärtig sein.
SIND ALLE MÄNNER TOXISCH?
An dieser Stelle sei angemerkt, dass der Begriff »toxische Männlichkeit« fehlinterpretiert werden kann – nicht die Männlichkeit selbst ist jedoch toxisch. Männlichkeit an sich hat erst einmal nichts mit toxischem Verhalten zu tun. Im Gegenteil: Es existieren zahllose Positivbeispiele, die zeigen, dass Männer progressiv, empathisch und an Gleichberechtigung interessiert sind. Toxisch wird es dann, wenn der Mann sich in der von dem Patriarchat vorgegebenen Rolle wiederfindet und diese ausfüllt, oder sich dazu gezwungen fühlt.
Hier muss differenziert werden! Daher noch einmal: Männlichkeit ist nicht toxisch, sondern die Rolle, in die Männer oft gedrängt werden, ist es.
Also: Nein, nicht alle Männer sind toxisch. Der Begriff »toxische Männlichkeit« bezieht sich auf bestimmte kulturelle Normen und Erwartungen an das Mannsein, die sowohl für Männer als auch für deren Umfeld schädlich sein können. Und während toxische Maskulinität zwar negative Folgen haben kann, verkörpern nicht alle Männer diese schädlichen Normen und Verhaltensweisen. Viele Männer lehnen toxische Männlichkeit aktiv ab und setzen sich für gesunde Formen von Männlichkeit ein, bei denen Respekt, Empathie und emotionale Intelligenz im Vordergrund stehen.
Es ist auch wichtig zu erkennen, dass toxische Männlichkeit ein kulturelles und gesellschaftliches statt ein individuelles Problem darstellt. Anstatt einzelne Männer für toxische Männlichkeit verantwortlich zu machen, ist es wichtig, auf die Schaffung einer Kultur hinzuarbeiten, in der alle Formen von Männlichkeit akzeptiert und gefeiert werden können, in der toxische Männlichkeit erkannt und bekämpft wird.
Männer, die keine toxische Maskulinität leben, haben ein ausgewogeneres und positiveres Verständnis dessen, was es bedeutet, ein Mann zu sein. So lehnen sie schädliche Stereotypen ab und setzen sich für Gleichberechtigung und Respekt gegenüber allen Geschlechtern ein. Sie sind tendenziell zudem eher bereit, Gefühle und Verletzlichkeit auszudrücken, anstatt diese als Zeichen von Schwäche anzusehen und zu unterdrücken.8
Diese Männer, die toxische Männlichkeit ablehnen, können selbstverständlich Eigenschaften aufweisen, die oft mit traditioneller Männlichkeit assoziiert werden, wie körperliche Stärke, Durchsetzungsfähigkeit oder einen ausgeprägten Beschützerinstinkt. Sie verstehen jedoch, dass diese Eigenschaften nicht dazu benutzt werden dürfen, andere zu dominieren oder zu verletzen, und dass es möglich ist, diese Eigenschaften zu verkörpern und gleichzeitig respektvoll, mitfühlend und einfühlsam zu sein.
Toxische Männlichkeit ist also keine inhärente Eigenschaft eines Mannes. Das sehen wir allein schon daran, dass auch Frauen durch selbiges Verhalten negativ auffallen können. Schädliche Einstellungen und Verhaltensweisen, die mit traditionellen Männlichkeitsnormen verbunden sind, müssen in Zukunft hinterfragt und abgelegt werden. Indem wir positive Einstellungen und Verhaltensweisen für alle Geschlechter fördern, schaffen wir eine integrativere und respektvollere Gesellschaft.
WARUM TOXISCHE MÄNNLICHKEIT ALLEN GESCHLECHTERN SCHADET
Fälschlicherweise wird toxische Männlichkeit in den Medien häufig so dargestellt, als würden Männer davon profitieren, und alle anderen Geschlechter darunter leiden. Doch das ist weit von der Realität entfernt. Während viele Frauen und auch nicht-binäre Menschen häufig offensichtlich leidtragend sind, darf man nicht vergessen, dass die schädlichen Stereotypen auch für Männer nachteilig sind. Und betrachtet man die Nachteile für alle Geschlechter, wird schnell klar, dass es sich nicht um einen Kampf der Geschlechter handelt, in dem Männer die Übeltäter sind, sondern um einen Kampf gegen toxische Standards, unter denen alle leiden.
MÄNNER WEINEN NICHT
Männer sind stark, unverwundbar und dominant. Sie sind niemals verletzlich oder zeigen anderweitige Gefühle. Sie sind unnachgiebig, unbesiegbar, verfügen über Macht und Kontrolle und sind überlegen. Mit absoluter Sicherheit zeigen sie aber vor allem niemals Emotionen jenseits von Aggression und Wut, welche den »schwachen Frauen« zugeschrieben werden. Männer weinen nicht.
So das Klischeebild.
Gemäß dieser toxischen Vorstellung von Männlichkeit wird von Männern erwartet, dass sie jederzeit die Kontrolle haben, dass sie alles vermeiden, was als schwach oder weiblich wahrgenommen wird. Dies kann dazu führen, dass Männer sich unter Druck gesetzt fühlen, sich diesen schädlichen und einschränkenden Erwartungen anzupassen, also ihre Emotionen und Verwundbarkeit zu unterdrücken – besonders, wenn sie bereits im Kindesalter mit diesem Männlichkeitsbild sozialisiert wurden.
Individualität hat in der toxischen Männlichkeit keinen Platz.
Toxische Männer passen sich den schädlichen kulturellen Normen und gesellschaftlichen Erwartungen an Männlichkeit aus verschiedenen Gründen an. Zum Beispiel wird aus Angst vor Zurückweisung gehandelt. Da Ablehnung in der Gesellschaft und in der Peergroup droht, entspricht man nicht den durch toxische Männlichkeitsideale geprägten Erwartungen. Auch das bereits erwähnte Fehlen von Vorbildern begünstigt toxische Männlichkeit durch das Ausbleiben von alternativen Männlichkeitsmodellen, die Empathie, Verletzlichkeit und Respekt für andere vorleben und fördern.
Toxische Männlichkeit hat weiterhin viel damit zu tun, Kontrolle über andere auszuüben und die eigene Dominanz zu behaupten, insbesondere über Frauen und diejenigen, die nicht den traditionellen Geschlechtsnormen entsprechen. Nicht selten wird physische oder psychische Aggression eingesetzt, um die eigene Dominanz und Kontrolle über andere durchzusetzen. Dabei werden Gefühle und Sichtweisen anderer ausgeblendet und die Bedürfnisse des Gegenübers nicht berücksichtigt.
Das Bestreben, ein »richtiger Mann« zu sein, geht mit starren Geschlechterrollen und der Kritik und Erniedrigung derjenigen einher, die diesen Erwartungen nicht entsprechen. Die Emotionspalette solch toxischer Männer ist bewusst kleingehalten, denn nur Wut und Aggression werden als starke und eines Mannes würdige Emotionen angesehen. Verletzlichkeit, Empathie oder Einfühlungsvermögen hingegen werden belächelt und abgelehnt. Dieses Verhalten kompensiert Unsicherheiten in Bezug auf den eigenen Wert und die eigenen Fähigkeiten; es trägt dazu bei, dass toxische Männer sich selbstbewusster fühlen, obwohl dies oft zu schädlichem Verhalten und einer verzerrten Sicht auf sich selbst und andere führt.
Doch auch wenn auf den ersten Blick Frauen die Leidtragenden der Auswirkungen von toxischer Männlichkeit sind, leiden Männer nicht weniger darunter. Denn das toxische Idealbild, das Männern teilweise anerzogen wird, ist hochgradig gefährlich und schadet ihnen selbst massiv. So führt toxische Männlichkeit zu einem Mangel an emotionaler Intelligenz sowie einem Gefühl der Isolation und einer sozialen Abspaltung, indem sie Männer davon abhält, Gefühle und Verletzlichkeit zuzulassen. Der Druck, sich an schädliche Normen anzupassen, führt zu einem hohen Maß an Stress und Angst, und erhöht dadurch das Risiko von Depressionen und anderen psychischen Problemen. Dies kann mit traurigen Zahlen belegt werden: Laut Weltgesundheitsorganisation ist die Suizidrate bei Männern global drei- bis viermal so hoch wie bei Frauen.9
Die mentale Gesundheit von Männern ist in der Gesellschaft nach wie vor ein Tabuthema, zudem ist die Bereitschaft von Frauen, sich professionelle Hilfe durch Therapien zu suchen, wesentlich größer. Dies zeigen diverse Studien, wie die des Journal of Mental Health oder des Journal of Clinical Psychology. Hier wird unter anderem besonders auf Hilfe bei Depressionen eingegangen, was als die Hauptursache für Suizid genannt wird.10 Demnach nehmen Frauen statistisch gesehen häufiger psychologische Hilfe bei Depressionen in Anspruch, während Männer häufiger Suizid begehen. Die Korrelation ist offensichtlich.
Die Unterdrückung von Emotionen und die Vermeidung von Verwundbarkeit, was zu Gefühlen wie Isolation, Wut und Hoffnungslosigkeit führen kann, kann sich genauso zu depressiven Gefühlen entwickeln wie die mit toxischer Männlichkeit verbundenen kulturellen Erwartungen, welche massiven Druck erzeugen, unrealistische Männlichkeitsstandards zu erfüllen.11
Um die unterdrückten Gefühle der Unzulänglichkeit, Wut oder Einsamkeit zu kompensieren, zeigen toxische Männer nicht selten schädliche Verhaltensweisen wie Drogenmissbrauch. Auch Beziehungsprobleme wie häusliche Gewalt, psychischer oder physischer Missbrauch korrelieren stark mit toxischer Männlichkeit.12 Die Verherrlichung von Gewalt und Aggression im Umfeld toxischer Männlichkeit ist ebenfalls kritisch zu betrachten und kann nicht nur körperlich gefährlich werden, sondern auch mentalen Schaden anrichten.
Indem Männer, die sich dem toxischen Männlichkeitsbild anpassen, oft weniger Hilfe und Unterstützung bei psychischen Problemen suchen, wird die Überwindung von Depressionen und anderen psychischen Problemen erschwert. Dementsprechend wird die mentale Gesundheit von Männern negativ durch toxische Männlichkeit und die entsprechende Sozialisierung beeinflusst.
Wir als Gesellschaft können mithilfe einer Auseinandersetzung mit den schädlichen kulturellen Normen im Zusammenhang mit dieser ebenso schädlichen Sozialisierung und der Verbesserung des Zugangs zu Ressourcen für psychische Gesundheit dazu beitragen, das Depressionsrisiko für Männer zu verringern, wir können sicherzustellen, dass alle Zugang zu der wichtigen Unterstützung und den entsprechenden Ressourcen haben und dass die Hemmung, diese anzunehmen, kleiner wird.
Neben dem gesundheitlichen Aspekt werden auch andere Bereiche des Lebens massiv beeinträchtigt. Ein toxisch sozialisierter Mann wird selten eine gesunde Beziehung führen, da es durch die Förderung von Aggression, Dominanz und einen Mangel an Empathie erschwert wird, tiefe, bedeutungsvolle Verbindungen zu anderen aufzubauen.
Die schädliche Definition von Männlichkeit schränkt außerdem die Selbstentfaltung der Männer massiv ein und hindert sie daran, ihre Individualität und Kreativität voll auszuleben.
Die drastischen Auswirkungen von toxischer Männlichkeit auf Männer sollten also keineswegs unterschätzt werden und ziehen nicht nur Konsequenzen wie emotionale Abschottung und Depressionen nach sich, sondern können bis hin zur Ausweglosigkeit und zum Suizid führen. Betrachten wir zum Beispiel die globalen Suizidraten der Jahre 2000 bis 2019, so sehen wir eine fast doppelt so hohe Suizidrate bei Männern als bei Frauen. Beispielsweise zählten wir im Jahr 2019 auf 100.000 Frauen 5,4 Suizide, während es bei den Männern bei gleicher Grundgesamtheit 12,6 Suizide waren.13
Selbstverständlich ist jeder Suizid schrecklich und sollte verhindert werden, unabhängig vom Geschlecht, jedoch sehen wir hier deutlich die Auswirkungen der Sozialisierung und des Drucks, der auf Männern lastet; so stehen an der Spitze der Liste für Ursachen, die zum Suizid geführt haben, (oft unbehandelte) psychische Probleme und Krankheiten.14
Es ist offensichtlich: Wir als Gesellschaft können toxische Männlichkeit nicht weiter ignorieren, sondern müssen den Dialog suchen, um sie zu identifizieren und letztlich abzuschaffen.
LEIDTRAGENDE MÄNNER IM TOXISCHEN UMFELD
Dass die Opfer der toxischen Sozialisierung nicht nur Frauen sind, sollte inzwischen deutlich geworden sein. Doch wie zeigt es sich im Alltag, dass besonders Männer mit einer gesünderen Einstellung weniger unter dem Einfluss leiden? So habe ich mit diversen Männern, die ich ohne jeden Zweifel als »nicht-toxische Männer« oder als leidtragende Männer bezeichnen würde, gesprochen. Diese Bezeichnung ist von ihren nicht selbst auferlegt, sondern entspricht meiner Einschätzung und meinen Beobachtungen. Sie erzählten mir von ihren Erfahrungen als Mann unter Männern, die Druck ausüben, unangebrachtes Verhalten an den Tag legen und eine entsprechende Erwartungshaltung auch allen anderen gegenüber haben.
So erzählte mir Sven, ein schwuler Mann, der sowohl geoutet ist als auch offen in einer festen Partnerschaft mit einem Mann lebt, dass er sich bei Abendessen im beruflichen Kontext schon mehrfach so unangenehm berührt gefühlt hatte, dass er inzwischen Ausreden erfand, um nicht teilnehmen zu müssen, wenn bestimmte Personen zugesagt hatten. Er schilderte weiter, dass er mehrfach schon in Restaurants saß, um dort mit Kollegen den Abschluss eines Workshops zu feiern oder offene Themen zu besprechen, sich dabei aber aufgrund der Ausdrucksweise und des Verhaltens einiger Kollegen und Vorgesetzten eine Dynamik entwickelte, die ihn anwiderte.
Die Kellnerin wurde sexualisiert, es fielen Sprüche wie »Die könnte mir das Essen auch auf ihrem nackten Körper servieren« und »Für ein extradickes Trinkgeld könnte sie ruhig mal etwas mehr Ausschnitt zeigen«. Auch Sven wurde direkt angesprochen, so hatte einer der Kollegen ihn gefragt, ob er nicht für »so ein Gerät« eine Ausnahme machen und heterosexuell werden würde. »Die könnte sogar den schwulsten Mann umpolen« hielt man für eine angebrachte Aussage – und ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll, diese Aussage verwerflich zu finden, weil sie auf so vielen Ebenen herablassend und abstoßend ist.
Raphael, ein weiterer leidtragender Mann, erzählte mir die Geschichte, die ihn zur Kündigung bewegte. Sein Manager Emil war gut in dem, was er tat, und gab sich mit den wichtigen Figuren im Unternehmen ab, sodass er schnell die Karriereleiter hinaufstieg sowie leitende Rollen und große Verantwortungsbereiche zugeteilt bekam. Emil stellte mit Vorliebe junge, blonde Frauen ein, die zum Großteil ihr Studium in Theologie, Philosophie oder Literaturgeschichte absolviert hatten – Studiengänge, die nichts mit dem Unternehmen oder dem auszuübenden Beruf zu tun hatten. Ein gut bezahlter Job in der freien Wirtschaft war nicht selbstverständlich für diese Frauen, weshalb sie Emil gegenüber dankbar und loyal waren, seine Grenzüberschreitungen hinnahmen, da diese das kleinere Übel waren, verglichen mit den alternativen Karrieren, die sich ihnen boten – zumindest redete Emil ihnen das erfolgreich ein: »Mit deinem Studium könntest du sonst nur Taxifahrerin werden«, lautete einer der regelmäßigen Sprüche, die sicherstellen sollten, dass die jungen Frauen ihm hörig waren.





























