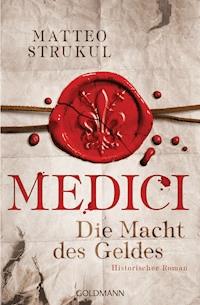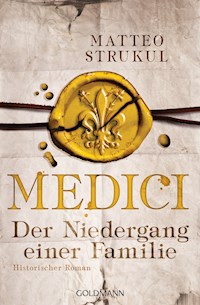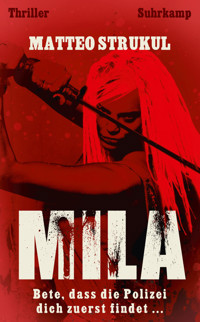6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die sieben Familien
- Sprache: Deutsch
1494 regiert auf der italienischen Halbinsel das Chaos. Während das Volk von Florenz in den Bann des Mönchs Savonarola gerät und Piero de’ Medici aus der Stadt jagt, betreibt in Rom der Borgia-Papst Alexander VI. eine korrupte Vetternwirtschaft und vergnügt sich schamlos mit seinen Mätressen. Unterdessen verbündet sich der Mailänder Ludovico Sforza mit dem französischen König und ermöglicht es ihm, die Alpen zu überqueren und in Italien einzumarschieren. Krankheit, Unterdrückung und Blutvergießen sind die Folge. Doch dann regt sich unter den Italienern mutiger Widerstand gegen die Knechtschaft der Anjou ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 755
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Buch
1494 regiert auf der italischen Halbinsel das Chaos. Während das Volk von Florenz in den Bann des Mönchs Savonarola gerät und Piero de’ Medici aus der Stadt jagt, betreibt in Rom der Borgia-Papst Alexander VI. eine korrupte Vetternwirtschaft und vergnügt sich schamlos mit seinen Mätressen. Unterdessen verbündet sich der Mailänder Ludovico Sforza mit dem französischen König und ermöglicht es ihm, die Alpen zu überqueren und in Italien einzumarschieren. Krankheit, Unterdrückung und Blutvergießen sind die Folge. Doch dann regt sich unter den Italienern mutiger Widerstand gegen die Knechtschaft der Anjou …
Informationen zu Matteo Strukul sowie zu lieferbaren Titeln des Autors finden Sie am Ende des Buches.
Matteo Strukul
Das Erbe der sieben Familien
Historischer Roman
Aus dem Italienischen von Ingrid Exo und Christine Heinzius
Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel »La corona del potere« bei Newton Compton editori, Rom.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstveröffentlichung Februar 2023
Copyright © der Originalausgabe © 2020 Newton Compton editori s. r.l., Roma
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2023
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
This edition published in agreement with the proprietor through MalaTesta Literary Agency, Milan
Covergestaltung: UNO Werbeagentur München
Coverfoto: © Vadym Honshovskyi / getty images
Redaktion: Christina Neiske
BH ∙ Herstellung: ik
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN: 978-3-641-29706-0V001www.goldmann-verlag.de
Für Silvia – Sinn meines Lebens
In den Herzogtümern und den Signorie Italiens erscheint der moderne europäische Staatsgeist zum ersten Mal frei seinen eigenen Antrieben hingegeben; sie zeigen oft genug die fessellose Selbstsucht in ihren furchtbarsten Zügen, jedes Recht verhöhnend, jede gesunde Bildung im Keim erstickend.
Jacob BurckhardtDie Cultur der Renaissance in Italien
Rom bleibt Rom, auch in seinen wildesten heftigsten Gegensätzen; in diesem einen Augenblick ist es ein Fluss, in den sich alle Reichtümer und Herrlichkeiten der Welt ergießen, denen das unglaubliche Elend des einfachen Volks gegenübersteht.
Maria Bellonci
Rinascimento privato
Die Geschlechter
Mailand (Visconti-Sforza)
Ludovico Sforza, genannt »Il Moro«: Regent, später Herzog von Mailand, Mäzen und Kulturliebhaber
Beatrice d’Este: Ehefrau von Ludovico Sforza und Herzogin von Mailand
Caterina Sforza: Herrin über Imola e Forlì, auch bekannt als Tigerin von Forlì
Gian Galeazzo Maria Sforza: rechtmäßiger Herzog von Mailand
Isabella von Aragón: Ehefrau von Gian Galeazzo Maria Sforza und rechtmäßige Herzogin von Mailand
Bartolomeo Calco: Edelmann und Berater am Hof von Ludovico Sforza
Leonardo da Vinci: Genie, Ingenieur, Mathematiker und Künstler am Hof von Ludovico Sforza
Ambrogio da Rosate: Astrologe und Leibarzt von Ludovico Sforza
Rom (Borgia und Colonna)
Rodrigo Borgia: nahm nach seiner Wahl zum Papst den Namen Alexander VI. an
Vannozza Cattanei: Hofdame und Geliebte von Rodrigo Borgia
Cesare Borgia: Kardinal, später Generalkapitän der Kirche und Herzog von Valentinois, genannt der Valentino, Sohn von Rodrigo Borgia und Vannozza Cattanei
Lucrezia Borgia: Edelfrau, Gräfin von Pesaro, später Herzogin von Bisceglie und Herzogin von Ferrara, Tochter von Rodrigo Borgia und Vannozza Cattanei
Juan Borgia: Herzog von Gandia, später Generalkapitän der Kirche, Sohn von Rodrigo Borgia und Vannozza Cattanei
Jofré Borgia: Prinz von Squillace, Graf von Alvito und Cariati, Sohn von Rodrigo Borgia und Vannozza Cattanei
Fabrizio I. Colonna: Edelmann, Söldnerhauptmann, Vizekönig, Großkonnetabel von Neapel, Herzog von Paliano
Prospero Colonna: Edelmann, Condottiere, Generalkapitän der Kirche, Generalleutnant der neapolitanischen königlichen Armee
Neapel (Aragón)
AlfonsII. von Aragón: Herzog von Kalabrien, dann König von Neapel
Truzia Gazella: Mätresse von Alfons II. von Aragón
FerdinandII. von Aragón, genannt Ferrantino: König von Neapel, Sohn von Alfons II. von Aragón und Ippolita Maria Sforza
Sancha von Aragón: Prinzessin von Squillace, Ehefrau von Jofré Borgia, Tochter von Truzia Gazella
Alfons von Aragón: Prinz von Salerno, Herzog von Bisceglie, zweiter Ehemann von Lucrezia Borgia
Friedrich von Aragón: König von Neapel, Bruder von Alfons II. und Onkel von Ferdinand II.
Gonzalo Fernández de Córdoba, genannt »El Gran Capitán«: Oberbefehlshaber im Dienste des Königreichs Neapel, Vizekönig von Ferdinand dem Katholischen, Herzog von Terranova und von Sessa
FerdinandII. von Aragón und Trastámara, bekannt als Ferdinand der Katholische, König von Sizilien und (als Ferdinand V.) gemeinsam mit seiner Frau Isabella König von Kastilien und León
Venedig (Condulmer)
Antonio Condulmer: oberster Anführer der Spione der Serenissima Repubblica und Botschafter Venedigs in Frankreich
Alessandro Benedetti: Inhaber des Lehrstuhls für Anatomie an der Universität Padua, Magister der Medizin, Chirurg, leitender Feldarzt des konföderierten venezianischen Heeres in der Schlacht von Fornovo
Gianconte Brandolini, genannt »der Skorpion«: Herr über Valmareno, Söldnerhauptmann im Dienste Venedigs
Florenz (Medici)
Piero di Lorenzo de’ Medici, genannt »Il Fatuo« (der Unglückliche): Herr über Florenz, erstgeborener Sohn von Lorenzo de’ Medici und Clarice Orsini
Giovanni di Pierfrancesco de’ Medici, genannt »Il Popolano« (der Volkstümliche): Angehöriger einer Nebenlinie der Medici, deren Oberhaupt Lorenzo il Vecchio war; Ehemann von Caterina Sforza
Ludovico di Giovanni de’ Medici, genannt »Giovanni delle Bande Nere«: Söldnerhauptmann
Girolamo Savonarola: Dominikaner, Bußprediger, politischer Begründer der Republik Florenz auf Basis eines theokratischen Modells, Oberhaupt der sogenannten Piagnoni, Anhänger einer bestimmten Glaubensrichtung
Erster Teil
1488
–
Prolog
Kirchenstaat, Forlì, Rocca di Ravaldino
Sie haben ihn umgebracht, dachte sie. Und sie werden dafür bezahlen. Ludovico und Checco Orsi, seine Mörder. Und auch Ordelaffi und Lorenzo de’ Medici, die Komplizen dieses Mordes. Sie würde warten und Tag um Tag ihre Rachlust nähren.
Caterina sah Girolamos Leichnam noch vor sich, wie er von den gierigen Händen der Bürger von Forlì zerfleischt worden war. Nachdem er von den Brüdern Orsi aus dem Fenster des Palastes geworfen worden war, hatten die Männer und Frauen sich wie die Aasgeier auf ihn gestürzt und ihn in Stücke gerissen. Am Ende war das, was von ihm übrig war, auf die Pritsche eines Karrens verfrachtet und zur Via dei Battuti Neri gebracht worden, wo eine Handvoll Ordensbrüder sich um die Beerdigung von Hingerichteten kümmerte. Als sich dann der Karren mit seiner Totenfuhre auf den Weg machte, stürmte die Menge den Palast – wie ein Schwarm beutehungriger Schmeißfliegen. Sie verwüsteten und plünderten, was sie nur konnten.
Vor ihrer Festnahme war es Caterina gelungen, Boten zu ihrem Bruder Ludovico in Mailand und den Bentivoglio in Bologna zu schicken und schließlich durch einen Diener ihren getreuen Kastellan Tommaso Feo zu verständigen, er solle sich in der Rocca di Ravaldino verschanzen.
Sie selbst war mit ihren Söhnen Scipione, Ottaviano und Francesco in den Verliesen der Burg der Orsi eingesperrt worden. Und dort wartete sie immer noch und wurde fast verrückt vor Kälte und Schmerz.
Es waren ihre Söhne, die sie am Leben hielten und ihr die Kraft gaben durchzuhalten. Ihre Liebe hatte sie genährt, und so hatte sie weitermachen können; während sie sich Scipiones Vorschläge zur Rache und Ottavianos Versprechungen anhörte, wiegte sie den kleinen, in eine Decke gewickelten Francesco. Sie waren wie junge Hunde, aber willensstark und entschlossen, und so ließ sie ihnen gegenüber ihren eigenen Willen außen vor. Sie hatte einen Plan im Kopf, aber dafür müssten sie sehr mutig und zu allem bereit sein.
Nach ein paar Tagen erschien Giacomo Savelli, der päpstliche Gouverneur von Cesena, vor dem Gefängnisgitter und ordnete an, dass Caterina und ihre Söhne zur Rocca di San Pietro gebracht und dort unter Aufsicht von Bartolomeo Capoferri gestellt werden sollten.
Sie hatte eine stolze, unbeugsame Haltung bewahrt und keinen Laut der Klage von sich gegeben, das Gleiche galt für ihre Söhne. Sie hatte sie schon vor langer Zeit gelehrt, sich nötigenfalls die Lippen blutig zu beißen, um ja nicht den Anschein zu erwecken, klein beizugeben.
Auf der Festung angelangt, hatte Savelli Caterina angesehen und um Geduld gebeten. Er würde das Collegio degli Otto zusammenrufen, das Gremium, das eigens beauftragt war, in der Stadt wieder Ordnung herzustellen, und zu gegebener Zeit würde er ihre Hilfe ersuchen, Tommaso Feo zu überzeugen, die Rocca di Ravaldino aufzugeben.
Und nun befand sie sich unterhalb der Festungsmauern. Müde, erschöpft, von Schmerzen zermürbt, ganz im Bann der Erinnerung an das Blut auf den Gliedern Girolamos. Sie sah immer noch die großen Augen ihrer Söhne vor sich, wie sie auf die Gefängnismauern starrten.
Sie hatte sie als Faustpfand bei den Orsi zurückgelassen, damit sie die Festung allein aufsuchen und versuchen konnte, Tommaso zu überzeugen. Ein metallischer Schmerz durchfuhr ihre Brust und nahm ihr den Atem. Schneeregen fiel vom grauen Himmel und durchnässte ihren Mantel. Das Falltor hob sich, und sie betrat den Hof. Tommaso empfing sie mit einer Verbeugung.
»Mia Signora! Wir haben Euch erwartet!«
»Tommaso, Ihr könnt Euch nicht vorstellen, wie mir das Herz blutet. Doch wir müssen tun, was getan werden muss. Bringt mich also jetzt zum Turm, damit ich mir alles ansehen kann.«
Tommaso blickte sie traurig an, nickte und gehorchte.
»Ich sage Euch, diese Hexe führt uns an der Nase herum!«, polterte Checco Orsi, der der blutrünstigere von beiden Brüdern war. Er war baumlang und hatte ein mächtig breites Kreuz. Auf dem Tisch vor ihm stand ein halb voller Becher Wein.
»Seid damit nicht so voreilig!«, schnappte Giacomo Savelli. »Immerhin haben wir ihre Söhne als Geiseln. Wie sollte sie uns da üble Streiche spielen?«
»Keine Ahnung, aber ich sage Euch was: Caterina hat die Rocca zur sechsten Stunde betreten, und es hat nun schon vor einer Weile die neunte geschlagen!«
»Das ist mir bewusst. Aber ich verstehe nicht, wie …«
»Ich traue ihr nicht!« Checco stand auf. Dann schmiss er den Weinbecher unvermittelt in den Kamin, wo er zerschellte.
»Ich bin der Ansicht, wir müssen dieser Frau begreiflich machen, wer hier das Sagen hat.«
»Und wüsstet Ihr auch wie, lieber Bruder?«, fragte Ludovico.
»Darauf könnt Ihr wetten!«
»Dann lasst mal hören«, forderte Savelli ihn auf. »Ich sage nur, dass wir mit Gewalt nichts erreichen werden.«
»Lasst das meine Sorge sein!«
»Was habt Ihr vor?«
»Bringt mir die beiden großen Brüder. Ich will mit ihnen zur Rocca.«
»Wollt Ihr sie vor den Augen der Mutter bedrohen?«, wollte Ludovico wissen.
»Das werden wir sehen.«
Schwarz gekleidete Männer warteten auf der Esplanade. Der Schneeregen hatte sich in Schnee verwandelt, weiße Tupfer bedeckten nun die braune Erde. Der tiefblaue Himmel wurde allmählich fahl. Bald bräche die Dämmerung herein und würde dann der Nacht weichen.
Durch die Schießscharte erkannte Caterina die Reiter: Es waren die Gebrüder Orsi mit ein paar ihrer Schergen, und der größere der beiden, Checco, saß auf einem riesigen Fuchswallach.
Doch das war es nicht, was ihren Atem stocken ließ – vor Checco saß ihr Ottaviano auf dem Ross. Sie wusste schon eine Weile, was geschehen würde, doch das Wissen darum machte den Anblick nicht weniger furchtbar.
Mit einer blitzartigen Bewegung ließ der Mann die Klinge eines Dolches im Licht der Fackeln an der Kehle des Jungen aufleuchten.
Dann schrie er: »Caterina Sforza! Ich weiß, dass Ihr mich hört! Und das habe ich Euch zu sagen: Wenn Ihr die Rocca nicht sofort übergebt, dann schneide ich Eurem Sohn die Kehle durch! Hier, auf der Stelle! Habt Ihr mich verstanden?«
Caterina blickte unbeweglich auf die Szene. Es schien ihr, als sei ihr das Blut gefroren, und wie versteinert konnte sie weder sprechen noch sich rühren. Sie stand nicht auf, sagte nichts. Doch ihr Herz tief im Innern schrie auf. Sie hatte diesen Jungen zur Welt gebracht und aufgezogen und versucht, ihm eine gute Mutter zu sein. Und nun musste sie tatenlos zusehen, wie ein Mörder, menschlicher Abschaum, drohte, ihm vor ihren Augen die Kehle durchzuschneiden.
Sie empfand tiefe Abscheu vor sich selbst. Übelkeit stieg bis zur Kehle in ihr auf, doch sie drängte sie zurück. Ebenso die Tränen. Mit aller Kraft umklammerte sie ein metallenes Kreuz, bis es sich in ihre Handflächen bohrte. Sie gab keinen Laut von sich. Die Tränen strömten jetzt reichlich über die Wangen. Über ihre Lippen jedoch kam kein Hauch. Nicht anders bei ihrem Sohn, der schweigend auf dem Pferd saß, die Klinge an seiner Kehle.
»Also? Was jetzt? Muss ich ihn wirklich wie ein Zicklein schächten?«
»Messer Orsi«, hörte man eine Stimme, »wenn Ihr nicht sofort geht, schwöre ich bei Gott, dass ich diese Bombarde hier laden und abfeuern werde!«
Caterina erkannte die Stimme, sie gehörte Tommaso.
Sie wartete ab.
»Ich schwöre Euch …«
»Das spielt keine Rolle. Ich weiß, dass Ihr Caterinas Söhne habt. Ich kann sie von hier aus sehen. Aber wenn Ihr glaubt, Ihr könntet mich aufhalten, dann täuscht Ihr Euch.«
Caterina erhob sich, verließ den Raum und stieg die steinernen Stufen hinauf. Sie erreichte die Spitze des Wehrturms. Den anderen zeigte sie sich nicht, aber sie blickte Tommaso in die Augen. Sie nickte.
Einen Augenblick später wandte der sich nochmals an Checco Orsi.
»Also gut! Was ich nun tun werde, ist der Beweis, dass ich keineswegs scherze«, brüllte er.
Kurz darauf hörte man eine Reihe von Kanonenschüssen. Rasch folgte ein heftiger Donner dem nächsten. Die ganze Welt schien in dem endlosen Getöse zu versinken, das die Luft erfüllte.
Als endlich Ruhe einkehrte, stieg Caterina schleppenden Schrittes wieder die Treppe hinunter in das Turmzimmer und schaute weiter durch die Schießscharte. Sie hoffte aus tiefstem Herzen, dass Checco Orsi begriffen hatte, dass sie und Tommaso Ernst machten. Ihr war sterbenselend zumute, doch gleichzeitig wusste sie, dass dies die einzige Möglichkeit war, ihre Feinde zu bezwingen.
»Nun«, hörte sie jetzt, »diese Bombardensalven waren nur ein Vorgeschmack. Wir können die Stadt jederzeit unter Beschuss nehmen. Das wisst Ihr. Nichts und niemand kann uns daran hindern. So lauten die Befehle, die ich von meiner Herrin Caterina Sforza erhalten habe. Ihr könnt machen, was Ihr wollt, aber ich versichere Euch: Wenn ihre Söhne verschont bleiben, wird sie Euch am Leben lassen und Forlì wird nicht dem Erdboden gleichgemacht. Die Entscheidung liegt natürlich bei Euch.«
Die Worte hallten durch inzwischen unbarmherziges Schneetreiben. Sie hingen lange in der Luft, als würde niemand wagen, die kurze Waffenruhe zu stören, als könnte die Stille das Unausweichliche hinauszögern. Schließlich sprach jemand. »Wenn wir tun, was Ihr verlangt, versprecht Ihr dann, die Stadt nicht zu beschießen?«
Caterina erkannte die Stimme. Es war die von Messer Savelli.
»Ihr habt das Wort meiner Herrin.«
»Und wir sollen …«, konterte Checco Orsi.
»Das Wort von Caterina Sforza ist Gesetz«, schrie Tommaso und schnitt ihm das Wort ab.
»Als sie das letzte Mal etwas versprochen hat, hat sie sämtliche Vereinbarungen missachtet«, gab Ludovico Orsi zurück.
»Tut, was Ihr für richtig haltet. Was ich Euch sagen kann, ist, dass Ihr nicht in der Position seid, irgendetwas zu verlangen.«
Der letzte Satz schien sich in der eisigen Luft des Abends zu verlieren. Caterina sah, wie die Schwarzgekleideten im dichten Schneetreiben die Köpfe zusammensteckten. Dann bemerkte sie, dass Messer Checco den Dolch wieder wegsteckte und sein Pferd zurücklenkte.
Die Übrigen taten es ihm bald nach, und so bewegte sich die Gruppe wieder in Richtung Stadt.
1494
–
1. Blutsbande
Königreich Neapel, Castello di Squillace
Cesare hatte sie gesehen – und war ihr verfallen. Sie hatte von ihm Besitz ergriffen wie eine Krankheit, eine fiebrige Seuche, die ihn verzehrte und doch seinen Hunger nicht stillte; er gierte nach ihr, es war, als könne er nicht weiterleben, bis er sie besessen hatte. Seit sie die Frau seines Bruders geworden war, hatte er sie ständig vor Augen und brannte darauf, wenigstens einen Augenblick mit ihr verbringen zu können. Er würde sich nicht scheuen, zu töten und zu foltern, nur um sie haben zu können. Das hatte er schließlich schon aus nichtigeren Gründen getan.
Sicher, sie hatte Jofré geheiratet. Na und? Es war nicht das erste Mal, dass er ihm eine Frau ausspannte, außerdem würde er es niemals erfahren, und wenn, würde er es akzeptieren. Er hatte sowieso nicht die geringste Achtung vor Jofré. Ebenso wenig wie vor Juan, seinem anderen Bruder, in den sein Vater, der Papst, derart vernarrt war, dass er ihm all seine unverzeihlichen Schwächen nachsah. Im Gegenteil, um ehrlich zu sein hasste er beide. Jofré, weil ihm das Schicksal solch eine schöne Frau geschenkt hatte, und Juan, weil er in der Familie Borgia für eine militärische Laufbahn vorgesehen war. Obwohl er ein Feigling und noch dazu unfähig war.
Er hingegen hatte das Kardinalat abbekommen.
Nicht, dass er sich darüber beklagen müsste: Pfründe und Leibrenten trugen ihm vierzigtausend Dukaten im Jahr ein, und sein Lebensstandard war der eines Fürsten, ganz davon abgesehen, dass er sich keineswegs an das Keuschheitsgebot hielt oder christliche Barmherzigkeit praktizierte. Gewiss nicht! Umso weniger, als sein Vater selbst schon immer ein Mann von unersättlichem sexuellem Verlangen gewesen war. Kürzlich erst hatte er Giulia Farnese zu seiner Geliebten gemacht. Ein Mädchen von neunzehn Jahren, über dreißig Jahre jünger als er!
Sancha von Aragón aber war eine Erscheinung. Ganz zu schweigen davon, dass man sich überall zuraunte, sie sei eine rassige und feurige Liebhaberin, mehr noch, sie sei hemmungslos. Und nun, in diesem Augenblick, nach Völlerei und Gelage, bei dem sich Jofré so betrunken hatte, dass man ihn in seine Gemächer tragen musste, sollte Cesare die unwiederbringliche Gelegenheit erhalten.
Im Vorgeschmack auf die Leidenschaft, die ihn schon bald erwartete, lachte er in sich hinein.
Sancha war unvergleichlich schön, daran bestand für Cesare kein Zweifel. Obwohl er in verbotener und eifersüchtiger Liebe mit seiner Schwester Lucrezia mit ihrem goldenen Haar und den meerblauen Augen verbunden war, musste er doch eingestehen, dass die Prinzessin von Squillace ihn in ihren Bann geschlagen, ihn gleichsam mit unbezwingbarer Zauberkraft betört hatte. Diese nachtschwarzen Haare, die sie wie ein Mantel umgaben, die katzenhaften und tiefgründigen Augen, aus denen eine Wollust sprach, die jeden Mann willenlos machen konnte. Der verlockend rote Mund, der, leicht geöffnet, unsagbare Freuden versprach … Alles an ihr trug zu einer lodernden, unwiderstehlichen Sinnlichkeit bei.
Cesare hatte sie die ganze Mahlzeit über unverhohlen angestarrt, und sie hatte seinen Blick kühn und herausfordernd lüstern erwidert, was ihn in Wallung versetzte; es war, als ob sie ihn schweigend aufgefordert hätte, zu tun, was immer er mit ihr im Sinn hatte.
Wie ein Dieb, schlimmer noch, wie ein Räuber, hatte er auf den Augenblick gewartet, in dem sie sich zurückzog.
Er nahm eine Fackel und durchschritt enge Flure und prunkvolle Säle; mit seinem Blick ließ er jeden zu Eis erstarren, der es auch nur wagte, ihn anzusehen.
Er war Cesare Borgia, und er hatte es nicht nötig, um Erlaubnis zu bitten. Als er vor der Tür angelangt war, die in Sanchas Gemächer führte, machte er sich nicht einmal die Mühe anzuklopfen. Er trat ein.
Halbschatten empfing ihn, erleuchtet nur vom zitternden Licht der Kerzen, die an verschiedenen Stellen im Raum aufgestellt waren. Einen Moment lang kam es ihm so vor, als befinde er sich in einer Kapelle.
Er war ganz benommen von dieser Atmosphäre zwischen Schatten und Licht, und als er seinen Blick noch auf dem luxuriösen Bett und den Möbeln mit den feinen Intarsien ruhen ließ, schreckte ihn eine Stimme plötzlich auf.
»Ihr habt wahrlich keine Zeit verloren, mein Fürst.«
Cesare sah sich suchend um. Sanchas Stimme war rauchig und verführerisch. Die junge Frau schien sich dessen bewusst zu sein, denn sie sprach wie in einem Singsang, der seine Wirkung nicht verfehlte und den Geist ihres Gegenübers vernebelte. Für Cesare klang diese Stimme wie der betörende Gesang einer Meeresgöttin, und wie so viele vor ihm ergab er sich dem süßen Vergessen, das sich auf einmal auf ihn legte und ihn willenlos machte. Nur mit einem Rest nüchternen Verstandes machte er sich klar, dass Sancha dieses Treffen in die Wege geleitet hatte, seit sie ihn heute zum ersten Mal gesehen hatte, vielleicht sogar länger schon, und nun war er ganz in ihrer Hand.
Schließlich entdeckte er sie. In schwarze Schleier gehüllt, bewegte sie sich, die Hüften wiegend, wie eine Schlange und fixierte ihn mit diesen Augen, denen er nichts entgegenzusetzen hatte.
»Ich habe Euch erwartet«, fuhr sie fort, »ich wusste, dass Ihr zu guter Letzt den Mut finden würdet, zu mir zu kommen.« Ein Hauch von Spott lag in diesen Worten.
Hätte irgendjemand anders so etwas zu sagen gewagt, hätte Cesare nicht gezögert, ihm die Zunge abzuschneiden, aber aus ihrem Mund klang dieser Satz nach einer reizvollen Provokation.
Er sah sie immer noch an, im Halbschatten; ohne jede Eile kostete er den Moment aus. Er spürte, wie das Verlangen in ihm wuchs, bis sie schließlich zu ihm trat und ihn langsam auszog. Er genoss die Berührungen ihrer weichen, schlanken Finger, konnte ein Erschauern nicht unterdrücken, als ihre Zunge über seine Lippen und weiter hinab glitt.
Da legte er ihr die Hände um den Hals, ließ sie weiter ins Dekolleté wandern, das nur dafür gemacht schien, Männer zugrunde zu richten, und zerriss den hauchfeinen Stoff. Er war so dünn, dass er ohne Weiteres nachgab, und so berührten seine Finger ihre glatte und samtige Haut. Er spürte die Wirkung ihrer Kurven, der runden Hüften, der perfekten Brüste, der zarten Kontur ihres Halses, bedeckte die dunkle Haut ihrer Schultern mit hastig hingehauchten Küssen. Dann biss er ihr zärtlich in die Lippen und führte ihre Hand in das wahre Zentrum seines Verlangens, bis er sie, inzwischen auf dem Gipfel der Lust, endlich nahm. Dabei murmelte sie Worte, die Cesare wohl noch nie aus dem Mund einer Frau gehört hatte.
2. Vorahnungen
Herzogtum Mailand, Castello Sforzesco
Ludovico schaute in die blutroten Flammen, die im Kamin loderten. Das Holz knisterte laut, die Schatullen des Herzogtums waren noch nie so gut gefüllt gewesen, seine Macht war inzwischen unantastbar. Und doch lauerte etwas Unheilschwangeres in der Frühlingsluft. Seit ein paar Tagen spürte er das schon. Vorahnungen? Davon abgesehen war er der Mann, der durch die Enthauptung Cicco Simonettas auf dem Ravelin, dem Wallschild vor dem Castello di Pavia, an die Macht gekommen war! Er hatte Bona von Savoyen, die Frau seines Bruders Galeazzo Maria und Herzogin von Mailand, aus dem Weg geräumt. Er hatte den Thronerben so lange hinter den Mauern einer Festung eingesperrt, bis auch er aus dem Verkehr gezogen war.
Was hatte ein Mann wie er zu befürchten? Vor wem sollte er Angst haben? Und doch, sagte er sich, war er nur so weit gekommen, weil er wachsam war und anderen gegenüber stets misstrauisch. Nun merkte er deutlich, dass in Rom ein anderer Wind wehte und alles hinfort fegte, was sich ihm in den Weg stellte. Die Wahl Rodrigo Borgias hatte eine ganze Gruppe einflussreicher Leute um diese spanische Familie ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Dieser Kreis baute die Hegemonie immer weiter aus. Die Ehe Jofré Borgias, des vierten Sohnes dieses sündigen und nepotistischen Papstes, mit der schönen Sancha, Tochter des Königs Ferrante von Aragón, Prinzessin von Squillace, stellte einen weiteren Grund zur Besorgnis dar. Eine neue Allianz entstand und festigte die Macht des Papstes. Ganz zu schweigen davon, dass das schwache Band, das mit jenem Mann vor einigen Jahren durch die Heirat seines Neffen Giovanni Sforza mit dessen Tochter Lucrezia geknüpft worden war, brüchig zu werden drohte. In seinem letzten Brief hatte Giovanni ihm sogar geschrieben, er komme sich am Hof des Papstes wie ein Eindringling vor und würde daher seine Tage lieber in der eigenen Festung in Pesaro verbringen, weit weg von den Ränken der Borgia und ihren Palästen. Und diese Worte hallten heute noch viel beunruhigender in Ludovicos Ohren nach und senkten sich tief in seine ohnehin schon düsteren Gedanken.
Abgesehen davon nährte Giovannis Schwägerin Isabella, Tochter des Königs von Aragón und Ehefrau des jungen Gian Galeazzo, tiefen Hass gegen ihn, geschürt vom Verlangen nach Macht, die ihr seit dem Tag, an dem er de facto Herzog von Mailand geworden war, verwehrt blieb. Über diese Titelanmaßung beschwerte sie sich bei ihrem Vater. So stand außer Zweifel, dass die Aragón und die Borgia gegen ihn waren. Florenz war in den Händen Piero de’ Medicis und nach dem Tod Lorenzo il Magnificos nur noch ein Schatten seiner selbst. Ferrara zählte kaum, und Venedig war wie immer ein Rätsel.
»Ich weiß nicht, wem ich trauen kann«, sagte er schließlich. »Ich fürchte, uns steht eine Tragödie bevor, wenn wir die Zeichen nicht rechtzeitig deuten.«
»Ich hatte einen Traum, heute Nacht.« Die tiefe Stimme, die ihm antwortete, schien aus den Tiefen der Erde zu kommen. Aus dem Schatten einer Nische löste sich eine hochgewachsene, schwarz gekleidete Gestalt. Der Mann, der gesprochen hatte, hatte grau meliertes dunkles Haar und trug goldene Ohrringe und edelsteinbesetzte Ringe. Es war Ambrogio da Rosate, der Hofastrologe. Seine Augen, die so blau waren wie Delfter Kacheln, funkelten. »Ein Leviathan entstieg dem brodelnden Meer und zerstörte mit seinen Fangarmen Mailand und dann nacheinander Venedig, Ferrara, Florenz, bis er schließlich in Rom ankam. Er verschlang Männer und Frauen und brachte großes Leid mit sich. Schließlich fiel auch Neapel, das letzte Ziel der Reise, unter seine unsägliche Herrschaft.«
Ludovico spürte die Gegenwart des Mannes in seinem Rücken. Aus den Augenwinkeln erkannte er seine hoch aufragende Gestalt, die eindrucksvollen Schultern, die schwarze Toga unter einem Mantel aus Rabenfedern.
»Was Ihr mir da erzählt, Ambrogio, ist eine sehr düstere Vorahnung. Aus dem Wasser also steigt die Gefahr? Venedig?«
»Keineswegs, mio Signore. Die Gefahr lauert eher im Golf von Genua. Im Übrigen waren die Vorzeichen in den letzten Monaten zahlreich und folgten aufeinander. Wie immer habt Ihr sehr wohl verstanden.«
»Spielt Ihr auf Frankreich an?«
»Ich mache keine Anspielungen, Euer Gnaden. Ich stelle fest. Und wie Ihr wisst, gibt es viele Äußerungen, die mich bestätigen. Girolamo Savonarola glaubte kürzlich erst, er habe Schwerter durch die Wolken brechen gesehen, während sich ein enormes schwarzes Kreuz auf Rom herabsenkte. Ich nehme ihm nicht alles ab, er hat die Ankunft eines brutalen und grausamen Eroberers vorhergesagt, der unsere Halbinsel wie eine ägyptische Plage unterwerfen und geißeln wird. Und dann wären da noch die Statuen, die neuerdings in allen Städten des Herzogtums Mailand und der Serenissima Repubblica von Venedig bluten. Nun, ich bin sicher, dass Euer Gnaden sich aufs Schlimmste vorbereiten sollte. Ich weiß genau, dass es nur einen gibt, der von einem empörend irdischen und persönlichen Interesse geleitet wird und entschlossen ist, zum Vernichter unserer Bevölkerung zu werden …«
»Karl VIII. von Frankreich«, sagte Ludovico schicksalsergeben.
»Ganz genau.«
»Was schlagt Ihr vor, Maestro?«
»Uns mit dem Invasoren zu verbünden.«
»Ist das Euer Ernst?«
»Uns bleibt nichts anderes übrig. Statt eine so starke Macht zu bekämpfen, sichern wir uns ihre Unterstützung.«
»Auf diese Weise haben wir alle gegen uns«, entgegnete Ludovico aufgebracht.
»Mio Signore, Karl von Frankreich führt viele Männer mit sich, ein so großes Heer, dass es die Sonne verdunkeln könnte, und vor allem Geschütze, die seine Feinde zerfetzen werden.«
Ludovico seufzte. »Einverstanden, ich werde auch mit Bartolomeo Calco darüber sprechen und ernstlich in Erwägung ziehen, Unterhändler zu schicken.«
»Tut das, mio Signore, sonst wird nicht einmal diese Festung dem Wüten der Franzosen standhalten.«
Nach diesen Worten hüllte sich Ludovico in tiefes Schweigen. Seine Augen schienen geradezu Funken zu sprühen. »Einverstanden«, sagte er schließlich. »Ich wäre jetzt gern allein, Maestro.«
»Natürlich, Euer Gnaden.«
Ohne ein weiteres Wort entfernte sich Ambrogio da Rosate. Seine Schritte hallten noch lange in Ludovico nach.
Er spürte das Aufziehen der Tragödie, und die Unruhe, von der er gehofft hatte, sie würde durch das Treffen mit dem Astrologen vertrieben werden, kehrte nun noch heftiger zurück, da das endgültige Wissen darum die Aussicht noch furchtbarer machte.
Schließlich wandte er sich vom Kamin ab und läutete mit einer silbernen Klingel, als hinge davon nicht allein sein eigenes Überleben, sondern das des ganzen Herzogtums Mailand ab.
»Ruft Messer Calco herbei«, trug er dem Diener auf, der sofort erschienen war. »Ich muss dringend mit ihm sprechen.«
3. Aussichten
Herzogtum Mailand, Comer Voralpen, in der Gegend von Mandello
Leonardo begann den Aufstieg, dabei nutzte er vorsichtig die natürlichen Vertiefungen und noch die kleinsten Vorsprünge, die ihm die nötige Sicherheit boten. Er hatte es nicht eilig. Er sah zu, wie die aufgehende Sonne den schwarzen Schleier der Nacht zerriss. Die Schlucht wurde von Licht durchflutet, er sah, wie die ganze Felswand aufleuchtete und der graue Fels unter seinen Fingern silbrig wurde.
Immer wieder prüfte er einen Tritt, ehe er den Körper möglichst gut ausbalancierte und weiterkletterte. Langsam, doch stetig. Ein kleiner Vorsprung im Kalkstein bot ihm den nächsten Halt.
Er atmete tief durch und ruhte einen Moment aus. Unter ihm öffnete sich der Abgrund. Er sah hinunter, als wollte er ihm die Stirn bieten. Er hatte sich nirgends angeseilt und ließ die Beine über den Rand des Abgrunds baumeln. Er würde sich nicht mit dieser Wand anlegen, da würde er am Ende wohl den Kürzeren ziehen; er musste sich den Gegebenheiten anpassen und das Beste aus dem machen, was der Stein ihm zu bieten hatte. Er konnte sich nur auf seinen trainierten Körper verlassen, seinen eisernen Willen und seine ausgeprägte Beobachtungsgabe. Und genau deshalb liebte er es, sich mit dem Fels zu messen.
Mit einer geschmeidigen Bewegung gelang es ihm, sich noch ein klein wenig weiter hochzuziehen. Wenn er von dort weitere Tritte und Griffe ausmachen konnte, könnte er sogar bis zum Gipfel vordringen. Er suchte und fand mit den Händen eine Felsnase, ehe er sie sah; dass sie vor ihm auftauchte, war ein echter Glücksfall, denn sich von dort auf den Vorsprung zu hieven, der wie eine Art Terrasse die Tiefe überragte, wäre keineswegs unmöglich. Im Gegenteil, es wäre geradezu ein Kinderspiel.
Mit Schwung gelang es ihm, das rechte Bein aufzusetzen, sich damit hochstemmend konnte er auch das linke hochziehen. Er brauchte eine kleine Pause und atmete tief durch. Die kalte Luft des Tals schien ihn durch und durch zu reinigen. Dann richtete er sich auf und arbeitete sich weiter vor. Er legte die rechte Hand in eine Öffnung im Fels. Der rechte Fuß kam auf einer kaum wahrnehmbaren Kante zu stehen. Mit der Linken tastete er die Wand ab, bis er auf einen losen Felsbrocken stieß. Der wirkte wenig vertrauenswürdig.
Er testete ihn mit der Handfläche, und es löste sich eine Handbreit krümeliges Gestein, das hinabrollte. Schweiß lief ihm übers Gesicht. Doch Leonardo merkte, dass Hoffnung bestand; nachdem der äußere Rand abgebrochen war, erwies sich der Teil darunter als fest genug, um ihm ein weiteres Hinaufsteigen zu ermöglichen. Er gelangte zu einer Art schmalem Absatz. Wenn er sich von dem aus nach vorn ausstreckte, konnte er sich an den letzten Felssporn klammern und würde schließlich zum Gipfel gelangen.
Er hoffte, dass diese Felsnase sein Gewicht halten würde. Wie ein Wurm kroch er über den Vorsprung. Er hing über absoluter Leere, und mit einer genau bemessenen Drehung des Oberkörpers gelang es ihm, ein Bein auf den felsigen Untergrund zu setzen. Da begriff er, dass er es geschafft hatte, dass er die wilde Schönheit der steilen Schlucht bezwungen hatte.
Nachdem er sich eine weitere Rast erlaubt hatte, stieg er auf einem schmalen Weg rasch wieder hinunter zum Dorf. Dort bog er auf einen Saumpfad ab, der durch das Tal führte. Dieser Weg bot einen wundervollen Ausblick und würde ihm helfen nachzudenken. Die Betrachtung der Natur war wie ein Geschenk. Er befragte sie mit seinem Blick, so wie er es schon in Kindheitstagen gemeinsam mit seinem Onkel getan hatte. Und er erhielt immer die Antworten, nach denen er suchte.
Er schaute auf die verschneiten Gipfel dieser schroffen und unzugänglichen Berge. Und lächelte. Sie gefielen ihm so sehr, dass er sie zum idealen Hintergrund seiner Bilder erkoren hatte. Und das würde er bestimmt auch weiterhin so halten.
Nach einem steileren Stück verlief der Saumpfad nun flacher. Leonardo ließ seinen Blick schweifen. Er sah eine Ansammlung von Häusern, die eins auf dem anderen zu hocken schienen, knorrige Olivenbäume, und ein Stück weiter nach oben gelangt, konnte er das Santuario di Santa Maria ausmachen, das dort wie bekrönend mit der felsigen und verschneiten Bergkuppe verwachsen zu sein schien.
Als er den Blick hob, sah er einen Falken im Flug. Mit weit aufgespannten Flügeln durchschnitt er majestätisch die Lüfte. Dieser Anblick erfüllte ihn gleichermaßen mit Freude und innerer Ruhe. Ganz deutlich merkte er, wie sich seine Seele beruhigte. Heute Morgen hatte er sich auch deshalb dem Aufstieg in die Wand gewidmet, um nicht an die Enttäuschungen der letzten Tage denken zu müssen. Seit Jahren arbeitete er nun schon hart an der Ausführung eines kolossalen Reiterstandbildes von Francesco Sforza.
Er wusste, wie viel Ludovico daran lag. Doch nach endlosen Berechnungen und Studien, nachdem er in seinem Atelier in der Nähe der Corte Vecchia ein riesiges Tonmodell geschaffen hatte, nachdem er sich lange damit beschäftigt hatte, welche Legierung er wählen sollte, und sich für Bronze entschieden hatte, hatte er erfahren, dass er die ganze Arbeit in den Wind schreiben konnte.
Ludovico fürchtete den Einmarsch Karls VIII. in Italien. Und er hatte allen Grund dazu – mit jedem Tag war die Befürchtung zu dramatischer Gewissheit angewachsen. Und nicht nur das. Er würde alle verfügbare Bronze aufwenden müssen, um dem französischen Monarchen die größtmögliche Anzahl an Kanonen zu garantieren.
Daher war das Projekt gescheitert. Ironie des Schicksals: Das Metall, das für das Werk bestimmt war, das er schaffen wollte, wurde zur Herstellung von Kriegsmaschinen beschlagnahmt. Und zwar genau solcher, die zu entwickeln er bei seiner Ankunft in Mailand selbst angeboten hatte. Ludovico hatte sie nie in Auftrag gegeben und ihn stattdessen gebeten, raffinierte Apparate zur Zerstreuung und für Bühneninszenierungen seiner Festivitäten anzufertigen. Es gab genügend Gründe, verstimmt zu sein.
Doch glücklicherweise wartete in diesen Tagen eine neue Herausforderung auf ihn. Denn Il Moro, der mindestens so enttäuscht war wie er, hatte ihn mit den Fresken für das Refektorium von Santa Maria delle Grazie beauftragt. Leonardo hatte den Raum gesehen und sich schon genaue Vorstellungen gemacht, wie er vorgehen würde. Er wollte eine neue Maltechnik ausprobieren.
Während er darüber nachdachte, waren die Kirche und das nahegelegene Benediktiner-Hospiz in den Blick gekommen. Er wusste, dass er dort Brot und Wein vorfinden würde, um Körper und Geist zu stärken. Danach würde er sich auf den Heimweg machen.
4. Mutlosigkeit
Königreich Neapel, Castel Nuovo
Alfons schaute Truzia an. Sie sah hinreißend aus mit ihren langen schwarzen Haaren, den Augen wie aus Onyx, den sinnlichen Lippen, und das Kleid, das sie trug, betonte Brust und Hüften. Ihre Tochter Sancha hatte alles von ihr geerbt. In diesem Moment jedoch nahm er die schon fast unverschämte, atemberaubende Schönheit dieser Frau fast nicht wahr, denn er war mit den Gedanken woanders.
Es gab keinen Zweifel mehr. Karl VIII. hatte sich in Bewegung gesetzt und wollte bis nach Neapel vordringen. Er wollte sein Recht auf die Krone geltend machen, das auf einer entfernten Verwandtschaft zu den Anjou über seine Großmutter Maria beruhte.
Er sah, dass Truzia voll und ganz erfasste, wie entsetzt er war. Und wie immer wirkte sie mit ihrer ganzen Energie auf ihn ein. Sie war eine großartige Frau, und sie hoffte, ihn aus dem Zustand der Schwäche reißen zu können, die ihn an dem Tag befallen hatte, als sein Vater gestorben und die Regentschaft auf ihn übergegangen war.
»Was ist los, mio Signore? Fürchtet Ihr das Herannahen des französischen Monarchen? Sagt mir, was Euch bedrückt. Ich schwöre, dass ich an Eurer Seite kämpfen werde, wenn es nötig ist.«
Alfons seufzte. »Ich sehe ihre Leichen vor mir, Liebste.«
»Wessen?«
»Der Barone … Diese Verschwörung hat in mir solche Spuren hinterlassen, dass meine Seele ganz geschwächt ist. Auch heute Nacht habe ich von ihnen geträumt. Ich sehe immer noch den flehenden Blick von Francesco Petrucci, während ihm der Henker auf dem Marktplatz mit einer Sichel die Kehle durchschneidet. Und wie dann der niedergemetzelte Leichnam an Pferde gebunden und gevierteilt wird. Ich sehe seinen Bruder Giovanni Antonio, den Grafen von Policastro, zu Fuß zur Piazza kommen, als dort gerade das Blut fortgespült wird. Ich sehe, wie er schweigend vor mir steht und auf seine Enthauptung wartet. Und später die leeren Augenhöhlen der beiden Brüder, die Augäpfel von Raben herausgepickt. Jede Nacht sehen mich ihre blau angelaufenen Gesichter an, aus ihren Mündern kriechen Maden.«
»Ihr müsst aufhören, Euch damit zu quälen, immer wieder an diese Momente zu denken. Ihr habt richtig gehandelt! Es gab keine andere Wahl. Es war notwendig, Eure Herrschaft zu festigen, und Ihr habt Euren Vater bestmöglich beraten. Was Ferrante getan hat, war seine Entscheidung, und Ihr habt Euch lediglich als das erwiesen, was Ihr seid: ein treu ergebener und mutiger Sohn. Dafür muss man sich nicht schämen.«
»So dachte ich bis vor einiger Zeit auch. Ich war es, der meinen Vater aufgewiegelt hat. Ich habe ihm in den Ohren gelegen, ja förmlich auf ihn eingeschrien, seine Rache solle wie ein Hammer auf das Haupt der Verschwörung niedergehen, auf jene Barone, die seine Macht herausgefordert hatten. Doch nun bin ich so müde. Ferrante ist von uns gegangen, und seither bin ich nicht mehr derselbe. Ich wünsche mir Frieden. Stattdessen muss ich erleben, dass Karl VIII. gegen Neapel zieht, um es uns wegzunehmen. Antonello Sanseverino war es, der ihn gegen mich aufgehetzt hat. Dieser Bastard hat sich nach Frankreich zurückgezogen, abgewartet, und nun will er sich rächen für das, was wir ihm angetan haben!« Alfons war den Tränen nahe, als er das sagte. Er war aufgebracht, unfähig, einen klaren Gedanken zur Verteidigung der Stadt in diesem kompromisslosen Krieg anzustellen, der sich da abzeichnete. Und ihm war unbegreiflich, wie es mit ihm so weit hatte kommen können.
Er sah, dass Truzia ihn voller Mitgefühl anschaute. Er hasste sich dafür, dass er so schwach geworden war. Wie gern würde er das Schwert zücken, auf den Turm der Festung steigen und ganz Neapel zuschreien, dass er es gegen die räuberischen Vorhaben der Franzosen verteidigen würde, aber er wusste, dass er dazu nicht mehr in der Lage war. Jahre voller Verrat und Gewalt hatten ihn zu einem Wurm werden lassen.
Auch wenn er eingestehen musste, ein Feigling zu sein, wusste er, dass Truzia andere Pläne mit ihm hatte.
»Ihr müsst jetzt stark sein, Majestät«, sagte sie und umfasste seinen Arm. »Ich werde Euch gegen jeden verteidigen, der es wagen sollte, Eure Macht oder Eure Autorität infrage zu stellen. Aber Ihr müsst mir helfen. Ihr könnt Euch nicht so gehen lassen. Wir haben mächtige Verbündete. Der Papst ist auf unserer Seite, Venedig ebenfalls – wenn auch nicht ganz klar in seiner Haltung. Außerdem Florenz.«
Alfons schüttelte den Kopf. »Der Papst? Dieser inzestuöse Nepotist Alexander VI.? Was wird der bewirken können? Sein Bastard Juan befindet sich auf spanischem Boden. Und sein Bruder Cesare? Ein Kinderkardinal, der vor allem junge Mädchen entjungfert. Wirklich zwei schöne Beispiele. Florenz? Piero ist nicht mal ein Viertel so viel wert wie sein Vater. Lorenzo de’ Medici hat eine Lücke hinterlassen, die nicht aufzufüllen ist. Sein Sohn ist ein Dummkopf, und er wird die Stadt ohne mit der Wimper zu zucken übergeben, darauf gebe ich Euch Brief und Siegel. Venedig wiederum wird sich hüten einzugreifen. In der Zwischenzeit schmieden die Colonna Komplotte gegen den Papst, und Ludovico il Moro hat sich mit dem Franzosen verbündet. Aber was sollte man auch erwarten von einem Usurpator, der meiner Tochter Isabella trotz ihrer Heirat mit dem legitimen Erben verwehrte, Herzogin zu werden? Nein, Liebste, wir haben keine mächtigen Verbündeten. Nicht im Geringsten! Stattdessen haben wir erbarmungslose Gegner. Doch ich will mich ihnen entgegenstellen. Das verspreche ich Euch.«
»Recht so, mio Signore. Endlich!«
»Karls Heer allerdings ist beeindruckend: Mehr als dreitausend Reiter, mehr als fünfzehntausend Infanteristen, darunter Söldner und Gaskogner, weitere zehntausend Bogen- und Armbrustschützen; wir sprechen von insgesamt fast dreißigtausend Männern, ganz zu schweigen von seinen verdammten Kanonen!«
»Und denen begegnet Ihr mit Eurem Heer! Guter Gott, Alfons, man nannte Euch einst Nero! Entsinnt Euch, wer Ihr seid, und nehmt Haltung an! Ihr habt dieses Reich mit Eisen und Blut zusammengehalten, als weit Ehrfurcht gebietendere Feinde gegen Euch und Euren Vater intrigiert haben.«
»Und diese Feinde verfolgen mich heute in meinen schlimmsten Albträumen!«
»Dann tut mir einen Gefallen. Tötet sie ein zweites Mal – in Eurem Geist!«
5. Allianzen
Kirchenstaat, Apostolischer Palast
Und auf diese Weise wollte Ludovico Sforza uns verraten! Indem er sich an die Seite des Invasoren stellt! Aber glaubt mir, mein Freund, das wird Euch teuer zu stehen kommen! Ich weiß, dass es nicht von Euch abhängt, aber seht zu, dass Ihr Euch das bisschen Vertrauen verdient, das ich noch in Euch habe!« Der Papst war außer sich, das war Kardinal Ascanio Sforza vollkommen klar. Umso mehr, weil der Mann, den er vor sich hatte, Rodrigo Borgia war, der den Petersthron als Alexander VI. bestiegen hatte und der für seinen unersättlichen Machthunger bekannt war, für sein unbändiges sexuelles Verlangen und für die unerschütterliche Entschlossenheit, mit der er seine eigene Familie begünstigte. Ascanio Sforza hatte seinerseits nicht die geringste Absicht, seinen Bruder des Verrates zu bezichtigen. Ludovico traf nur eine Schuld: sich geweigert zu haben, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Das erklärte er dem Papst mit Bestimmtheit.
»Eure Heiligkeit, ich verstehe Eure Besorgnis. Andererseits hat es niemand gewagt, meinem Bruder ein Bündnis anzubieten, das diesen Namen verdient hätte. Ludovico hat sicher nicht die Mittel, sich der französischen Invasion entgegenzustellen, und wurde von allen im Stich gelassen. Ich glaube, es wäre richtig, wenn Ihr das zur Kenntnis nehmen würdet.« Sforza wusste genau, dass er sich sehr weit vorwagte. Doch er war an einem Punkt angelangt, an dem er sich nicht mehr für sein eigen Fleisch und Blut schämen wollte. Wenn dieser verdamme Papst ihm den Krieg erklären wollte, sollte er – er würde nicht zurückweichen.
»Ach tatsächlich … wenn das so ist, lasst mich gleich sagen, dass ich mich von nun an hüten werde, mich für Euch einzusetzen!«
»Wieso? Wann hättet Ihr das denn bisher getan?«
»Wie könnt Ihr es wagen! Habt Ihr vielleicht vergessen, wem Ihr es zu verdanken habt, dass Ihr Vizekanzler geworden seid?«
»Keineswegs! Sofern Ihr Euch daran erinnert, dass Ihr den Thron dank der Stimmen bestiegen habt, die ich für Euch gesammelt habe.«
Der Papst erhob sich, vor Wut schäumend. Er war ein kräftiger und dank der Gewänder und Paramente geradezu imposanter Mann. Nun trat er an Sforza heran und sah dem Kardinal tief und herausfordernd in die Augen. »Wie könnt Ihr es wagen, mir so etwas ins Gesicht zu sagen? Die Wahrheit ist, dass Ihr mich nur wegen persönlicher Vorteile unterstützt habt, und auch erst nachdem Eure Aussichten, Papst zu werden, auf null gesunken waren, weil Ihr nicht genügend Stimmen hattet. Das ist weder meine Schuld noch die von jemand anderem, doch nun sehe ich mit aller Deutlichkeit, dass ich mich vor den Sforza hüten muss, mehr noch, ich bekomme Angst bei dem Gedanken, was meiner Tochter zustoßen könnte, die ich auf Euer Drängen hin vielleicht zu leichtfertig Giovanni zur Frau gegeben habe!«
»Heiligkeit, ich bedaure, diese Eure Worte zu hören. Was Giovanni angeht, kann ich Euch versichern, dass er ein Ehrenmann ist und dass er, da er Eure Tochter geheiratet hat, gewiss weder sie noch Euch verraten wird«, gab Kardinal Sforza angewidert zurück. »Soweit ich sehe, lag Euch bis vor Kurzem an einem Bündnis mit meiner Familie mehr als mit jeder anderen. Nun seid Ihr ganz geblendet vom Glanz des aragonesischen Hofes, der dem Königreich Neapel wegen alter Bande der Vasallenschaft verpflichtet ist und wegen der gemeinsamen spanischen Herkunft. Und bei alldem habt Ihr nichts Besseres zu tun, als mir vorzuwerfen, ich sei parteiisch zugunsten meines Bruders. Und das, ich sage es noch einmal, nachdem Ludovico im Stich gelassen wurde. Glaubt Ihr, ich sähe nicht, was Eure Absichten sind?«
»Ich bin gespannt, mehr über sie zu erfahren, da Ihr Euch zum Deuter meiner Gedanken und zum Richter über mein Verhalten erhebt.«
»Ihr zielt darauf ab, den Kirchenstaat um Neapel zu erweitern. Ihr plant, die Romagna zu unterwerfen und Eure Macht, die wahrlich nichts Spirituelles an sich hat, noch weiter auszudehnen, indem Ihr auch Mailand vereinnahmt. Venedig interessiert Euch nicht, auch wenn sie als Mätresse der Meere, die sie nun einmal ist, in solcherlei Gedankenspielen sicher bereit wäre, zu Eurer treuen Untergebenen zu werden. Doch es gibt da eine Schwierigkeit. Ihr habt das Pech, dass Eure Söhne weit weniger tüchtig sind als Ihr, und daher werdet Ihr mit Euren hegemonialen Absichten scheitern, das kann ich Euch garantieren!«
»Mein lieber Kardinal … Ihr solltet Gott und meiner unendlichen Großmut danken, dass ich Euch nicht sofort vom Hauptmann der Garde ergreifen lasse und ihm befehle, Euch in Ketten legen und ins Gefängnis werfen zu lassen! Ich werde nicht eher ruhen, bis Eure Familie ausgelöscht ist. Ich rate Euch, Rom auf der Stelle zu verlassen, denn morgen früh könnte ich meine Meinung geändert haben und Euch festnehmen lassen. Ihr solltet meinen Akt der Barmherzigkeit zu schätzen wissen, den ich auch gegenüber Eurem Cousin walten lassen werde, indem ich ihm meinen gerechten Zorn über das, was ich gerade gehört habe, erspare. Und nun befreit mich von Eurer Anwesenheit.«
Ascanio Sforza erwiderte bleich: »Ihr begeht einen großen Fehler, Heiligkeit.« Damit begab er sich ohne ein weiteres Wort zur Tür.
6. Im Sold der Franzosen
Kirchenstaat, Palazzo Colonna
Die Cousins sahen einander an. Beiden war klar, dass diese Gesandtschaft nur auf eine Weise enden konnte. Nach einer Weile des Hin- und Herlavierens, sich mal mit der einen, dann wieder mit der anderen Seite verbündend, war der Moment gekommen, sich festzulegen. Und wie immer, wenn es galt, eine solche Entscheidung zu treffen, folgten Fabrizio und Prospero nur einem Kriterium: Wer ihnen die bessere Bezahlung bot.
Die Gesandten Karls VIII. hatten Geschenke und Versprechen mitgebracht. Sie hatten auch besonders hervorgehoben, ihr König habe bereits eine Bündniszusage von Ludovico Sforza. Nun hofften sie auf Verbündete in der Ewigen Stadt, denn es war klar, dass der Papst alles tun würde, was in seiner Macht stand, um ihr Vordringen in Italien aufzuhalten.
Da er das Anliegen des französischen Herrschers voll und ganz erfasste, hatte sich Prospero Colonna sofort bereit gezeigt, zuvorkommend auf die Wünsche einzugehen. Nachdem er den Gruß der Gesandten ebenso entgegengenommen hatte wie die Schwerter, deren Griffkörbe mit Steinen besetzt waren und die Karl VIII. ihm und seinem Cousin zum Geschenk machte, befleißigte er sich, sich willens und zum Handeln bereit zu geben.
»Monsieur de Basche, zunächst möchte ich Euch versichern, dass Ihr Euch in diesem Palazzo in einem geschützten Bereich befindet, zum einen, weil Ihr als Gesandter selbstverständlich unantastbar seid, zum anderen, weil dieser Eurer Gesprächspartner sich Hoffnungen macht, sich ein Freund der Franzosen rühmen zu dürfen. Mein Cousin und ich wissen nicht allein die Geschenke zu schätzen, die Ihr uns brachtet, wir sind auch der Ansicht, dass die Ansprüche Karls VIII. auf den Thron von Neapel vollkommen gerechtfertigt sind.« Bei diesen Worten trat in Prospero Colonnas gierigen Blick ein selbstzufriedener Ausdruck der Genugtuung, als würde ihm die Bekräftigung dieser Tatsache körperliches Wohlbehagen bereiten. Der römische Edelmann erhob sich und durchmaß mit großen Schritten den prächtigen Saal, in dem sie sich befanden. »Doch glaubt mir, wir werden noch mehr tun, um dem Gesagten die Ehre zu erweisen, nicht wahr, Fabrizio?«
Letzterer richtete sich, als sein Name fiel, zu seiner eindrucksvollen Größe auf, die durch seine kräftige, wenn auch schlanke Statur betont wurde. Mit seinem wegen seiner Hakennase leicht raubvogelartigen Blick sah er den französischen Gesandten an und sprach mit der volltönenden Stimme eines Kriegers: »Was mein Cousin soeben sagte, ist vollkommen richtig, denn sobald der König seine Zurückhaltung aufgibt, werde ich für ihn die Rocca di Ostia einnehmen und den vom Papst ernannten Kastellan von dort verscheuchen. Ich gehe davon aus, dass Euer Herr aufgrund seiner Allianz mit Ludovico il Moro und der allgemein bekannten Unfähigkeit Piero de’ Medicis und seiner Stadt Florenz, jedweder Bedrohung etwas entgegenzusetzen, auf seinem Weg auf geringen Widerstand stoßen wird. Und so wird er im Handumdrehen vor den Toren Roms stehen, denn Ostia ist der Schlüssel zur Ewigen Stadt.«
Perron de Basche lächelte. Er war ein schmaler Mann, angespannt wie die Sehne eines Bogens, elegant gekleidet. Die Cousins hatten den Eindruck, dass er ihre Worte mit Erleichterung aufnahm.
»Was Ihr sagt, Signori, beruhigt mich sehr. Euch als Verbündete meines Königs zu wissen, ist der größte Lohn für die Mühen dieser Tage. Ihr sollt wissen, dass Karl VIII., während ich noch hier mit Euch spreche, bereits den Marsch gen Süden befohlen und mit großer Wahrscheinlichkeit schon die Grenze des Herzogtums Savoyen erreicht hat. Dort wird er in Kürze einmarschieren, dank der von Euch erwähnten Allianz mit dem Regenten von Mailand. Wenn es so ist, wie Ihr sagt, ist meine Hoffnung daher, dass Ihr Eure Pläne bereits ab dem kommenden Monat umsetzt, sobald sich, sofern alles wie erhofft läuft, der König in Florenz befindet. Ein Überraschungsmanöver wie dieses könnte übrigens durchaus auch die päpstlichen Truppen destabilisieren, die nach Auskunft meiner Spione bis heute der Meinung sind, sie hätten bei der Verteidigung leichtes Spiel.«
Prospero konnte sich nicht beherrschen, er brach in Gelächter aus. Er schien wirklich amüsiert. Er goss sich einen Becher Rotwein ein und trank in großen Schlucken daraus. Dann wischte er sich mit dem Handrücken über den Mund. »Seht mir mein Benehmen nach, mein Freund, doch wenn Ihr wüsstet, mit wem wir es hier zu tun haben, könntet Ihr den Grund meiner Heiterkeit verstehen. Der Kastellan der Rocca di Ostia ist ein Hasenfuß, und ich glaube gern, dass wir mit Leichtigkeit seiner Herr werden. In jedem Fall ist es beschlossene Sache, mit dem Gesagten ist der Pakt besiegelt. Unsere Schwerter und unsere Herzen sind dem König von Frankreich zu Diensten, doch sind wir so kühn, etwas im Gegenzug zu fordern. Ich hoffe, dass diese Worte bei Euch nicht falsch ankommen, doch seht, sich so angreifbar zu machen, wie wir es vorhaben, wird für unsere Familie nicht ohne Folgen bleiben. Wir haben die Borgia gegen uns, so viel steht fest, dann die Orsini und die Aragón, und zwar allesamt, noch ehe Ihr mit Eurem prächtigen Heer hier angekommen seid. Ich denke, ich liege nicht falsch, wenn ich behaupte, dass unser Einsatz ein nicht unerhebliches Risiko mit sich bringt. Wie ich schon sagte, nicht so sehr wegen Ostia, als wegen der Auswirkungen, die das auf die anderen mächtigen Familien, unsere Feinde, haben wird. Den Unmut der Borgia, Orsini und Aragón zu ertragen wird beileibe kein Kinderspiel sein. Und insofern frage ich Euch: Was stellt Ihr Euch als Gegenleistung für einen derartigen Freundschaftsbeweis vor?« Nachdem er dem Gesandten diese alles entscheidende Frage gestellt hatte, strich sich Prospero über seinen dünnen Schnurrbart.
Wenn sich diese Forderung in Perron de Basches Ohren unangemessen angehört haben sollte, ließ er es sich nicht anmerken. Vielmehr schien er seit seiner Ankunft im Palazzo Colonna darauf gewartet zu haben.
So zeigte er keinerlei Zögern, sondern antwortete, als wüsste er schon längst genau, wohin diese Unterhaltung führen würde. »Signori, was Ihr erbittet, ist nicht nur gerechtfertigt, sondern mehr als verdient. Ich möchte Euch daher neben der Auszahlung von fünfundzwanzigtausend Dukaten, die mein König Euch, Messer Prospero Colonna, garantiert, ankündigen, dass unser Bundesgenosse, der Regent von Mailand, Eurem Cousin dieselbe Summe zahlen wird. Und das ist nur der Anfang. Die Vergabe von Ländereien ist natürlich auch nicht ausgeschlossen, sobald Italien uns zu Füßen fällt.«
Fabrizio nickte Prospero zu. Dann trat er zum französischen Gesandten. »Nun, wenn es sich so verhält, Messer de Basche, dann kann ich Euch ohne Weiteres zusichern, dass wir eine Vereinbarung haben.« Er hielt dem Franzosen seine Rechte hin.
»Das freut mich«, antwortete dieser ebenso zufrieden.
»Bei der Gelegenheit«, meldete sich Prospero zu Wort, »richtet Monsignor della Rovere unsere besten Grüße aus. Wir wissen, wie sehr er Eure Position unterstützt hat, und wir bedauern es sehr, ihn in Frankreich zu wissen, so weit vom päpstlichen Thron, der seiner Anwesenheit noch nie so sehr bedurft hat wie jetzt.«
»Wie im Übrigen auch der von Ascanio Sforza«, hob Fabrizio hervor.
»Wieso? Weilt Kardinal Sforza nicht mehr in Rom?«, fragte Perron de Basche.
»Keineswegs! Seine jüngsten – berechtigten – Klagen haben den Papst veranlasst, ihm zu drohen, und er hat Rom in diesen Stunden verlassen.«
»Verstehe. Nach monatelangem Verhandeln und Intrigieren haben sich die Fronten also geklärt, und die Lager zeichnen sich deutlich ab.«
»Genauso ist es, Messer de Basche: Die Sforza und die Colonna sind auf Eurer Seite, die Borgia, Medici, Este und Aragón haben es darauf abgesehen, Euch das Leben schwer zu machen. Die Einzigen, über die ich nichts sagen kann, sind die Venezianer«, schloss Prospero.
»Oh, um die müsst Ihr Euch keine Sorgen machen«, erwiderte Basche, »Messer Antonio Condulmer, der venezianische Gesandte in Paris, hat die Neutralität der Serenissima zugesichert.«
»Ganz dieselben verdammten Kaufleute wie immer«, polterte Fabrizio, »unbeständig wie das Wasser in ihrer Lagune.«
»Das hätte ich nicht besser sagen können«, scherzte de Basche. »Wie auch immer, Signori, es ist Zeit, unsere Pläne in die Tat umzusetzen.«
7. Karl VIII.
Contea d’Asti, Castello di Annone
Dieser Mann ist der Teufel in Person! Seine Soldaten, um genau zu sein. Sie kämpfen wie die Höllenhunde. Sie haben bei Rapallo die Flotte von Friedrich von Aragón geschlagen, und die Schweizer, die an ihrer Seite kämpfen, haben die Bevölkerung niedergemetzelt. Die Herzöge von Savoyen und die Markgrafen von Saluzzo und Monferrato haben sich ihm an den Hals geworfen. Pah! Wie die Kaninchen vor der Schlange.« Ludovico glaubte beinahe seinen eigenen Worten nicht. Und doch stimmte es. Es war erst ein paar Tage her, dass der Herzog von Orléons die aragonesischen Schiffe in die Flucht geschlagen hatte, während die Truppen von Sanseverino zusammen mit den Schweizer Söldnern und deren Kanonen die Männer von Ibietto dei Fieschi niedergemacht haben – dreitausend Infanteristen. Nach diesem überwältigenden Sieg traten die Helvetier die Hölle los und massakrierten die Männer und Frauen auf den Straßen Rapallos.
»Und am Ende habe auch ich mich mit diesem König eingelassen«, murmelte Ludovico und knallte seinen Zinnbecher auf den Tisch.
Seine Gemahlin Beatrice sah ihn entgeistert an. Sie war schön, ihr langes kastanienfarbenes Haar trug sie in einem Zopf, in den perlenbesetzte Silberketten eingearbeitet waren. Ihre Augen waren kohlschwarz und voller Glut. Ihr Gesicht war ein perfektes Oval, nun jedoch verriet es Furcht – sie hatte Ihren Gemahl noch nie so besorgt gesehen. Der Bericht von den Taten des französischen Herrschers machte es gewiss nicht besser. Im Versuch, auch die eigene Furcht zu vertreiben, nahm sie es auf sich, ihrerseits darzulegen, was sie gehört hatte. »Es hat den Anschein, als ob der König der Franzosen einen ungeheuer großen Kopf hat. Die wässrigen Augen schwimmen hin und her und schauen in alle Richtungen. Er ist missgestaltet, bucklig und furchtbar. Sein Blutdurst ist unstillbar. Das sagen alle, die ihn gesehen habe. Er ist ein wildes Tier. Ihr tut gut daran, Euch von solch einem Verbündeten fernzuhalten.«
»Das ist mir schon klar! Wenn ich die Wahl gehabt hätte, wäre ich nicht in diesen Krieg gezogen. Man hat mich im Stich gelassen, die einzigen Ausnahmen waren Euer Vater und die Colonna, die, eingesperrt in Ihren Palazzi, nur darauf warten, den Borgia und Orsini im Schutze der Nacht an die Gurgel zu gehen. Wird das reichen? Ich glaube nicht. Aber wir können ganz gewiss keinen Widerstand leisten. Vor allem fehlen uns die Mittel. So furchtbar dieser Herrscher auch sein mag, uns bleibt nichts anderes übrig, als ihm die Ehre zu erweisen, und wir müssen es außerdem überzeugend tun. Morgen darf er nicht den geringsten Zweifel an unserer Loyalität haben, habt Ihr verstanden, Liebste? Sonst geht es nicht mehr nur um unsere Zukunft, sondern um unser Leben.«
»Ich verstehe, mio Signore. Und ich versichere Euch, dass Ihr an mir nicht zu zweifeln braucht. Keine Sekunde.«
»Danke, mein Herz«, sagte Ludovico und umarmte seine Gemahlin mit brennender Dankbarkeit. Er liebte diese Frau, und auch wenn er seine Triebe nicht zügeln konnte und sie ihn häufig die Betten seiner zahlreichen Geliebten aufsuchen ließen, kehrte er doch immer zu Beatrice zurück. Er legte ihr Gesicht an seine Brust und strich ihr zärtlich über das glänzende Haar, ließ seine Hand auf dem perlengeschmückten Zopf ruhen. Dann hob er ihr Gesicht mit Daumen und Zeigefinger an und küsste ihren korallenroten Mund.
»Ihr müsst keine Angst haben, Beatrice, verzeiht mir lieber, dass ich so schwach war und mich so habe gehen lassen. Ich weiß, es gibt keine Entschuldigung. Ausgerechnet ich, der ich Euch vor allen Gefahren und Schwierigkeiten beschützen sollte. Dabei wünschte ich doch nur, ich müsste mich diesem Barbaren, der Italien hinabzieht, allein, um es in Brand zu setzen, nicht ehrerbietig erweisen. Doch nur so kann ich Mailand schützen.«
Sie legte ihm den Zeigefinger auf die Lippen. »Kein Wort, Ludovico. Ihr müsst nichts sagen. Ich verstehe Eure Liebe zu Mailand voll und ganz. Und genau aus diesem Grund braucht Ihr mir nichts zu erklären, denn ich kenne Euch ja und weiß, wie viel Mut in Euch steckt. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es keinen besseren Mann geben könnte, um dem König von Frankreich entgegenzutreten. Wenn Ihr es für nötig haltet, ihn in die Irre zu führen, um uns alle zu retten, werden wir das tun. Ich habe nie an Euch gezweifelt, und ich werde bestimmt nicht heute damit anfangen.« Dann spürte er, wie sie ihm über die Wange strich und ihn küsste. Schließlich löste sie sich aus der Umarmung und ging zum großen Fenster des Saales, durch das das Sommerlicht hereinfiel.
Sie wandte ihm den Rücken zu und schaute hinaus.
Ludovico stellte sich vor, was sie sah: den Hof der Burg, die bewaffneten Wachen in Rüstung, die Stallburschen, die die Pferde in die Stallungen brachten. In der Festung herrschte reges Treiben.
»Einverstanden. Ich danke Euch für Eure Worte. Aber vielleicht weiß ich auch einen Weg, wie es sich vermeiden lässt, dem französischen König in diesen elenden Feldzug zu folgen«, schloss Il Moro orakelhaft.
8. Das Feldlager
Contea d’Asti, Feldlager KarlsVIII.
Das Feldlager schien endlos. Die Zelte erstreckten sich bis fast zum Horizont, und die Ebene vor der Stadt war wie schwarz überzogen mit all den Rüstungen aus brüniertem Eisen und Leder. Ludovico bewunderte die exakte Ausrichtung und kriegerische Strenge des Lagers. Er sah die großen Kanonen auf riesigem Bronzegestell, die in der Schlacht von Rapallo die Flotte Friedrichs von Aragón zerstört hatten. Noch beeindruckender waren deren Geschosse – Eisenkugeln so groß wie der Kopf eines Mannes. Für einen Augenblick musste er an Leonardo denken, der ihn vor über zehn Jahren gebeten hatte, Kriegsgerät für ihn bauen zu dürfen. Letztlich hatte er seine Sachkenntnis nie überprüfen können. Nun war es vermutlich zu spät. In den Krieg hatte er sich nur widerwillig hineinziehen lassen, schließlich ging er stets lieber den Weg der Intrige und versuchte, wann immer er konnte, ein Blutvergießen zu vermeiden. Es war viel besser, ein Territorium durch List und Komplotte zu beherrschen, als zu den Waffen zu greifen, zumindest war das seine Meinung. Er bemerkte jedoch, dass ein wilder Blutdurst sich im Lager breitmachte, als seien die Soldaten Karls VIII. Raubtiere, im Begriff, ihre Zähne in das Gerippe eines erlegten Beutetieres zu schlagen.
Vom Rücken seines eleganten Rotfuchses mit dem glänzenden Fell aus sah er sich um, gleichermaßen fasziniert wie bestürzt. Er erkannte, dass er sich in der Einschätzung seines Verbündeten vollkommen geirrt hatte: Was er vor sich hatte, war nicht das Heer eines Söldnerhauptmanns, nicht bloß eine Handvoll angeheuerter Kämpfer, bereit, das Lager jederzeit zu wechseln, wenn es schlecht liefe. Nein, nicht im Mindesten: In den Augen dieser Männer war ein Leuchten, das Ludovico Sforza noch nie zuvor gesehen hatte. Sie vermittelten den Eindruck, als seien sie bereit, für ihren König ihr Leben zu lassen. Etwas, das unter seinem Befehl niemals vorgekommen wäre. Darin lagen Reinheit und Perfektion, etwas, das man mit keinem Geld der Welt hätte kaufen können und das, davon war Ludovico überzeugt, den notwendigen Unterschied machen würde, um auf dem Schlachtfeld zu siegen. Das machte ihm Angst. Denn nun wurde ihm mehr denn je bewusst, dass er einem wahren Massenmörder Tür und Tor zur Halbinsel aufgestoßen hatte, einem Mann, der ohne Erbarmen für irgendwen oder – was bis nach Neapel vorrücken würde, koste es, was es wolle.
Als er ihn dann sah, diesen Mann, wurde ihm auch klar, dass er ihn weder würde kontrollieren können, noch Einfluss auf seine Entscheidungen haben würde.
Ludovico war abgestiegen und hatte das Zelt betreten, dort hatte er ihn das erste Mal vor sich.
Karl VIII