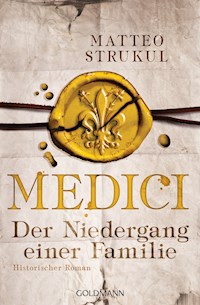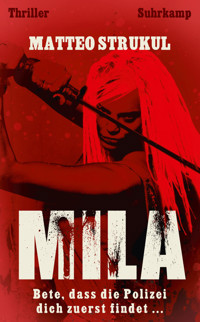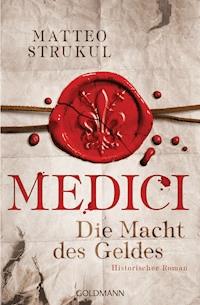
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Medici-Reihe
- Sprache: Deutsch
Morde, Intrigen, Verschwörungen: die Medici und ihr blutiger Weg zur Macht.
Florenz im Februar 1429: Als der Bankier Giovanni de‘ Medici stirbt, hinterlässt er ein enormes Vermögen und ein hervorragend funktionierendes Netzwerk. Seine Söhne Cosimo und Lorenzo sollen gemeinsam die Leitung von Familie und Geschäft übernehmen. „Politisch nüchtern, im eigenen Leben maßvoll zurückhaltend, aber entschlossen im Handeln“ – das sind die fundamentalen Verhaltensregeln, die Giovanni seinen Söhnen sterbend aufträgt. Doch so einfach lässt sich sein letzter Wunsch nicht erfüllen, denn Giovanni hatte mächtige Feinde. Vor allem der verschlagene und blutrünstige Rinaldo degli Albizzi kennt nur ein Ziel: die Vorherrschaft in Florenz zu übernehmen. Und dafür ist ihm jedes Mittel recht ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 475
Veröffentlichungsjahr: 2017
Sammlungen
Ähnliche
Buch
Florenz im Februar 1429: Als der Bankier Giovanni de’ Medici stirbt, hinterlässt er ein enormes Vermögen und ein hervorragend funktionierendes Netzwerk. Seine Söhne Cosimo und Lorenzo sollen gemeinsam die Leitung von Familie und Geschäft übernehmen. »Politisch nüchtern, im eigenen Leben maßvoll zurückhaltend, aber entschlossen im Handeln« – das sind die fundamentalen Verhaltensregeln, die Giovanni seinen Söhnen sterbend aufträgt. Doch so einfach lässt sich sein letzter Wunsch nicht erfüllen, denn Giovanni hatte mächtige Feinde. Vor allem der verschlagene und blutrünstige Rinaldo degli Albizzi kennt nur ein Ziel: die Vorherrschaft in Florenz zu übernehmen. Und dafür ist ihm jedes Mittel recht …
Autor
Matteo Strukul wurde 1973 in Padua geboren. Er hat Jura studiert und in Europäischem Recht promoviert. Er gehört zu den neuen Stimmen der italienischen Literatur und hat sich bisher vor allem als Autor von Thrillern einen Namen gemacht, die für die wichtigen italienischen Literaturpreise nominiert wurden. Strukul lebt mit seiner Frau Silvia abwechselnd in Padua, Berlin und Transsilvanien.
MATTEO STRUKUL
MEDICI
Die Macht des Geldes
Historischer Roman
Aus dem Italienischen
von Ingrid Exo
Die Originalausgabe erschien 2016
unter dem Titel »I Medici. Una dinastia al potere«
bei Newton Compton editori, Rom.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Deutsche Erstveröffentlichung April 2017
Copyright © der Originalausgabe
© 2016 Newton Compton editori s.r.l.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2017
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur München
Umschlagfoto: FinePic®, München
Redaktion: Sigrun Zühlke
BH · Herstellung: Str.
Satz: omnisatz GmbH, Berlin
ISBN: 978-3-641-21002-1V003
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Für Silvia
Februar 1429
1
Santa Maria del Fiore
Er schaute zum Himmel. Ein Blau wie aus Lapislazuli gemacht. Einen Moment lang spürte er, wie Schwindel in ihm aufstieg und sich seiner Gedanken bemächtigte. Dann entspannte er die Augen, indem er den Blick auf seine Umgebung richtete. Er sah, wie die Maurer aus Kalk und dem hellen Sand des Arno Mörtel anmischten. Einige von ihnen hockten vor den Verschlägen auf den Mauern und nahmen ein rasches Frühstück zu sich. Sie schufteten in mörderischen Schichten – es kam häufig vor, dass sie die gesamte Woche auf der Baustelle zubrachten und auf den hölzernen Gerüsten, Marmorplatten, Ziegeln und Bauschutt schliefen.
Und das hundert braccia über dem Boden.
Cosimo suchte sich seinen Weg über die Bohlen des Gerüstes. Seine Kragträger sahen aus wie die schwarzen scharfen Zähne einer fantastischen Kreatur. Er bewegte sich mit großer Vorsicht, um keinen falschen Schritt zu machen. Dieser Anblick einer Stadt über der Stadt faszinierte und erschreckte ihn zugleich.
Nach und nach gelangte er zum Unterbau der im Bau befindlichen Kuppel, welchen die Architekten und Baumeister Tambour nannten. Sein Blick schweifte vom Gerüst nach unten, wo das Volk von Florenz von der Piazza aus mit großen Augen auf Santa Maria del Fiore schaute. Wollkämmer, Händler, Fleischer, Bauern, Prostituierte, Gastwirte und Durchreisende. Sie alle schienen ein stummes Gebet zum Himmel zu schicken, dass der Entwurf von Filippo Brunelleschi endlich verwirklicht würde. Jene Kuppel, auf die sie so sehr gewartet hatten, nahm endlich Form an, und es sollte anscheinend ausgerechnet jener verrückte kahlköpfige Goldschmied mit den schlechten Zähnen und dem hitzigen Temperament sein, dem dieses Unternehmen gelingen würde.
Cosimo sah ihn wie eine leidende Seele zwischen den Materialhaufen und Ziegelstapeln herumgeistern. Gedankenverloren, geradezu geistesabwesend, doch in Wirklichkeit in wer weiß welche Berechnungen versunken. Alabasterhelle Augen leuchteten über der weißen Haut seines Gesichtes, das mit allen möglichen Farben und Materialien verschmiert war.
Hammerschläge rissen ihn aus seinen zum wiederholten Male abgeschweiften Gedanken – die Schmiede waren bei der Arbeit. Die Luft war erfüllt vom Stimmengewirr aus tausenderlei Zurufen und Anweisungen. Cosimo holte tief Luft und ließ den Blick dann nach unten wandern, zum Fuß des Oktagons. Die riesige, von Filippo Brunelleschi entworfene Winde drehte sich ohne Unterlass. Die beiden angeketteten Ochsen schritten ruhig dahin und drehten stumm ihre Runden. Geführt von einem jungen Burschen liefen sie stetig im Kreis, und in diesem Rundlauf setzten sie ein Werk aus ineinandergreifenden Zahnrädern in Gang, das eine Winde antrieb, mit der man Steinblöcke von ungeheurem Gewicht in Höhen hieven konnte, die anders nicht zu erreichen gewesen wären.
Brunelleschi hatte sich erstaunliche Maschinen ausgedacht, hatte sie gezeichnet und die besten Handwerker angestellt, und indem er die Arbeiter unaufhörlich arbeiten ließ, hatte er in kurzer Zeit ein ganzes Arsenal technischer Wunderwerke erschaffen, die es ihm ermöglichten, Marmorplatten und Holzgestelle für die Gerüste sowie dutzende Säcke Sand und Kalk genau an die richtige Stelle zu befördern.
Cosimo hätte seine Genugtuung und Freude darüber, auf welch wunderbare Weise die Arbeiten vorangingen, am liebsten laut herausgeschrien. Niemand hatte sich eine Kuppel über achteckigem Grundriss vorstellen können, niemand! Zweiundsechzig braccia waren schon ungeheuer weit, und Filippo hatte eine Kuppel von noch größerer Spannweite entworfen, und das ohne sichtbare Stützen. Es gab weder Strebepfeiler von außen noch hölzerne Lehrgerüste. Er hatte die Opera del Duomo, die Dombauhütte, welche die Errichtung der Kuppel in Auftrag gegeben hatte, in Staunen versetzt.
Brunelleschi war entweder ein Genie oder ein Wahnsinniger. Vielleicht auch beides. Und die Medici waren diesen Bund mit Genie und Wahnsinn eingegangen! In erster Linie Cosimo. Er lächelte über diese Kühnheit und überlegte bei sich, was ein solches Vorhaben nicht nur für die Stadt, sondern auch für ihn persönlich bedeuten würde. Wenn man noch in Betracht zog, was da oben vor sich ging, gab es guten Grund, vor Begeisterung außer sich zu sein, insbesondere, wenn man sah, wie der Bau beständig Fortschritte machte, eine Art verrückt gewordener Turm zu Babel, an dem an allen Ecken und Enden unzählige Gewerke beteiligt waren: Fuhrleute, Maurer, Seiler, Zimmerleute, Schmiede und Wirtsleute, zuständig für den Verkauf von Wein, ja sogar ein Koch samt Ofen, in dem das Brot für die Pausen der Arbeiter gebacken werden konnte. Einige kletterten auf den hölzernen Gerüsten herum, andere arbeiteten von Korbkonstruktionen aus, die, hoch über den umliegenden Dächern hängend, aussahen wie Vogelnester – als hätten die Menschen die Störche gebeten, ihnen zu helfen, dieses gigantische Vorhaben zu Ende zu bringen.
»Was haltet Ihr davon, Messer Cosimo?«
Die dünne, jedoch feste Stimme gehörte Filippo.
Cosimo drehte sich fast schon jäh um und sah sich ihm gegenüber, mager wie ein Gespenst, mit unstetem Blick. Er trug nichts außer einer roten Tunika. In seinem direkten Blick lag eine Mischung aus Stolz und Feindseligkeit, die seinem rebellischen und unbezähmbaren Charakter entsprach, ein Blick, der von einem Moment zum anderen weich werden konnte, wenn er einem großen Geist begegnete.
Cosimo wusste nicht, ob er sich zu dieser Schar zählen durfte, aber es stand fest, dass er der Erstgeborene Giovanni de’ Medicis war, des Stammvaters der Familie, die die Finanzierung und die Umsetzung des Bauvorhabens ohne Vorbehalte unterstützt und Brunelleschis Bewerbung am stärksten befürwortet hatte.
»Wunderbar, Filippo, ganz wunderbar«, antwortete er, jederzeit bereit, dem andächtigen Staunen Ausdruck zu verleihen, das in seinem Blick lag. »Ich hatte nicht zu hoffen gewagt, solche Fortschritte zu sehen.«
»Wir sind noch weit vom Ziel entfernt, das möchte ich nicht beschönigen. Am wichtigsten ist, Messer, dass Ihr mich arbeiten lasst.«
»Solange es die Medici gibt – die zu den Ersten gehören, die ein solches Wunderwerk gefördert haben –, hast du nichts zu befürchten. Darauf gebe ich dir mein Wort, Filippo. Wir haben es gemeinsam begonnen, und gemeinsam werden wir es beenden.«
Brunelleschi nickte. »Ich bin bestrebt, die Kuppel nach klassischem Kanon zu vollenden, wie im Entwurf vorgesehen.«
»Daran habe ich keinen Zweifel, teurer Freund.«
Während er mit Cosimo sprach, huschte Filippos Blick in tausend Richtungen: zu den Maurern, die den Mörtel anmischten und Stein auf Stein setzten. Dann zu den unablässig hämmernden Schmieden, schließlich zu den Fuhrleuten, die unten auf der Piazza säckeweise Kalk herankarrten. Mit der Linken umschloss er ein Pergament, auf welchem er eine der zahlreichen Arbeitsskizzen festgehalten hatte. In der Rechten hielt er einen Meißel – was zum Teufel auch er damit vorhaben mochte.
So unvermittelt wie er aufgetaucht war, verabschiedete sich Brunelleschi mit einem knappen Nicken und verschwand wieder im Gebälk und der Konstruktion der Innenkuppel, wie verschluckt von diesem kolossalen Werk, in dem es vor Leben und Kraft nur so brodelte. Cosimo blieb nur der beeindruckende Anblick der hölzernen Bögen, während die Winde unter vielfältigen Rufen unermüdlich Lasten emporhievte.
Da hörte er plötzlich hinter sich eine schneidend strenge Stimme.
»Cosimo!«
Er lehnte sich ans Geländer, und als er sich umdrehte, sah er seinen Bruder Lorenzo auf sich zueilen.
Er kam nicht einmal mehr dazu, ihn zu begrüßen.
»Unser Vater, Cosimo, unser Vater liegt im Sterben.«
2
Der Tod des Giovanni de’ Medici
Er war kaum eingetreten, da kam ihm Contessina schon entgegen. Ihre schönen braunen Augen waren verweint. Sie trug ein schlichtes schwarzes Gewand und einen hauchzarten, fast unsichtbaren Schleier.
»Cosimo …«, flüsterte sie. Mehr brachte sie nicht hervor, als bräuchte sie all ihre Kraft, um die Tränen zurückzuhalten. Für ihren geliebten Gatten wollte sie stark sein. Und das gelang ihr. Er drückte sie an sich.
Einen Augenblick später löste sie sich aus der Umarmung. »Geh zu ihm, er erwartet dich.«
Er drehte sich zu Lorenzo um, und zum ersten Mal an diesem Tag sah er ihm wirklich ins Gesicht. Sein Bruder war die ganze Zeit hinter ihm geblieben, als sie die Gerüste zum Fuße der Kathedrale Santa Maria del Fiore hinabgestiegen waren und sich dann in halsbrecherischer Eile zur Via Larga begeben hatten, über der das Dach des Palazzo Medici emporragte.
Lorenzo malträtierte seine Lippen mit den schönen weißen Zähnen. Cosimo erkannte, wie niedergeschlagen er war. So schön, dass man ihm für gewöhnlich keinerlei Müdigkeit anmerkte, sah Lorenzos Gesicht jetzt angestrengt aus, und dunkle Ringe lagen unter seinen grünen tiefgründigen Augen. Er hätte sich eine Pause gönnen sollen, dachte er. In den letzten Tagen, seit ihr Vater erkrankt war, hatte Lorenzo sich noch mehr den Bankgeschäften gewidmet und ohne Unterlass gearbeitet. Pragmatisch und eher ein Mann der Tat, zweifelsohne ein lebhafter Geist, verfügte Lorenzo über wenig Sinn für Kunst und Wissenschaft. Wenn es jedoch darauf ankam, war immer er derjenige, der sich um alle schwierigen Angelegenheiten der Familie kümmerte. Cosimo hingegen hatte sich im Einvernehmen mit den Vertretern der Opera del Duomo der Überwachung und Überprüfung der Arbeiten an der Kuppel von Santa Maria del Fiore verschrieben. Ihm waren Strategie und Politik übertragen worden, und in beidem glänzte er, indem er als Mäzen und in der Kunst prunkvoll ihre Macht demonstrierte.
Auch wenn die Auftragsvergabe für die Fertigstellung der Domkuppel nach einhelligem Bekunden und auf dem Papier einzig und allein in den Händen der Dombauhütte lag, wusste doch jeder in Florenz, mit welchem Nachdruck Cosimo die Kandidatur des schließlich auch siegreichen Filippo Brunelleschi unterstützt hatte. Ganz zu schweigen davon, dass er in nicht geringem Maße die Mittel der Familie für die Finanzierung dieses wunderbaren Meisterwerkes in Anspruch genommen hatte, das nun seiner Vollendung entgegenging.
Cosimo umarmte seinen Bruder.
Dann ging er hinein.
Der Raum war mit dunklem Brokat ausgekleidet. Man hatte die Vorhänge zugezogen, sodass nur sehr schwaches Licht in den Raum drang. Hier und da standen goldene Kerzenleuchter. Der Geruch nach geschmolzenem Wachs verschlug einem den Atem. Als Cosimo seinem Vater Giovanni in die fast erloschenen, vom nahen Tode getrübten Augen blickte, wurde ihm klar, dass nichts mehr zu machen war. Giovanni de’ Medici, der Mann, der die Familie in der Stadt ganz nach oben gebracht hatte, war im Begriff, von ihm zu gehen. Auf sein Gesicht, sonst so unerschütterlich und entschlossen, schien sich auf einmal ein Schleier der Schwäche gelegt zu haben, ein Anflug wissender Resignation, die ihn zu einem blassen Abbild des Mannes machte, der er einmal gewesen war. Dieser Anblick traf Cosimo mehr als alles andere. Es erschien ihm unmöglich, dass Giovanni, bis vor wenigen Tagen noch stark und zielgerichtet, von einem so heftigen und aggressiven Fieber befallen worden sein könnte.
Er sah seine Mutter, die bei ihm war und seine Hand in ihrer hielt. Piccardas Antlitz war noch immer schön, auch wenn seine erlesene Anmut gelitten hatte: Die langen schwarzen Wimpern waren von Tränen benetzt, die zu einer schmalen Linie aufeinandergepressten Lippen ließen den roten Mund wie die blutige Klinge eines Dolches aussehen.
Sie flüsterte seinen Namen und schwieg, weil jedes weitere Wort sich erübrigte.
Cosimo wandte sich seinem Vater zu und dachte von Neuem über jene Krankheit nach, die diesen aus dem Nichts überfallen hatte, ganz ohne ersichtlichen Grund. Als er schließlich die Augen auf ihn richtete, war es, als würde Giovanni erst in diesem Moment bewusst, dass sein Sohn den Raum betreten hatte, und das gab ihm noch einmal zusätzliche Kraft. So geschwächt er auch sein mochte – aufgeben wollte er nicht. Gerade jetzt veranlasste ihn die stählerne Härte, die ihn immer ausgemacht hatte, sich zu regen, und sei es zum letzten Mal. Es gelang ihm, sich auf die Ellbogen zu stemmen und sich im Bett aufzusetzen, wobei er mit den Händen zwischen den Federkissen herumwühlte, die die beflissene Piccarda ihm zurechtgerückt hatte, damit er es bequemer hatte. Missmutig schob er sie mit einer ungehaltenen Bewegung beiseite und machte Cosimo ein Zeichen, näher zu treten.
Auch wenn er sich vorgenommen hatte, im entscheidenden Moment stark zu sein, konnte Cosimo die Tränen nicht zurückhalten. Dann schämte er sich für diese Schwäche, wischte mit dem Handrücken der Rechten über die Augen und strich eine Strähne seines dichten schwarzen Haares zurück.
Er trat zu seinem Vater.
Giovanni wollte ihm noch etwas sagen, ehe er von ihnen ging. Er neigte sich zu ihm hin, während Cosimo ihn an den Schultern gefasst hielt.
Er richtete seine dunklen Augen fest auf die des Sohnes. Im flackernden Licht der Kerzen, die das Halbdunkel des Raumes da und dort erhellten, schimmerten sie wie Onyx.
Die Stimme des Patriarchen klang so heiser und hohl, als käme sie aus einem Brunnenschacht.
»Mein Sohn«, raunte er, »versprich mir, dass du dich mit nüchternem Verstand auf dem politischen Parkett bewegen wirst. Dass du in maßvoller Zurückhaltung leben wirst. Wie ein einfacher Florentiner Bürger. Und du dennoch mit fester Entschlossenheit handeln wirst, wenn es erforderlich ist.«
Die Worte strömten in einem einzigen Fluss, jedoch klar und deutlich artikuliert, mit dem letzten Funken Lebenskraft, den Giovanni in diesem außerordentlichen Moment aufbringen konnte.
Cosimo sah ihn an, ganz versunken in den dunkel schimmernden Augen des Vaters.
»Versprich es mir«, drängte Giovanni mit einem letzten Aufgebot seiner Kraft. Die durchdringenden Augen schienen den Blick des Sohnes geradezu bezwingen zu wollen, der Schwung der Lippen sprach von starkem Willen und tiefstem Ernst.
»Ich verspreche es«, erwiderte Cosimo, ohne zu zögern, dermaßen von Gefühlen überwältigt, dass ihm die Stimme kaum gehorchte.
»Nun kann ich frohen Sinnes sterben.«
Mit diesen Worten schloss Giovanni die Augen. Sein Gesicht entspannte sich, nachdem er nun schon allzu lang auf diesen Augenblick gewartet und gegen den Tod gekämpft hatte, einzig, um seinem heiß geliebten Sohn dies auf den Weg geben zu können.
Darin lag alles, was ihn ausgemacht hatte und nun nicht mehr war: seine Ergebenheit gegenüber seiner Heimatstadt und seinem Volk, die Mäßigung und Zurückhaltung, die ihm geboten hatten, Reichtum und Überfluss niemals zur Schau zu tragen, und natürlich seine Fähigkeit, schonungslos und unbeirrt Entscheidungen zu treffen.
Seine Hand erkaltete, und Piccarda brach in Tränen aus.
Giovanni de’ Medici war tot.
Cosimo umarmte seine Mutter. Sie fühlte sich zerbrechlich und schutzlos in seinen Armen an. Ihm liefen die Tränen übers Gesicht. Dann flüsterte er ihr zu, sie solle stark sein, löste sich von ihr und schloss seinem Vater die Augen. Für immer war damit jener Blick gelöscht, der das Leben angefacht hatte.
Lorenzo ließ den Priester rufen, damit er das letzte Sakrament spendete.
Als Cosimo den Raum verließ, trat er an ihn heran. Er zögerte einen Augenblick, weil er fürchtete, Cosimo zu stören, doch der bedeutete ihm mit einer Geste, dass er bereit war, ihm zuzuhören.
»Sprich, was gibt es so Dringendes?«
»Um die Wahrheit zu sagen«, begann Lorenzo, »geht es um unseren Vater.«
Cosimo zog eine Braue hoch.
»Ich habe den Verdacht, dass er vergiftet wurde«, presste Lorenzo zwischen den Zähnen hervor.
Diese unerwartete Enthüllung traf Cosimo wie ein Hammerschlag.
»Was sagst du da? Wie kannst du so etwas behaupten?«, rief er und packte Lorenzo am Kragen.
Doch Lorenzo hatte mit einer solchen Reaktion gerechnet und umfasste seine Handgelenke.
»Nicht hier«, stieß er mit erstickter Stimme hervor.
Cosimo begriff sofort. Natürlich, er benahm sich wie ein Idiot. Er ließ die Arme sinken.
»Lass uns hinausgehen«, sagte er, ohne noch etwas hinzuzusetzen.
3
Böses Erwachen
Im Garten war es noch kalt.
Es war der zwanzigste Februar, und auch wenn es bis zum Frühjahr nicht mehr lange hin war, wollte der Himmel doch seine bleierne Farbe nicht ablegen, während ein eisiger Wind tödlich über den Palazzo Medici hauchte.
Aus dem Springbrunnen in der Mitte des hortus conclusus strömte es eisig, silbrig sprang der Strahl ins Becken. Auf der Wasseroberfläche bildete sich eine Eisschicht.
»Ist dir klar, was du da behauptest?«
Cosimo war wütend. Nicht genug, dass er aufgewühlt war, weil er seinen Vater auf diese Weise verloren hatte, nun musste er sich auch noch mit den hinterhältigen Winkelzügen einer Verschwörung beschäftigen! Doch was hatte er erwartet? Sein Vater war ein mächtiger Mann, und über die Jahre hatte er sich viele Feinde gemacht, ganz abgesehen davon, dass Florenz nun einmal war, was es war: einerseits der Inbegriff von Erhabenheit und Macht und andererseits ein Schlangennest und Hort von Verrätern, dessen einflussreichste Familien den Aufstieg dieses Mannes sicher nicht gern gesehen hatten, dem es mit gerade einmal zwanzig Jahren gelungen war, ein Finanzimperium zu gründen – mit Banken nicht nur in Florenz, sondern auch in Rom und Venedig. Schlimmer noch: Sein Vater hatte sich immer geweigert, seine niedere Abstammung zu verleugnen. Weit davon entfernt, sein Haus bei den vornehmen Familien einzureihen, war er lieber unter einfachen Leuten geblieben und hatte sich wohlweislich davor gehütet, politische Ämter zu bekleiden. Die Male, die er den Palazzo della Signoria betreten hatte, ließen sich an einer Hand abzählen.
Cosimo schüttelte den Kopf. Tief im Innern erreichten ihn Lorenzos Argumente. Aber wenn die Dinge so standen, wie er sagte, wer könnte ein solches Verbrechen begangen haben? Und vor allem, wie war es möglich gewesen, dass das Gift bis an die Tafel seines Vaters gelangt war? Mit seinen tiefschwarzen Augen suchte er die klaren und lebhaften seines Bruders. In seinem Blick lagen tausend Fragen, und er ließ diesen Blick einen Moment in seinem ruhen, um ihn zum Sprechen zu bewegen.
»Ich habe mich schon gefragt, ob es richtig ist, es dir zu sagen, zu einem Zeitpunkt, wo ich nichts als Verdächtigungen vorzuweisen habe«, sprach Lorenzo weiter. »Ich habe nur einen einzigen Beweis. Aber der Tod unseres Vaters kam zu plötzlich, um Zweifel zu lassen.«
»Darin hast du natürlich vollkommen recht. Aber wie soll das möglich gewesen sein?«, fragte Cosimo aufgebracht. »Wenn es stimmt, was du sagst, muss das Gift von jemandem aus dem Haus verabreicht worden sein. Unser Vater ist in letzter Zeit nicht ausgegangen, und wenn doch, hätte er außer Haus bestimmt nichts gegessen oder getrunken.«
»Das ist mir bewusst. Und aus diesem Grund habe ich, wie gesagt, auch nur einen Verdacht. Andererseits hatte Giovanni genug Feinde. Und als ich schon dachte, es sei nur eine Wahnvorstellung meines Geistes, habe ich die hier gefunden.«
Er brachte ein paar schwarze Beeren zum Vorschein. Sie sahen wunderschön aus, wie schwarze Perlen – verführerisch und unwiderstehlich.
Cosimo begriff nicht, er schaute fragend.
»Belladonna. Ein Pflanze, die dunkle Blüten und giftige Früchte hervorbringt. Man findet sie auf dem Land, meist in der Nähe von antiken Ruinen. Tatsache ist, dass ich diese hier in unserem Haus gefunden habe.«
Diese Enthüllung löste bei Cosimo Bestürzung aus. »Wenn das stimmt, bedeutet es, dass sich jemand in diesem Haus gegen unsere Familie verschworen hat.«
»Ein Grund mehr, keinen Verdacht durchsickern zu lassen.«
»Ja«, stimmte Cosimo zu, »da bin ich ganz deiner Meinung, aber das soll uns nicht daran hindern herauszubekommen, was hinter der Sache steckt. Wenn etwas Wahres daran sein sollte, würde das den Tod unseres Vaters noch tragischer machen. Ich hoffe immer noch, dass wir uns irren, denn wenn nicht, Lorenzo, dann schwöre ich bei Gott, dass ich den Verantwortlichen mit eigenen Händen töten werde.«
Cosimo seufzte. Er merkte, wie dumm und leer seine Drohungen waren, dass sie ihm ein Gefühl der Ohnmacht gaben, gegen die er fast nichts ausrichten konnte.
»Es dürfte nicht schwierig sein, sich solch ein Gift zu verschaffen, meinst du nicht? In einer Stadt wie Florenz?« In seiner Frage lag eine gewisse Besorgnis, denn es war schon eine bittere Feststellung, dass man es in dieser Stadt so leicht hatte, wenn man es auf das Leben eines Menschen abgesehen hatte. Und bei dem Risiko, das sein Erbe mit sich brachte, musste er doppelt achtsam sein.
»Nahezu jeder gute Apotheker kommt an Substanzen dieser Art heran und kann daraus ein entsprechendes Mittel oder einen Trank herstellen.«
Cosimo ließ den Blick über den Garten schweifen. Er war kahl und grau, genau wie dieser Wintermorgen. Die Kletterpflanzen bildeten auf den Mauern dunkle und beunruhigende Gespinste.
»Gut«, sagte er dann, »wir machen es folgendermaßen: Du versuchst herauszufinden, auf welchem Weg das Gift gekommen sein könnte. Im Haus sagen wir nichts. Bau deinen Verdacht aus, gib ihm Konturen. Wenn wirklich jemand unseren Vater umgebracht hat, dann will ich ihm in die Augen sehen.«
»Das werde ich tun, ich werde keine Ruhe finden, bis diese Schlange einen Namen hat.«
»So soll es sein. Nun lass uns wieder hineingehen.«
Lorenzo stimmte zu.
Damit kehrten sie ins Haus zurück, und die düstere Vorahnung dieser Entdeckung versetzte ihrem Herzen einen Stich.
4
Der letzte Wille
In den folgenden Tagen war die Totenwache abgehalten worden.
Alle Vertreter der großen Familien von Florenz waren gekommen, um Giovanni die Ehre zu erweisen. Sogar jene, die ihn im Leben als ihren ärgsten Feind angesehen hatten, darunter auch die Albizzi, die sich seit jeher als die Herren von Florenz aufspielten. Sie hatten Rinaldo geschickt, der mit dem für ihn typischen Blick voller Verachtung und Arroganz erschienen war, aber diesen Besuch doch nicht hatte vermeiden können. Zwei Tage lang hatte im Palazzo Medici ein ständiges Kommen und Gehen der besseren Gesellschaft geherrscht.
Nun, da alles vorüber war und das Begräbnis zwar würdig, aber maßvoll begangen worden war, hatten sich Cosimo, Lorenzo und ihre Ehefrauen in einem der großen Säle des Palazzos eingefunden, um Giovannis letzten Willen zu vernehmen.
Ilarione de’ Bardi, der Vertraute der Familie, welchem Giovanni uneingeschränktes Vertrauen entgegengebracht hatte, hatte soeben die Siegel erbrochen und war im Begriff, seinen letzten Willen zu verlesen. Lorenzo hatte eine verdrießliche Miene aufgesetzt und schien tief in düstere Gedanken versunken. Cosimo vermutete, dass er mit seinen Nachforschungen vorankam, und beschloss, bald mit ihm darüber zu sprechen und die Fortschritte zu erörtern. Unterdessen hatte Ilarione mit der Eröffnung begonnen.
»Meine Söhne und einzige Erben: Ich habe es nicht für nötig erachtet, ein Testament zu verfassen, da ich euch schon vor vielen Jahren in die Führung der Medici-Bank berufen habe und euch in allen Belangen der Leitung und des allgemeinen Tagesgeschäftes an meiner Seite hatte. Ich weiß genau, dass mir die Lebenszeit vergönnt war, die Gott mir in seiner Güte am Tag meiner Geburt zugedacht hat, und ich gehe wohl nicht fehl in der Annahme, sagen zu können, dass ich zufrieden sterben werde, weil ich weiß, dass ich euch vermögend und bei guter Gesundheit zurücklasse. Ihr werdet gewiss in der Lage sein, in Florenz ein Leben in Ehren und angemessenen Würden zu führen und Trost in zahlreichen Freundschaften zu finden. Ich bin sicher, sagen zu können, dass der Tod mich nicht schwer ankommen wird, im klaren und deutlichen Bewusstsein, dass ich niemandem je Leid zugefügt habe, vielmehr, soweit es mir möglich war, jenen Gutes getan habe, die bedürftig waren. Aus ebenjenem Grunde ermahne ich euch, dasselbe zu tun. Wenn ihr in Sicherheit leben und respektiert werden wollt, rate ich euch, die Gesetze zu achten und nichts von dem zu nehmen, was anderen zusteht. Wenn ihr das beachtet, werdet ihr keinerlei Neid auf euch ziehen und Gefahr von euch fernhalten. Ich sage euch dies, damit ihr immer daran denkt, dass eure Freiheit dort endet, wo die der anderen beginnt, und weil das, was man jemandem antut, weniger Hass schürt als das, was man ihm nimmt. Achtet daher auf das, was ihr tut, denn auf diese Weise werdet ihr viel mehr haben als jene, die gierig sind und die Güter anderer begehren; diese werden am Ende die ihrigen verlieren und zu guter Letzt in Elend und Kummer versunken ihr Dasein fristen. Indem ich diese wenigen Regeln des gesunden Menschenverstandes befolgt habe, ist es mir gelungen, da bin ich sicher – allen Feinden, Niederlagen und Enttäuschungen zum Trotz, die jeden von uns im Leben einmal treffen –, in dieser Stadt meinen guten Ruf zu wahren und, soweit möglich, sogar zu mehren. Ich hege keinen Zweifel daran, dass auch ihr den euren wahren und mehren werdet, wenn ihr diese meine wenigen und einfachen Ratschläge befolgt. Wenn ihr aber meint, euch anders verhalten zu müssen, dann werde ich euch mit ebenso großer Sicherheit voraussagen, dass dies nur zu einem einzigen Ende führen kann, und zwar jenem, das all die genommen haben, die sich selbst ruiniert und ihre Familien in unsagbares Verderben gestürzt haben. Meine Söhne, ich segne euch.«
Hier machte Ilarione eine Pause. Piccarda war längst wieder in Tränen ausgebrochen, stille Tränen, welche auf den Wangen feuchte Spuren hinterließen. Sie trocknete sie mit einem Taschentuch aus feinstem Leinen, ohne jedoch ein Wort zu sprechen. Sie wollte vor allem, dass Giovannis Wille und Worte noch einen Moment lang im Raum standen und die Vision formten, die zum Verhaltenskodex seiner Söhne werden sollte.
Schließlich stellte Ilarione die Frage, die die offensichtlichste und dringlichste war.
»Nun, wo ich vorgetragen habe, worum ich gebeten worden bin, frage ich euch: Was wollen wir mit der Bank machen?«
Cosimo ergriff das Wort.
»Wir werden alle Verwalter unserer Bankhäuser in Italien nach Florenz rufen, damit sie uns über ihre jeweilige Situation Bericht erstatten. Fürs Erste möchte ich dich bitten, Ilarione, dich darum zu kümmern.«
Der Vertraute der Medici nickte gewichtig.
Dann verabschiedete er sich.
Piccarda hatte in der Bibliothek des Hauses auf Cosimo gewartet und sah ihn nun mit festem Blick an, wie sie es immer tat, wenn sie ihm etwas Wichtiges zu sagen hatte.
Sie saß in einem edlen, mit Samt bezogenen Sessel. Die rote Glut im Kamin knisterte, und ab und an erhob sich ein Funke wie ein rebellisches Glühwürmchen bis hinauf zur Kassettendecke.
Piccarda hielt das lange Haar, das von warmer kastanienbrauner Farbe war, unter einer bestickten und perlengesäumten Haube mit einer Kappe aus Goldbrokat zusammen, die mit wertvollen Steinen besetzt war. Ihr pelzverbrämtes Obergewand, die cioppa, betonte durch sein tiefes Indigo die weiche Farbe ihrer dunklen Augen. Es wurde dicht über der Taille durch einen wundervollen silbernen Gürtel gefasst. Die Falten, die an den Händen zusammengehalten wurden, stellten auf diskrete Weise die bemerkenswerte Fülle des wertvollen Stoffes zur Schau, die für dieses Kleidungsstück verwendet worden war. Weite geschlitzte Ärmel endeten am Handgelenk mit einer weiteren Stickerei, diesmal in Silber, und waren so geschnitten, dass man darunter die Ärmel der gamurra aus grau schimmerndem Brokatsamt sehen konnte, deren Anfertigung ohne Zweifel aufwändig gewesen war.
Ungeachtet der harten Tage, die hinter ihr lagen, sah Piccarda blendend aus und war entschlossen, ihrem Sohn klarzumachen, was er zu tun hatte. Cosimo war sicher kein Dummkopf, aber er hegte eine Vorliebe für Kunst und Malerei, die sich nach ihrer Meinung nicht immer so gut mit dem Erbe vertrug, mit dem er betraut war. Und Piccarda wollte keine Irrtümer oder Missverständnisse aufkommen lassen. Sie musste sichergehen, dass Cosimo begriffen hatte, was von ihm erwartet wurde.
»Mein Sohn, dein Vater hätte sich nicht klarer und leidenschaftlicher ausdrücken können. Und doch bin ich sicher, dass er dir im Sterben auch weitere Ratschläge nicht erspart hat. Florenz ist wie ein wilder Hengst: wunderschön, aber man muss ihn im Zaum halten. Jeden Tag. Auf der Straße findest du Leute, die willens sind, dir zu helfen und dich in deinem Tun zu unterstützen, aber auch Nichtsnutze und Tagediebe, bereit, dir die Kehle durchzuschneiden, und perfide Feinde, die versuchen werden, dein gutes Herz und deine Rechtschaffenheit auszunutzen.«
»Mutter, ich bin nicht naiv«, protestierte Cosimo und dachte daran, dass er gerade sehr wohl lernte, wie naiv er war.
»Lass mich fortfahren. Ich weiß bestens, dass du das nicht bist und bereits einen wichtigen Anteil am Wachstum dieser Familie hast, aber nun wird die Lage komplizierter, mein Sohn. Ich bin überzeugt, dass du deinen Weg machen wirst, der sich bei allem Respekt für deinen Vater ganz nach deinen Überzeugungen gestalten wird. Ich möchte dir ans Herz legen, auf dem vorgegebenen Weg zu bleiben und dementsprechend dein Verhalten nach dem der Stoiker auszurichten: geprägt von dem äußeren Streben nach dem Gemeinwohl, der Mäßigung in jeder Hinsicht und einem ausdrücklichen Verzicht auf persönliches Ansehen und Prahlerei. Ich will dir außerdem sagen, dass ich vorhabe, immer bei dir zu sein, jetzt und in Zukunft, und dass meine erste Sorge sein wird sicherzustellen, dass die ganze Familie hinter dir steht, welche Entscheidungen du auch immer triffst. Doch bedenke immer: Die Finanzen mögen florieren und das Ansehen unbestritten sein, die Feinde sind zahlreich und hinterhältig. Dabei denke ich insbesondere an Rinaldo degli Albizzi. Hüte dich vor ihm und seinen politischen Schachzügen. Er ist skrupellos und zu allem bereit. Sein Ehrgeiz kennt keine Grenzen, und ich bin sicher, dass er alles tun wird, um dir zu schaden.«
»Ich werde auf der Hut sein, Mutter, und mir Geltung zu verschaffen wissen.«
»Natürlich kannst du auf deinen Bruder zählen. Ich war immer der Meinung, dass ihr, du und Lorenzo, euch wunderbar ergänzt in Charakter und Gemüt. Er der Schnellere und Ungestümere, du der Nachdenklichere und Analysierende. Wo er handelt, gehst du erst in dich und handelst dann mit umfassenderem Blick auf die Welt und das Schöne und Nützliche im Leben. Ihr seid euch immer nahgestanden und respektiert die Art und Weise und das Vorgehen des anderen. Nochmals zu dem, was dich erwartet: Sieh zu, dass du dich um deine Angelegenheiten kümmerst, und denke immer daran, dass es sehr wichtig ist, die Schachzüge deiner Gegner vorauszusehen. Giovanni hat sich immer gesträubt, am politischen Leben der Stadt teilzunehmen, aber damit bin ich nie so recht einverstanden gewesen. Ich glaube vielmehr, dass es wichtig ist, eine Position in der Mitte einzunehmen: dem Volk, das immer auf unserer Seite stand, nah zu bleiben und doch eine Laufbahn in politischen Ämtern und öffentlichen Positionen anzustreben, durch die man ebenso den Anliegen der Bevölkerung Geltung verschaffen wie den Belangen des Adels Rechnung tragen kann und so auch bei den einflussreichsten Familien Unterstützer findet. Auch darauf solltest du hinarbeiten, um dir doppelten Rückhalt zu verschaffen.«
Cosimo verstand vollkommen, wie richtig und klug Piccardas Ratschläge waren. Er nickte. Doch seine Mutter war längst noch nicht fertig.
»Ich muss dir nicht sagen, dass es aussieht, als hätte Giovanni di Contugi Giusto Landini in Volterra aufgewiegelt. Die Gründe dafür liegen im Katastergesetz, für das sich dein Vater verbürgt hat. Wir können es uns im Hinblick auf die Politik der Stadt nicht erlauben, in dieser Angelegenheit nicht Position zu beziehen. Ich will dir nicht vorwerfen, dass du den Arbeiten an der Domkuppel zu viel Aufmerksamkeit schenkst, aber es könnte uns teuer zu stehen kommen, wenn wir uns aus dem politischen Geschehen heraushalten. Schenke diesem Umstand eine gewisse Beachtung. Ich verlange nicht von dir, dich weiter zu exponieren als nötig, denn Rinaldo degli Albizzi könnte dein plötzliches Interesse an öffentlichen Dingen schlecht aufnehmen, aber ebenso wenig können wir ihm und seiner Familie die Initiative überlassen. Florenz bereitet sich auf einen Waffengang gegen Volterra vor, und unsere Position muss klar sein.«
»Andererseits können wir auch die gemeinen Leute, das Volk, nicht im Stich lassen«, wandte Cosimo ein, »mein Vater, Giovanni, hat das Katastergesetz befürwortet, weil es der Florentiner Bevölkerung dazu verholfen hat, den Adel stärker besteuert zu sehen.«
»Doch das hat ihm Rinaldo degli Albizzi nie verziehen. Was ich dir zu sagen versuche, ist, dass wir uns jetzt nicht gegen ihn stellen können.«
»Ich weiß. Deshalb ist Rinaldo mit seinen bewaffneten Leuten gemeinsam mit Palla Strozzi gegen Giusto Landini gezogen.«
»Natürlich. Dein Vater hätte sich auf die Seite des Adels gestellt, aber ohne eine allzu klare Position einzunehmen. Und das wäre auch richtig gewesen. Was jetzt jedoch zählt, ist, deutlich zu machen, auf wessen Seite wir stehen: Du kannst dir nicht erlauben, keine klare politische Linie zu vertreten und deine Absichten nicht zu erkennen zu geben. Gib Florenz also – ohne das Werk deines Vaters in Abrede zu stellen – deine Unterstützung.
Denn Giovannis Absicht war es, die finanziellen Mittel und Opfer proportional zu verteilen, und daran ist nichts Schlechtes. Und es liegt auch kein Widerspruch darin, an diesem Prinzip festzuhalten und sich einer Stadt entgegenzustellen, die sich gegen Florenz erhebt.«
»Ich weiß«, seufzte Cosimo, »ich werde mich wohl den anderen Familien anschließen, damit nicht der Eindruck entsteht, ich wollte mich zu sehr profilieren. Gleichzeitig aber muss ich darauf achten, dass unsere Rolle als Beschützer der gesamten Bevölkerung gewahrt bleibt. Wenn wir die einfachen Leute verlieren, geht alles verloren, wofür Vater gearbeitet hat.«
Piccarda nickte zufrieden. Cosimo traf mit gutem Urteilsvermögen die richtige Entscheidung. Ein Lächeln erhellte ihr Gesicht, wenn auch mit einer Spur von Bitterkeit. Zu mehr kam sie nicht, denn Contessina stürmte mit weit aufgerissenen Augen in die Bibliothek.
Sie sah aus, als sei ihr der Teufel auf den Fersen.
»Giusto Landini …«, stieß sie mit tonloser Stimme hervor, »Giusto Landini ist tot – getötet durch die Hand Arcolanos und seiner Schergen!«
5
Rinaldo degli Albizzi
Der Alte ist endlich tot, und das hat die Medici schwer getroffen«, frohlockte Rinaldo degli Albizzi.
Er hatte es sich in seinem Wams aus grünem Brokat und den enganliegenden Beinkleidern von derselben Farbe auf der Bank eines Wirtshauses bequem gemacht. Palla Strozzi sah ihn schief an.
»Was willst du damit sagen? Dass dies der richtige Zeitpunkt wäre, diese verdammten Wucherer zu schlagen?«
Rinaldo warf die braunen Locken zurück. Seine Augen leuchteten. Er streifte die Lederhandschuhe ab und schmiss sie auf den Tisch. Während er darauf wartete, dass die schöne Wirtin zu ihm kam, würdigte er Palla keiner Antwort. Es gefiel ihm, ihn warten zu lassen. Es betonte den Rangunterschied, der trotz allem zwischen ihnen bestand. Die Familie Strozzi war einflussreich, jedoch nicht so einflussreich wie seine. Außerdem war Palla Humanist, ein zarter und edler Federfuchser, der nichts zustande brachte. Um etwas zu bewegen, musste man Zähigkeit und Kampfgeist haben, und er verfügte über beides.
»Bring uns eine Lammkeule«, trug er der Wirtin auf, »außerdem Brot und Wein. Und beeil dich, denn wir haben hart gekämpft und haben Hunger.«
Während sich die Frau mit den langen schwarzen Locken unter Röckerauschen in die Küche begab, warf Rinaldo ihr von der Seite her einen Blick zu. Sie hatte ein ehrliches Gesicht und goldbraune Augen, in ihren Zügen lag etwas, das sein Blut in Wallung brachte.
»Interessant, wie du mit unseren kriegerischen Tugenden prahlst, wo wir noch nicht einen Finger gerührt haben. Aber ich nehme an, das gehört zu deiner fragwürdigen Art, Eindruck auf Frauen aus dem Volk zu machen«, sagte Palla Strozzi mit einem Anflug von Ärger. Er hasste es, wenn Albizzi ihm nicht antwortete, und das geschah öfter, als ihm lieb war.
Rinaldo lächelte nur.
Dann sah er doch dem wartenden Palla in die Augen.
»Mein guter Palla, ich werde es dir ganz genau erklären. Es stimmt doch, dass der Rat, die Dieci di Balia, unsere Männer gegen das aufständische Volterra gesandt hat, um es zu bestrafen, und sich die Dinge dann ganz von allein entwickelt haben? Stimmt doch, oder? Der Kopf von Giusto Landini auf einer Lanze! Und du erinnerst dich, warum Giusto sich gegen Florenz erheben wollte, nicht wahr?«
»Freilich! Wegen der neuen Steuern, die das Katastergesetz vorsah!«
»Und wer hat das gewollt …?«, soufflierte ihm Rinaldo degli Albizzi.
»Giovanni de’ Medici.«
»Ganz genau.«
»Aber am Ende wurde Giusto für seine Arroganz von den eigenen Mitbürgern bestraft. Arcolano hat seine Leute zusammengetrommelt, und die haben ihm den Kopf abgeschnitten.«
»Und ich erlaube mir hinzuzufügen, wie du ja bereits richtig angemerkt hast, dass sie uns damit die Drecksarbeit abgenommen haben und wir erfolgreich und mit sauberer Weste Volterra wieder unter den Schutz von Florenz gestellt haben.«
»Ohne einen Finger zu rühren«, ergänzte Palla Strozzi.
»Exakt. Nun ist es kein Geheimnis«, fuhr Rinaldo fort, »dass Niccolò Fortebraccio sich in Fucecchio herumquält. Das ist ebenso wahr, wie dass Giovanni de’ Medici der Hauptbefürworter des Friedens von Florenz gewesen ist und der Mann, der ihn, Fortebraccio, von den Florentinern hinauswerfen ließ. Oder kannst du das bestreiten?«
»Ich werde mich hüten«, sagte Strozzi ungeduldig, »aber treib keine Spielchen mit mir, Albizzi.«
»Ich treibe keine Spielchen, nicht im Geringsten, das wirst du gleich sehen. Also: Es ist eine Tatsache, dass uns die rebellische Stadt Volterra gerade – wenn auch nur widerstrebend – von Messer Arcolano zurückgegeben wurde, dank eines geschickten Vorgehens, versteht sich.«
»Wenn man einen bewaffneten Überfall als geschicktes Vorgehen bezeichnen will.«
Rinaldo wischte diesen Einwand mit einer Handbewegung fort, als fühlte er sich belästigt. Und er ärgerte sich tatsächlich, weil er Pallas affektierte Art, diese dummen Details so hervorzuheben, schlecht ertragen konnte.
»Und wenn schon. Wenn man nicht bereit ist, Blut zu vergießen, wird man es schwer haben, Florenz an sich zu bringen.«
»Ich habe überhaupt kein Problem damit, Albizzi, ich nenne die Dinge nur gern beim Namen.« Palla wusste, dass er seinen Gefährten damit ärgerte, sah aber keinen Anlass, es ihm leichter zu machen.
»Ach komm schon, mein Freund, wir wollen die Feinheiten nicht überbewerten. Heb dir das für andere auf. Zurück zum Thema: Niccolò Fortebraccio wartet sehnlichst darauf zurückzukehren, die Stadt in Brand zu setzen und Frauen zu schänden.«
»Wie könnte man es ihm verübeln?«, unterbrach ihn Palla, und währenddessen fiel auch sein Blick auf die schöne Wirtin, die derweil duftendes Brot, einen Krug Wein – tiefrot, dunkler als die Sünde – und hölzerne Becher auf den Tisch stellte. Dabei enthüllte der weite Ausschnitt ihres einfachen volkstümlichen Kleides weiße, volle Brüste und veranlasste Palla, mit der Zunge zu schnalzen, als hätte er gerade von einer unwiderstehlichen Köstlichkeit probiert.
Sie schien keine Notiz davon zu nehmen, und während er die Augen nicht von ihr lassen konnte, kehrte sie in die Küche zurück.
»Schenk lieber meinen Worten volle Aufmerksamkeit, statt mich zu unterbrechen und dann Wirtinnen zu behelligen, du alter Schwerenöter«, tadelte ihn Albizzi. »Ich habe wohl begriffen, dass du die Begehrlichkeiten Fortebraccios teilst, aber darum geht es gar nicht.«
»Und worum geht es dann, bitte schön?«, fragte Strozzi, während er Wein in die Becher einschenkte. Er führte seinen zum Mund und leerte ihn in wenigen Schlucken; der Göttertrank erfreute seine Sinne.
»Was ich dir begreiflich machen will, ist, dass wir die Schlacht vorbereiten müssen. Nur wenn wir einen Krieg auslösen, können wir die Stadt ins Chaos stürzen und sie so auf einen Schlag in unsere Gewalt bringen.«
»Wirklich?«, hakte Palla skeptisch nach. »Hältst du das wirklich für die beste Strategie? Mal sehen, ob ich das richtig verstanden habe: Du willst dir Fortebraccios Groll gegen die Florentiner zunutze machen, ihn unter der Hand bestechen, ihn dazu bringen, einen Krieg gegen Florenz anzufangen, und dich dann der Stadt bemächtigen, indem du von Blutvergießen und Terror profitierst?«
»Na ja, das ist schon so der Plan, und es wäre ja ein vorgetäuschter Kriegszug. Wir bringen ein bisschen Gesindel um, vielleicht erwischt es darunter auch Cosimo und die seinen, und danach hören wir auf mit dem Abschlachten, da sind wir uns einig, und übernehmen die Macht. Ist doch klar und einfach, findest du nicht?«
Palla schüttelte den Kopf.
»Das überzeugt mich nicht im Geringsten. Wäre es nicht besser, eine günstigere Gelegenheit abzuwarten? Du weißt, dass Niccolò da Uzzano ein Freund der Medici ist, und gegen dessen Beistand wird es nicht einfach sein, etwas gegen Cosimo zu unternehmen und schlussendlich die Stadt in unsere Hand zu bringen, so wie du sagst.«
»Was schlägst du denn vor?«, platzte Albizzi ungeduldig heraus. »Giovanni de’ Medici ist tot, und die Familie und sein Vermögen gehen an die Söhne. Lorenzo ist ein Trottel, aber Cosimo könnte gefährlich werden. Er hat bei mehr als einer Gelegenheit gezeigt, dass er weiß, wie er sich zu verhalten hat. Es ist sein Name, der hinter der Kuppel steht, und wir wissen alle, wie seine Beziehungen zum Pontifikat sind. Sicher, er spielt sich als großer Wohltäter auf und tut so, als scheue er Auseinandersetzungen, aber in Wahrheit ist er genauso verschlagen und skrupellos wie sein Vater, vielleicht sogar noch schlimmer. Die Wahrheit ist, dass er ein Beutelschneider ist, der Leute besticht, und wenn wir ihn gewähren lassen, wird er nicht nur unsere Familien, sondern die gesamte Republik Florenz in den Ruin führen.«
Palla schnaubte.
»Andererseits ist die Kuppel von Santa Maria del Fiore doch nicht allein Sache der Medici. Es ist die Opera del Duomo, die über Art und Zeitplan der Ausführung bestimmt, bei der, soweit mir bekannt ist, Filippo Brunelleschi gerade großen Erfolg hat.«
»Schon das ist zu viel!«, unterbrach Rinaldo diesmal Palla.
»Schon viel zu viel«, pflichtete Palla ihm bei, »und was noch schlimmer ist: zum Nachteil von Lorenzo Ghiberti, der doch ursprünglich beauftragt war, mit Filippo gemeinsam die Aufsicht zu führen.«
»Ja, ja, ich weiß, dass dich das sehr grämt, aber du musst dich damit abfinden, mit Kultur werden wir unsere Probleme nicht lösen«, polterte Rinaldo, der die ständigen Abschweifungen seines Freundes kaum ertragen konnte, weil sie häufig mit etwas zu tun hatten, das ihm völlig fremd war, wie etwa Kunst.
»In jedem Fall«, nahm Strozzi den Faden wieder auf, »sehe ich nicht, welchen Vorteil es uns brächte, unsere eigene Stadt zu zerstören, nur um die Medici umbringen zu lassen. Da könnte man ebenso gut ein paar bezahlte Mörder anheuern. Und wäre es im Übrigen nicht auch sinnvoller, Fortebraccio nicht gegen Florenz, sondern gegen ein anderes Ziel ziehen zu lassen? Und zwar vielleicht sogar von den dei Dieci di Balia legitimiert?«
Während Palla Strozzis verführerische, anspielungsreiche Worte noch in der Luft hingen, kam die Wirtin mit einem hölzernen Tablett. Darauf thronte eine Platte mit einer enormen Lammkeule, die in zwei Teile geteilt war. Aus zwei kleineren Schälchen verströmten gedünstete Linsen einen intensiven Duft.
»Großartig«, entfuhr es Rinaldo, als er das Essen vor sich stehen hatte, »was sagtest du doch gerade?«
»Ich sagte, dass wir vielleicht größeren Gewinn daraus ziehen könnten, wenn wir Fortebraccio davon überzeugen, seine blutigen Absichten auf Lucca zu richten.«
»Worin liegt der Vorteil?«
»Am Ende unser Hoheitsgebiet zu vergrößern und darüber einen weiteren Krieg zu rechtfertigen, aber ohne einen Überfall auf unsere eigene Stadt in Kauf zu nehmen. Das wäre schlichtweg verrückt. Aber das ist noch nicht alles. Der erste Teil deines Plans ist gut: Fortebraccio die Taschen zu füllen, um ihn zu einem Angriff zu bewegen. Nur dass ich ihn Lucca angreifen lassen würde. Er ist es leid, in Fucecchio zu vermodern, er ist gefährlich und kopflos, das hast du selbst vorhin gesagt, und so werden wir die Entscheidung rechtfertigen, ihn gegen Paolo Guinigis Stadt anzuheuern. Ich sitze ja derzeit im Rat der Dieci di Balia und habe meine verlässlichen Gefolgsleute, so wie du deine hast: Es wird nicht schwer sein, den Obersten Magistrat davon zu überzeugen, ein Votum für einen Angriff auf Lucca auszusprechen, um ein für alle Male unsere Vorherrschaft durchzusetzen. Genau so wie es in Volterra geschehen ist. Fortebraccio wird Lucca angreifen und besetzen. Wenn die Stadt erst einmal eingenommen ist, wird es wieder an uns als Abgesandte der Stadt Florenz sein, die Gemüter zu beruhigen; dadurch werden wir die Gunst der kleinen Leute zurückgewinnen und als Retter der Republik unsere Stellung in der Stadt gegenüber den Medici stärken.«
Rinaldo dachte nach. Der Gedanke war nicht übel, aber Palla war zu spitzfindig in seinen ausgetüftelten Überlegungen.
Er zog das Fleisch vom bleichen Knochen und kaute schweigend.
Sie hatten gerade erst die Schlacht gegen Volterra gewonnen, aber der Krieg musste weitergehen, in dieser Hinsicht war er mit Palla einer Meinung, und der Gedanke, durch militärische Überlegenheit und die Ausweitung der Florentiner Vorherrschaft das eigene Ansehen und den eigenen politischen Einfluss zu mehren, hieß, auf kluge Weise die Position Cosimo de’ Medicis weiter zu schwächen. Außerdem – im Krieg … ein Stoß in den Rücken, ein schicksalhafter Hieb … Das war an der Tagesordnung. Der Tod war überall, und er, Albizzi, hatte die Absicht, über Zeitpunkt und Art des Todes zu bestimmen. Er würde nicht bloß zusehen.
»Also auf in den Kampf«, sagte er und erhob den Becher. Palla Strozzi tat es ihm gleich, um mit ihm anzustoßen.
»Und bringen wir diesen verdammten Spross des Hauses Medici zum Schweigen.«
Rinaldo leerte den Becher. Der Wein hing ihm auf den Lippen. Im gelblichen Licht der Kerzen sah er aus wie geronnenes Blut. Ein grausames Grinsen huschte über sein Gesicht.
»Cosimos Tage sind gezählt«, sagte er dumpf.
6
Die Parfümhändlerin
Mit Giften kannte Lorenzo sich aus. Die Leidenschaft für Kräuter und Pülverchen hatte er von seiner Mutter geerbt. Zwar war er kein Apotheker und auch nicht in die Geheimnisse der Volksheilkunde eingeweiht, aber er wusste, welche Apotheker in Florenz sich recht leicht giftige Pulver oder Pflanzen besorgen konnten.
Das war nicht viel, aber immerhin etwas, womit man arbeiten konnte, und um ehrlich zu sein, war er sich sowieso sicher: Giovanni de’ Medici konnte keines natürlichen Todes gestorben sein. Diese plötzliche und tödliche Krankheit war absichtlich herbeigeführt worden.
Von wem und zu welchem Zweck hatte er noch nicht in Erfahrung bringen können.
Unzählige Fragen gingen ihm durch den Kopf, und die möglichen Antworten darauf warfen noch mehr Fragen auf. Um allzu großen Aufwand zu vermeiden, hatte er beschlossen, das Problem so rational wie möglich anzugehen, indem er eine einfache und sichere Methode anwandte: den verbrecherischen Plan vom Ende zum Anfang hin aufzurollen.
Unter dieser Maßgabe hatte er für die Tage unmittelbar nach Giovannis Tod geplant, energisch und unbeirrt einige Apotheker zu befragen. Natürlich hatte er einiges riskiert, ein paar Mal hatte er sogar deutlich Grenzen überschritten, aber man konnte es auch so sehen: Es wussten sowieso alle, wer er war und, was noch wichtiger war, wen er repräsentierte.
Daher hatten auch jene, die ein Wort oder eine Geste zu viel hatten erdulden müssen, sich gehütet, ein Wort darüber zu verlieren, um es sich nicht mit den Medici zu verscherzen. Tatsache war jedoch, dass er nichts erreicht hatte.
Derweil hatte er gemeinsam mit Cosimo das Gesinde, das im Palazzo Medici zu Diensten war, unter die Lupe genommen. Das war eine verzwickte Angelegenheit gewesen, aber schlussendlich verdichtete sich der Verdacht auf eine schöne Dienstmagd mit rabenschwarzem Haar, die vor einiger Zeit eingestellt worden war. Sie führte ein paar Tage die Woche niedere Arbeiten aus. Im Zuge der Nachforschungen hatte Lorenzo geklärt, dass die Frau in Florenz eine Zeit lang einen Laden für Parfüm besessen hatte. Ihr Name war Laura Ricci. Wenn jemand sich mit Mixturen und anderem Teufelszeug auskannte, dann sie, so hieß es. Natürlich hatten sie darauf geachtet, sich nichts von ihren Verdächtigungen anmerken zu lassen. Lorenzo sollte ihr nachgehen, um herauszufinden, wo sie wohnte, und ihr nach Möglichkeit einige Fragen zu stellen. Allerdings würde er äußerste Vorsicht walten lassen müssen, denn sie verfügten noch über keinerlei Beweise dafür, dass sie es gewesen war. Allerdings war sie die Person, auf die mit großer Wahrscheinlichkeit alles hindeutete.
Aus diesem Grund folgte Lorenzo in diesem Moment der schönen Parfümhändlerin durch schmutzige und dunkle, von Blut und Schlachtresten besudelte Gassen der Stadt.
Die Schlachter waren eine viel diskutierte und leidige Angelegenheit in der Stadt. Im steten Hin und Her ihrer Karren und Wägelchen hinterließen sie auf den Straßen der Stadt eine Spur aus Blut und Fleischabfall. Der Geruch war ekelerregend, ein süßlicher Gestank, der einem den Magen umdrehte. Schon vor Langem hatte der Consiglio dei Duecento das Problem angesprochen, aber keine der zuständigen Institutionen hatte einen Beschluss gefasst, was zu tun sei.
Man hatte geplant, alle Metzgereien von Florenz auf den Ponte Vecchio zu verlegen, aber dann war nichts weiter geschehen. Wie dem auch sei, nachdem er den Heumarkt überquert hatte, war Lorenzo der Frau bis über den Ponte Vecchio gefolgt und schließlich ins Viertel Oltrarno gelangt. Dort war die Parfümhändlerin am Ospizio per i Viandanti vorbei weiter bis zum Ponte Santa Trinità gegangen und war dort nach links in ein kleines Gässchen eingebogen, bis sie schließlich wohl vor ihrem Geschäft stehen blieb.
Sie hatte den Schlüssel hervorgeholt und ihn ins Schloss gesteckt.
Mit einem Anflug von Besorgnis, den sie nicht verbergen konnte, hatte sie sich umgeschaut, dann war sie hineingegangen. Sie schien zu spüren, dass sie verfolgt wurde.
Bei ihrem Eintreten hatte Laura den Raum schwach beleuchtet vorgefunden. Vier Kerzen in einem eisernen Deckenleuchter verbreiteten schwaches Licht. Im Bemühen, den Ort etwas weniger düster zu machen, hatte sie ein Schubfach aufgezogen und ein paar Talglichter herausgeholt, sie in einen silbernen Kandelaber gesteckt und ihn auf einen Tresen gestellt, zwischen lauter Glasbehälter, die Kräuter und farbige Pulver enthielten.
Sie war gerade damit fertig, den Raum ein bisschen heller zu machen – wobei sie sorgfältig darauf achtete, dass die Fensterläden gut geschlossen waren –, als eine Stimme sie aufschreckte.
In einem Samtsessel in der Ecke saß ein Mann von phänomenalem Aussehen. Er hatte tiefgründige blaue Augen und lange rote Haare. Er war ganz in Schwarz gekleidet, einschließlich des Mantels, der ihm über der Schulter hing. Das Wams war mit Eisenplättchen verstärkt, womit er zu den Waffenträgern zu zählen war, und wie als letzten Beweis trug er einen Kurzdolch am Gürtel, den er wohlweislich bereits gezogen hatte. Und zwar offenbar schon vor einer Weile, denn er hatte damit einen Apfel geviertelt und begonnen, ihn mit erkennbarer Genugtuung zu essen.
»Bist du also endlich da, mein Kätzchen?«
Die Stimme des Mannes klang schrill und unangenehm, spröde, als könnte sie die Tonlage nicht halten. Sie wechselte gewissermaßen von oben nach unten, wie es ihr gefiel, ohne dass er es kontrollieren konnte, zumindest nicht ganz.
»Mein Gott, Schwartz, hast du mich erschreckt!«
Der Schweizer Söldner schaute sie lange an, ohne etwas zu sagen. Er bemerkte, wie sie schauderte.
»Fürchtest du dich vor mir?«
»Ja.«
»Sehr gut. Schöpfen sie Verdacht?«
»Ja.«
»Das dachte ich mir. Im Übrigen hast du getan, was du tun musstest. Selbst wenn sie etwas gemerkt haben sollten, wird es zu spät sein.«
»Was willst du damit sagen?«
»Komm her.«
Sie war geblieben, wo sie war.
Er hätte es niemals zugegeben, aber das gefiel ihm am meisten. Er liebte Frauen mit Temperament, und das hatte Laura ganz gewiss.
Er fixierte sie einen Augenblick zu lang, aber sie war eine wahre Schönheit. Selbst im zitternden Licht der Kerzen war er geblendet von dieser bronzefarbenen Haut und hätte sich nur zu gern – und sei es nur für einen Moment – in diesen grünen Augen verloren, grün wie ein Sommerwald. Ein Wasserfall schwarzer Locken rahmte ein perfektes Oval, aber vielleicht war es auch der Duft, fesselnd und verführerisch, der seine Seele vollends in Beschlag nahm, dieses Aroma aus Patschuli und Ambra, das sich im ganzen Raum auszubreiten und ihn mit seiner betörenden Wirkung zu überfluten schien.
»Wieso hast du den Laden zugemacht?«, wechselte er das Thema.
»Die Geschäfte liefen nicht mehr gut, aber das geht dich nichts an.«
»Schon gut, schon gut.« Er hob kapitulierend die Hände, wobei die Klinge des Dolches im Kerzenlicht schimmerte.
»Verrätst du mir den Grund deines Besuchs?«
»Ich komme, um dich zu retten.«
»Tatsächlich?«
»Ich vermute, dass die Medici inzwischen den Braten gerochen haben. Die Tatsache, dass Lorenzo dir gefolgt ist, gibt mir recht. Und nicht nur das: Er steht draußen und wartet auf dich. Ich habe ihn gesehen.«
»O mein Gott!« Laura fuhr zusammen. »Ich habe es nicht einmal bemerkt! Fürchtest du ihn?«
»Kein bisschen!«
»Das solltest du aber!«
»Und warum?«
»Hast du auch nur eine ungefähre Vorstellung davon, wer ich bin? Offensichtlich nicht.«
»Komm her«, forderte er sie erneut auf.
»Und wenn ich nicht will?«
»Ich will es nicht noch einmal sagen. Ich habe keine Lust, mir von einer Frau, die auf mich angewiesen ist, einen kleinen Wunsch abschlagen zu lassen.«
Laura schien einen Moment über Schwartz’ Worte nachzudenken.
Dann sagte sie drei Worte.
»Eine schwarze Schönheit.« Sie unterstrich das Gesagte mit der Andeutung eines Lächelns. »Zu schön für einen wie dich, Schwartz.«
»Ja«, scherzte er, »auf die ein oder andere Weise hat eine schwarze Schöne jedenfalls damit zu tun, nicht wahr? Spiel dich nicht so auf, sonst werde ich deinem Gesicht, bei Gott, mit diesem Dolch ein paar Andenken vermachen, durch die du deinen Liebreiz ganz rasch verlierst.«
Laura empfand etwas Unsagbares. Etwas, das untrennbar mit einer lang zurückliegenden Vergangenheit verbunden war, von der sie gehofft hatte, sie für immer hinter sich gelassen zu haben. Eine ungeheure Wut, deren Grund nur sie allein kannte, flammte in ihren Augen auf. Doch nur für einen Augenblick, und sie sorgte dafür, dass sie unbemerkt blieb. Sie hoffte, schnell und umsichtig genug gewesen zu sein, um Schwartz getäuscht zu haben. Umso mehr, als sie sich auf unerklärliche Weise zu diesem Mann hingezogen fühlte.
Schwartz packte sie bei den Haaren und zwang sie auf die Knie.
»Dieses Mal will ich, dass du mir deine volle Dankbarkeit zeigst.«
»Was wird er dazu sagen …?«
»Unser gemeinsamer Herr? Mach dir da keine Sorgen, denk nur an das hier«, sagte er und legte ihr die Klinge an die Kehle.
Laura begriff. Und ohne ein weiteres Wort begab sie sich auf die Knie. Sie ließ seine Beinkleider herunter, langsam, um Schwartz hinzuhalten und sein Vergnügen zu verlängern. Und auch das eigene. Schließlich wusste sie bestens, wie man einem Mann Genuss verschaffte. Sie nahm sein Glied in die Hand. Es war prall und groß. Der erste Lusttropfen perlte die Eichel herab.
»Lutsch ihn mir. Oder ich schiebe ihn dir in den Rachen.«
Laura nahm den Schwanz in den Mund, und Schwartz schwelgte in Genüssen, wie er sie noch nie erreicht hatte.
7
Glaube und Schwert
Cosimo hatte das Bedürfnis, allein zu sein. Zu vieles hatte ihn in diesen Tagen des Schmerzes und des Irrsinns bedrückt. Giovannis Tod hatte eine unüberwindliche Leere hinterlassen, und das Wissen, dass eine Vergiftung nicht auszuschließen war, hatte eine tiefe Wunde gerissen und ihm vor Augen geführt, wie verletzlich er selbst war. Jemand im Haus hatte eine Verschwörung gegen sie angezettelt. Es mochte nur ein Hirngespinst von Lorenzo sein, aber Cosimo bezweifelte das, weil sich Giovannis Zustand so plötzlich verschlechtert hatte und er so unvermittelt gestorben war. Noch ein paar Tage zuvor war er ihm als solch ein starker Mann erschienen.
Das allein genügte jedoch nicht. Abgesehen von den Belladonnabeeren und dem Verdacht gegen die Dienstmagd hatten sie keinerlei Beweise und doch … Schließlich hatte auch seine Mutter gesagt, dass die Feinde zahlreich waren, warum also weiter den Arglosen geben?
Lorenzo hatte das gesamte Gesinde überprüft, und es waren einige neue Vorkoster bestimmt worden. Und als ob das nicht genug wäre, auch eine ganz neue Gruppe von Mundschenken. Als Piccarda eine Erklärung dafür verlangte, wollte Cosimo sie nicht unnötig beunruhigen, deshalb hatte er nur gesagt, dass er es für angebracht hielt – abgesehen von ein paar wenigen Ausnahmen –, den Großteil des Personals auszuwechseln.
Piccarda hatte ihn ungläubig angesehen, hatte die Angelegenheit aber nicht vertiefen wollen. Sie vertraute ihm, wie sie es versprochen hatte.
Er schaute nach oben und nahm die schöne Kuppel in den Blick. Das helle Winterlicht fiel in sanften Strahlen durch die Laterne und die Oculi am Fuße der Stützrippen. Dieser Anblick heiterte ihn auf. Er dachte an Filippo Brunelleschi, an seine Kunst, in der sich Einfallsreichtum und Entschlossenheit aufs Glücklichste verbanden. Dieser Mann war besessen, gefangen von Architektur und Dekor, von Zahlen und Gleichungen. Doch zog er eine verblüffende Kraft daraus, sich Tag für Tag aufzureiben, die wunderbare und fantastische Formen annahm, so wie die vollkommene Geometrie der Rundbogen in der Kapelle von San Lorenzo, die im Wechsel mit der nüchternen quadratischen Struktur des Grundrisses die perfekte Vereinigung gerader und geschwungener Linien darstellte.
So müsste er auch sein, dachte er: von der Schlichtheit gerader Linien und mit der Fähigkeit zum Wagnis, die der Kreis repräsentierte. Was letztlich auch das war, was sein Vater ihm geraten hatte, nur in anderen Worten.
Er hatte Angst, ihn zu enttäuschen, das stand fest. Es war nicht die Leitung der Bank, die ihm Angst machte. Er wusste, wie man mit den Verwaltern umgehen musste, und darüber hinaus gab es ja auch Lorenzo, um ihm zu helfen. Es war vielmehr die schwierige Kunst, politische Entscheidungen zu treffen und Kompromisse einzugehen, die ihn beunruhigte. Er war fest entschlossen, alles für seine Familie zu tun und denen zu helfen, die es am nötigsten hatten, doch fühlte er sich von verschiedensten Angehörigen der Dieci di Balia daran gehindert, die nur dafür zu leben schienen, ihn auf die Probe zu stellen und dabei möglichst zu übervorteilen.
Und dann waren da noch Giovanni und Piero, seine Söhne.