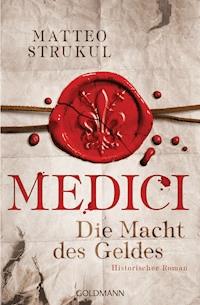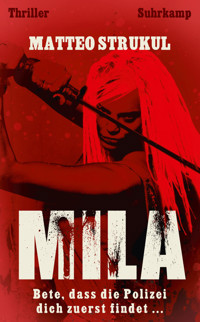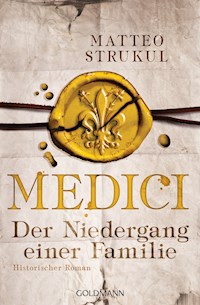
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Medici-Reihe
- Sprache: Deutsch
Der französische Hof im Jahr 1600: Als Heinrich IV. Maria de‘ Medici zur Frau nimmt, hat er nicht mit der Rache seiner Mätresse Henriette d’Entragues gerechnet. Henriette besitzt ein schriftliches Eheversprechen ihres Geliebten, mit dem sie den König nun erpresst. Eine noch größere Gefahr stellt aber eine Gruppe von adeligen Verschwörern dar, die den König stürzen wollen. Als Heinrich IV. tatsächlich das Opfer eines tödlichen Komplotts wird, beginnt der Siegeszug des geschickt agierenden Kardinals Richelieu. Die machtbewusste Maria de‘ Medici gehört zu seinen größten Unterstützern – und begibt sich damit in eine verhängnisvolle Abhängigkeit …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 474
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Buch
Der französische Hof im Jahr 1600: Als Heinrich IV. Maria de’ Medici zur Frau nimmt, hat er nicht mit der Rache seiner Mätresse Henriette d’Entragues gerechnet. Henriette besitzt ein schriftliches Eheversprechen ihres Geliebten, mit dem sie den König nun erpresst. Eine noch größere Gefahr stellt aber eine Gruppe von adligen Verschwörern dar, die den König stürzen wollen. Als Heinrich IV. tatsächlich das Opfer eines tödlichen Komplotts wird, beginnt der Siegeszug des geschickt agierenden Kardinals Richelieu. Die machtbewusste Maria de’ Medici gehört zu seinen größten Unterstützern – und begibt sich damit in eine verhängnisvolle Abhängigkeit …
Autor
Matteo Strukul wurde 1973 in Padua geboren. Er hat Jura studiert und in Europäischem Recht promoviert. Er gehört zu den neuen Stimmen der italienischen Literatur und hat sich bisher vor allem als Autor von Thrillern einen Namen gemacht, die für die wichtigen italienischen Literaturpreise nominiert wurden. Strukul lebt mit seiner Frau Silvia abwechselnd in Padua, Berlin und Transsilvanien.
Mehr von Matteo Strukul
Medici. Die Macht des Geldes. Historischer Roman Medici. Die Kunst der Intrige. Historischer Roman Medici. Das Blut der Königin. Historischer Roman
Matteo Strukul
MEDICI
Der Niedergang einer Familie
Historischer Roman
ISBN: 978-3-641-23816-2V002
Für Silvia
Für Tim, Sergio und Chris
Inhalt
November 1597
Prolog
Februar 1601
1 Leonoras Vorschlag
2 Die Geschichte eines Spions
3 Ein unbequemes Versprechen
4 Der Vorfall auf dem Markt
5 Zwei Ankündigungen
6 Das Treffen mit der Königin
7 Eine unangenehme Überraschung
8 Ein willkommener Fund
Juni – Juli 1602
9 Der Graf von Auvergne hat einen Verdacht
10 Lafin
11 Eheleute
12 Leonora und Concino
13 Fontainebleau
14 Die Bastille
15 Place de Grève
Juni 1606
16 Die Fähre
17 Die Geistesgegenwart des Monsieur Laforge
18 Gespräche über Malerei
19 Das Schwarz der Krankheit
September 1606
20 Margot
21 Die Sorgen der Reine Margot
22 Vater und Sohn
Juni 1609
23 Liebesbriefe
24 Entschlüsselung
Mai 1610
25 Am Vorabend
26 Die Königsweihe
27 Rue de la Ferronnerie
28 Ravaillac
29 Das Ende einer Ära
Februar 1615
30 Die Rede des Staatssekretärs
31 Der Marschall d’Ancre
32 Condé
Dezember 1615
33 Winter
34 Das Scharmützel
35 Rebellen
August 1616
36 Die Verschwörung
37 Die Überlegungen des Bischofs von Luçon
38 Der König und sein Favorit
39 Formen und Farben
40 Luynes
41 Tragödie im Louvre
42 Die Antwort des Königs
43 Einsamkeit
44 Ins Exil
45 Fort aus Paris
46 Makabre Fantasie
Februar 1619
47 Blois
48 Bonne Dame
49 Königlicher Stolz
August 1620
50 Die Narretei von Ponts-de-Cé
51 Richelieu
Dezember 1621 – Januar 1622
52 Verdruss und Groll
53 Rubens im Palais du Luxembourg
Mai 1625
54 Die Heirat zwischen Frankreich und England
55 Anna von Österreich und der Herzog von Buckingham
56 Im Garten des Bischofssitzes von Amiens
57 In Annas Zimmer
58 Eisiges Schweigen
Oktober 1628
59 La Rochelle
60 Der Sturm
61 Ein Glücksfall
62 Briefe
November 1630
63 Nächtlicher Spaziergang
64 Orthez
65 Der Tag der Geprellten
Februar 1631
66 Compiègne
67 Die Verschwörung
68 Niedergang einer Königin
Mai 1640
69 Altern
Anmerkungen des Autors
Danksagung
Glossar
November 1597
Prolog
Passiteas große braune Augen erinnerten an den warmen Farbton von wildem Honig. Sie schienen ihr kleines Gesicht mit den allzu zarten Zügen beinahe vollständig auszufüllen. Doch so klein sie auch sein mochte, so klar war ihre unerschütterliche Beharrlichkeit zu erkennen.
Maria war fasziniert von ihrem Anblick.
Sie war in der Kutsche vom Palazzo Pitti zu dem Haus in der Nähe der Kirche Santissima Annunziata gefahren, das die Familie Medici Passitea und ihren achtzehn Gefährtinnen überlassen hatte.
Nach dem gescheiterten Versuch, in Siena einen eigenen Frauenorden zu gründen, hatte diese fromme, sanfte Frau in Florenz volle Unterstützung gefunden. Und nun strebte sie danach, in einem Kloster ein gottesfürchtiges und mildtätiges Leben zu führen, sich zu kasteien und den verlorenen Seelen eine Hand zu reichen, seien es Frauen oder Männer.
Gott allein wusste, wie sehr dies in diesen unglückseligen, von Schwert und Gold, Verrat und Täuschung beherrschten Zeiten vonnöten war.
Maria musterte sie eindringlich, sie konnte ihren Blick gar nicht von ihr losreißen: Passitea trug ein Kleid aus Sackleinen, sonst nichts. Das Gewebe war bereits so verschlissen, dass man die roten Wundmale darunter erkennen konnte, die ihre Flanken überzogen, dort, wo sie sich mit Dornen und Ketten tiefe Wunden beibrachte, die sie durch den heißen Essig, den sie von den Gefährtinnen auftragen ließ, noch verschlimmerte, um die Erinnerung an den Schmerz und die Buße wachzuhalten.
Ihr Leiden schien jedoch ihre ungebrochene Aufmerksamkeit für ihre Umwelt in keiner Weise zu beeinträchtigen. Im Gegenteil, sie schien dadurch noch gesteigert zu werden. Einen Augenblick lang glaubte Maria ihre feine Aura spüren zu können, die sich in hellen Linien ausbreitete und im blassen Licht aufging, das durch die hohen Fenster des Saales fiel.
Maria war überzeugt, dass es genau diese Strenge und Disziplin waren, die diese Aura zum Leuchten brachten.
Passitea kam auf sie zu.
Fasste sie bei den Händen.
Maria spürte, wie sich die alabasterweißen, kühlen Hände mit den ihren verschränkten, und ließ es bereitwillig geschehen.
Sie hätte nicht sagen können, woran es lag, doch hatte diese Begegnung etwas, das über das Irdische weit hinausging. Passitea hatte eine Gabe – die seltene Fähigkeit, die Qualen anderer zu erfassen, ohne ein einziges Wort sagen zu müssen.
Dennoch ließ Maria sich hinreißen, ihr den Grund des Besuchs zu schildern. Ihr Herz quoll über vor Gefühlen, und die Stille behagte ihr nicht. Sich dieser Frau zu öffnen war genau das, was sie brauchte.
»Ich bin gekommen, weil ich Angst habe, ehrwürdige Mutter. Ich mache mir Sorgen um meine Zukunft …« Doch sie kam nicht dazu, den Satz zu beenden, denn Passitea legte den Zeigefinger an die Lippen, um ihr zu bedeuten, dass sie schweigen solle.
Maria befolgte die Aufforderung, als hätte eine übernatürliche Macht ihr das Denkvermögen und den eigenen Willen geraubt. Sie ließ sich von dieser außergewöhnlichen Frau in Richtung zweier Schemel dirigieren.
Alles in diesem großen Saal war Ausdruck größtmöglicher Reduziertheit aufs Wesentliche. Der helle Marmor des Fußbodens wirkte wie der Inbegriff der herrschenden Novemberkälte. Die Kerzen, die man in eiserne Leuchter gezwängt hatte, waren nicht entzündet, so als wäre künstliches Licht an diesem Ort verpönt.
Abgesehen von den Hockern war eine Kniebank das einzige andere Möbelstück. An ihren Seitenwänden war deutlich ein dunkelroter Kranz zu sehen, der überdeutlich vom Blut kündete, das Passitea in den Stunden der Buße und des Gebetes vergossen hatte.
Maria nahm auf einem der Schemel Platz.
Passitea, die ihr gegenübersaß, schloss die Augen. Sie umklammerte das große Holzkreuz auf ihrer Brust.
»Liebste Freundin«, begann die fromme Frau, »ich sehe in Eurem Blick die Sorge, die Euch verschlingt, doch Ihr müsst Vertrauen haben. Habt Geduld und plagt Euch nicht mit törichten Zweifeln, denn ich sehe Eure Zukunft klar vor mir.«
»Tatsächlich?«
Maria sah sie verzückt an. Doch auch voller Furcht, denn als Passitea die Augen wieder öffnete, sah sie in ihrem Blick ein derart intensives Leuchten, dass es ihr fast den Atem verschlug.
Hätte sie ihr nicht blind vertraut, würde sie diese Frau für eine Fanatikerin gehalten haben.
»Vertraut meinen Worten, teure Freundin.«
Schweigend schaute sie Maria tief in die Augen, als könnte sie so ihre Seele erkunden. Und wahrscheinlich war das auch so. Maria hegte daran keinen Zweifel.
»Ihr seid so schön«, sagte Passitea, »Eure ernsten Augen, Eure Haut, weiß wie Schnee, Euer kastanienfarbenes Haar, dessen Glanz seine Betrachter blendet. Und doch sind dies alles nur Nichtigkeiten der Eitelkeit, versteht Ihr? Auf den Glauben kommt es an, Maria, überlasst Euch der Vorsehung unseres Herrn, quält Euch nicht länger mit sinnlosen Fragen. Fragt Euch lieber, wie Ihr ihm dienen und seine Herrlichkeit preisen könnt.«
»Was soll ich tun?«, fragte Maria de’ Medici.
»Verbringt mehr Zeit im Gebet. Besucht jene, die Euch brauchen, die Geringsten, die nicht einmal wissen, wovon sie leben sollen.«
Maria senkte zerknirscht den Kopf.
Passitea hatte recht.
Sie war so besorgt wegen ihrer ungewissen Zukunft. Ihr Onkel Ferdinando hatte ihr eine großartige Hochzeit versprochen, aber die Zeit verging, sie war zweiundzwanzig Jahre alt und immer noch allein. Und trotz ihrer unbestreitbaren Schönheit schien sich daran nichts ändern zu wollen.
»Warum will mich bloß keiner?«, flüsterte sie mit kaum vernehmbarer Stimme.
Gepeinigt vom Gefühl der Unzulänglichkeit, das sie hin und wieder wie eine heftige Krankheit befiel, rutschte ihr diese Frage heraus.
Sie bereute diese Worte sofort, denn ihr war klar, wie egoistisch und eitel sie waren.
Doch Passitea geriet nicht aus der Fassung.
Sie legte ihr die Hand unters Kinn und hob es an.
Dann sah sie sie auf überraschende Weise an.
Es waren jedoch ihre Worte, die Maria erschauern ließen.
»Bereitet Euch darauf vor, die Königin von Frankreich zu werden. Denn das werdet Ihr sein, so wahr ich Passitea Corgi bin. Doch freut Euch nicht zu sehr darüber. Denn die irdische Macht verdirbt die Herzen der Gerechten, und der Reichtum zerstört ihre Seele.«
Februar 1601
1
Leonoras Vorschlag
Ich sage Euch, sie hassen mich. Alle, ausnahmslos. Ich weiß, dass mir der Ausweis echten Adels fehlt, der hier so unverzichtbar scheint. Doch, meine Königin, ich verspreche Euch, dass ich Euch treu sein werde bis ans Grab, wenn Ihr mir auch dieses Mal zur Seite steht.«
Leonora Galigais Stimme zitterte vor Wut. Maria de’ Medici wandte ihr den Rücken zu. Ihr Blick verlor sich augenscheinlich hinter den finsteren Fenstern des Louvre, die durch diesen schier endlosen bleiernen Winter noch düsterer zu werden schienen. Das fahle Licht ließ bläuliche Schatten auf die dunklen und schweren Möbel und die leeren Bücherregale im Saal fallen. Dieser Palazzo war von so vielen unheilvollen Erinnerungen durchzogen, dass es einem den Atem raubte. Es war, als hätten die vorherigen Herrscher nichts unternommen, um die Geister der Tragödien, die sich hier abgespielt hatten, zu vertreiben. Vielleicht trieb sie insgeheim große Furcht um, etwas an der bestehenden Ordnung zu ändern, so schrecklich sie auch sein mochte. Mindestens tausend Menschen hatten hier im Laufe der Zeit ihr Leben gelassen, denjenigen, der es wagte, sich zu widersetzen, erwartete offenbar ein Leben voller Angst und Leid.
»Ihr braucht es nicht zu erwähnen, Leonora, das ist mir völlig klar.« Maria drehte sich nicht um. Ihre Größe verlieh ihrer Statur königliche Haltung und Ausstrahlung, mit der sie sich vor dem Blutorange der Kerzenflammen abhob. »Und glaubt mir«, fuhr die Königin fort, »ich habe nicht die geringste Absicht, das auf sich beruhen zu lassen. Ihr seid meine Erste Kammerfrau, meine Dame d’atours, und es interessiert mich nicht im Geringsten, ob sogar mein Ehemann ab und an klagt, dass diese Rolle eigentlich der Vicomtesse de Lisle zukäme.« Maria ließ einen Seufzer hören, als sie das sagte. »Sie wird sich an den Gedanken gewöhnen. Ich werde nicht nachgeben, darauf könnt Ihr Euch verlassen, Leonora.«
»Ich danke Euch, ich weiß, wie sehr Ihr Euch für mich einsetzt, und ich verspreche Euch, dass ich Euch jegliche Zuwendung, die Ihr mir zuteilwerden lasst, dutzendfach vergelten werde.«
Nun drehte Maria sich zu Leonora um. Sie lächelte. Perlweiß schimmerte ihr schönes, regelmäßiges Gebiss. Ihr Anblick schlug einen in seinen Bann, ihre klaren Gesichtszüge waren von außergewöhnlicher Schönheit, betont noch durch eine Frisur, die ihre üppige Haarpracht unter einem Diadem bändigte, das über und über mit kostbaren Edelsteinen besetzt war. Als sie Leonora in die pechschwarzen Augen schaute, sprach deren Gesichtsausdruck Bände. »Daran habe ich keinen Zweifel. Schließlich sind wir gemeinsam aufgewachsen, nicht wahr? Glaubt Ihr, ich könnte diese Vergangenheit gegen die arroganten Forderungen einer Handvoll französischer Adliger eintauschen? Woher nehmen sie die Kühnheit, von mir zu verlangen, auf Euch zu verzichten? Wie kann der Mann, der mich mit der Dirne Henriette d’Entragues betrügt, ernsthaft wagen, von mir zu verlangen, dass ich die einzige Person verlasse, der ich absolut vertraue?«
Leonora war sehr erfreut, das zu hören, ließ es sich jedoch nicht anmerken. »Dieser Mann ist der König, meine Königin«, sagte sie lediglich.
»Natürlich. Und ich achte ihn als Gemahl und Herrscher. Jeden Tag. Das könnt Ihr mir glauben, Leonora. Doch nicht einmal er hat mir zu sagen, wer meine Dame d’atours sein soll! Keine Angst, Leonora, ich werde Euch immer schützen. Doch ganz offensichtlich werden wir in diesem Palast, der so grau und trist ist wie dieses von Elend und Krieg versehrte Frankreich, jemanden brauchen, der für uns Auge und Ohr ist, meint Ihr nicht?«
»Eure Majestät, wenn Ihr mir die Ehre erweisen wollt, werde gerne ich für Euch Auge und Ohr sein«, sagte Leonora mit fast schon übertriebenem Eifer.
»Daran habe ich keinen Zweifel. Doch das wird nicht genügen, glaubt mir. Es ist ein Mann vonnöten. Jemand, der sowohl die Kunst der Verstellung wie die des Schwertes beherrscht, jemand, auf den felsenfest Verlass ist, was die Beschaffung von für uns lebenswichtigen Informationen angeht. Nein, es braucht jemanden, der die Kunst der Intrige beherrscht und politisches Geschick hat, der bereit ist, auch die schwierigsten und schrecklichsten Aufträge zu erfüllen, jemanden, der sich nicht um seinen guten Ruf sorgt, dafür aber auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist und für Geld alles tun würde, was wir von ihm verlangen. Ich habe anfangs an Concino Concini gedacht, doch ich glaube, er ist nicht der Richtige. Er verhält sich zu auffällig und ungestüm. Nein, es muss jemand völlig anderes sein.«
»Da habt Ihr recht, meine Königin. Concino ist euch treu ergeben, das kann ich Euch versichern, doch ist er nicht der richtige Mann für die Aufgabe, die Ihr im Sinn habt. Aber ich glaube, ich kenne jemanden – eine Person, die Euren Anforderungen entspricht, Eure Majestät.«
»Wirklich?«
Leonora nickte.
»Ich höre«, ermunterte sie Maria.
»Majestät, einer meiner engsten Freunde verfügt über entsprechende Eigenschaften. Ein gut aussehender, abenteuerlustiger junger Mann, der jedoch so raffiniert und diskret vorgeht, dass er unbemerkt bleibt. Denn er hat seit Langem schon begriffen: Wer im Hintergrund bleibt, hat den besseren Überblick und kann die Gelegenheiten nutzen, die das Leben ihm bietet.«
»Ist er zuverlässig?«
»Ich lege für ihn meine Hand ins Feuer.«
»Das genügt mir.«
»Ich lasse ihn rufen, wenn es Eurer Majestät beliebt.«
»Tut das.«
»Gut, dann …« Leonora kam nicht dazu, den Satz zu beenden, denn die Königin wollte noch etwas wissen.
»Und wie heißt der Auserkorene?«
»Matteo Laforgia. Aber er hat ihn in Mathieu Laforge geändert, um keinen Verdacht zu erregen.«
Über Marias Gesicht huschte ein Lächeln. »Ein falscher Name. Großartig!« Ihre Augen begannen zu strahlen. »Er ist also Italiener!«
»Aus Venedig, Eure Majestät.«
»Ah, Venedig, wie wunderbar!«, rief Maria aus.
»Ja«, wiederholte Leonora. »Venedig – Heimat der Spione und Verräter.«
Maria tat dieses Detail mit einer geringschätzigen Handbewegung ab. »Dann wollen wir hoffen, dass unser Mann nur der ersten dieser beiden Kategorien angehört.«
»Vertraut mir, meine Königin.«
»Selbstverständlich, Leonora.« Bei diesen Worten ließ sie einen großen Seufzer der Erleichterung hören. Vielleicht hatte sie nach so vielen durchgestandenen Ängsten und Sorgen nun einen Weg gefunden, es all jenen, die ihr Ende wollten, Schlag um Schlag heimzuzahlen. Sie wusste, dass dies Krieg bedeuten würde, der mit Verrat und Intrigen geführt wurde, doch nun, nachdem sie mit Leonora gesprochen hatte, war sie dazu bereit: Sie war eine Medici und würde nicht so leicht weichen.
Sie nickte, als wollte sie diesen Gedanken bekräftigen.
Dann sah sie Leonora an und machte eine Kriegserklärung:
»Ich fürchte diese Franzosen nicht, Leonora. Sollen sie ruhig ihre Spielchen spielen, ich spiele meine. Am Ende werden wir sehen, wer länger durchhält.«
2
Die Geschichte eines Spions
Paris war zu dieser Zeit der Inbegriff des Lasters und der Gewalt: ein Hexenkessel, in dem die Armen und die Verlorenen übereinander hinwegstiegen, im verzweifelten Versuch, dort herauszukommen und zu überleben.
In den einfachen Vierteln waren die Straßen nichts anderes als Trampelpfade, die nach Moder und Exkrementen rochen, die Häuser waren unförmige und unordentliche Ansammlungen von Gestein, die geschwulstartig wucherten und den verbliebenen Raum mit einer Anhäufung aus Dächern und Mauern in Beschlag nahmen, sodass man keine Sonne mehr sah.
Die Paläste der Adligen machten etwas mehr her, doch im Innern waren Mord und Vergewaltigung ebenso an der Tagesordnung, wenn nicht sogar noch verbreiteter.
Die Seine durchfloss die Stadt wie ein Strom der Verdammnis, so groß war die Zahl der Menschen, die darin ertranken oder schlicht als menschlicher Müll dort entsorgt wurden.
Auf der Place de Grève war der Galgen permanent im Einsatz, und die Zahl der Bordelle nahm von Tag zu Tag zu. Nicht einmal die Kirchen schienen vor der Welle aus Hass, Gewalt und entfesseltem Sex mehr sicher.
Unter der Herrschaft Heinrichs IV. war Paris zu einem riesigen Zirkus der Lasterhaftigkeit verkommen, ganz so, als hätte die Bartholomäusnacht dreißig Jahre zuvor seine Einwohner nichts gelehrt.
Matteo Laforgia war darüber bestens unterrichtet. Er war in die französische Hauptstadt gekommen, um dort sein Glück zu machen, und zwar im Gefolge der Florentinerin Leonora Galigai, Protégée der Königin und wohl bald deren Dame d’atours.
Er hatte umgehend beschlossen, seinen Namen zu ändern, so wie er sofort begriffen hatte, dass sein hübsches Gesicht mit den regelmäßigen Zügen, das schon so manches Mädchen zum Seufzen gebracht hatte, ihm bestimmt noch öfter von Vorteil sein würde.
Er war im Schatten des Campanile von San Marco aufgewachsen und hatte als Dieb und professioneller Schwindler gearbeitet, Letzteres im Sold eines adligen Venezianers. Als schließlich ein Betrug an einem etwas allzu jähzornigen und rachsüchtigen Edelmann aufgeflogen war, hatte er die Serenissima verlassen und war nach Florenz gegangen.
Dort hatte er sich seine Erfahrungen zunutze gemacht und eine Karriere als Spion und Meuchelmörder begonnen, und genau diese Fähigkeiten und Talente hatten ihn schließlich in die französische Hauptstadt gebracht.
Er streifte durch die Straßen, trieb sich herum wie ein Tagedieb. Sein dunkelgraues Wams und die Pluderhosen hatten dieselbe Farbe wie sein Kapuzenumhang. Eine Kopfbedeckung trug er nicht. Er hatte weder Degen noch Pistole dabei, eben weil er nicht unnötig Aufmerksamkeit erregen wollte. Hätte sich jedoch jemand die Mühe gemacht, ihn zu durchsuchen, hätte er vielleicht den Dolch gefunden, den er in einem Futteral im rechten Ärmel seines Wamses versteckt hielt.
Er hatte langes Haar, trug es jedoch der Mode der Zeit entsprechend nicht allzu lang. Außerdem einen sorgfältig gestutzten Schnurrbart über wohlgeformten Lippen. An seinem Äußeren also gab es nichts, das ihm besondere Ausstrahlung verliehen hätte. Er sah nicht schlecht aus, doch fiel er eben auch nicht besonders auf.
Es war ihm ganz recht, auf diese Weise in der Menge der Städter untertauchen und sich unbekümmert unter ihnen bewegen zu können. Wenn nötig, konnte er sich einfach irgendeine Verkleidung überwerfen, um seine Nächsten übers Ohr zu hauen.
Diese Kunst beherrschte er bis zur Perfektion. Und das hatte ihm schon so manchen Vorteil verschafft.
In diesem Augenblick hatte er jedoch keineswegs vor, sich zu verkleiden. An diesem Tag beschäftigten ihn ganz andere Dinge, denn er sollte einen Mann töten.
Am späten Vormittag erreichte er Les Halles, die Markthallen von Paris. Hier drängten sich schon beim ersten Morgengrauen Männer und Frauen jeder Herkunft um die Stände mit Fleisch und Fisch. Die überdachten Gänge ermöglichten es den Händlern der Gegend, ihre Waren unabhängig von der Witterung zu verkaufen; es spielte keine Rolle, ob es regnete oder die Sonne schien. Die Häuser, Kirchen und Hôtels um die Markthallen herum waren von einer aberwitzigen Vielfalt der Formen.
Bei Les Halles, die als Ort des Warenaustauschs entstanden waren, wimmelte es nicht nur von Käufern, sondern auch von kleinen Dieben, Huren, Mördern und Banden übelster Sorte, so wie an den Ständen Waren aller Art feilgeboten wurden: Nicht nur Obst und Gemüse, Käse und Schinken, sondern auch Leder, Felle, Stoffe, Schuhe, Hüte, Möbel, Besteck, Hausrat und Waffen.
Laforgia, oder vielmehr Laforge, wie er sich jetzt nannte, wusste genau, dass der Mann, den er töten sollte, an diesem Morgen irgendwo bei den Stoffen und den Hüten zu finden sein würde. Monsieur de Montreval, so sein Name, kleidete sich gern elegant, ja man konnte sagen, er war ein rechter Stutzer, und es verging keine Woche, bei der er nicht bei Hofe ein neues Wams, eine auffällige Jacke oder einen Hut von besonders gewagter Form vorführte.
Doch abgesehen von seiner Leidenschaft für schöne Kleider war er auch eine echte Dreckschleuder; um die Comtesse du Bernais für sich zu gewinnen, hatte er sich nicht gescheut, über Leonora Galigai herzuziehen, indem er es als Skandal bezeichnete, dass eine Frau ohne Adelstitel, deren einzige Legitimation darin bestehe, mit Maria de’ Medici befreundet zu sein, es so weit gebracht habe. Eine Italienerin als Dame d’atours der Königin von Frankreich sei eine Schande, ja eine Beleidigung. Concino Concini, Edelmann aus Florenz und ein so enger Freund der Galigai, dass manch einer ihn schon für ihren Liebhaber hielt, hatte daraufhin Gift und Galle gespuckt. Sollte jemand diese Worte wiederholen, hatte er erklärt, würde er ihm die Kehle durchschneiden. So war er eben: Ein Hitzkopf und ein Schaumschläger dazu. Nicht dass er nicht gefährlich gewesen wäre – und ob! Aber alles, was er tat, wurde von großem Getöse begleitet. Er war der Inbegriff des Theatralischen. Und in den allermeisten Fällen folgten auf seine großen Worte keine Taten.
Leonora war da ganz anders. Sie war keinesfalls bereit, sich ungestraft beleidigen zu lassen; und um die Gerüchte wirklich zum Schweigen zu bringen, hatte sie Laforge klare Anweisung gegeben, den Aufschneider mundtot zu machen.
Für immer.
Der Auftrag musste blitzschnell und mit größter Diskretion ausgeführt werden. Es sollte der Eindruck entstehen, dass jedem, der es wagen würde, Leonora herauszufordern, Verhängnisvolles drohe, doch ohne dass die Beseitigung des Monsieur de Montreval auf sie zurückzuführen wäre.
Und genau aus diesem Grund hatte sich Mathieu Laforge unauffällig wie ein Schatten an die Verfolgung des ahnungslosen Edelmannes gemacht. Da dieser sich jedoch gewiss nicht durch Heldenmut auszeichnete, ließ er sich immer von einem bis an die Zähne bewaffneten Rüpel begleiten, einem gewissen Orthez aus der Gascogne, stattlich von Statur und immer bereit, beim geringsten Anzeichen einer Bedrohung zur Verteidigung überzugehen.
Deshalb hatte er auf eine ebenso einfache wie wirksame List gesonnen, denn Montrevals Leibwache hatte bekanntermaßen eine Schwäche für schöne Frauen.
Um den Mann abzulenken, hatte er also eine schöne Fischverkäuferin gebeten, dafür zu sorgen, dass der Gascogner sich im geeigneten Moment nach ihr umdrehen würde; in diesem Augenblick der Unaufmerksamkeit würde er zuschlagen.
3
Ein unbequemes Versprechen
Der König traute seinen Ohren nicht. »Was sagt Ihr da?«, schrie er. An seinem Hals traten die Adern hervor, sie waren angeschwollen, als wollten sie platzen. Die Frau, die vor ihm stand, vermochte ihm zwar zu schmeicheln, doch zugleich verstand sie es wie keine zweite, ihn auf die Palme zu bringen. Er hatte sie soeben aufs Höflichste gebeten, ihr das Dokument auszuhändigen, das er vor etwas mehr als einem Jahr unterzeichnet hatte; darin versprach er vor ihrem Vater, Monsieur François de Balzac, und vor Gott, sie zu ehelichen – unter der Bedingung, dass sie ihm ein Kind schenken würde.
Und nun hatte seine Mätresse ihm genau das anvertraut – dass sie ein Kind von ihm erwartete. Und sie verlangte, dass das Versprechen eingelöst würde.
Heinrich IV. von Frankreich hatte nicht die geringste Absicht, dies zu tun.
Henriette d’Entragues schmollte. Das tat sie immer, wenn etwas nicht gut lief, und in diesem Augenblick bestand ihre schärfste Waffe darin, sich als Opfer zu geben.
»Gereicht es Eurer Majestät denn zum Nachteil? Hattet Ihr mir nicht geschworen, Euch an dieses Versprechen zu halten?«
Der König sah in das reizende Gesichtchen und kam einen Augenblick lang ins Schwanken. Doch er fing sich sofort wieder. Er konnte doch dieser Frau unmöglich jedes Mal nachgeben! Verrückt genug, dass er so unbedacht dieses elende Gelöbnis unterschrieben hatte. Damals hatte er dem kein Gewicht beigemessen, er war überzeugt gewesen, dass sich dieser absurde Anspruch, ihn zu heiraten, von selbst erübrigen und Henriette sich mit der Rolle als Mätresse zufriedengeben würde, die er ihr zugedacht hatte.
Doch es war anders gekommen, als er gedacht hatte. Nicht nur, dass der Vater der jungen Frau auf der Einhaltung des Vertrages bestand und Henriette sich aus ebendiesem Grund weigerte, ihm diesen auszuhändigen, schlimmer noch, Henriette selbst bestand auf dieser aberwitzigen Forderung und versuchte, ihn mit dem Kind als Faustpfand unter Druck zu setzen.
Der König schüttelte fassungslos und voller Abscheu den Kopf. In seinen Augen war Henriettes Ansinnen so unangemessen, dass es schon beleidigend war.
»Seht Ihr nicht, dass Ihr bereits alles bekommen habt, was ich zu geben habe?«, fragte er kaum hörbar. »Reicht Euch das noch immer nicht? Habe ich nicht für königliche Einkünfte gesorgt? Habe ich Euch nicht zu Ehren und Reichtum verholfen? Reicht es nicht, dass ich Euch Wohnungen und Gemächer einrichten ließ, die der edelsten Dame Frankreichs würdig sind? Oder dass ich Euch die Markgrafschaft Verneuil zuerkannt habe? Was wollt Ihr noch? Wollt Ihr meinen Ruin, Henriette? Denn, seid versichert, ein solches Entgelt ist außerhalb meiner Möglichkeiten. Es gibt niemanden, der sich mehr über dieses Kind freut, glaubt mir. Aber ich werde Euch nicht erlauben, es gegen mich einzusetzen.«
Henriette zeigte sich uneinsichtig.
»Heinrich, Liebster, Einziger, Ihr wisst doch, dass ich Euch dies Stück Papier wirklich zurückgeben wollte, welches Ihr selbst unterzeichnet habt, um mir zu beweisen, wie sehr Ihr mich liebt. In Anbetracht der Hochzeit mit dieser verdorbenen und ruhmsüchtigen Florentinerin, die mir Euch entrissen hat, erkenne ich nun, dass dies nur ein schäbiger Schachzug war, um mich zu beschwichtigen.«
»Wie könnt Ihr es wagen, so über Maria zu reden?« Heinrichs Augen blitzten vor Wut – das Maß war voll. »Ich erlaube Euch nicht, in dieser Weise von der Königin zu sprechen. Habe ich mich klar ausgedrückt?«
Henriette biss sich auf die Unterlippe. Den König noch wütender zu machen als er schon war, wäre nicht von Vorteil, sie durfte nicht vergessen, dass Beleidigungen der Königin der sicherste Weg waren, genau das Gegenteil des Bezweckten zu bewirken. Sie musste sich das merken. Doch ihre schon sprichwörtliche Eifersucht brachte sie immer wieder zu törichter Übertreibung, was dann dazu führte, dass sie ihr Ziel nicht erreichte.
»Heinrich, ich bitte Euch, Ihr habt ja recht«, versuchte sie einen gemäßigteren Ton anzuschlagen, »ich wollte es Eurer Gemahlin gegenüber nicht an Respekt mangeln lassen. Doch wie, glaubt Ihr, fühle ich mich, wenn ich derart links liegen gelassen werde? Eure Eheschließung war das Aus für meine Liebe. Bis vor ein paar Monaten hattet Ihr nur Augen für mich, doch seit diese Frau hierherkam, habt Ihr mich völlig vergessen.«
Es gelang Henriette sogar, eine Träne zu vergießen. Wie eine gläserne Perle rann sie über ihre blasse Wange. »Liegt Euch denn wirklich gar nichts an mir? Oder an unserem Kind?«, setzte sie nach.
Sie legte das Köpfchen zur Seite, und eine blonde Locke fiel ihr keck ins Gesicht.
Sie war verdammt noch mal unwiderstehlich.
Und Heinrich, der ihrer Ausstrahlung mehr als jeder andere Mann erlag, wäre beinahe schon in die Falle gegangen. Doch dieses Mal stand zu viel auf dem Spiel – er riskierte dabei, dem Königreich Schaden zuzufügen.
»Henriette, strapaziert meine Geduld nicht zu sehr. Ich rate Euch, dieses verfluchte Gelöbnis wiederzufinden und mir zurückzugeben. Ich bin sicher, wir werden in gegenseitigem Einvernehmen eine diskrete Lösung finden, mit der wir alle drei glücklich werden, ich, Ihr und die Königin. Maria ist sich darüber im Klaren, dass ich nicht auf Euch verzichten werde, doch ist sie zu Recht nicht bereit, sich demütigen zu lassen. Ganz abgesehen davon, dass sie eine Frau von großer Ausstrahlung, Temperament und ausgezeichnetem Benehmen ist. Sie weiß genau, wie viel Ihr mir bedeutet und hat diesen Umstand mit gebotener Klugheit und Reife akzeptiert. Ihr hingegen spielt immerfort mit dem Feuer. Seht zu, dass Ihr nicht zu weit geht, Henriette. Denn Ihr wisst ja recht gut, wozu ich in der Lage bin. Ich will Euch nicht zwingen müssen …«
»Das würdet Ihr nicht wagen«, sagte Henriette und warf ihm einen vernichtenden Blick zu.
»Heute vielleicht nicht. Aber seid gewiss, dass ich früher oder später etwas unternehmen werde, um wieder in den Besitz meines schriftlichen Versprechens zu gelangen. Ich habe nicht die Absicht, Euch die Stellung zu verwehren, die ich Euch zugebilligt habe, zumindest vorerst nicht, doch bedenkt, dass dies ein Zugeständnis ist und keine Verpflichtung. So wie meine Wahl auf Euch gefallen ist, kann ich Euch auch wieder dem Vergessen anheimgeben. Oder Euren Sohn. Ich bin der König!«, erwiderte er zähnefletschend.
»Dies ist auch Euer Kind. Ihr seid herzlos«, beharrte Henriette, und ihre Tränen strömten nur so herab.
Doch der König war es leid.
»Denkt also daran, ich möchte Euch nicht noch einmal darum bitten. Händigt mir dieses verdammte Stück Papier aus. Wenn diese Angelegenheit aus der Welt geschafft ist, werde ich mich endlich über die Geburt unseres Sohnes freuen können. Bis dahin muss ich in erster Linie an die Pflichten denken, die mir mein Amt auferlegt.«
Ohne ein weiteres Wort verschwand Heinrich durch die Tür.
Unwillkürlich schaute Henriette in den großen Spiegel an der Wand. Und sah, dass ihre Augen voller Tränen waren.
Doch es waren keine Tränen der Verzweiflung. Es waren Tränen der Wut. Sie würde einen Weg finden, es dieser Medici-Schlampe heimzuzahlen. Und auch der König würde zahlen.
4
Der Vorfall auf dem Markt
Laforge beobachtete Monsieur de Montreval im Gewühl von Les Halles. Die Gelegenheit war günstig. Zwischen den schreienden Händlern, die die Qualität ihrer Waren anpriesen, und der Menge, die sich vor den Ständen drängte, würde es nicht allzu schwierig sein, das Vorhaben zu Ende zu bringen.
Doch wollte er den Auftrag auch nicht unterschätzen.
Genau in dem Moment, in dem die schöne Fischhändlerin Orthez’ Aufmerksamkeit auf sich zog, schritt Laforge zur Tat.
Die Frau hatte tiefblaue Augen und Haare so rot wie flammendes Herbstlaub. Ein winziges Schmuckstück lugte aus ihrem weiten Ausschnitt hervor.
Sie beugte sich nach vorn, um ihre Auslage noch etwas hervorzuheben, und sah Orthez dabei tief in die Augen. Die Fülle dessen, womit die Natur sie gesegnet hatte, blendete den Mann.
»Mein Bester, habt Ihr jemals frischere Forellen gesehen?«
Der Gascogner warf einen kurzen Blick auf das Bassin mit den Fischen. Doch sogleich zog ihn der üppige Busen dieser ebenso schönen wie ungehemmten Frau wieder unwiderstehlich in seinen Bann.
Laforge verlor keine Zeit. Er sah, dass Monsieur de Montreval von der ganzen Schmierenkomödie nichts mitbekommen hatte, weil er gerade einen Hut mit breiter Krempe aufprobierte. Da er nicht ganz überzeugt war, legte er ihn zurück. Er beschwerte sich über die Menge, die ihn von mehreren Seiten bedrängte und ihm nicht genug Bewegungsfreiheit ließ.
Laforge näherte sich.
Er tat so, als ginge er einfach nur seiner Wege und rempelte Montreval dabei mit der Schulter an. Im selben Augenblick ließ er die Klinge hervorschnellen, die er im Ärmel seines Wamses verborgen hielt, und stach ihm zweimal ins Herz. Es ging blitzschnell, die beiden Bewegungen waren fast nicht wahrnehmbar, da sie zudem durch den weiten Umhang verborgen wurden.
Dann ging Laforge weiter, als sei nichts geschehen, und verschwand rasch in der Menschenmenge auf dem Markt.
Montreval legte die Hände auf die Brust. So unversehens hatten ihn die tödlichen Messerstiche getroffen, dass er nicht einmal mehr Luft holen konnte.
Er spürte ein brennendes Beißen in der Brust, als hätte ihn aus dem Nichts ein riesiger Stachel getroffen. Daraufhin beugte er sich leicht vornüber, um sich zu übergeben, und es kam – ein Schwall Blut.
Er brach zusammen, griff in die Luft und klammerte sich dann verzweifelt an die Schulter des Mannes vor ihm.
»Mort-dieu!«, schrie der, nachdem er begriffen hatte, was geschehen war. »Der Mann stirbt!«
Als spürte er, dass die Sache ihn betreffe, sah Orthez sich um; die Worte waren wie ein Peitschenhieb gewesen, dessen scharfes Zischen er wahrgenommen hatte. Unwillkürlich legte er die Hand auf den Griff des Degens, den er unter dem Mantel bei sich trug. Er riss sich von der Fischverkäuferin los und wandte sich dorthin, woher der Schrei gekommen war.
Und da sah er direkt vor sich seinen zusammengesunkenen Patron.
»Monsieur de Montreval!«, rief er in einem erstickten Schrei. Orthez stürzte hinzu, doch als er seinen Herrn erreichte, erkannte er, dass die Situation aussichtslos war.
»Fort mit Euch!«, schrie der Gascogner. »Seht ihr nicht, dass er kaum mehr Luft bekommt? Wer ist das gewesen? Wer hat ihn angegriffen?« Raubvogelgleich erforschten seine schwarzen Augen die unmittelbare Umgebung, mit einem flammenden Blick voll Schuldgefühl und Wut, eine Mischung, die jedem, der seinen Weg kreuzte, brandgefährlich werden konnte.
Doch Zorn und Verzweiflung bewirkten nichts, vor sich sah er nur leere Gesichter, die Gesichter braver Pariser Bürger, die ihm ihrerseits stumme Fragen zu stellen schienen.
Weiter nichts.
Er schüttelte den Kopf.
Der Angreifer war wohl schon längst weg. Und ihm blieb nichts anderes übrig, als über die eigene Unfähigkeit nachzudenken.
Er betrachtete seinen Herrn, der dort vor dem Hutstand lag, das Wams mit seinem Blut getränkt, die Pfütze auf dem Boden breitete sich gleich einem scharlachroten Mantel um ihn aus.
Montrevals blaue Augen waren weit aufgerissen. Sein Gesicht war eine Maske des Schreckens, als hätte er ein Gespenst gesehen; es erstarrte im Herannahen des Todes, der nach seinem Leben gierte. Rote Bläschen platzten auf seinen Lippen. Montreval blieb noch die Zeit für ein letztes Röcheln, dann verschied er.
Orthez blieb allein mitten in der Markthalle stehen. Die Leute wichen vor ihm zurück. Es war, als hätte er die Pest – plötzlich blieb es um den Gascogner leer, die Menge zog sich zurück wie das Meer bei Ebbe und zerstreute sich in alle Richtungen.
Die Fischverkäuferin!
Orthez sah zu dem Stand hinüber, wo er gerade noch mit dieser wunderschönen Frau Blicke gewechselt hatte.
Doch an ihrer Stelle stand nun ein Mann mit einem langen Bart.
Sie hatten ihn wie einen dummen Jungen zum Narren gehalten! Wie hatte er so blöd sein können? Orthez ging zum Stand mit den Fischen.
»Das Mädchen!«, brüllte er.
»Pardon, Monsieur? Ich verstehe nicht …«
»Die junge Frau mit den roten Haaren, die eben noch hier war! Wo ist sie hin?« Dabei zog Orthez den Degen halb aus der Scheide und ließ zur Verdeutlichung den Stahl aufblitzen.
Doch der Händler zuckte nicht mit der Wimper. Er war groß und kräftig, hatte breite Schultern und war gewiss stark wie ein Stier.
»Meint Ihr Colette?«
»Keine Ahnung, heißt sie so?«
»Auf mein Wort, mein Herr, sie ist die einzige Rothaarige, die ich kenne.«
»Wo ist sie jetzt?«
»Sie ist gegangen. Sie hat gesagt, sie müsse etwas erledigen.«
»Und Ihr habt sie einfach gehen lassen?«
»Was hätte ich denn tun sollen?«, fragte der Mann scheinheilig. Dann bekam seine Stimme einen bedrohlichen Klang: »Colette hilft mir hier und da aus, dafür bekommt sie einen Eimer Garnelen. Sie hat keine festen Zeiten, und ich bin froh, dass sie bei mir arbeitet und nicht bei jemand anderem. Wenn sie da ist, kommen die Kunden scharenweise und beißen an wie die Fische.«
Orthez begriff, dass Diskutieren nicht helfen würde. »Wohin ist sie gegangen?«, fragte er noch einmal, doch bereits weniger überzeugt.
»Was weiß ich?«
Der Gascogner stieß einen Fluch zwischen den Zähnen hervor.
Dann entfernte er sich wortlos.
Er konnte seinen Herrn nicht dort liegen lassen, wo er war.
Doch offenbar hatte sich schon jemand darum gekümmert, denn die königlichen Wachen trafen gerade ein.
Hastig dachte Orthez nach, er musste sich schnell entscheiden. Was war wichtiger, Loyalität gegenüber demjenigen, in dessen Lohn er eben noch stand, oder die eigene Haut zu retten? Er zögerte nicht lang.
Ohne noch mehr Zeit zu verlieren, lief er in entgegengesetzter Richtung davon.
5
Zwei Ankündigungen
Bei all seinen Qualitäten war der König vor allem dafür bekannt, ein guter Liebhaber zu sein. Vielleicht wegen all der Dinge, die er in der Jugend durchgemacht hatte, vielleicht, weil er um seine Wirkung wusste, die man eben nur mit zunehmender Reife entfaltet, hatte er sich über die Jahre entschieden, sich ganz und gar den Frauen zu widmen. Ganz Frankreich wusste von seiner außergewöhnlichen Manneskraft und seinen vielen, ja allzu vielen Liebschaften. Und doch verloren seine zahllosen Geliebten gegenüber Maria, seiner Königin, an Bedeutung.
Sogar Henriette.
Endlich einmal war das Glück ihm hold, dachte er, als er hingerissen diese fast durchscheinend helle und samtweiche Haut betrachtete.
Er war völlig betört von der Schönheit der Medici. Ihre wohlgerundeten Formen, ihr großer, weicher Busen, dem er sich so gern hingab, ihre kräftigen, festen Hüften, der straffe Leib, der dazu gemacht schien, von ihm genommen zu werden, und zugleich der Tempel war, dem er seine Sinne darbrachte.
Und dann all das Geschmeide, mit dem sich Maria gerne schmückte, von dem sie manches nicht einmal in den intimsten Situationen abnahm, was ihm köstliche Momente bescherte. Etwa die flammendrote Kette aus Rubinen, die auf ihrer Brust funkelte; kaum ein anderer Edelstein konnte sich so perfekt ins Dekolleté schmiegen. Und dann die Perlen, die die Handgelenke umschmeichelten.
Daran musste er denken, als er die korallenroten Lippen Marias wieder und wieder küsste. Wenn er mit ihr zusammen war, schien alles andere sich plötzlich aufzulösen: die Sorgen, die Probleme, die Intrigen und Betrügereien. Und er war frei: frei zu lieben, zu berühren, sie zu nehmen.
Die Königin lächelte still. Heinrich streichelte ihr das Gesicht. Sie hatte große Augen, hohe Wangenknochen und ganz glatte Haut, wie aus Porzellan. Sie war von rosiger Blässe, und ihre Konturen raubten ihm den Verstand.
Und wie klug Maria war! Nicht so eifersüchtig, misstrauisch und grausam wie die anderen Frauen. Ganz und gar nicht! Ihre Großmut und ihre Großzügigkeit waren so unermesslich wie Frankreich selbst.
Heinrich bedeckte ihre weißen Arme mit Küssen. Er kostete ihr festes Fleisch, als sei sie buchstäblich zum Vernaschen. Unter seinen zärtlichen Bissen schloss sie die Augen und ließ sich völlig gehen.
In einem solchen Augenblick hätte sie alles von ihm verlangen können. Doch Maria nutzte das nicht aus.
Was sie für ihn noch begehrenswerter machte. Sie versuchte keinerlei Vorteil oder Profit aus ihrer schon sprichwörtlichen Schönheit zu ziehen.
Und dass sie sich ganz offensichtlich mit den Dingen des Lebens auskannte, machte sie zu einer wunderbaren Geliebten, voller Überraschungen und stets bereit, Neues auszuprobieren.
Maria setzte sich aufs Bett. Die Laken bedeckten ihre volle Brust, die kastanienbraunen Haare fielen in weichen, glänzenden Locken über ihre Schultern.
Sie lächelte.
»Ich muss dir etwas sagen, Liebster«, gestand sie mit ihrer tiefen, warmen Stimme.
Heinrich war ihr machtlos ausgeliefert. »Sprecht nur, mein Augenstern, ich höre Euch zu.«
Maria wandte für einen Moment den Blick ab. Dann schaute sie ihm wieder in die Augen. »Majestät, ich erwarte Euren Sohn.«
Einen Augenblick lang war Heinrich überwältigt, es schien, als sei die Botschaft nicht ganz bei ihm angekommen. Dann jedoch breitete sich unzähmbare Freude auf seinem sonst eher ausdruckslosen, meist mürrischen und faltigen Gesicht aus.
»Meine Königin, Ihr überbringt mir die schönste aller Nachrichten, sie hätte nicht willkommener sein können!« Er küsste Maria zärtlich.
Beglückt von dieser unerwarteten Eröffnung ließ er den Blick schweifen. Einen Augenblick lang hing sein Blick verträumt an den Bechern aus Jaspis, die Maria in ihr Gemach hatte bringen lassen. Kerzenständer aus Alabaster und kleine Leuchter aus vergoldetem Silber setzten im Raum Lichtreflexe, die von den vergoldeten venezianischen Spiegeln zurückgeworfen wurden und den Raum wie mit Edelsteinen schmückten.
All diese Kostbarkeiten schienen die Freude, die sein Herz ergriffen hatte, noch größer werden zu lassen. Maria veränderte sein Leben, wie sie auch den düsteren und heruntergekommenen Louvre erneuerte und Lebensfreude, Licht und Lebendigkeit hineinbrachte.
»Ihr seid der Segen meines Lebens, Maria«, gestand er ihr merklich bewegt.
Sie umarmte ihn. Sie küsste voller Zärtlichkeit seinen Rücken. Doch dann ging diese unschuldige Zuwendung in ganz andere Empfindungen über. Heinrich spürte ihre Zähne an den Schultern. Dann fügte sie ihm mit ihren Bissen auch an den Flanken süßen Schmerz zu und fuhr ihm mit etwas Kühlem über die Lenden.
Er begriff zunächst nicht, was es war, doch dann entdeckte er in ihren schönen Händen einen taubeneigroßen Diamanten.
»Ihr seid von einer Sinnlichkeit, Maria, dass ich mir Sorgen um Eure Tugend machen würde, wenn ich nicht wüsste, wie verliebt und treu ergeben Ihr mir seid.«
Heinrich neckte sie gern auf diese Weise. Und auch wenn er wusste, dass er sich so möglichen Vorhaltungen wegen seiner allgemein bekannten Untreue aussetzte, hatte er doch seine Freude daran, vor allem weil sich Maria nicht sonderlich daran zu stören schien.
Und so band sie ihn sogar noch fester an sich. Seit sie an den französischen Hof gekommen war, war sein Interesse an Henriette und all den anderen deutlich abgeflaut. Und das nicht allein, weil sie eine Neuheit darstellte, noch dazu eine sehr verführerische, sondern eben wegen ihrer unbekümmerten Haltung, als sei sie überzeugt, dass schlussendlich keine der Geliebten des Königs ihr ebenbürtig sei.
Heinrich seufzte.
Er war glücklich.
Zärtlich streichelte er ihre Wange. Und küsste sie leidenschaftlich. »Doch die Tatsache, dass wir einen Nachkommen erwarten, bedeutet nicht, dass wir auf die Freuden des Schlafgemachs verzichten müssen.« Und so nahm er die Hand seiner Gemahlin und führte sie dorthin, wo sich das Vergnügen für ihn besonders genussvoll ausleben ließ.
»Ich sage Euch, es ist beschlossene Sache, Herrin.«
In anderen Gemächern des Louvre, nicht weit von jenen, wo die Herrscher sich ihrer Liebe hingaben, empfing Leonora Galigai Mathieu Laforge.
Wie verlangt, war dieser wahrhaft außergewöhnliche Mann gleich nach Ausführung des Auftrags zu ihr gekommen.
»Dieser Mann ist also nicht mehr am Leben?«
»Ich habe ihm das Herz zweimal durchbohrt«, schloss Laforge vollkommen kalt und ungerührt seinen Bericht.
Leonora musterte ihn eindringlich. Ihre schwarzen Augen schienen ihm ins Herz blicken zu wollen, aber Laforge nahm keine Notiz davon. Sein unauffällig hübsches Gesicht verriet keinerlei Gemütsregung. So jung er auch war, schien er doch eine beneidenswerte Selbstbeherrschung und eine bemerkenswerte Fähigkeit zu heucheln entwickelt zu haben, Eigenschaften, die an einem Hof, an dem Tratsch und Intrigen zum guten Ton gehörten, umso wertvoller waren.
»Hat Euch jemand gesehen, Mathieu?«
»Auf keinen Fall. Die Menschenmenge in Les Halles war der beste Schutz.«
»Sehr gut.« Sie konnte ein zufriedenes Lächeln nicht unterdrücken. Dann begab sie sich unverzüglich zu dem wunderbaren, intarsienverzierten Schreibtisch. Aus dem Ärmel ihres prächtigen Gewandes zauberte sie einen winzigen silbernen Schlüssel hervor und öffnete das Möbel.
Die Schreibtischplatte gab ein Fach im Innern frei. Leonora nahm eine klimpernde Börse heraus. Nachdem sie das Möbelstück wieder verschlossen hatte, übergab sie Laforge den Beutel.
»Bitte sehr, Monsieur, fünfzig Goldscudi für Eure Unannehmlichkeiten, der vereinbarte Lohn für Eure Dienste.«
Laforge verneigte sich.
»Ich danke Euch, Madame«, sagte er ehrerbietig. Und auch in diesem Fall war er weder übertrieben herzlich noch besonders galant. Alles schien darauf angelegt, maßvoll zu sein, als sollte jede seiner Handlungen Normalität vermitteln. Seine schlichte, unauffällige Art sich zu kleiden sorgte dafür, dass man ihn kaum zur Kenntnis nahm. Er gründete seine Erfolgsaussichten als Spion und bezahlter Mörder sogar genau darauf, dass man ihn augenblicklich vergessen würde. Das Halbdunkel schien sein natürlicher Lebensraum zu sein. Was Leonora außerordentlich gefiel.
Er war genau der richtige Mann für die Königin, dachte sie nochmals.
Und so wollte sie ihm recht rasch anvertrauen, was sie seit Beginn ihrer Unterhaltung bewegte.
»Monsieur Laforge – oder vielleicht sollte ich lieber sagen Messer Laforgia, so lange, wie ich Euch schon kenne?«
»Wie es Euch lieber ist, Herrin.«
»Ihr werdet von den vielen Geliebten des Königs gehört haben, nehme ich an.«
»Es ist mir nicht neu.«
»Und sicher wisst Ihr auch, dass seine Mätresse …«
»… Henriette d’Entrague ist, Marquise de Verneuil«, ergänzte er.
»Ganz genau. Nun, Ihr wisst, wie sehr mir unsere Königin am Herzen liegt, und Ihr seid sicher auch darüber unterrichtet, dass sie ebenso aufrichtige freundschaftliche Gefühle für mich hegt.«
»Sodass sie Euch sogar zu ihrer Dame d’atours ernannt hat, Herrin, was viele französische Edeldamen düpiert hat«, merkte Laforge an.
»Ihr seid auf dem Laufenden, Mathieu, ja, so werde ich Euch nennen.«
»Gut informiert zu sein, ist die Grundlage meines Geschäftes«, entgegnete der Mörder, und dabei blitzte etwas in seinen grauen Augen auf. Doch es war sofort wieder verschwunden, sodass sich Leonora schon fragte, ob sie sich getäuscht hatte.
»Sehr gut. Nun also zu meiner Bitte.«
»Ich bin ganz Ohr, Herrin.«
6
Das Treffen mit der Königin
Nach Einbruch der Dunkelheit wollte Maria den Spion treffen, von dem Leonora Galigai gesprochen hatte. Auf Anraten der Freundin hatte sie die Kutsche genommen, um zum vereinbarten Treffpunkt zu fahren, einem kleinen Haus in der Rue de Vaugirard. Sie hatte einen Wagen ohne Wappen gewählt, um kein Aufsehen zu erregen. Begleitet wurde sie von ein paar Wachen, die wie normale Edelleute gekleidet waren.
Leonora Galigai erwartete sie dort. Die Königin hatte das Gefühl, es sei nicht das erste Mal, dass Leonora diese Hütte für ihre heimlichen Treffen nutzte. Doch sie wollte nicht danach fragen. Am Hof gingen jedenfalls Gerüchte um, die diesen Verdacht bestätigten.
Seit ein paar Tagen war es für einige der angesehensten Adligen kein Geheimnis mehr, dass Monsieur de Montreval auf ihr Geheiß ins Jenseits befördert worden war. Die königlichen Wachen hatten ihn bäuchlings am Boden der Markthallen vorgefunden. Eine rasche Bestandsaufnahme hatte ergeben, dass der Edelmann von zwei Dolchstichen niedergestreckt worden war.
Natürlich konnte niemand beweisen, dass Leonora dahintersteckte, doch die Tatsache, dass Montreval die Galigai wenige Wochen zuvor beleidigt hatte, ließ in vielen den Verdacht aufkommen, dass das Geschehene ein Racheakt der Dame d’atours sei. Sicher, es hätte auch ihr Galan, Concino Concini, der Florentiner Edelmann mit dem bekanntermaßen feurigen Temperament sein können, doch die Art des Vorgehens sah nicht nach ihm aus. Je länger sie darüber nachdachte, desto mehr war Maria überzeugt, dass es Leonora gewesen sein musste, die diesen Mord in Auftrag gegeben hatte.
Maria kannte Leonora und wusste, dass sie von einem eisernen Willen und außergewöhnlicher Aggressivität angetrieben wurde. Diese Charakterzüge erschreckten sie. Doch sie wusste ebenso, dass sie im Louvre in einem Schlangennest lebte, dass der gesamte französische Adel gegen sie eingenommen war. Weil sie Italienerin war, schlimmer noch, aus Florenz stammte, weil sie schön und anziehend war und nicht von Blutadel, wie es von einer Königin verlangt wurde. Maria war die Cousine jener Caterina de’ Medici, die bis vor zehn Jahren die verhassteste Königin der französischen Geschichte gewesen war. Und nun schien sie ihren Platz einzunehmen.
Daher war es letzten Endes gar nicht so seltsam, mit unbedingter und unnachgiebiger Entschlossenheit für die eigene Sicherheit zu sorgen, indem sie den laut Leonora besten Spion am Platze auf ihre Seite brachte. Maria vertraute der Freundin, auch wenn es ein nicht unerhebliches Risiko darstellte, einen solchen Mann anzuheuern, damit Heinrich wieder in Besitz dieses dummen Versprechens käme, das er vor langer Zeit Henriette d’Entragues gegeben hatte.
Seit sie nach Paris gekommen war, war ihr bewusst, dass sie Schwierigkeiten am besten dadurch vermeiden konnte, dass sie vertrauenswürdige Freunde um sich scharte und dem Ehemann trotz seiner Laster treu zur Seite stand, ohne allzu eifersüchtig zu sein oder sich zu beklagen. Heinrich war kein kleiner Junge mehr, und mit der Zeit würde er sich sicher bändigen lassen. Seine erotischen Leidenschaften würden mit zunehmendem Alter nachlassen, und dann wäre sie die einzige Frau in seinem Leben, sie, seine Gemahlin und Königin.
Kurz und gut, sie konnte die Zeit für sich arbeiten lassen, ohne unnütze Intrigen anzuzetteln. Sie war schön und wusste, wie sie ihm Vergnügen bereiten konnte. Und doch ließ sich nicht leugnen, dass dieses schriftliche Versprechen – schlimmer noch, dieses offizielle, unter den Augen von Zeugen verfasste Dokument – kein geringfügiges Problem darstellte. Es war etwas, das über dumpfen Neid und sinnlose Komplotte bei Hofe hinausging.
Es war kein Geheimnis, dass nicht allein Henriette, sondern ihre ganze Familie und sogar ein Teil des Adels außerordentlich daran interessiert waren, dass der König sie zurückweisen und Henriette zur Frau nehmen würde.
Maria glaubte nicht, dass Heinrich so weit gehen würde, auch weil sie sich ihrer eigenen Überlegenheit recht sicher war, doch andererseits konnte sie nicht ausschließen, dass dieses Problem, das im Augenblick noch beherrschbar war, sich zuspitzen würde, insbesondere wenn es von Unzufriedenheit und Neid genährt wurde. Und genau das waren die Empfindungen der Familie von Henriette. Das galt vor allem für ihren Halbbruder Charles de Valois, den Grafen von Auvergne, der keinen Hehl daraus machte, dass er auf den Thron von Frankreich aus war. Und ein Nachkomme aus einer königlichen Verbindung vermochte bereits begrabene Hoffnungen wieder anzufachen. Umso mehr, als auch Charles de Gontaut, Herzog von Biron, Marschall von Frankreich sich seinen Vorteil sichern wollte. Zu den Forderungen von Henriette d’Entragues gesellten sich also weitreichende und noch weit gefährlichere Machenschaften. Heinrich schien das gar nicht zu bemerken. Oder er gefiel sich so sehr in der Rolle des großen Liebhabers, dass er für diese finsteren Ränke blind war.
Er war gewiss nicht dumm; die Tatsache, dass er den Valois die Krone entrissen hatte, war Beweis genug für seine Gerissenheit und Tüchtigkeit. Doch nun war er müde, er wollte nichts als Ruhe und Frieden und neigte deshalb dazu, die subversiven Kräfte zu unterschätzen, die von Tag zu Tag stärker wurden.
Der König hatte für die Eheschließung mit Margarete von Valois, der Reine Margot, päpstlichen Dispens erhalten. Jene Königin war einst so schön, wie sie nun furchtbar und aufmüpfig war. Noch dazu war sie grausam und der Wollust ergeben, der sie ohne Rücksicht auf Verluste in Orgien jeglicher Art nachging. Es hieß, ihre sexuellen Begierden überstiegen bei Weitem die ihres Ex-Gemahls, sodass sie als Entschädigung für die Scheidung eine Zahlung von dreihunderttausend Livre und eine Schar junger Liebhaber erhalten habe, die sie zu jeder Tages- und Nachtzeit besitzen und benutzen konnte.
Ob an diesen Geschichten nun etwas Wahres dran war – Maria hatte die Königin nur ein einziges Mal gesehen, und ihr Eindruck war der einer klugen Frau, mit der das Leben und das Alter nicht die geringste Nachsicht gehabt hatten. Fast sah es sogar so aus, als hätten die Jahre sich gegen sie verschworen und ihr alle frühere Schönheit genommen.
Doch mochte auch die legendäre Anmut vergangen sein, so galt dies nicht für ihren ausgesuchten Geschmack und die exquisite Art, sich zu kleiden. Ganz zu schweigen von ihrem Scharfsinn und der Liebe zur Kunst, die ihre faszinierende Ausstrahlung ausmachten.
Nun war jedoch weniger Margot das Problem, als vielmehr der Titel der Königin von Frankreich. Denn es war eine Tatsache, dass dieses vom König selbst unterschriebene Dokument in den falschen Händen zu einer Waffe werden konnte. Der Graf von Auvergne und der Herzog von Biron zählten genau darauf.
Maria seufzte.
Als die Kutsche endlich ans Ziel gelangt war, ging einer ihrer beiden adligen Begleiter voraus und half ihr auszusteigen.
Der andere klopfte an die Tür des Häuschens in der Rue de Vaugirard, und sobald sie geöffnet wurde, verschwand die Königin im Innern.
Die beiden Männer bewachten den Eingang. Doch zu dieser Stunde, lange nach Sonnenuntergang, lag die Straße verlassen unterm nächtlichen Himmel, keine Menschenseele war zu sehen.
Drinnen fand sich Maria in einem winzigen und schwach erleuchteten Raum wieder. Im Halbschatten erblickte sie Leonora. Sie trug Schwarz, und allein die Perlen ihrer schönen Kette reflektierten das schwache Licht der Kerzen.
Auf einem Samtsessel in der Ecke, dessen Bezug schon ganz verschlissen war, entdeckte sie einen Mann. Dieser hatte sich bei ihrem Eintreten erhoben und sich verbeugt. Er hatte den breitkrempigen Hut mit der großen Feder abgenommen, und als er sich nun wieder aufrichtete, war sein Gesicht zu sehen.
Maria sah einen durchdringenden Blick in einem Allerweltsgesicht, er hatte graue Augen und braunes Haar. Die Spitzen des sorgfältig gestutzten und pomadisierten Schnauzbartes wiesen nach unten, seine Züge waren fein, wenn auch nicht aristokratisch.
Er war weder groß noch klein. Sehnig, jedoch nicht schmächtig. Er trug ein dunkelgraues Wams, Pluderhosen und kniehohe Stiefel.
Das Bild wurde vervollständigt von einem Degen mit Griffkorb, der in der Scheide steckte, die wie eine schwanzartige Verlängerung unter dem Stoffmantel hervorlugte.
Alles in allem hätte sie ihn für einen der vielen Edelleute gehalten, die in Paris ihr Glück suchten. Und damit hätte sie gar nicht so falsch gelegen.
Leonora Galigai verlor keine Zeit. »Eure Majestät, ich danke Euch, dass Ihr gekommen seid. Ich habe das Vergnügen, Euch den Mann vorzustellen, der von nun an alle Probleme lösen und sich voll und ganz unserer Sache widmen wird.«
»Ich heiße Matteo Laforgia, doch ich habe meinen Namen in Mathieu Laforge geändert. Ich stamme aus Venedig, Eure Majestät, und bin daher von Natur aus Euer Verbündeter, kämpften doch meine Republik und die Eure, die von Florenz, so oft Seite an Seite. Doch aus Vorsicht gebe ich mich lieber als Franzose aus. Dieser Umstand wird Euch nützen, denn niemand wird annehmen, dass eine Dame wie Ihr sich einem Mann wie mir anvertraut, noch dazu einem Franzosen. Auf solch einfache Weise werden wir mögliche Verdächtigungen entkräften.«
Maria nickte. Dann sagte sie: »Monsieur Laforge, wie ich sehe, fehlt es Euch nicht an Tatkraft. Ich nehme an, dass Leonora Euch das Problem bereits umrissen hat, das nicht nur uns betrifft, sondern ganz Frankreich bedroht.«
»Die Sachlage könnte nicht klarer sein, meine Königin.«
»Sehr gut. Worum ich Euch also bitte, ist, so schnell wie möglich das bewusste Dokument wiederzubeschaffen. Ich habe keine Ahnung, wo Henriette d’Entragues es versteckt hat, aber es ist von äußerster Wichtigkeit, dass es baldmöglichst wieder in die Hände des Königs gelangt.«
»Das Problem ist mir in aller Deutlichkeit bewusst.«
Maria seufzte.
Leonora erriet, was ihr Unbehagen bereitete, und kam ihr zu Hilfe. »Herrin, ich kann Eure Bedenken gut verstehen. Wir alle wissen, wie heikel dieses Vorgehen ist, doch wir haben keine andere Möglichkeit. Der König hat mehrfach versucht, seinen Fehler wettzumachen, doch ohne nennenswerte Resultate. Der Sturheit von Madame d’Entragues ist nicht beizukommen. Den Dingen einen Schubs in die richtige Richtung zu geben birgt daher ein überschaubares Risiko gemessen am großen Nutzen, den es für Euer Leben und das des Königs haben wird.«
Die Königin sah Leonora an. Und dann Laforge. »Ihr müsst verstehen, Monsieur, dass ich Euch in dieser Sache großes Vertrauen entgegenbringen muss. Ich übertrage Euch eine der heikelsten Aufgaben, die man sich denken kann, und solltet Ihr auch nur ein Wort darüber verlieren, wäre ich, gelinde gesagt, verloren. Ich habe mich nur deshalb an Euch gewandt, weil Ihr mir von Leonora empfohlen worden seid. Ich hoffe, richtig gehandelt zu haben.«
Laforge zögerte nicht einen Augenblick. Seine Stimme und seine Worte klangen ernst. »Meine Königin, ich kann Eure Besorgnis gut verstehen, doch habt keine Angst. Mich verbindet mit Leonora eine tiefe Freundschaft. Etwas, das stärker ist als Blutsbande. Mein Herz gehört Euch. Tut damit, was Euch gefällt. Sollte ich je ein Wort über das verlieren, was Ihr mir gesagt habt, dann reißt es mir auf der Stelle heraus und werft es den Hunden zum Fraß vor. Von nun an bin ich Euer Eigen. Niemandem sonst werde ich gehorchen. Das schwöre ich Euch, so wahr ich Venezianer bin.«
Die Aufrichtigkeit dieser Worte berührten Maria – so aufrichtig wie sie bei einem Venezianer eben sein konnten. Noch dazu bei einem Spion. Und doch hatte Laforge seinen kleinen Vortrag mit solcher Leidenschaft gehalten, dass sie keinen Zweifel an seiner Glaubwürdigkeit hatte. Und irgendwem musste sie wohl oder übel vertrauen.
»Einverstanden, Monsieur«, sagte sie schließlich. Dann wandte sie sich an die Freundin: »Leonora, seid Ihr so freundlich, unserem gemeinsamen Freund schon einmal die Hälfte des Vereinbarten zu geben?«
Daraufhin überreichte die Galigai einen klimpernden Samtbeutel.
»Bitte sehr, fünfzig Pistolen für Eure Mühen. Weitere fünfzig erhaltet Ihr, sobald die Arbeit getan ist.«
Laforge umschloss den Beutel mit seiner behandschuhten Hand, dann ließ er ihn unter dem Mantel verschwinden.
»Und nun«, beendete die Königin die Unterhaltung, »wird es das Beste sein, wenn ich mit Leonora in den Palast zurückkehre.«
Der Spion nickte.
»Eine Sache noch«, bat Maria. »Wie werden wir erfahren, dass Ihr die Angelegenheit erledigt habt, die wir Euch anvertraut haben?«
»Keine Sorge, meine Königin, ich werde mich melden.«
Und zum ersten Mal seit dem Beginn ihrer Unterredung bemerkte Maria den Beiklang düsterer Entschlossenheit in Laforges Stimme.
Auf dem Weg zur Tür lief ihr ein eiskalter Schauer über den Rücken.
Sie drehte sich nicht noch einmal um.
7
Eine unangenehme Überraschung
Tagelang war Mathieu Laforge, so gut es ging, Henriette d’Entrague überallhin gefolgt. Es war ermüdend und unendlich langweilig, sich mit den Gewohnheiten der verwöhnten und arroganten jungen Edeldame vertraut zu machen, und zwar so sehr, dass er sie mit seinen eigenen Händen hätte erwürgen mögen. Doch durfte er ihr ja kein Haar krümmen. Nicht dass er sie persönlich kennengelernt hätte, denn er hielt gebührenden Abstand zu ihr, aber schon durch die Beobachtung aus der Ferne war zu erkennen, wie schlecht ihr Charakter war.