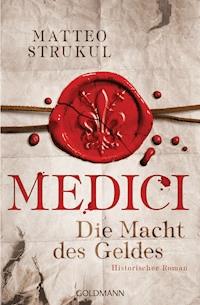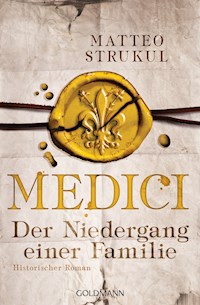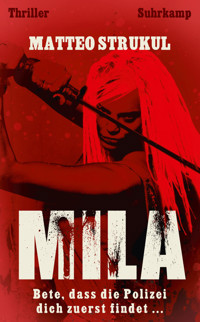9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Medici-Reihe
- Sprache: Deutsch
Morde, Intrigen, Verschwörungen: die Medici und ihr blutiger Weg zur Macht.
Florenz 1469. Die Vorbereitungen für die Heirat zwischen Clarice Orsini und Lorenzo de’ Medici laufen auf Hochtouren. Lorenzos Herz gehört eigentlich Lucrezia Donati. Doch er folgt dem Willen seiner Mutter und heiratet die Tochter einer einflussreichen Familie. Zerrissen zwischen seinem Liebesleben und schwierigen politischen Aufgaben, unterschätzt Lorenzo seine Gegner, die alles daransetzen, ihm die Macht über Florenz zu entreißen. Und so gelingt es Girolamo Riario, dem Neffen von Papst Sixtus IV., eine weitreichende Verschwörung anzustiften. Vor Lorenzos Augen wird sein Bruder Giuliano brutal ermordet. Damit beginnt eine Zeit der Gewalt und der Rache, die noch lange anhalten wird …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 445
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Buch
Florenz 1469. Die Vorbereitungen für die Heirat zwischen Clarice Orsini und Lorenzo de’ Medici laufen auf Hochtouren. Lorenzos Herz gehört eigentlich Lucrezia Donati. Doch er folgt dem Willen seiner Mutter und heiratet die Tochter einer einflussreichen Familie. Zerrissen zwischen seinem Liebesleben und schwierigen politischen Aufgaben unterschätzt Lorenzo seine Gegner, die alles daransetzen, ihm die Macht über Florenz zu entreißen. Und so gelingt es Girolamo Riario, dem Neffen von Papst Sixtus IV., eine weitreichende Verschwörung anzustiften. Vor Lorenzos Augen wird sein Bruder Giuliano brutal ermordet. Damit beginnt eine Zeit der Gewalt und der Rache, die noch lange anhalten wird …
Autor
Matteo Strukul wurde 1973 in Padua geboren. Er hat Jura studiert und in Europäischem Recht promoviert. Er gehört zu den neuen Stimmen der italienischen Literatur und hat sich bisher vor allem als Autor von Thrillern einen Namen gemacht, die für die wichtigen italienischen Literaturpreise nominiert wurden. Strukul lebt mit seiner Frau Silvia abwechselnd in Padua, Berlin und Transsilvanien.
MATTEO STRUKUL
MEDICI
Die Kunst der Intrige
Historischer Roman
Aus dem Italienischen
von Ingrid Exo und Christine Heinzius
Die Originalausgabe erschien 2016
unter dem Titel »Medici. Un uomo al potere«
bei Newton Compton editori, Rom.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Deutsche Erstveröffentlichung Juni 2017
Copyright © der Originalausgabe
© 2016 Newton Compton editori s.r.l.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2017
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur München
Umschlagfoto: gettyimages/De Agostini/A. Dagli Orti
FinePic®, München
Redaktion: Sigrun Zühlke
BH · Herstellung: kw
Satz: omnisatz GmbH, Berlin
ISBN: 978-3-641-21000-7V002
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Für Silvia
Für Leonardo
Februar 1469
1
Das Turnier
Die Luft war kalt. Lorenzo atmete tief ein. Im Sattel seines geliebten Rosses Folgore spürte er die steigende Spannung. Der kohlschwarze Rappe mit dem glänzenden Fell hatte sich von der allgemeinen Nervosität anstecken lassen, scharrte mit den Hufen auf dem Pflaster der Piazza und drehte sich um die eigene Achse. Lorenzo hielt ihn nur mit Mühe unter Kontrolle.
Von den Tribünen und den Holzbänken erhob sich ein Murmeln wie ein Gebet. Von den Balkonen, den Fenstern und den Arkaden erklangen Seufzer. Lorenzos Blick suchte Lucrezia. Die edle Donati trug an diesem Tag ein prächtiges Kleid: Die cioppa, das Überkleid, strahlte indigoblau und erinnerte an Obsidian. Die perlgraue gamurra darunter war mit Juwelen übersät und ließ frech die Silhouette des Busens erahnen. Die Pelzstola aus weißem Fuchs ließ ihre hübschen hellen Schultern frei, und die üppigen schwarzen Locken hatte sie so frisiert, dass sie an dunkle Wellen erinnerten.
Lorenzo fragte sich, ob es ihm heute gelingen würde, ihr Ehre zu erweisen.
Er legte die Hand an den Schal um seinen Hals. Lucrezia hatte ihn mit eigener Hand für ihn genäht. Er sog den Kornblumenduft ein und fühlte sich, als hätte er einen Vorgeschmack auf das Paradies erhalten.
Einen Augenblick wanderten seine Gedanken in die jüngste Vergangenheit zurück: Die Ankunft beim Turnier, sein Bruder Giuliano, prächtig anzusehen in seinem grünen giustacor, und dann die Schar seiner zweihundert Männer in Frühlingsfarben, als wollten sie die kriegerischen Seelen einer Stadt versöhnen, die bis zum Vortag noch tief in Blut und Korruption versunken war. Eine Stadt, die sein Vater, Piero de’ Medici, obwohl gesundheitlich angeschlagen und von der Gicht gequält, mit Anstrengung und bewundernswertem Engagement vor rebellischen Familien gerettet hatte, die gegen die Medici konspirierten und ihnen mehrmals Fallen und Hinterhalte gestellt hatten. Er hatte Lorenzo eine müde Republik hinterlassen, zermürbt und am Rande des Zusammenbruchs, die sich schwertat, wieder zu sich selbst zu finden.
Aber an diesem Tag, weit weg von Blut und Qual, gab es den Tjost, das Turnier zu Ehren der Hochzeit von Lorenzos gutem Freund Braccio Martelli, eine Veranstaltung, die die Unsumme von zehntausend fiorini gekostet hatte und wenigstens für eine Weile alle Ängste und Rachegelüste beseiteschieben würde.
Lorenzo richtete den Blick geradeaus: Er sah die Holzbarriere, die bis zum gegenüberliegenden Ende der Piazza reichte. Und ganz hinten, eingeschlossen in seiner Rüstung, Pier Soderini. Der schmale Helm wirkte durch das bereits heruntergelassene Visier noch bedrohlicher. Der Arm mit der langen Eschenholzlanze war angewinkelt. Die Menge tobte jetzt, im Kessel der Piazza Santa Croce dröhnten die Stimmen ohrenbetäubend.
Lorenzo überprüfte ein letztes Mal seinen Schild. In einer Pfütze sah er die Farben der Medici gespiegelt, sie leuchteten auf der Schabracke seines Pferdes: die fünf roten Kugeln und die sechste mit den Lilien, ein Gnadenzeichen des französischen Königs, ein Symbol des Adels. Die Verantwortung und das Warten trieben ihn fast in den Wahnsinn.
Er schlug das Visier herunter, und die Welt vor ihm verengte sich zu einem eiskalten Streifen. Er legte die Lanze an und gab seinem Pferd die Sporen. Der Hengst sprang sofort los, schneller als ein Windstoß, und galoppierte auf Pier Soderini zu.
Lorenzo spürte die kräftigen Muskeln des Rosses spielen und die mit Schlamm verspritzte Schabracke im Wind wehen. Er zielte mit der Lanze. Soderini war gerade erst angaloppiert, während er bereits knapp die Hälfte der Strecke hinter sich hatte. Er hob den Schild zum besseren Schutz, griff die lange Eschenholzlanze noch fester und wappnete sich für den Aufprall.
Die Menge schien den Atem anzuhalten.
Vom hohen Holzbalkon aus hielt Lucrezia den Blick fest auf Lorenzo geheftet. Sie hatte keine Angst, sie wollte sich diesen Augenblick nur gut einprägen. Sie wusste, wie sehr sich ihr Geliebter auf dieses Turnier vorbereitet hatte, und sie wusste um sein außergewöhnliches Können. Er hatte es bereits demonstriert. Dass er inzwischen Clarice Orsini versprochen war, der römischen Edelfrau, die seine Mutter für ihn ausgewählt hatte, kümmerte sie an diesem Tag nicht, und sie gab sich auch keine Mühe, ihre Leidenschaft für ihn zu verbergen.
Im Übrigen kümmerte es auch Florenz und seine Einwohner nicht, im Gegenteil, sie betrachteten das liebende Paar mit Nachsicht, wenn nicht gar Freude, weil sie es nur schwer hinnehmen konnten, dass der Mann, der einst die Signoria leiten sollte, eine Römerin erwählt hatte, auch wenn dafür seine Mutter verantwortlich war und die Braut dem Adel entstammte.
Aber jetzt war keine Zeit, sich solchen Gedanken hinzugeben. Aus den dampfenden Nüstern der Pferde stieg blauer Dunst in die eisige Luft, die Stahlplatten der Rüstungen glitzerten, Banner und Standarten flatterten in einem Triumph aus Farben.
Und endlich kam der Treffer.
Es war ein krachender Donner, als Holz und Stahl aufeinanderprallten. Lorenzos Lanze fand ihren Weg durch Pier Soderinis Deckung und traf die Brustplatte seiner Rüstung. Das Eschenholz zerbrach, Soderini wurde nach hinten geworfen und aus dem Sattel geschleudert.
Er landete mit großem Getöse auf der Piazza, während Lorenzo bis ans Ende der Bahn galoppierte, wo er Folgore zügelte, der sich wiehernd aufbäumte.
Mit leichter Verspätung erhob sich ein erstaunter Schrei aus der Menge des Volkes, als hätte Folgore mit seiner sprichwörtlichen Geschwindigkeit allen die Zeit geraubt. Gleich darauf brüllte die Menge ihre Begeisterung in Jubelschreien heraus. Die Anhänger der Medici schrien aus voller Kehle, die Männer spendeten tosenden Applaus, und die Frauen lächelten und seufzten.
Lorenzo konnte es kaum fassen. Ihm war noch nicht ganz bewusst, was geschehen war, so schnell war alles passiert.
Pagen und Knappen eilten zu Pier Soderini, um ihm aufzuhelfen. Er war schon fast wieder auf den Beinen und schien nicht schwer verletzt zu sein. Nachdem er den Helm abgenommen hatte, schüttelte er ebenso ärgerlich wie ungläubig den hochroten Kopf: Er war direkt auf die Brust getroffen worden!
Lucrezia legte die Hände ans Herz, und ihr hübsches Gesicht erstrahlte in einem blendenden Lächeln.
Lorenzo legte Helm und die Handschuhe aus Stahl ab, fast unwillkürlich berührte er den Schal. Er nahm ihren Duft wahr, berauschend und leicht und doch voller Versprechen.
Eine glühende Liebe für diese Frau erfüllte ihn, eine Leidenschaft, die er in seinen ungeschickten Sonetten auszudrücken suchte. Viele fanden seine Werke großartig, aber er wusste, dass alle Wörter der Welt dem, was er empfand, nicht gerecht werden konnten.
Er fühlte sich so lebendig. Als sich Lucrezias Blick auf ihn senkte, fühlte er sich gesegnet. Die langen schwarzen Wimpern und diese Augen, die den Schatten einzufangen schienen – es gab nichts Schöneres.
Dem Publikum schien dieses subtile Spiel der Blicke und Gesten aufzufallen, und es spendete einen weiteren Applaus, noch tosender als der erste.
Florenz liebte ihn. Und Lucrezia auch. Sie schenkte ihm nur einen Augenblick, aber Lorenzo ließ sich in diesen einen unendlichen Blick fallen und verstand. Er verstand, dass er immer nur sie lieben würde, auch wenn seine Mutter bereits eine römische Braut für ihn ausgesucht hatte, eine Edelfrau, die der Familie wichtige und nützliche Verbindungen einbringen würde – sein Herz jedoch würde nur einer gehören: Lucrezia.
Während er solchen Gedanken nachhing, verkündete der Herold das Ergebnis des Kampfes.
Mit diesem so klaren Erfolg wurde Lorenzo zum Sieger des Tjosts proklamiert. Adelige Freunde und Würdenträger schienen nichts anderes erwartet zu haben. Braccio Martelli sprang als Erster von der Tribüne, um zu gratulieren. Er lief zu Lorenzo, dem die Knappen jetzt halfen, vom Pferd zu steigen und Brustpanzer und Beinschienen abzulegen, damit er den Beifall, den die Menge ihm spendete, auch entgegennehmen konnte.
Braccio war so froh, dass er begann, seinen Namen zu skandieren.
Die Menge fiel ein.
Giuliano, der jüngere der beiden Medici, lächelte von der höchsten Tribüne. Er war groß und elegant, seine Gesichtszüge zart und vornehm, ganz anders als die kräftigeren und markanteren seines großen Bruders.
Lucrezia entwich ein Schrei der Bewunderung, und als habe sie nicht schon für genug Skandal gesorgt, warf sie ihrem Sieger einen Kuss und ein Taschentuch aus feinstem Leinen zu.
Lorenzo hob das Tuch auf. Der Kornblumenduft nahm ihm fast den Atem. In einer ideellen Umarmung legte sich die Stadt um ihren Lieblingssohn.
Doch eine merkwürdige Gestalt in dieser ganzen feiernden Menge wiegte sich wie die Fühler eines Insekts.
Sie hatte die Figur und die noch unfertigen Gesichtszüge eines Jungen, eines hübschen Jungen noch dazu. Aber etwas an dem Grinsen, das seine schmalen blutroten Lippen umspielte, passte ganz und gar nicht.
Bald schon, dachte dieser schweigende Zuschauer, wird all diese Harmonie in Scherben liegen.
2
Riario
Sein Onkel hatte absolut recht.
Und sein Onkel würde bald Papst werden. Daran gab es keine Zweifel, es war nur eine Frage der Zeit.
Girolamo Riario betrachtete den Jungen. Er hatte tiefblaue Augen und mahagonifarbene Haare. Schmale Lippen malten ein unangenehmes Lächeln auf sein Gesicht. Er hatte das Gefühl, als läge eine perfide Grausamkeit dahinter, kaum verborgen von den scharf geschnittenen vornehmen Zügen.
Er seufzte.
Seine Gedanken kreisten um seinen Plan: Er war noch nicht vollständig ausgearbeitet, mehr eine unsichere Hypothese, gerade erst erdacht und wahrscheinlich schwer umzusetzen. Dennoch verzweifelte er nicht.
Ehrgeiz war das Wichtigste, was ein Mann haben konnte. Und der Junge, der vor ihm stand, hatte reichlich davon. Und zwar von nachgewiesener Ernsthaftigkeit.
Girolamo löste eine lange Haarsträhne. Seine grauen Augen funkelten. Er wusste, dass diese kleine Schlange über eine teuflische Intelligenz verfügte, fast schon zu wagemutig, aber nie leichtfertig war.
»Bist du dir so sicher, wie du behauptest?«
»Ich habe keine Zweifel, Signore«, erwiderte der Junge.
»Und du hast sie gesehen?«
»So wie ich jetzt sehe. Ganz Florenz hat diesen Blicken applaudiert.«
Ach ja! Lorenzo de’ Medicis Liebe zu Lucrezia Donati war sicher kein Geheimnis. Und auch wenn sie ungelegen kam, war sie nicht sonderlich verwerflich. Solange sie nicht öffentlich wurde zumindest. Sein Onkel hätte so etwas ganz sicher nicht geschätzt. Und der Papst wohl ebenfalls nicht. Aber andererseits war es auch nichts Neues, und ein Blick reichte nicht, um jemanden zu exkommunizieren. Außerdem waren Zweckehen vollkommen normal, und dass Lorenzo Liebe für die junge Donati empfand, sei es höfische oder fleischliche, hatte überhaupt nichts zu bedeuten. Ja, seine Stadt unterstützte diese Untreue sogar offen.
Verdammte Florentiner, dachte er.
»Was hast du noch gesehen?«
»Florenz, Signore.«
Girolamo hob eine Augenbraue.
»Florenz?«
»Die Stadt verehrt diesen Mann.«
»Wirklich?«
»Es schmerzt mich, es zuzugeben, aber so ist es.«
Riario seufzte. Noch einmal. Er musste etwas unternehmen. Sicher, doch was? Musste seine vage Idee etwa schon so dringend umgesetzt werden?
»Sprich mit Giovanni de’ Diotisalvi Neroni.«
»Dem Erzbischof von Florenz, Signore?«
»Wem sonst?«
»Natürlich. Aber, wenn ich mir die Frage erlauben darf, wozu?«, fragte er mit seinem typischen Grinsen. Die Frage war allerdings berechtigt. Girolamo hätte ihn umbringen können. Wie konnte er es nur wagen? Andererseits war da immer noch die Neugier. Was sollte er ihm antworten? Er zerbrach sich den Kopf. Dass er auch immer zu viel reden musste! Warum hatte er Giovanni de’ Diotisalvi Neroni erwähnt? Er hatte das gesagt, um eine Inspiration, einen Vorschlag, einen genialen Einfall zu bekommen.
Nichts.
Er spürte so viel Kraft in sich, aber er kannte sich selbst gut genug, um zu wissen, dass er keine brillanten Einfälle hatte. Nicht so, wie er es sich wünschte. Die besten waren stets, nützlich und zum richtigen Zeitpunkt, dem teuflischen Geist dieses Jungen entsprungen.
So oder so, Neroni musste über die Situation Bescheid wissen. Sicherlich besser als er, der er hier zwischen Savona und Treviso darauf wartete, dass sein Onkel den Papstthron bestieg.
»Zumindest wird er die Launen des Adels besser kennen und die Frustration und Wut der Feinde der Medici begreifen.«
Ein klarer Gedanke, perfekt, scharf wie eine Messerklinge.
»Darf ich mir einen Vorschlag erlauben?«, fuhr der teuflische Junge fort.
Riario nickte.
Er wusste nicht, wohin ihn all das Gerede führen würde, aber wenn er einen Plan schmieden könnte, um den Medici aus dem Weg zu räumen, einen perfekten Plan, fehlerfrei, nun, das wäre ein denkwürdiger Moment, denn, ganz ehrlich, genau danach suchte er.
»Ich höre«, ermunterte er ihn.
Der Junge schien sich zu konzentrieren.
»Nun, der Einfall, das Terrain zu sondieren, ist faszinierend, Signore, ich möchte sagen, brillant …«
»Komm auf den Punkt!«, unterbrach Riario ihn.
»Gut. Wenn also, wie Ihr richtig vermutet, Giovanni de’ Diotisalvi Neroni, Erzbischof von Florenz, erkennen kann, welche Familie von denen, die gegen die Medici sind, die mächtigste ist, wäre es womöglich ratsam, genau diese aufzuwiegeln, damit sie eine Verschwörung gegen Lorenzo beginnt, einen verbrecherischen Plan, um ihn und seinen Bruder ins Exil zu jagen. Blutvergießen ist nie eine gute Idee, aber die Verbannung, wie sie schon seinem Großvater Cosimo auferlegt wurde, könnte eine ideale Lösung sein.«
»Bist du sicher?«, fragte Girolamo.
»Überaus. Seht, Signore, Lorenzo ist auf gewisse Weise seine Stadt: Wenn man sie ihm nimmt, nimmt man ihm alle mögliche Macht. Und, seien wir ehrlich, sein Vater Piero ist feige und hat die Familie empfindlich geschwächt. Lorenzo könnte uns Probleme bereiten, aber wenn wir jetzt handeln, wo er noch jung und unerfahren ist, könnten wir leichtes Spiel mit ihm haben, und das könnte einer Familie den Weg öffnen, die auf Eure Forderungen und die Eurer Verbündeten eingeht.«
»Listig, mein junger Freund, listig, aber noch sehr ungenau. Welche Anschuldigungen könnten denn zu der von dir angesprochenen Verbannung führen?«
»Tatsächlich, Signore, könnten es viele Anschuldigungen sein, aber nur eine kann ihn so sehr diskreditieren, dass sie eine Strafe legitimiert.« Der Junge sprach wie ein fähiger Politiker. Allerdings fühlte sich Girolamo in seiner Gegenwart immer etwas unwohl, als hätte er es mit einem Wesen zu tun, das direkt den Lenden einer dämonischen Kreatur entsprungen war.
»Und welche wäre das?« Seine Stimme verriet die ungläubige Ungeduld.
»Hochverrat«, erwiderte der Junge, ohne zu zögern.
Girolamo Riario zog eine Augenbraue hoch.
»Seht, Signore, in Florenz gibt es einen Künstler, der noch nicht berühmt ist, aber sicher ganz außergewöhnlich begabt. Um die Wahrheit zu sagen, ist er auch Ingenieur und Erfinder. Es gibt auf der Welt keinen Mann mit solcher Intelligenz und solchem Geist. Natürlich ist er noch sehr jung, aber er wird schon bald von sich reden machen. Wenn wir zeigen könnten oder noch besser, wenn eine uns verbündete Familie zeigen könnte, dass Lorenzo mit diesem Mann zusammenarbeitet, um eine Waffe zu entwickeln, die so mächtig ist, dass sie für jeden beliebigen Staat tödlich wäre und dass sie eingesetzt werden soll, um die Nachbarreiche zu überfallen, würde das die Stadt Florenz in schlechtem Licht erscheinen lassen, alle würden sie hassen und fürchten … nun, ich glaube, dann wäre es überhaupt kein Problem, die Medici zu stürzen und die Stadt durch eine befreundete Familie zu unserer zu machen. Wir könnten Lorenzo sehr überzeugend des Hochverrats beschuldigen und gleich noch der Ketzerei, wegen eines blinden Vertrauens in Krieg und Wissenschaft, das die von der Kirche gezogenen Grenzen überschreitet.«
An dieser Stelle schwieg der Junge.
Girolamo sah ihn mit vor Erstaunen weit aufgerissenen Augen an.
Dann sagte er: »Wunderbar, wunderbar, mein Junge! Natürlich ist das immer noch ein komplexer Plan voller Unwägbarkeiten, aber genau deswegen werden wir auf jeden Fall weiter darüber nachdenken. Nun geh und kümmere dich um unser Vorhaben. Aber keine Eile. Wir haben Zeit. Meine Partei muss noch zur Macht aufsteigen. Bis dahin suchen wir die Familie aus. Dann werden wir die Elemente zusammenbringen, die es uns erlauben, die Medici zu stürzen. Wenn wir auf dem Höhepunkt unserer Macht sind, schlagen wir zu. Und wir werden es so anstellen, dass die Medici sich nicht mehr von dem Schlag erholen können. Sag deiner Mutter, dass ich die Vorschläge ihres Sohnes sehr zu schätzen weiß. Und um mein Wohlwollen zu besiegeln, bitte ich dich, ein Zeichen meiner ewigen Hochachtung anzunehmen.« Mit diesen Worten nahm Girolamo Riario aus der Schublade eines Mahagonischreibtischs einen violetten Samtbeutel und warf ihn dem Jungen zu.
Ludovico Ricci fing ihn im Flug auf, während ein unverwechselbares silberhelles Klingeln zu hören war.
»Ihr seid sehr großzügig, Signore.«
Dann machte er auf dem Absatz kehrt und ging zur Tür.
»Noch eine letzte Sache, Ludovico.«
Der Junge blieb stehen und drehte sich zu seinem Herrn um.
»Wie heißt der Mann, von dessen Genie du mir erzählt hast?«
»Leonardo da Vinci«, antwortete der junge Ricci.
3
Lucrezia und Lorenzo
Sie hat große Augen und einen starken Charakter. Ich glaube, sie wird dir gefallen und all deinen Wünschen entsprechen, lieber Sohn. Noch wichtiger ist, dass sie dir Verbündete und Freundschaften einträgt, die dir bisher verschlossen waren, und Gott weiß, wie sehr unsere Familie diese braucht.« Seine Mutter, Lucrezia Tornabuoni, sprudelte vor Lob für Clarice nur so über, als sei sie die Botin eines neuen Lebens in Florenz.
Aber Lorenzo war nicht überzeugt. Kein bisschen. Sicher, er verstand die Staatsräson, er war nicht naiv, doch was man ihm über seine Zukünftige erzählte, fand er überhaupt nicht verlockend. Sie klang wie eine fromme, kleinliche, vorsichtige Frau, Tugenden, die sicherlich nicht zu verachten waren, ihn aber nicht interessierten. Wie sollten sie einander verstehen?
Er versuchte, seiner Mutter dies zumindest ein bisschen verständlich zu machen. Er tat es mit aller ihm zur Verfügung stehenden Diplomatie und Höflichkeit.
»Mutter, natürlich erfreut es mich, was Ihr sagt, und ich bin Euch unendlich dankbar für alles, was Ihr getan habt, aber ich frage mich, ob Ihr glaubt, dass Clarice auch über so etwas wie einen lebhaften Verstand verfügt und die Anmut, die so vielen jungen Frauen ihres Alters eigen ist …«
Lucrezia war eine vornehme Frau, aber kalt. Ihre Gesichtszüge verfügten über eine gefasste Härte, die, wenn es nötig war, undurchdringlich sein konnte. Sie bedachte ihren Sohn mit einem eisigen Blick.
»Mein lieber Lorenzo, ich möchte jetzt ein für alle Mal sprechen und danach nicht wieder darauf zurückkommen. Ich weiß von deiner merkwürdigen Schwärmerei für Lucrezia Donati. Ich sage nicht, dass das Mädchen keinen Blick wert wäre, aber eines ist klar: Es muss aufhören. Und zwar schnell. Ich kenne dein Temperament und, schlimmer noch, ich kenne ihres. Dieses Mädchen hat Feuer, aber sie wird dir kein Glück bringen, das kannst du mir glauben. Ganz abgesehen davon, dass du dir ab heute keine Zerstreuung mehr leisten kannst. Clarice kommt aus Rom, und sie ist eine Orsini. Wir sprechen hier von einer der nobelsten Familien überhaupt, und das allein macht sie bereits unwiderstehlich. Ich weiß, dass Florenz etwas Zeit brauchen wird, um sie zu akzeptieren, aber wenn du damit beginnst, wird sich der Rest von selbst ergeben. Ich will keinerlei Geschichten in dieser Hinsicht. Natürlich wirst du zu gegebener Zeit auch darüber nachdenken können, dir etwas Abwechslung zu gönnen, das weiß niemand besser als ich, die ich schließlich selbst die Tochter einer anderen Frau in unsere Familie aufgenommen und deinem Vater verziehen habe. Aber eines darfst du nie vergessen: Dein Vater leidet unter einer schwachen Gesundheit und einer Krankheit, durch die er nicht mehr der sein kann, der er einmal war. Jetzt ist deine Zeit gekommen, und du darfst nicht einmal daran denken, die Führung der Republik abzulehnen. Und die Herrschaft über Florenz bekommst du über die Ehe mit Clarice Orsini. Je eher du dich damit abfindest, desto besser für uns alle.«
Lorenzo verstand die Gründe seiner Mutter nur zu gut, und er wusste um die tausend Probleme und die vielen Fallstricke, die sie hatte überwinden müssen, erst in Rom, dann in Florenz, um zu der Übereinkunft zwischen den Medici und den Orsini zu gelangen, mit der die Medici die Standesgrenzen überschreiten und in den hauptstädtischen Adel aufsteigen würden. Und dennoch war Lucrezia Donatis Sinnlichkeit, ihre Blicke, ihre Figur, die Art, sich zu kleiden und zu gehen, ja, einfach alles an ihr, pure Faszination, reine Verführung, versprach Geheimnis und Abenteuer. Und genau das brauchte er, um sich lebendig zu fühlen, begehrt, unbesiegbar. Aber er wusste, dass seine Mutter nichts hören wollte.
»Ich werde vernünftig sein, und Ihr werdet stolz auf mich sein«, sagte er. »Ich werde mich vor unseren Feinden in Acht nehmen und mich getreulich an das halten, was mein Vater und vor ihm mein Großvater mich gelehrt haben, also das rechte Maß zu wahren, in dem Würde und Einigkeit wurzeln. Aber niemand wird je von mir verlangen können, Lucrezia Donati zu vergessen.«
Seine Mutter seufzte. Sie schaute ihrem Sohn noch einmal in die Augen.
»Mein einziger Schatz, ich verstehe, und glaube mir, ich möchte dein Glück. Ich bin froh, dich das sagen zu hören, und es verlangt auch niemand von dir, deine Lucrezia zu vergessen. Aber bereite dich darauf vor, Clarice Orsini als deine Frau zu ehren, denn das Schicksal von Florenz ist an sie gebunden. Und ich gehe sogar noch weiter, bemühe dich darum, dass die Stadt sie ebenfalls so aufnimmt, wie sie es verdient. Ich fürchte, diese trotzige und kalte Brise, die ihr derzeit entgegenweht, ist die Frucht deines unbesonnenen Verhaltens. Versuche daher, unsere Leute zu besänftigen und sie dazu zu bringen, sie wie eine Königin zu feiern. Sie wird deine Frau sein, und genauso musst du sie behandeln. Eine Allianz zwischen Rom und Florenz ist umso notwendiger, als, auch wenn der gute Papst Paul II. unserer Partei sicherlich wohlgesinnt ist, das nicht heißt, dass sein Nachfolger es ebenfalls sein wird. Wir müssen uns wappnen. Aber mit der Familie Orsini auf unserer Seite haben wir vielleicht – und ich sage vielleicht – bessere Aussichten auch für den Fall, dass der neu gewählte Papst, wann auch immer das sein wird, uns nicht sonderlich gewogen sein sollte. Verstehst du mich?«
»Natürlich verstehe ich«, erwiderte Lorenzo leicht pikiert. »Ich weiß sehr gut, dass Pius II. Filippo de’ Medicis Nominierung zum Erzbischof von Pisa betrieben hat und dass dies nur dank des Drucks von Großvater Cosimo möglich wurde. Genauso bezweifle ich nicht, dass der derzeitige Erzbischof von Florenz gegen uns eingestellt ist … Das wurde zur Genüge bewiesen. Schließlich war ich es ja, der das Attentat auf der Straße von Careggi verhindert hat. Erinnert Ihr Euch?«
Lucrezia nickte.
»Und es war wieder der Erzbischof von Florenz, der hinter diesem feindseligen Akt steckte. Es ist nicht zu leugnen, dass er bloß auf einen Skandal wartet, um mich zu kreuzigen …« Lorenzo hielt einen Augenblick inne. Dann fuhr er fort: »Hört, Mutter, ich möchte, dass eines klar ist: Ihr müsst Euch keine Sorgen über mein Benehmen machen. Ich werde ein beispielhafter Ehemann und ein aufmerksamer Bräutigam sein, aber bittet mich nicht darum, sie zu lieben. Das werde ich nicht können. Jedenfalls nicht sofort. Aber ich kenne meine Pflichten und hege keinerlei Zweifel daran, wie erbarmungslos meine Feinde sind. Andererseits glaube ich, einen gewissen Einfluss auf die Leute zu haben. Beim Turnier zu Braccio Martellis Ehren hatte ich den Eindruck, dass Plebs, Volk und sogar ein Teil des Adels auf meiner Seite waren. Kurz, ich will mich nicht selbst verleugnen. In mir lodert ein Feuer, das, wenn es gut geschührt wird, unserer Familie nützlich sein kann, das müsst Ihr mir wenigstens zugestehen.«
»Umarme mich«, sagte Lucrezia, »und glaube keinen Augenblick, dass du mich enttäuscht hättest. Was ich gesagt habe, sollte dir nur helfen, und ich habe es nur gesagt, weil ich dich sehr schätze, so sehr, dass ich glaube, dass du, mein Sohn, und nur du die Medici zu dem Ruhm führen kannst, der ihnen zusteht, indem du das Werk deines Vaters und noch mehr das deines Großvaters Cosimo, der dich so sehr geliebt hat, fortführst.«
»Er fehlt mir sehr«, schloss Lorenzo. Er ging auf seine Mutter zu, die sich aus dem Sessel erhoben hatte, und umarmte sie beinahe so leidenschaftlich wie eine Geliebte.
4
Leonardo
Leonardo sog die frische Luft dieses Februarmorgens ein.
Die langen blonden Haare vom Wind zerzaust, schaute er auf die braunen Felder, die mit glitzernden Raureifflecken bedeckt waren.
Die Natur verfügte über so außergewöhnliche Macht, dass es ihm jedes Mal den Atem verschlug, wenn er deren Zeuge wurde.
Er fühlte sich so klein, unbedeutend, empfand Staunen und Dankbarkeit für das, was die Welt ihm anscheinend jeden Tag schenkte.
Und doch schien all das den Menschen egal.
Sogar er selbst hatte für den Krieg gearbeitet, diese unsinnige und grausame Fehde, die die Menschen im Namen eines beschämenden Ziels gegeneinander aufhetzte: der Eroberung von Macht und Land. Wo doch im Verweigern der Freiheit für alle nur eines lag: Scham.
Aus diesem Grund hatte er beschlossen, für Lorenzo de’ Medici zu arbeiten, der ihm schon seit einiger Zeit den Eindruck eines klugen und willensstarken, aber nicht tyrannischen oder kriegslüsternen Mannes machte. Gleich zu Beginn ihrer Zusammenarbeit hatte Lorenzo ihn aufgefordert, im Dienst der Medici sein Wissen zu erweitern und seine Experimente zu verfeinern, um Kriegsmaschinen zu konstruieren. Allerdings sollten sie ausschließlich der Verteidigung dienen. Niemals würde er seine Waffen dazu verwenden, eine andere Stadt anzugreifen, hatte er gesagt. Lorenzo folgte den Lehren seines Großvaters und Vaters und war davon überzeugt, dass die Zukunft von Florenz in Frieden und Wohlstand lag, in Kunst und Literatur, aber ganz sicher nicht im Krieg.
Unter diesen Voraussetzungen hatte Leonardo akzeptiert, seine Arbeit in den Dienst der Medici zu stellen. Er war in der Werkstatt von Andrea Verrocchio geblieben, weil er noch viel zu lernen hatte, ganz besonders in dem Bereich, der im Moment seine größte Leidenschaft war: die Malerei. Doch dank seiner Einfälle zur Kriegsmaschinerie erhielt er monatlich hundert fiorini und konnte so in größter Ruhe leben und, um bei der Wahrheit zu bleiben, auch noch etwas beiseitelegen, um sich eines Tages ein eigenes Atelier leisten zu können.
Während er an diesem Morgen so nachdachte, erblickte er Lorenzo, der sich mit seinem Wachtrupp näherte. Die Pferde galoppierten auf der unbefestigten Straße und hatten schon bald die Hügelkuppe erreicht, genau die Stelle, an der er unter Zypressen stand und die gepflügten Felder und die unsichtbaren Winde betrachtete, die scharf und kalt wehten.
Einmal angekommen stieg Lorenzo elegant vom Pferd. Er trug ein prächtiges dunkelgrünes Wams und einen Mantel in derselben Farbe. Seine markanten Gesichtszüge verliehen seinem Blick eine außergewöhnliche Entschlossenheit, die jede seiner Handlungen mit einzigartiger Vitalität zu erfüllen schien.
Er drückte ihm mit einer ansteckenden Kraft und Dankbarkeit die Hand. Leonardo spürte die gewohnte und lebendige Freundschaft und eine fast entwaffnende Aufrichtigkeit. Er täte gut daran, einen solchen Mann nicht zu enttäuschen, dachte er. Aber er war zuversichtlich, denn an diesem Tage hatte er eine schöne, große Überraschung für ihn.
»Mein Freund«, sagte Lorenzo, »Euch zu sehen bereitet mir immer große Freude, weil ich dann stets das deutliche Gefühl habe, bald Zeuge eines Wunders zu werden.«
»Nun übertreibt es nicht, Messere, Ihr seid zu großzügig, und überhaupt müssen wir erst noch sehen, ob das, was ich für Euch vorbereitet habe, Euch tatsächlich überraschen kann.«
»Daran habe ich keinerlei Zweifel.«
Während Medicis Männer von ihren Pferden stiegen, begann Leonardo, seine Erfindung zu erläutern.
»Mein großer Herr«, fing er an, »wie Ihr seht, habe ich in den letzten Tagen einige Strohmänner gebaut, um die folgende Simulation besonders eindrücklich zu machen«, und während er das sagte, deutete er auf einige Vogelscheuchen, die ein paar Hundert Schritte von ihnen entfernt standen.
»Ihr stimmt mir sicher zu, dass einer der wichtigsten Männer jeder Armee der Armbrustschütze ist. Wir erinnern uns alle daran, wie die Schlacht von Anghiari gewonnen wurde. Ohne die großartigen genuesischen Armbrustschützen, die von den Abhängen der Hügel aus Astorre Manfredis Armee an der Flanke angegriffen und vernichtet haben, stünden wir heute vielleicht nicht einmal hier.« Er ließ die Worte wirken. Er war ein fähiger Redner, wusste, wie wichtig Pausen sind, und war theatralisch genug, um eine Entdeckung oder eine Erfindung aufs Beste zu präsentieren. Die Vorstellung wurde stets genauso gut vorbereitet wie das Werk selbst. Er musste Neugier und Aufmerksamkeit wecken, der Erzählung den richtigen Rhythmus geben. Er fuhr fort: »Wir wissen auf jeden Fall, dass die Armbrust eine alte Waffe ist, die, wo möglich, die Reichweite und die Kraft des Bogens übertreffen sollte, dessen Weiterentwicklung sie ja auch ist. Sie zeichnet sich vor allem durch Effizienz aus, zusätzlich zu Kraft und Präzision.«
Mit diesen Worten war Leonardo auf einen Tisch zugegangen, den er hatte bringen lassen, und mit einer etwas theatralischen Geste zog er ein graues Leintuch fort und enthüllte einige Armbrüste aus glänzendem Holz.
»Wir sprechen also von einer ausgeklügelten und strategischen Waffe. Andererseits verliert sie ihre Genauigkeit, seit immer kräftigere Modelle gebaut werden, und das Nachladen wird so kompliziert, dass es ihre Effizienz einschränkt. Die Einführung von Stahlbogen hat sicher die Leistung gesteigert, aber auch unbestreitbare Probleme in der Handhabung verursacht. Die Bogen sind inzwischen so schwer zu spannen, dass der Schütze die Sehne nicht mehr allein spannen kann, nicht einmal mit beiden Händen, weshalb man Hebel, Winden oder Flaschenzüge benötigt. Völlig verrückt, denn das bedeutet einen dramatischen Zeitverlust und setzt den Schützen nicht zuletzt ständiger Lebensgefahr aus.«
»Ganz zu schweigen davon«, warf Lorenzo ein, »dass alle zusätzlichen Gerätschaften, die der Armbrustschütze mit sich tragen muss, seine Beweglichkeit einschränken.«
»Genau. Ich ergänze noch, dass es einfach nicht sein darf, so viel wertvolle Zeit beim Nachladen verlieren zu müssen.«
Leonardo machte noch eine Pause, seine Zuhörer warteten auf seine Erklärung, jetzt stieß er zum Kern der Sache vor.
»Aus diesem Grund möchte ich Euch ans Herz legen, was ich ›schnelle Armbrust‹ nenne, eine Armbrust, bei der das Spannen viel schneller geht. Wie Ihr sehen könnt, ist die Säule zweigeteilt. Die untere, von einem robusten Scharnier gehalten, lässt sich leicht öffnen …« Leonardo nahm eine der Armbrüste vom Tisch und klappte in einer fließenden Bewegung die Hauptsäule in zwei Teile auseinander. »Und durch ein Hebelsystem im Inneren nähert sich die Nuss der Sehne im Ruhezustand, um sie zu packen und gleitend zu spannen.«
In diesem Moment hörte man ein Schnappen, und Lorenzo und seine Männer sahen mit großem Erstaunen, wie die Sehne bereits perfekt gespannt und bereit war, einen Bolzen abzuschießen.
Ohne weitere Zeit zu verlieren, legte Leonardo einen Bolzen ein und zielte mit der Waffe auf einen der Strohmänner.
Er drückte den Abzug, und der Bolzen schoss los, pfiff durch die Luft und bohrte sich mit einem düsteren, todbringenden Zischen in den Kopf des Strohmannes.
Lorenzo konnte eine begeisterte Bewegung nicht unterdrücken. Die Wachen, die bei ihm geblieben waren, standen mit offenem Mund da. Das gesamte Spannen und Laden des Bolzens hatte nur wenige Augenblicke gedauert, und während sie noch auf die getroffene Vogelscheuche starrten, hatte Leonardo die Waffe bereits erneut geladen und schoss einen weiteren Bolzen ab.
Noch ein Pfeifen und noch ein Kopf, der vom Bolzen durchbohrt wurde.
»Erstaunlich!«, kommentierte Lorenzo begeistert, er konnte der Faszination dieser unglaublichen Armbrust nicht widerstehen und nahm eine vom Tisch.
Er klappte die Hauptsäule auseinander und wieder zusammen, lud die Waffe, ohne die Sehne auch nur zu berühren und ohne irgendein Hilfsmittel zu benutzen, es war einfach unfassbar.
»Auf diese Weise gelingt das Laden sehr schnell, findet Ihr nicht, Signore?«, fragte Leonardo.
Zur Antwort traf Lorenzos Bolzen den dritten Strohmann in Höhe des Herzens.
»Gut gemacht, Signore!«, rief der Kommandant der Wachen aus, die Lorenzo bei diesem Morgenritt begleitet hatten.
»Hervorragend, Leonardo«, verkündete der junge Medici, »Ihr seid ein Genie und der Stolz unserer Stadt! Eure Erfindung macht aus einer Armbrust nicht nur eine kraftvolle und schnelle Waffe, sondern auch eine der effizientesten und gefährlichsten.«
»Perfekt für eine wirkungsvolle Verteidigung im Fall eines Angriffs«, betonte Leonardo, und ein dunkler Schatten glitt über seine blauen Augen.
Es war nur ein Augenblick, aber Lorenzo sah es deutlich.
»Sicher, mein Freund, aber ich nehme meine Versprechen ernst. Wir werden sie nur zur Verteidigung gegen eventuelle Überfälle unserer Feinde einsetzen.«
Leonardo nickte. Er hatte hören müssen, wie Lorenzo es aussprach.
Sicher, Worte waren Schall und Rauch, aber die Worte eines Mannes wie Lorenzo konnten die Erde erbeben lassen. Leonardo wusste es nur zu gut und war ihm noch dankbarer, weil er sicher war, dass er trotz seines jugendlichen Alters weder seinem Temperament, über das er mit Sicherheit verfügte, noch dem für sein Alter typischen Ungestüm erlauben würde, den Verlockungen der Gewalt oder der Aggressivität nachzugeben.
Er lächelte und dachte daran, dass er nicht älter war, sogar ein paar Jahre jünger als Lorenzo, aber ihn hatten Krieg, Konflikt und das Schlachtfeld nie interessiert. Er wusste sich zu verteidigen, wenn es nötig war, aber sich zu schlagen gehörte nicht zu seinen Prioritäten, er fand es sogar so dumm und unnütz, dass er nicht einmal begriff, wieso die Herrscher der Nachbarstaaten das nicht verstanden.
Und es gab viele: Florenz, Imola, Forlì, Ferrara, Mailand, Modena, Rom, Neapel, Venedig … all diese Reiche sahen im Krieg und im Konflikt ein unverzichtbares Mittel, um die eigene Existenz zu sichern. Es schien fast, als hätten sie ein verzweifeltes Bedürfnis nach Konflikten, um sich selbst zu verewigen.
Er schüttelte den Kopf.
Da war es schon wieder passiert, er war in seinen Gedanken versunken. Aber gerade als er zu sich zurückgekehrt war, umarmte Lorenzo ihn und bedankte sich.
»Leonardo«, sagte er ihm, »unsere Freundschaft und Zusammenarbeit ehrt mich und feiert jeden Tag den Ruhm von Florenz. Ihr werdet für Eure unschätzbaren Dienste belohnt werden. Jetzt lade ich Euch ein, mit mir in die Stadt zurückzukommen. Meine Männer werden sich darum kümmern, Eure Gerätschaften zu transportieren, wenn Ihr so großzügig seid und mit meinen Ingenieuren darüber sprecht, werde ich bei Euch mindestens zweihundert dieser unglaublichen Armbrüste bestellen.«
»Nehmt diese von mir«, erwiderte Leonardo und reichte ihm eine, »es ist die beste und schönste von allen, die ich bisher gebaut habe.«
»Besser geht es nicht«, rief Lorenzo aus, und seine Stimme verriet, wie stolz und glücklich er über die Gabe war. »Doch jetzt kommt mit mir in die Stadt zurück, wir müssen über etwas sprechen, das mir sehr wichtig ist und das Euch, wie ich glaube, Freude machen wird.«
»Was ist es?«
»Das werde ich Euch zu gegebener Zeit erklären. Vertraut mir.«
5
Lucrezia Donati
Lorenzo hatte sich in der onyxschwarzen, nach Minze und Brennnesseln duftenden Lockenflut verloren. Lucrezia war eine Frau von so großer Schönheit, dass sie praktisch alles andere auf der Welt überstrahlte.
Er hörte die Glut im Kamin knistern, purpurne Flocken erhoben sich wie eifrige rote Glühwürmchen.
Lucrezia sah ihn mit wilden Augen an. Schwarze funkelnde Iriden trafen ihn bis ins Innerste und raubten ihm das Herz. Er konnte den Blick nicht von ihr reißen. Sie war nicht bloß schön, sie hatte einen besonderen Reiz, ähnlich der Natur selbst, eine geheimnisvolle, ererbte, unauslöschliche Faszination, die ihn fesselte.
Lucrezia legte den Kopf in den Nacken, bog den Rücken, die großen, vollen Brüste im eisernen Licht der Kerzen. Ihre Hüfte bot ihm eine erhabene Lehne. Lorenzo versank immer tiefer im Strudel des Vergnügens, bis er jegliches Gefühl für Raum und Zeit verlor, bis nichts mehr wichtig war.
In dieser wilden Leidenschaft lag eine Kraft, die innerhalb eines Augenblicks jedes Bedürfnis und jedes Verlangen jenseits des puren Vergnügens aufzulösen vermochte.
Er versank in ihrem Geschlecht und ließ sich mitreißen.
Lucrezia keuchte vor Vergnügen, während sie ihn ritt, sein Glied bereit, sie zu überfluten.
Schließlich gab sie sich einem Schrei hin, warf die Arme auf seine Brust, zerkratzte ihm die Brustwarzen und kam gemeinsam mit ihm in einem gewaltigen Orgasmus, der sie zu zerreißen schien.
Lorenzo ließ sich nach hinten fallen. Lucrezia legte sich langsam auf ihn. Ihre Brüste auf seiner Brust, ihre Arme auf Lorenzos: Für einen Augenblick schien sich das Zimmer zu drehen, während ein mitreißendes Gefühlskarussell ihm den Geist verwirbelte.
Sie schwiegen, verloren in dieser Umarmung, am liebsten wollten sie für immer so bleiben, verzaubert und beschützt von dieser Liebe, weit weg vom Lärm einer Welt, die ihrer Leidenschaft nichts zugestehen wollte.
Deswegen weinte Lucrezia. Die Tränen fielen aus ihren Augen und befeuchteten Lorenzos Gesicht. Und er musste nicht einmal fragen, warum. Nach und nach, während die Konturen der Gegenstände und die Grenzen der Wände, der Decke und die Geometrie des alltäglichen Lebens wiederauftauchten, wurde ihm die Ungerechtigkeit nur allzu deutlich, die darin lag, dass ihm diese Gefühle verweigert werden sollten.
Und nachdem sie gewartet und geschwiegen hatte, sprach Lucrezia, vielleicht weil sie ihre Stimme hören wollte, vielleicht weil sie ein fassbares Zeichen dessen brauchte, was sie gerade erlebt hatten. Als könnte ein Wort ein Schutzbrief sein, um zu beweisen, dass ihr Gefühl auch in der wirklichen Welt überleben würde.
Sie verlangte es.
»Schwöre, dass du nur mich lieben wirst«, sagte sie zu ihm.
»Das schwöre ich.«
Darüber musste Lorenzo nicht nachdenken. Mit Lucrezia war alles so einfach und wunderbar. Sie wusste genau, was er sich wünschte. Es konnte keine andere wie sie geben, unmöglich. Er empfand für sie dieselbe Hingabe und Dankbarkeit wie für den nächtlichen Sternenglanz. Sicher, eine so offensichtliche, fast unverschämte Liebe, machte ihm Angst. Aber diese Angst war ein Luxus, den er sich leisten konnte und wollte. Wenn der Moment gekommen war, würde er sich entsprechend verhalten. Er würde Lucrezia beschützen, das war sicher.
Das war das Einzige, was ihm wichtig war.
»Auch wenn Clarice hier ist?«, fragte sie.
»Ich schwöre es«, wiederholte er.
»Und wirst du mich auch noch lieben, wenn ich alt bin, weiße Haare und eine Haut wie Pergament habe?«
»Auch dann noch und sogar noch stärker.«
»Und wirst du bereit sein, mich zu verteidigen, falls nötig?«
»Das werde ich.«
»Mehr verlange ich nicht, Lorenzo. Und doch weiß ich sicher, dass es nicht so kommen wird. Jetzt schwörst und versprichst du, aber wer weiß, wie die Zeit dich verändern wird. Wer weiß, zu wem du werden wirst. Jetzt erscheint dir dieses Zimmer wie das Paradies, aber bald schon wird es zu eng und kahl sein und ich nur noch eine der Frauen, die du gehabt hast. Das weiß ich wohl.«
Er nahm ihr Gesicht in seine Hände. »Sag so etwas nicht mal im Scherz.«
Lucrezias Lippen verzogen sich zu einem bitteren Lächeln.
»Du bist zum Herrscher von Florenz bestimmt, Lorenzo. Schon bald wird dir die Stadt zu Füßen liegen. Mehr als jetzt schon. Du wirst dich der Macht stellen müssen, der wahren, der dreckigen, die Schmerz und Tod gebiert, du wirst dich mit gnadenlosen Feinden auseinandersetzen und Kompromisse für das Wohl deines Volkes und deines Landes machen müssen. Und was wird dich an mich erinnern, wenn dein Herz schwer und deine Hände schmutzig vom Blut sind? Wenn der Krieg dein einziger Gedanke sein wird, weil du keinen anderen Weg findest, das, woran du glaubst, gegen die gemeinen Angriffe kleiner Männer zu verteidigen, die der Gier und der Plünderung anhängen?«
»Mir wird deine Liebe bleiben«, erwiderte er. Er sagte es, ohne zu zögern, weil er fest an die Kraft dieses Gefühls glaubte, weil er wusste, dass es auf die eine oder andere Art niemals enden würde. »Wir haben so viel damit zu tun, der Stimme des Tages zuzuhören, die uns dazu auffordert zu vergessen, was wir hatten. Und was wir hatten, ist nicht wenig. Zu oft erlauben wir der Gegenwart, die Vergangenheit zu verbergen und mit ihr das, was uns dazu angetrieben hat, besser werden zu wollen. Ich werde deine Liebe im Schrein meiner Seele aufbewahren. Und ich werde niemandem gestatten, sie zu sehen. Sie gehört nur mir, und ich werde sie wiegen wie einen Säugling: an festlichen wie an schmerzlichen Tagen. Und diese Liebe wird mir Kraft und Qual, Freude und Bitterkeit sein, aber sie wird lebendig und unvergesslich sein.«
Sie hob den Kopf. Die Tränen fielen nicht mehr.
»Wie schön deine Worte sind«, sagte sie. »Es wäre traumhaft, wenn das, was du sagst, auch tatsächlich geschehen könnte.«
»Das liegt an uns, Lucrezia, und an niemand anderem. Was auch geschehen mag, wir müssen unerschütterlich in unseren Prinzipien und in unserem Gefühl bleiben. Wenn wir das schaffen, wird unsere Liebe am Leben bleiben. Wenn wir sie verlieren, wird es unsere Schuld sein, aber dann werden wir sie zumindest einmal gehabt haben. Und schon dafür bin ich dem Leben dankbar.«
Lucrezia sah ihm in die Augen. Sie waren dunkel, aber ein Licht ließ sie leuchten.
Dann weinte sie.
Denn sie wusste, dass das, was zu schön ist, nicht für immer andauern kann.
April 1469
6
Die Musik
Die Tafeln waren reich gedeckt. Die Tischdiener wachten über sie und achteten darauf, dass die Speisen immer appetitlich und im Überfluss angeboten wurden: Truchsess, Mundschenk, Vorschneider und Brotmeister hatten viel zu tun, sie tranchierten rotes und weißes Fleisch, kredenzten Weine und füllten Kelche, legten ansehnliche Scheiben von Pasteten und Aufläufen auf Platten oder präsentierten die vielen Früchte, die die Gaumen der Gäste kitzelten, in einem Wirbel von Düften und Geschmäcken. Alles, ganz zu schweigen von den Süßigkeiten, den gefüllten Kuchen, dem bunten Durcheinander kandierter Früchte, die Lorenzo extra für seine Mutter hatte herstellen lassen, kam von den besten Zuckerbäckern von Florenz.
Zu den Gästen auf diesem Fest, einem von vielen, das Lorenzo im Palazzo der Medici in der Via Larga gab, gehörten einige der besten Geister und dicksten Geldbörsen von Florenz.
Zu Ersteren zählte sicherlich Marsilio Ficino, der an diesem Tag, wie so häufig, ein rotes Gewand trug. Er war nicht sonderlich groß. Dünn, aber zäh, verkörperte er die Klarheit des Intellekts und das Gleichgewicht eines Mannes, der sich ganz der Liebe zur Wissenschaft widmete. Er konnte sich zahlreicher Verdienste rühmen, darunter auch Übersetzungen, die gelinde gesagt für den gesamten Westen grundlegend waren, darunter Texte von Hermes Trismegistos und Platon.
Zu Letzteren dagegen zählte Francesco de’ Pazzi, weil seine Familie vielleicht diejenige war, die derzeit in Florenz am schnellsten aufstieg und keine Hindernisse zu kennen schien. Er trug schwarzen Samt, seine Lieblingsfarbe. Seine Arroganz war die des Reichtums, gepaart mit einem äußerst reizbaren Temperament. Er legte eine fast übersteigerte Entschlossenheit an den Tag, war stets bereit, auf eine Provokation zu reagieren, selbst wenn er sie nur vermutete. Doch seine anmaßende, übertriebene Art, die beinahe schon vulgäre Züge trug, ließ, besser als in tausend Gesprächen möglich, in gewalttätigen Blitzen jenes Gewitter durchscheinen, das sich am Himmel über Florenz zusammenbraute.
Lorenzo und Giuliano fürchteten die Pazzi sicher nicht. Mitglieder einer reichen Familie, sicher klug, auch mit ausreichend Glück gesegnet, doch sie hielten sich stets im Hintergrund, wenn auch einem vergoldeten, und würden niemals in den Vordergrund treten.
Andererseits machte Francesco, der sich zwar hütete, seinen Tatendrang und seinen Aufstiegswillen zu zeigen, kein Hehl daraus, dass ihm der Hausherr nicht besonders sympathisch war. Seine finsteren Augen, von einem kräftigen tintigen Schwarz, blickten hektisch von einem Salon zum anderen, als könnten sie allein mit Blicken nützliche Informationen aufnehmen, die sich gegen Lorenzo und Giuliano verwenden ließen.
Die Säle des Palazzo Medici waren also voller Edelmänner und -frauen, die allesamt damit beschäftigt waren, ihre Macht oder Schönheit, je nachdem, herauszustellen, und dennoch schienen plötzlich jedes Gesicht, jedes Gewand, jedes Licht zu verlöschen und sich aufzulösen, als eine zuckersüße Musik an Lorenzos Ohr drang, die ihn entzückte.
Wie ein mitreißender Wasserfall aus Honig, der säuselte und ihn lockte, ihm Willen und Aufmerksamkeit raubte. Ihm stockte kurz der Atem, ganz benommen von diesem Strom aus Tönen. Mit einem Mal war ihm, als schwebte er in einer unbekannten Dimension, als wäre praktisch alles um ihn herum – Dekoration, Salons, Gäste – ausgelöscht.
Lorenzo schloss die Augen und lauschte. Zunächst fragte er sich nicht, woher diese wunderbare Melodie kam. Gut gespielte Musik zu hören war ein Vergnügen, das er nur selten genoss und das er sich zumindest dieses Mal nicht versagen wollte.
Zu oft hatte er mit Worten und seiner Stimme auszudrücken versucht, was er empfand, die Gefühle zu beherrschen, aber es war ihm nie so gelungen, wie er es anstrebte.
Es war, als versuche er, mit seinen Händen Eis zu gestalten, und als kämen Linien und Kanten heraus, die so gar nicht dem entsprachen, was er in der Seele hatte. Aus diesem Grund erschienen ihm seine Sonette verstümmelt, ein deformiertes und verkehrtes Bild dessen, was er im Herzen trug.
Ebenso wie Worte niemals einer solchen Musik gerecht werden konnten.
Er roch den Duft von Kornblumen. Dieses liebliche Aroma kannte er gut.
Er spürte, wie ihm die Tränen kamen.
Es war stärker als er: Er hatte keine Erklärung für das, was geschah. Aber es war ihm auch egal: Es war so schön, nicht erklären zu müssen, nicht verstehen zu müssen.
Die Töne stiegen, dann fielen sie, wie eine schwingende Schaukel, die die Gefühle in unbekannte Höhen emporhob.
Die Musik spielte weiter, erst schnell und jagend, dann weicher, fast geschmeidig. Lorenzo verspürte ihre aufwühlende, unwiderstehliche Sinnlichkeit. Die Saiten der Laute wurden so leicht gezupft, dass es klang, als spielten sie von selbst.
Für einen Augenblick schien sich die Musik aufzulösen. Eine Pause. Dann setzte sie erneut ein, dieses Mal traurig, bitter, voll von einer leisen, diskreten Melancholie, einer Melancholie, die etwas über die Musikerin verriet. Denn in diesem Moment war Lorenzo sich sicher, dass es sich um eine Frau handelte.
Er kostete die Augenblicke aus, genoss sie wie süße Tropfen eines Likörs mit unwiderstehlichem Aroma, einen Vorgeschmack auf die Freude der Entdeckung.
Dann schlug er die Augen auf.
Da erschien ihm das, was er bereits verstanden hatte, denn das Herz begreift schon lange, bevor der Blick es sieht.
Vor ihm, strahlend schön, saß Lucrezia.
Die braunen zarten Hände berührten kaum die Saiten der Laute, die sie, auf den linken Arm gestützt, im Schoß hielt. Ihr Kopf war leicht zum Instrument geneigt, nicht, weil sie auf die Saiten achten musste, sondern weil sie sich in dieser Melodie genauso sehr verlor wie er.
Den Harmonien der Musik ganz hingegeben schien ihre Haut Feuer zu fangen, Purpur mischte sich in das natürliche Inkarnat, das ihn an Zimt erinnerte, pure Sinnlichkeit. In ihren schwarzen träumerischen Augen blitzten die dunklen Spiegel der Iris auf.
Lorenzo war auf diesen Anblick nicht vorbereitet gewesen oder besser gesagt, er hatte nie etwas von Lucrezias Talent gewusst oder auch nur geahnt.
Leidenschaftlich und wunderschön saß sie in der Mitte des Saals, ganz in Rot, in einer gamurra aus Samt blendete sie ihn fast, während der Blick seiner Mutter ein weiteres Mal all ihre Wut und Angst angesichts dieses neuen Affronts im eigenen Hause verriet.
Außerdem gelang es Lorenzo, entgegen all seinen Versprechen und Schwüre, nicht, seine Gefühle und seine Bewunderung für das Gehörte zu verbergen. Und wie ihm ging es offensichtlich auch den Gästen, die, kaum dass die Musik verklungen war, in tosenden und aufrichtigen Applaus ausbrachen.
Dieses kristallklare Talent war ebenso unbestreitbar wie ungelegen: Lorenzo würde bald heiraten, aber was er gehört hatte, konnte er nicht mehr auslöschen.
Zunächst konnte er nicht einmal Beifall spenden. Es schien ihm, als könnte es dem Gehörten nur Unrecht tun. Also schaute er sie nur an. Schweigend. Für einen Augenblick spürte er deutlich, wie seine Seele ihre berührte. Er hatte das Gefühl, dass sie einen Pakt schlossen.
Nicht einmal in diesem Moment hatte er das Bedürfnis, ein Wort zu sprechen.
Er teilte mit ihr die Stille, ungeachtet der Begeisterung der Anwesenden.
Er blieb dort und sah sie an.
Plötzlich spürte er, dass etwas diese Harmonie störte, ein unsichtbarer Riss in einer Fensterscheibe, der immer größer werden würde, tiefer, bis er die Oberfläche zersplittern ließe.
Lorenzo sah sich um und bemerkte, dass Francesco de’ Pazzi ihn anschaute.
Da erkannte er, wie tückisch es werden würde, Lucrezia vor einer solchen Gefahr zu bewahren.
Er würde sie beschützen, sagte er sich, und wenn er sie dadurch verlor.
Aber in seinem Herzen befürchtete er, dass es dafür bereits zu spät war.
Juni 1469
7
Clarice
Die Sonne strahlte hoch am Himmel. Ihr goldenes Licht ergoss sich auf die Häuserdächer und den hellen Stein der Fassaden der Palazzi und Kirchen. Es glänzte auf den Pflastern der Straßen und Plätze von Florenz und erleuchtete die Porta del Paradiso von Lorenzo Ghiberti und die rote Kuppel von Santa Maria del Fiore.
Clarice war in der Stadt eingetroffen, begleitet von fünfzig Rittern. Wie eine kriegerische Jungfrau war sie zu Pferd gekommen, um zu unterstreichen, aus welch noblem römischem Geschlecht sie stammte, aber auch, um auf ihrem eigenen Territorium herauszufordern, über die so viel geredet wurde: Lucrezia Donati. Als wollte sie sagen, dass Lorenzo sie selbst erwählt hatte, statt einfach nur den finanziellen Vorteil, den sie ihm verschaffte.
Zwischen Statuen und Tabernakeln, zwischen Architraven und Inschriften schlängelte sich das Gemurmel des Volkes, das darauf wartete, wie dieses Duell ausgehen würde.
Giuliano ritt neben ihr. Entlang des Weges von Santa Maria del Fiore bis zum Palazzo Medici in der Via Larga standen bunte Wagen, beflaggte Tische und direkt hintereinander Banner und Standarten mit dem Wappen der Medici: rote Kugeln, mit französischen Lilien auf goldenem Grund.
Dieser Karneval der Farben und Formen war eine Demonstration der Pracht und Macht, Lorenzos Amtseinführung, der auf diese Weise den Ruhm seines Großvaters Cosimo und seines Vaters Piero erbte, welcher inzwischen müde und krank geworden war.
Als er Clarice sah, fiel ihm sofort auf, wie attraktiv sie war: Ihre langen Haare hatten die Farbe antiken Goldes, die tiefgründigen grünen Augen versprachen eine erlesene, aber bestimmte Verführung, die Lippen schienen wie Korallen, frisch aus den Meeresfluten. Wie eine jagende Diana trug sie ein leichtes Gewand, das die Schultern frei ließ.
Lorenzo fand, dass seine Mutter gut gewählt hatte.
Und doch, trotz ihres erlesenen Aussehens und stolzen Blickes, erschien ihm diese Frau kalt und distanziert. Sie schien in einer Rolle gefangen. Genau wie er. Er spürte in ihr eine tiefe und unentrinnbare Traurigkeit. Dieser Charakterzug war vielleicht das, was ihn am meisten bedrückte. Es befeuerte einen inneren Konflikt, der sich Tag für Tag von der steten Auseinandersetzung der Vernunft mit dem Instinkt, der Konvention mit der Freiheit nährte.
Der Festzug erreichte den Innenhof des Palazzos, die Diener beeilten sich, Clarice beim Absteigen zu helfen, aber sie kam ihnen fast schnippisch zuvor und stieg allein ab. Ein Spalier aus Adligen und Gästen, die am Fest teilnahmen, empfing sie, und nicht wenige unter ihnen machten große Augen, als sie merkten, wie hart diese Frau war.
Viele Blicke suchten das Gesicht von Lucrezia Donati, die eine auserlesene gamurra in kräftigem Himmelblau trug, mit tiefem Ausschnitt und mit geflochtenen Ärmeln voller Edelsteine, die ihre braune Haut betonten. Die Dame schaffte es nicht, die Wut aus ihren Augen zu verbannen, und so mancher genoss es, Zeuge eines solchen Duells zu sein.
Nachdem seine Mutter Clarice an die Hand genommen und zu ihm geführt hatte, ging Lorenzo vor Clarice auf ein Knie.
Als sie vor ihm stand, nahm Lorenzo ihre Hand zwischen seine.
»Lange habe ich auf Euch gewartet, Madonna. Endlich seid Ihr hier. Ich freue mich, dass Ihr heil angekommen seid und dass Eure Schönheit noch größer ist als die außergewöhnliche, die ich erwartet hatte. Daher bin ich meinem Bruder doppelt dankbar dafür, dass er so erfolgreich über Euch gewacht hat.« Er gab Giuliano ein Zeichen. Er fühlte sich, als spielte er eine Rolle in einem Theaterstück, als rezitierte er einen kurzen Monolog, den ein Hofnarr für ihn geschrieben hatte, der über ihn spottete und einstudierte Witze machte, um ihn auf ewig zu verdammen. Andererseits erinnerte er sich an Francesco de’ Pazzis Blick, und jegliches Bedauern löste sich sofort auf. Sicher, er musste an Lucrezia denken, aber welche Hilfe wäre er ihr gewesen, wenn er sie weiter der Gefahr der dunklen Intrigen seiner Feinde ausgesetzt hätte?
Das konnte er nicht zulassen.
Clarice bat ihn aufzustehen.
Sie nahm seine Hände in ihre.
»Mein geliebter Lorenzo, ich gebe zu, dass ich das Unbekannte gefürchtet habe, als ich Rom verließ. Ich war noch nie in Florenz, aber jetzt sehe ich, welch unsagbarer Schönheiten es sich rühmt. Giuliano war wunderbar, und ich bin glücklich, endlich Eure starken Hände in meinen zu halten. Vor mir sehe ich einen herrschaftlichen Mann von großer Ausstrahlung, und es freut mich unendlich, dass unsere Familien sich verbinden.«
Lorenzo küsste ihre Hände, während sein Vater die große Treppe hinabschritt, schwach auf den Beinen, aber mit lebhaftem Blick voll weiser Entschlossenheit.
Er trug ein violettes Wams und eine Ballonhose in derselben Farbe. Sein Gesicht war müde, aber die Augen bewegten sich blitzschnell wie die eines Falken über die große Schar der Gäste, die den Hof bevölkerten.
Clarice und Lorenzo warteten, bis Piero den Fuß der Treppe erreicht hatte. Dann umarmte er seine künftige Schwiegertochter. Nicht wenige mussten grinsen. Piero musste dieses Mädchen besonders gernhaben und ihre sechstausend fiorini