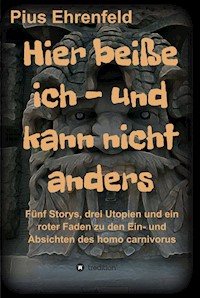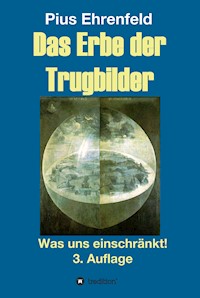
4,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Werke wie die Bibel sind von Menschenhand verfasst und beschreiben die Welt oft sehr fehlerhaft aus dem Augenschein ihrer Entstehungszeit heraus. Bezogen auf das Tatsächliche erzeugt das Augenscheinliche viele Trugbilder, aus denen sich kaum ein vernünftiger Verhaltenscodex für die Menschen und erst recht keine naturwissenschaftlichen Erkenntnisse gewinnen lassen. Oft verhindern dann auch noch Denkverbote eine kritische Auseinandersetzung mit diesen Texten. Viele Probleme unserer Zeit wie die durchaus noch zunehmende Wissenschaftsfeindlichkeit die Benachteiligung der Frauen, der Missbrauch von Sozialisation und Spiritualität, die Missachtung der Gesetze der Evolution und die unzureichende Bekämpfung von Dummheit sind ein Erbe dieser Trugbilder.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 163
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
PIUS EHRENFELD
Das Erbe der Trugbilder
Was uns einschränkt!
Über den Autor:
Geboren im Rheinland, Schulstart kriegsbedingt in Belgien; in Holland auf Toilettenpapier Rechnen und Schreiben gelernt. Mäßiger Schüler: Träumer. Handwerksberuf. Nach drei Gesellenjahren: Da steckt mehr drin. Anstrengend: Hochschulreife und Studium. Geldbeschaffung in der Gastronomie. Start in der Industrie, Fachbücher. Auslandstätigkeit. Selbständigkeit und Lehrauftrag an einer Hochschule. Das Berufsleben formt: Systemanalysen. Hinterfragen bis zum Nerven, Fehler machen und daraus lernen. Nachdenken über Ungereimtheiten. Daraus entstand das Fundament des Buches „Das Erbe der Trugbilder“. Sein zweites Buch: „Hier beiße ich - und kann nicht anders“ versucht, den Ursachen für ‚Die Leiden des homo carnivorus‘ auf die Spur zu kommen.
Pius Ehrenfeld
Das Erbe der Trugbilder
Was uns einschränkt!
Sieben Betrachtungen über Gott und die Welt
3. Auflage
© 2017 EHRENFELD, PIUS:
Das Erbe der Trugbilder
Was uns einschränkt!
© Verlag und Druck:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN:
978-3-7439-5036-8 (Paperback)
978-3-7439-5037-5 (Hardcover)
978-3-7439-5038-2 (e-Book
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Inhalt
Vorwarnung
1. Welt der Augenscheinzeit
Was wir sehen können
Beobachten und denken
Denkverbote
Was wir heute vom Universum wissen
Was kann man sich noch vorstellen?
Das Lichtjahr
Unvorstellbare Weiten und Mengen
Das Alter unseres Universums
Heilige „Wahrheiten“
Die Bibel wörtlich nehmen
Fragwürdige Altersangaben
Fazit
2. Evolution
Die Theorie von Jean-Baptiste Lamarck
Die Theorie von Charles Darwin
Kirche und Evolution
„Bibel statt Darwin“
Fehlgeschlagener Gegenbeweis, ein Beispiel
Liebe und Evolution
Die Evolution fördert keine staatsfesten Individuen
Die Beweislage: Evolution
Die Beweislage: Kreationisten
Die Evolution reduziert nicht den Soziopathen-Anteil
Mit Verlaub: Eine kleine Parodie
Als Fazit ein schönes Zitat
3. Frauen und Religion
Eine schlimme Geschichte
Das Buch Genesis
MANN analysiert FRAU
200 Vorhäute und ein Liebesepos
Wer war zuerst da?
Die Frau in den Paulusbriefen
Frauen im Hochmittelalter aus der Sicht der Kirche
Hexenverfolgung
Frauen zu Beginn des 21. Jahrhunderts
Frauen waren immer schon gleichwertig
Frühe Matriarchate
Warum stützten die Frauen ihre Peiniger?
Fazit
4. Freiheit
Was ist Freiheit?
Religionen und Freiheit
Sklaverei
Bibel und Sklaverei
Religionsfreiheit
Trennung von Kirche (Religion) und Staat
Ein „Runder Tisch“ für die Religionen
Homosexualität
Linkshänder
Poly-, Mono-, Pan- und Atheismus
Gibt es Gott?
Fazit
5. Das Geheimnis der Sozialisation
Formen des Lernens
Frühkindliche Prägung
verblüffende Idee aus dem Bundeskanzlerinnenamt
Milliardenfacher Missbrauch
Rückgang der religiösen Sozialisation
Einfluss der Gesellschaftsformen
Fazit
6. Über die Dummheit
Was bedeutet „Dummheit“?
Recht auf Dummheit
Wissensschnittmengen mit anderen
Dummheit und Sozialisation
Dummheit in der fremdbestimmten Gesellschaft
Sind Juden schlauer als andere?
Sonderfall USA
Fazit: Die Sehnsucht nach dem Einfachen
7. Spiritualität, Religion, Gott
Naive Spiritualität
Verschiedene Definitionen für Spiritualität
Es war einmal ein Jesus
Die Bergpredigt
Der gnadenlose Missionar
Religion für Raubtiere
Lindert Religion die Angst vor dem Tod?
Schöne Rituale
Buddhismus
André Comte-Sponville
Kirchengesang
Die große Illusion
Fazit: Das Dilemma des homo sapiens
Epilog
Nachtrag: Etwas Statistik
Quellen und Hinweise
Vorwarnung
In einigen dieser „Sieben Essays über Gott und die Welt“ setze ich mich kritisch mit der Herkunft religiöser Schriften und dem Gottesbegriff auseinander. Meiner persönlichen Sozialisation entsprechend geht es dabei im Schwerpunkt um christlich/katholische Sichtweisen. Ich wende mich ausdrücklich nicht an gläubige Menschen, deren religiöse Gefühle durch diese kritische Auseinandersetzung mit den Ursprüngen der Religion verletzt werden könnten. Dies ist nicht beabsichtigt, aber aufgrund des Themas auch nicht zu vermeiden. Lesen Sie trotz dieses Hinweises weiter, so tun Sie dies auf eigenes Risiko – ich habe Sie gewarnt und bin nicht verantwortlich, wenn Sie sich in irgendeiner Weise unglücklich fühlen. Ich missioniere auch nicht, da ich nicht weiß, ob ich bei einem Leser etwas zerstöre, für das ich keinen Ersatz bieten kann. Allerdings haben die echten Missionare selten gefragt, ob die meist unfreiwillig Bekehrten überhaupt missioniert werden wollten!
Ausdrücklich wende ich mich an die Zweifler und Sucher, die ein Unbehagen über das Verhalten der Amtskirchen und deren Selbstverständnis verspüren.
Immanuel Kant schrieb am Ende des 18. Jh.:
„Aufklärung ist der Ausstieg des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes sondern der Entschlusskraft und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen12. Sapere Aude! Habe Mut, Dich Deines eigenen Verstandes zu bedienen!“
Versuchen Sie einmal, diesen Kernsatz der Aufklärung zu verinnerlichen und prüfen Sie kritisch, ob Sie sich danach noch wohl fühlen.
In den folgenden sieben Essays habe ich die zum jeweiligen Thema gehörende These vorangestellt und schließe dann eine lockere Sammlung von Fakten an. Ich möchte Sie neugierig machen und empfehle dringend, mit den hier gewonnenen Suchbegriffen in den einschlägigen Suchmaschinen des world-wide-web auf Jagd zu gehen.
Im Spätsommer 2014
Pius Ehrenfeld
Zur 2. Auflage
Einige Schreibfehler korrigiert, Anregungen von Lesern eingearbeitet und einige meiner Erkenntnisse und Vermutungen besser formuliert.
Im Frühjahr 2015
Pius Ehrenfeld
Zur 3. Auflage
Kapitelaufteilung wurden gestrafft und einige Textstellen überarbeitet. Hinweise und Quellenangaben am Buchende zusammengefasst.
Im Spätherbst 2017
Pius Ehrenfeld
Dank
Einige meiner Freunde haben im Manuskript kritisch nach Missverständlichkeiten und Schreibfehlern gesucht und sind auch fündig geworden. Ein herzliches Dankeschön also an U.U., E. U., U. R., U. R., B. P. und U. P.
Bildnachweis
Zur Umschlagillustration wurde ein Ausschnitt des Außenflügels von Hieronymus Boschs Triptychon „Der Garten der Lüste“ verwendet, s. auch Kapitel 1, Zwischenüberschrift „Heilige Wahrheiten“. Quelle: Datei Jheronimus Bosch 023 exterior 02.jpg, veröffentlicht von Vincent Steenberg am 12. Okt. 2010 in wikimedia.org. Zitat: „Dieses Werk wurde als frei von bekannten urheberrechtlichen Einschränkungen identifiziert, einschließlich aller verwandten Schutzrechte.“
1. Welt der Augenscheinzeit
Wenn das Universum einen Anfang hatte, können wir von der Annahme ausgehen, dass es durch einen Schöpfer geschaffen worden sei. Doch wenn das Universum wirklich völlig in sich selbst abgeschlossen ist, wenn es wirklich keine Grenze und keinen Rand hat, dann hätte es auch weder einen Anfang noch ein Ende; es würde einfach sein. Wo wäre dann noch Raum für einen Schöpfer?
STEPHEN HAWKING
These
Der größte Teil der religiösen Schriften sind aus Eindrücken heraus entstanden, die aus dem Augenschein ihrer Entstehungszeit gewonnen wurden. Für die meisten der dort behandelten naturwissenschaftlichen, psychologischen und soziologischen Phänomene sind diese Eindrücke, gemessen am heutigen Wissensstand, pure Trugbilder und daher nicht als Basis für eine wünschenswerte universelle Weltordnung (oder bescheidener: Erdordnung) geeignet.
Denkanstöße zur These
Ich war 11 Jahre alt, als ich in der 1. Klasse einer Realschule mein Wissen aus den Fächern Religion, Geografie und Geometrie zur folgenden Frage an den Religionslehrer kombinierte:
„Wo kamen eigentlich die hunderte von Millionen Tonnen Wasser für die Sintflut her und wohin sind sie am Ende wieder abgeflossen?“
Basis der Überlegung war, dass das Wasser, so wie man es in der Bibel ab Genesis 6,173 lesen kann, als hohe Flut über die ganze Erde hereinbrach und alles Leben vernichtete, soweit es sich nicht auf die Arche retten konnte. Der Religionslehrer meinte, die Bibel sei kein Naturkundebuch, man dürfe sie für solche Themen daher auch nicht wörtlich nehmen. Außerdem sei die Größe der Erde den Menschen der damaligen Zeit auch völlig unbekannt gewesen.
Mit dieser Antwort musste ich mich zufriedengeben. Heute sehe ich sie als Ausdruck eines Dilemmas: Auf der einen Seite sind religiöse Basiswerke wie die Bibel für die jeweiligen Mitglieder nicht nur Glaubens- sondern auch Wissensverpflichtung, auf der anderen Seite entlarven die stetig wachsenden Erkenntnisse der Wissenschaften die meisten der dort aufgestellten Thesen als a priori falsch. Da die Grenzen zwischen religiösen und naturwissenschaftlichen Themen oft nur sehr unscharf zu ziehen sind, kommt man ohne fachmännische, theologische Kommentare nicht weiter: Die Bibel ist also nur etwas für geschulte Kleriker.
Schauen wir uns kurz einmal die einfache Frage nach der Größe unserer Welt an. Beschränkt man sich auf das Augenscheinliche, das ohne irgendwelche Hilfsmittel und Denkakrobatik Erkennbare, dann ist die Antwort nicht sonderlich kompliziert. Wir müssten dann aus den Informationen, die wir aus der sichtbaren Welt empfangen, Rückschlüsse auf den unsichtbaren Rest ziehen. Nehmen wir jedoch Werkzeuge wie beispielsweise Teleskope für die verschiedensten elektromagnetischen Wellenbereiche sowie Computer zur Hand, gerät der Himmel aus den Fugen und wir erreichen für uns unvorstellbare Dimensionen. Hier gibt es dann keine einfachen Fragen und erst recht keine einfachen Antworten mehr.
Was wir sehen können
Beginnen wollen wir also mit dem Augenscheinlichen und versetzen uns zurück in die Zeit der Entstehung der großen Kulturen. Was wir „Augentiere“ erkennen können sind Land, Berge und Täler, Flüsse und Meere. Als Form der Erde konnten wir damals wohl nur eine Scheibe vermuten, für die Kugelform fehlten noch Erkenntnisse. Die Ränder dieser Scheibe waren uns aus alten Mythen und Überlieferungen bekannt, auf alle Fälle geht es dort unheimlich zu.
Wir sehen tagsüber die wärmende und lichtspendende Sonne von Ost nach West über den Himmel gleiten und nachts den Mond mit sich in einem Zyklus von ungefähr 29 Tagen wandelnder Gestalt. Diese Zeitspanne wird dann auch in zahlreichen Kulturen eine magische Bedeutung erhalten und beispielsweise die Basis für Kalendersysteme sein.
Wir erkennen die vielen Sterne. Mit bloßem Auge können wir in klaren Nächten ungefähr 6.000 in unterschiedlicher Helligkeit erkennen. Bis auf einige wenige verändert sich die Anordnung der Sterne untereinander nicht und das ganze Sternengebilde dreht sich um den Himmelsnordpol. Die Drehung ist etwas kürzer als ein Tag und nach genau einem Jahr sehen wir um die gleiche Uhrzeit wieder die gleichen Sterne an der gleichen Stelle. Seit alten Zeiten hat man Sterngruppen in phantasievollen Bildern zusammengefasst und ihnen Namen gegeben: Orion, Großer Bär, Andromeda, um nur drei zu nennen. Die Beständigkeit dieser Bilder wurde Grundlage für die Navigation vor allem bei seefahrenden Völkern.
Die Milchstraße als weißlich schimmerndes Band bewegt sich genau wie die Sterne. Aber was ist sie, was hat sie zu bedeuten? Die Antworten der alten Kulturen sind recht unterschiedlich, hier eine Deutung aus der griechischen Mythologie: Die alten Griechen erklärten sich das Phänomen Milchstraße mit einer Sage: Herkules, der Sohn des Göttervaters Zeus und der Menschenfrau Alkmene, soll schon als Baby sehr stark gewesen sein. Aus „himmelspolitischen“ Gründen stillte nicht Alkmene, sondern die Göttin Hera den Kleinen. Der jedoch sog der viel zu heftig an der Mutterbrust und die Milch spritzte in hohem Bogen zum Himmel und wurde dort zur Milchstraße45.
Vor allem in den polytheistischen alten Kulturen finden sich ähnlich anschauliche Geschichten sowohl für die Entstehung der Welt als auch für tausende kleinere Phänomene unserer Umwelt. Unendlich war hier zwar noch nicht das Weltall, aber sicher die Phantasie der Erfinder solcher Urmärchen, die in ihrer erhabenen Grausigkeit einen erschaudernden Einblick in die Welt des Übernatürlichen gaben.
Doch zurück zum Ausgangspunkt. Über die Entfernungen der einzelnen Himmelsgebilde untereinander hatten die Menschen nur unklare Vorstellungen, vielleicht gab es auch keinen Grund, sich darüber Gedanken zu machen.
Beobachten und denken
Bis das Fernrohr im 17. Jahrhundert erfunden wurde hatte man bereits mit Beobachten, Nachdenken und Messen wesentliche Erkenntnisse gewinnen können, die über das Augenscheinliche deutlich hinausgehen. Zwei Beispiele:
Einige unserer Ur-Vorfahren waren Küstenbewohner und es wird ihnen aufgefallen sein, dass man von einem höheren Standort aus am Horizont entfernt liegende Inseln oder Klippen zunächst erkennen kann, diese dann aber mit dem Herabsteigen allmählich wieder verschwinden. Nach gründlichem Nachdenken könnte man auf die Idee gekommen sein, dass die Erde eine riesige Kugel sei. Den ersten seefahrenden Völkern war auch bereits vor Jahrtausenden bekannt, dass man von einem herannahenden Schiff zunächst nur die Mastspitze, dann den Mast und erst bei weiterer Annäherung auch den Rumpf sehen konnte – und das abhängig von der Höhe des Beobachterstandortes.
Der griechische Wissenschaftler Eratosthenes67 lebte im 3. Jh. vor Christus und hat durch Nachdenken und Beobachten den Erdumfang mit 39.375 km erstaunlich präzise berechnet. Ihm kam dabei zugute, dass zu seiner Zeit die Schiefe der Ekliptik fast genau mit dem Breitengrad von Syene (heute: Assuan) in Ägypten identisch war und die Sonne folglich am 21. Juni im Zenit und damit genau senkrecht zur Erdoberfläche stand. Rund 785 km weiter nördlich in Alexandria zeigte zur gleichen Tageszeit ein senkrecht in die Erde getriebener Stab jedoch einen Schatten, also eine Neigung gegenüber der direkten Linie zur Sonne. Eratosthenes bestimmte einen Schattenwinkel als ein 50stel eines Kreises (das sind 7,2°) und schloss daraus, dass der Erdumfang 50mal so groß sein muss wie die Strecke von Syene bis Alexandria. Eine großartige Leistung, zumal er sich mit seiner Berechnungsmethode auch gegen die damals noch vorherrschende Erdscheibentheorie stellte.
Denkverbote
Überspringen wir die Jahrhunderte und kommen zu der im ausgehenden Mittelalter heiß diskutierten Frage, ob nun die Erde der Mittelpunkt der Welt sei oder die Erde mitsamt den anderen Planeten sich um die Sonne dreht: Geozentrisches kontra heliozentrisches Weltbild. Es war damals bereits allgemeiner Konsens, dass die Erde eine Kugel und nicht etwa eine Scheibe ist.
Aber eine die Sonne umkreisende Erde war pure Ketzerei und wurde von der Inquisition auch entsprechend geahndet. Giordano Bruno (1548–1600) war mit seinen Gedanken weit bis in unsere Zeit vorgedrungen und lehrte damals bereits die Unendlichkeit des Universums, die Möglichkeit (unendlich) vieler Lebewesen auf fernen Planeten und die Einheit von Gott und Weltall (Pantheismus). Dafür starb er im Jahre 1600 auf Geheiß der Inquisition qualvoll auf einem Scheiterhaufen in Rom.
In der Zeit Galileo Galileis (1564 - 1642), einem der größten Genies der Menschheit, tobte die Inquisition auf Rekordhöhe. Kleinste Quäntchen an Abweichung vom Dogmensystem der römisch-katholischen Kirche wurden als Ketzerei gebrandmarkt und nicht selten mit dem Feuertod geahndet. Das galt nicht nur für Glaubensabweichler, nein, auch Abweichler im Bereich der Naturwissenschaften lebten gefährlich. Galilei musste sich 1633 vor der Inquisition verantworten, weil er die fast 100 Jahre alte kopernikanische Lehre von der Sonne statt der Erde als Weltmittelpunkt für richtig unterstützt hatte. Hätte er dieser Theorie nicht gegen seine Überzeugung schriftlich und mündlich abgeschworen, wäre er sicher, wie so viele andere, verbrannt worden. Und das für eine Theorie, die sich durch richtig gedeuteten Augenschein und ohne Denkverbote damals bereits problemlos hätte verifizieren lassen.
Über Jahrhunderte hatte die Kirche die Bibel als Wahrheitsfundament auch für naturwissenschaftliche Fakten teilweise mit Gewalt durchgesetzt. Denkverbote belegten weite Wissensbereiche und so fiel man oft weit hinter den Erkenntnisstand der „alten Griechen“ zurück. Das änderte sich erst mit dem Beginn der Neuzeit, das heliozentrische Weltbild wurde zum Wissensstandard und einschlägige Denkverbote, die jahrhundertelang jeden Fortschritt u. a. auch in der Astronomie blockiert hatten, fielen so nach und nach.
Interessant zu wissen, dass in der Blütezeit des Islam (ca. 750 – 1250) fast alle wissenschaftlichen Disziplinen dort weiterentwickelt waren als im Abendland. Sicher wäre das Abendland ohne die von der Kirche gesetzten Restriktionen von vielen Fehlentwicklungen verschont geblieben.
Eine treffende Bezeichnung für das Mittelalter, das ungefähr die Zeitspanne von 6. bis zum 15. nachchristlichen Jahrhundert umfasste und das in Europa wesentlich wenn nicht sogar ausschließlich von der römisch-katholischen Kirche geprägt wurde, findet sich bei J. C. Majer8: Die tausendjährige Nacht.
Was wir heute vom Universum wissen
Auch die abendländische Astronomie wäre ohne die Denkverbote wesentlich weitergekommen, den Durchbruch erzielten jedoch technische Hilfsmittel. Dies war zunächst einmal das Fernrohr (Anfang des 17. Jh.), mit dessen Hilfe man sich die Himmelsobjekte näher heranholen konnte. Inzwischen können wir mit speziellen Teleskopen auch unsichtbare Informationsträger wie Radiowellen, Ultraviolett- und Infrarotstrahlung empfangen. Nicht zu vergessen die Computertechnik, mit der die gigantischen Rechenleistungen zur Aufbereitung der Bilder erbracht werden können. Die vorläufige Krone ist das 1990 in Betrieb gegangene Hubble-Weltraumteleskop, ein etwa omnibusgroßer Satellit, der ungestört von den Einflüssen der Erdatmosphäre phantastisch scharfe Bilder aus den Tiefen des Weltalls liefert.
An die Größe unseres Heimatplaneten Erde haben wir uns gewöhnt, wir kennen ihn aus Karten und den kleinen Nachbildungen, den Globen. Den Umfang von ungefähr 40.000 km können wir uns auch noch vorstellen: Das ist so die Strecke, die ein vielbeschäftigter Familienvater in einem Jahr mit seinem Auto zurücklegt, um Kunden oder Lieferanten zu besuchen.
Was kann man sich noch vorstellen?
Die Entfernungen zwischen Himmelskörpern sprengen schnell unsere Vorstellungskraft. Die mittlere Entfernung unseres Mondes beträgt 380.404 km, das sind fast zehn Erdumfänge. Ein gutes Dieselauto schafft es, in seinem „Autoleben“ diese Strecke auf der Erde einmal zurückzulegen und verbraucht dabei bei moderater Fahrweise 30.000 Liter Treibstoff. Alles noch vorstellbar und wir ändern für weitere Vergleiche die Einheit der Entfernung auf 1 Million km. Durch die Computertechnik sind wir es gewohnt, das Speichervolumen in Gigabyte anzugeben, das sind 1 Million Kilobytes. So stellen wir fest, dass der Mond 0,38 Gigameter, abgekürzt Gm, von uns entfernt ist.
Kommen wir zur Sonne, unserem gigantischen Wärme- und Lichtspender. Fast 150 Gm ist sie entfernt und das Licht mit seiner Geschwindigkeit von 300.000 km pro Sekunde (0,3 Gm/s) benötigt 8,3 Minuten, um zu uns zu kommen. Wenn wir uns mit Hilfe eines speziellen Fernrohres die Sonnenoberfläche ansehen, dann sehen wir also den Zustand, den diese vor 8,3 Minuten hatte.
Wir spüren die Grenzen unserer Vorstellungskraft nicht nur bei den kosmischen Entfernungen, auch die Zeitspannen sind nicht wirklich greifbar für unsere Sinne. Es gilt heute als erwiesen, dass unser Weltall durch eine explosionsartige Aufblähung einer extrem dichten Urmaterie entstanden ist. Dieser Urknall fand vor ungefähr 13,5 Milliarden Jahren statt. Unser Sonnensystem und damit auch die Erde entstanden, nach dem über zwei Drittel dieser Zeit bereits abgelaufen war.
Erstes mehrzelliges Leben entstand auf der Erde vor über eine Milliarde Jahren im Proterozoikum. Die Dinosaurier hatten ihre Blüte in der Kreidezeit und endeten abrupt durch eine kosmische Katastrophe vor 65 Millionen Jahren. Aus den Säugetieren entwickelte sich in Afrika der heutige Mensch, der homo sapiens (das bedeutet soviel wie „weiser Mensch“) vor etwa 100.000 – 200.000 Jahren. Erste Hochkulturen finden sich in Mesopotamien und Ägypten vor ungefähr 6.000 Jahren.
Ich nehme zur Veranschaulichung der Proportionen ein dickes Buch, z. B. die Bibel in einer Ausgabe der Deutschen Bibelgesellschaft Stuttgart von 1982. Sie umfasst nahezu 1.350 Seiten und jede Seite enthält etwa 1.600 Zeichen. Wir ordnen den Urknall der ersten und unsere heutige Zeit der letzten Seite zu. Unser Sonnensystem entsteht erst bei Seite 1.000 mit dem Neuen Testament. Da eine Seite 10 Millionen Jahre widerspiegelt, finden wir das Kambrium auf Seite 60 vor dem Schluss der Bibel. Die Dinosaurier sterben bereits auf der siebtletzten Seite aus. Den 150.000 Jahren, seit denen es so ungefähr den heutigen Menschen gibt, entsprechen nur 24 Zeichen, z. B. der Satz
„Wir sind der homo sapiens!“
Für die weniger als 6.000 Jahre seit dem Beginn der Hochkulturen bleibt uns gerade mal ein Buchstabe, z. B. das
o.
Unsere Vorstellungskraft kommt bei solchen Zahlenspielchen leicht in Schwierigkeiten und man muss sich möglichst unterschiedliche Bilder ausdenken. Besser bekommt man diese 6.000 Jahre Kulturgeschichte in den Griff mit der Vorstellung, dass dies gerade einmal 200 Generationen unserer Spezies sind. Wir können daher annehmen, dass sich die Menschen vor 6.000 Jahren in Aussehen und Charakter nur sehr wenig von uns unterschieden haben. Aber das ist ein Thema für ein anderes Kapitel.
Das Lichtjahr
Wozu benötigt man denn solch gigantische Einheiten? Wir werden sehen, dass selbst 1 Pm für Astronomen eine Winzigkeit ist, hat doch der uns am nächsten gelegene Fixstern Proxima Centauri im Sternbild Zentaur eine Entfernung von 4,2 LJ oder 40 Pm.