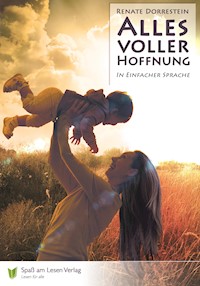2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bertelsmann, C.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Loes’ Mutter wegen Mordes zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt wird, ist die wilde, süße Kindheit der Sechsjährigen vorbei. Von allen geschnitten, von Scham und Schuldgefühlen geplagt, findet sie wider Willen das furchtbare Geheimnis der Mutter heraus. Aber ist ihre Mutter tatsächlich auch eine Mörderin? Jahre später, Loes ist inzwischen eine junge Frau, holt die Vergangenheit sie noch einmal ein, und sie bekommt die Chance auf ein befreites, glückliches Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 430
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Per Luige Brioschi,con affetto
und für Kika
Inhaltsverzeichnis
ERSTER TEIL
Sechs
A ist eine Anlage
Wir hatten uns wahrscheinlich irgendwann vorgenommen, kein Wort mehr mit ihr zu wechseln, denn wie auf Verabredung wurde es immer totenstill, sobald sie in unserem Blickfeld erschien. Wir pressten die Lippen aufeinander und schauten in die entgegengesetzte Richtung, wenn wir sie auf dem Schulhof angeschlendert kommen sahen oder wenn wir ihr auf der Straße begegneten, wo sie ganz allein Hüpfen oder Murmeln spielte.
Wann wir damit angefangen hatten? Vermutlich in dem Jahr, in dem wir bei Joyce lesen lernten. Jedenfalls schon vor so langer Zeit, dass auf die Dauer ein vager, aber unverkennbarer Kreis um sie herum sichtbar geworden war, wo sie auch stand, saß oder ging: Sie war markiert. Als Zielscheibe.
Unser Schweigen bedeutete nicht, dass wir ihr nichts zu sagen hatten. Und damit da keine Missverständnisse aufkamen, passten wir sie nach der Schule oft ab. Zu viert, zu sechst, und wenn es nichts Besseres zu tun gab, zu noch vielen mehr.
Wir versteckten uns in der Anlage auf dem alten Dorfplatz, hinter der Buchenhecke, deren Blätter im Frühling schokoladenbraun waren. Vor der Hecke stand eine Bank, die mit Dornengestrüpp überwuchert war. Früher, als die Anlage noch unterhalten worden war, war sie ein beliebtes Fleckchen für turtelnde Pärchen gewesen. Jetzt war sie meistens ausgestorben. Aber unsicher war es dort nicht, denn alle Häuser rund um den Platz gingen darauf hinaus: Alle konnten sehen, was sich dort abspielte, es sei denn, sie hatten gerade etwas im Auge.
Wir stießen uns gegenseitig in die Rippen und krochen hinter die Hecke. In der feuchten Erde wimmelte es von Spinnen, die mit nachgebenden Beinen Land zu gewinnen versuchten, wenn man eine Flamme an sie hielt. Beim Verbrennen machten sie ein puffendes Geräusch, und aus dem versengten Kügelchen kräuselte sich ein mickriges Rauchfädchen empor.
Sobald sie sich näherte, steckten wir unsere Streichhölzer weg und zogen die Köpfe ein. Wir hockten so dicht aufeinander, dass wir ein einziges Bündel zitternder Muskeln und aufgesperrter Nasenlöcher waren.
Auf der anderen Seite der Hecke verzögerte sie den Schritt. Sie ging immer langsamer, bis sie abrupt stehen blieb. Sie wog natürlich ihre Chancen ab: Ihr Nachhilfeunterricht hatte länger gedauert als sonst, aus den geöffneten Fenstern der Häuser wehten schon Essensgerüche, niemand spielte mehr auf der Straße. Vielleicht hatte sie ja heute unverhofft Glück. Ihre Finger nestelten an ihren Kleidern, fassten einen Saum, wie um Halt zu suchen. Ihre Kleider hatten immer eine undefinierbare Farbe. Das sei das Werk der Lucos, sagten unsere Mütter kopfschüttelnd. Männer könnten nicht waschen, und sie hätten auch keine Ahnung, wie man ein Mädchen hübsch anziehe. »Das arme Kind«, sagten sie.
Mit vor Spannung aufgeblähten Wangen sahen wir einander an. Keiner wollte der Erste sein, oder schlimmer noch, der Letzte. Und bei dem Gedanken sprangen wir allesamt auf und versperrten ihr den Weg. Mit verschränkten Armen, weit gespreizten Beinen und erhobenem Kinn. Ein menschlicher Schlagbaum.
Ihr Mund und ihre Augen schossen auf O, ihre Haut wurde so blass, dass die Sommersprossen wie Ameisen über ihre Nase zu krabbeln schienen, und ihre roten Zöpfe, die sie sich, nur um uns zu provozieren, wieder hatte wachsen lassen, gingen vor Schreck auseinander.
Im weiten Umkreis herrschte vollkommene Stille. In keinem Haus läutete ein Telefon. Kein Topf klapperte mehr auf einem Herd. Kein Baby wagte noch zu weinen. Keine Nachbarsfrau hielt ein Schwätzchen über den Gartenzaun. Sogar das Dornengestrüpp hörte auf zu wachsen, wenn wir den Zettel mit unseren neuesten Vorhaben bis auf Augenhöhe hochhoben, damit sie ihn lesen konnte. Sie hatte Mühe damit. Aber wir hatten Zeit. Seelenruhig schauten wir zu, während ihr vor Anstrengung Schweißtröpfchen auf die Oberlippe traten. Wenn sie unsere Botschaft endlich Wort für Wort entziffert hatte, stopften wir ihr den Zettel in den Mund, damit er nicht gegen uns verwendet werden konnte. Sie kaute und schluckte gehorsam. Sie hatte die Augen niedergeschlagen, aber wir wussten nur zu gut, wie blau sie waren, noch immer kein bisschen weniger unverschämt blau, obwohl sie wie begossen dastand. Die gekränkte Unschuld mimen, darin war sie gut. Wir gaben ihr einen Stoß, und sie taumelte über den verlassenen Platz, unser Versprechen im Magen. »Wir zünden dich an, du Dreckschlampe.«
Kaum dass sie außer Sichtweite war, mussten wir an uns halten, um uns nicht wie nasse, tolle Hunde zu schütteln. Wir hatten plötzlich ein enormes Bedürfnis, laut zu sein. Wir schrien alles Mögliche durcheinander, um uns darin zu bestärken, dass es unser vollstes Recht war, ihr zu verstehen zu geben, dass sie bis in alle Ewigkeit in dieser Hölle leben würde. Morgen würden wir ihr eine Quittung verpassen. Oder besser in einigen Tagen. Wenn sie sich wieder in Sicherheit wähnte, würden wir zuschlagen, ja, das würden wir machen. In diesem Jahr hatten wir zum letzten Mal die Gelegenheit dazu: Bald wurden wir zwölf, nach den Ferien würden wir alle auf verschiedene Schulen gehen. Zu Hause setzten sie in letzter Zeit schon sentimentale Gesichter auf, wenn sie von unserer glücklichen Kindheit redeten, die nun, wie sie sagten, bald hinter uns liegen würde.
Wir waren fast alle im einzigen Neubauviertel eines verschlafenen Ortes geboren, der längst von der Landkarte verschwunden gewesen wäre, wenn das Niemandsland zwischen Entwässerungsgraben und Autobahn nicht zur Toplage für Projektentwickler geworden wäre.
Unsere Väter sagten immer stolz, dass sie die allerersten Bewohner des neuen Viertels gewesen seien. Eine Art Pioniere. Wohnhöfe habe es damals wirklich noch nirgendwo anders im Land gegeben. Das Fernsehen sei dabei gewesen, als der Ministerpräsident symbolisch das erste Haus aufgeschlossen habe, erzählten unsere Mütter mit immer noch leuchtenden Augen. Sie hatten sich gleich an die Arbeit gemacht und im Garten Bambus gepflanzt und witzige Figuren hineingestellt. Danach waren sie zum Frisör gegangen, um sich blonde Strähnchen machen zu lassen.
Die Väter mussten schon ordentlich verdienen, wenn man sich so ein Haus mit versetzten Wohnebenen leisten wollte, aber im Vergleich waren die Preise hier trotzdem lächerlich niedrig. In Amsterdam hockte man für das gleiche Geld im dritten Stock mit Fenster zum Hof. Und obendrein war hier frische Luft inbegriffen, gratis.
Im ersten Sommer im Wohnhof hatten unsere Eltern reihum gegrillt wie die Verrückten, das ganze Viertel hatte mitgemacht, Pioniere mussten gut essen, die hatten Vorbildfunktion. Unsere Mütter hatten Badewannen voll Kartoffelsalat gemacht, unsere Väter hatten sich Schürzen umgebunden und die Fleischgabeln gekreuzt. Im Winter hatten sie im Plaza 1980 alle gemeinsam einen riesigen Weihnachtsbaum geschmückt, wobei es derartig zugig gewesen war, dass sie eimerweise Glühwein hatten trinken müssen, um auf den Beinen zu bleiben. Und als es wieder Sommer geworden war, kamen wir auf die Welt, zwar alle einzeln und nacheinander, aber schon mehr oder weniger gleichzeitig, als würde die Hypothek verfallen, wenn nicht bis zu einem bestimmten Stichtag ein Baby produziert wurde.
Wir wussten damals noch nicht, wie das ging, geboren werden. Wir erfassten noch nicht, was so alles dazugehörte oder welche Folgen es haben konnte. Wir waren einfach auf einmal da, zur Freude unserer Eltern. Sie beugten sich über die Wiege, nahmen uns auf den Arm, behutsam, weil wir so ein kostbarer Schatz waren, und zeigten uns, dass wir aus zwei Welten das jeweils Beste bekommen hatten: ein Badezimmer mit modernen sanitären Einrichtungen plus eine Küche aus hygienischem rostfreien Stahl, aber auch eine Brache um die Ecke, voller blühendem Wiesenkerbel und mit Schlamm, der später warm und behaglich in unsere Gummistiefel sickern würde.
Wir sogen Luft in unsere Lungen und krähten vor Freude. Wir krähten so laut, dass wir einander durch die Wände hindurch von links, rechts und gegenüber hören konnten. Auch das war inbegriffen: Freunde und Freundinnen für jeden gratis. Wie schön würde das später sein, wenn wir uns alle im Gleichtakt entwickeln würden, die ersten Schritte, die ersten Worte, die erste blutige Lippe. Und zusammen Roller fahren! Wo konnte man so sicher Roller fahren wie bei uns?
Wir hatten das große Los gezogen. Wir saßen im warmen Nest. Als hätte die ganze Welt genau gewusst, was uns zustand.
Der alte Ortskern bestand aus vier schmalen Sträßchen und einem Platz. Auf ihn nahmen unsere Mütter mit ihren blonden Locken täglich Kurs, um Einkäufe zu machen.
Sie parkten unseren Buggy in dem erdig riechenden Laden des Gemüsehändlers, dessen Finger von der Arthrose so stark angeschwollen waren, dass er den knackfrischen Salat kaum in eine Zeitung gewickelt bekam, und wenn man es nicht passend hatte, musste man hinter die Kasse kommen, um sich das Wechselgeld selbst herauszunehmen. So leckeres Gemüse bekomme man nirgendwo anders, beteuerten unsere Mütter Herrn de Vries. Sie gingen in ihren engen Jeans in die Hocke und gaben uns eine Möhre, an der wir nuckeln konnten. Sie trödelten noch ein wenig, weil sie zu einem kleinen Schwatz aufgelegt waren, sie hatten ja nicht so viel Kontakt, aber Herr de Vries wog schweigend Spalterbsen ab, und so zuckelten sie, plötzlich verlegen, aus dem dunklen Laden, weg von Alter und Schmerzen und harter Arbeit, weg, weg.
Draußen fingen sie sich wieder. Sie beugten sich über unseren Buggy und gaben mit geröteten Wangen beschwichtigende Laute von sich. Man konnte hören, wie froh sie waren, dass wir wenigstens noch mehr als sie einer Fremdbestimmung unterworfen waren. Sie konnten sich immerhin selbst den Hintern abwischen. Entschieden verstauten sie den Salat tief unten im Einkaufsnetz des Buggy. Wir wurden erneut über die holprigen Klinker gerollt. Über uns sahen wir blauen Himmel mit vereinzelten Wolken, die einem Elefanten oder einem Küken ähnelten. Däumchen in den Mund, denn wir wurden sowieso nicht nach unserer Meinung gefragt.
Fleischer. Fleisch aus eigener Schlachtung.
Bäcker. Mischbrot aus Meisterhand.
Wenn unsere Mütter fertig waren mit ihren Einkäufen, trafen sie sich in der öffentlichen Anlage auf dem Dorfplatz, gegenüber vom alten Pfarrhaus. Wir lagen auf karierten Plaids an ihren Hüften und dösten. Ihre braunen, weißen oder gefleckten Gesichter glänzten in der Sonne, sie tupften sich den Hals ab, ihre Stimmen schrillten. Sogar in unserem Halbschlaf machte uns das unruhig, wir bekamen Juckreiz und fingen ohne eigentlichen Grund an zu greinen, um sie abzulenken. Ihre Panik war schon zu verstehen. Mit gerade mal zwanzig weit von der Stadt in ein Neubauviertel in irgendeinem Kaff verbannt zu sein, wo man im Wilden Westen des Wohnhofs Tag für Tag auf sich selbst gestellt war, während der Mann im Stau steckte! Aber erneut nahmen sie sich zusammen, umfassten ihre lackierten Fußnägel, griffen sich in die gebleichten Haarspitzen und zogen und zogen mit ganzer Kraft, und sie lachten, zwar mit den Nerven am Ende, aber doch schon wieder aus vollem Halse. Schließlich gab es immer irgendeine Neuigkeit, über die man klatschen konnte. Immer war da irgendeine Skandalgeschichte, die man im Beisein von Säuglingen ruhig erzählen konnte. Und immer hatten sie auch etwas Leckeres zu essen dabei, das schwesterlich geteilt wurde.
In dem Sommer, in dem wir zum ersten Mal staunend die Augen öffneten, wurden oft Erdbeeren herumgereicht; es war ein grandioses Erdbeerjahr, sie waren so groß wie Enteneier, und die ganze Welt duftete nach dem süßlichen, schwülen Aroma. Mit spitzen Fingern pflückten unsere Mütter das Krönchen von den Früchten, bissen sie in der Mitte durch und schoben uns die Stücke sanft zwischen die blubbernden Lippen. Der Saft lief uns übers Kinn und rann uns ins Hemdchen.
»Vorsicht vor den Wespen«, warnte die Mutter von Loes.
Im Meer der Mütterleiber war sie die Einzige, die man im Schlaf erkennen konnte. Weil sie nach Patschuli roch und unsere Mütter allesamt nach Paris von Yves Saint Laurent. Unsere Mütter hatten ja auch unsere Papas, sie hatten einen Mann, der ein Parfüm bezahlen konnte, das in der Avenue angepriesen wurde, und einen Schrank voller sexy Sommerkleider obendrein.
Die Mutter von Loes in ihren selbst genähten, immer schwarzen, fließenden Gewändern und mit ihrem gleichermaßen schwarzen und fließenden Haar war in mehr als nur einer Hinsicht eine Ausnahme, denn sie wohnte als Einzige mitten im alten Ortskern. Noch nicht so lange, antwortete sie, darauf angesprochen, und lachte. Unsere Mütter waren ganz vernarrt in sie, auch wenn sie lange nicht so viel über sie erfuhren, wie sie gern gewollt hätten. Sie war die Fröhlichste von allen und hatte für jedes Problem eine Lösung. Sie konnte mithilfe von Tarotkarten die Zukunft vorhersagen. Zurückzuschauen habe keinen Sinn, sagte sie immer, man müsse den Blick nach vorn richten. »Seht mal, das ist die Drei der Becher. Die Karte der Freundschaft«, sagte sie zu unseren verwaisten Müttern. »Das ist die wichtigste Karte im Spiel.«
Gemeinsam machten wir Bäuerchen und produzierten volle Windeln. Wir schliefen, hatten Krämpfe, lernten, dass man lachen musste, wenn »tata« zu einem gesagt wurde, wir steckten Dinge in den Mund, wir wuchsen. Wir wuchsen und gediehen prächtig. Zuerst krabbelten wir noch auf allen vieren in der Welt umher, aber schon bald fingen wir an zu laufen und zogen zerbrechliche Gegenstände vom Tisch. Wir probierten die Steckdosen aus und entdeckten die Treppe. Wir sagten zum ersten Mal »Mama« und wurden schier totgeknuddelt. Jedes Mal, wenn wir etwas Neues machten, wurde eine Videokamera auf uns gerichtet. Soviel wir wussten, drehte sich die ganze Welt um uns, und zu bestimmten Zeiten pusteten wir die Kerzen auf Geburtstagstorten aus.
Papa schenkte uns eine farbenfrohe Rechenmaschine, damit wir später alles ausrechnen konnten, Kosten und Nutzen, Soll und Haben und den Rest, oder eine Puppe mit Schlafaugen und echten Locken, damit wir für eine mindestens genauso wichtige Arbeit üben konnten. Mit seiner schweren Papahand wuschelte er uns durchs Haar. Er zog uns an sich. Er rollte sich mit uns über den Badezimmerfußboden. Seine Miene stand auf HAHAHA. Er gab uns eine Abreibung mit der Gartenspritze. Samstagnachmittags wuschen wir zusammen das Auto, beide mit einer Bürste, um die Felgen zu säubern. Sonntags werkelten wir im Garten. Wir steckten Blumenzwiebeln in die Erde oder harkten das Laub zusammen. »Wohnen wir hier in einem kleinen Paradies oder nicht?«, sagte Papa. Aber manchmal schaute er über unseren Kopf hinweg zu den dünnen Polderulmen, und dann seufzte er plötzlich.
Abends, wenn sie dachten, wir schliefen, sagten unsere Mütter in scharfem Ton zu ihnen: »Aber du wolltest ja unbedingt hierher!«
»Ach, und du nicht, was?«
»Und jetzt muss ich jeden Abend mit dem Essen auf dich warten.«
»Was hattest du denn erwartet? Dass meine Firma hier in diesem Nest eine Filiale eröffnen würde?«
»Du bist den ganzen Tag weg, und ich hocke hier mit den Kindern!«
Durch die Wand hindurch hörten wir, wie böse unsere Mamas waren. Sie wollten zeigen, wer sie waren, dem Universum, unseren Vätern, vielleicht sogar uns. Sie seien doch einzigartig, verflixt noch mal, sie hätten alle möglichen Fähigkeiten und Talente, o ja, überdurchschnittliche sogar! Nach so einem Ausbruch konnte man darauf wetten, dass sie uns am nächsten Morgen unsere Liga-Biskuits mit verkniffenem Mund und vorwurfsvollem Blick schmieren würden: Unseretwegen waren sie schließlich an Händen und Füßen gebunden. Weil wir unbedingt an einem Ort aufwachsen sollten, wo die Luft noch sauber war und man noch Brachen mit Wiesenkerbel hatte, konnten sie jetzt weder vor noch zurück. Wir waren das Kreuz, das sie zu tragen hatten, tagaus, tagein.
Während sie leise über uns wetterten, verhielten wir uns mucksmäuschenstill. Wenn man wusste, dass man ein Kreuz für jemanden war, bekam man die trockenen Liga-Krümel fast nicht hinunter, und das Herz begann einem immer banger zu hämmern. Man setzte mit seiner Geburt offenbar eine ungeahnte Kettenreaktion in Gang. Mama stellte für einen ihre Interessen zurück! Sie opferte sich für einen auf! Sie hatte eine ganze Litanei von Mutterausdrücken, die dafür sorgten, dass einem die Buntstifte noch Stunden später vor Zittern auf dem Papier ausrutschten.
An Tagen, die so grimmig anfingen, machte man mittags oft einen Besuch im alten Pfarrhaus auf dem Dorfplatz, wo Loes mit ihrer Mutter und den Lucos wohnte.
Es war ein großes, etwas zugiges Haus mit mechanischer Türklingel, getäfeltem Treppenhaus und knarrenden Holzfußböden. Im ersten Stock war das Arbeitszimmer von Loes’ Mutter, die ja lieber den Blick nach vorn richtete und sich um alles Übrige nicht so sehr kümmerte. Bücher und Papiere lagen einfach in Stapeln auf dem Fußboden herum. In den Fensterbänken standen Marmeladengläser mit eingetrockneten Farbresten, und an allen Wänden hingen Holzkohleskizzen, die sie im Laufe der Arbeit an einem Bilderbuch angefertigt hatte. Klaartje 13 war ihr berühmtestes Buch, über eine Kuh, die immer Pech hatte. Wir hatten alle ein Exemplar davon zu Hause.
In der dunkelsten Ecke des Zimmers stand ein Tisch mit einer grünen Filzdecke. Das war der Tarottisch. Dort wurde über Glück oder Unglück entschieden. Dort sorgte die Fünf der Stäbe für inneres Ringen, stellte das Rad des Schicksals alles auf den Kopf oder tauchte der Ritter der Kelche als Retter in der Not auf. Daran sei wirklich nichts Übernatürliches, sagte die Mutter von Loes, aber he, sieh mal einer an, da sei die Zwei der Münzen, diese wunderbare Karte der Veränderung, und dazu noch die Hohepriesterin, die Schutzkarte schlechthin.
Begierig ließen sich unsere Mamas die Wendungen ihres Schicksals aus den Karten lesen. Sie beugten sich über die sonderbaren Karten, die die Bildergeschichte ihres Lebens darstellten. Unterdessen gafften wir Loes’ Mutter an. Sie hatte ein Grübchen in der einen Wange. Ihre Augen hatten die Farbe von Kornblumen. Die Knöpfe ihrer Bluse waren nie alle zu, und wenn sie die Beine übereinander schlug, schaute ein gebräuntes Bein aus dem tiefen Schlitz ihres schwarzen Rocks hervor. Wenn man sie ansah, wurde einem immer so angenehm schwummrig von innen, dass man sich gar nicht vorstellen konnte, dass sie im Ernst die Mutter von jemandem war. »Loes ist oben«, sagte sie, von den Karten aufblickend, »geht mal schön mit ihr spielen.«
Und auch das ließen wir uns nicht zweimal sagen. Eilig klommen wir die Treppe hinauf, bei der jede Stufe leise ächzte.
Weil kein Mensch allein von Bilderbüchern leben konnte, wohnten im zweiten Stock die Lucos, beide in einem Zimmer mit Frühstück. Die Lucos waren leicht phlegmatische, freundliche Männer unbestimmten Alters, die ständig telefonierten. Ansonsten bemerkte man sie meist kaum, abgesehen von ihren Schuhen, die im Flur aufgereiht standen. Die von Ludo waren allesamt schwarz, mit Lochmuster, die von Duco waren Turnschuhe in verschiedensten Stadien des Zerfalls. Wir hielten uns die Nase zu, wenn wir daran vorbeigingen.
Loes’ Zimmer war ganz oben unter dem Dach.
Am Hahnenbalken hing eine Schaukel. In der Fensterbank der Dachgaube stand immer ein frischer Veilchenstrauß. Der Fußboden war mit kleinen Teppichen und Kissen übersät. Loes hatte keine Minny-Mouse-Nachttischlampe wie wir, sondern eine Christbaumlichterschnur, die in kunstvollen Windungen an die Wand über ihrem Bett genagelt war. Auf die gegenüberliegende Wand hatte ihre Mutter einen Regenbogen gemalt und darunter ein Boot auf blauem Meer, aus dem Giraffen, Zebras und Löwen neugierig die Köpfe herausstreckten.
Meistens saß Loes im Schneidersitz auf dem Fußboden, wenn wir hereinkamen, ganz allein in ein Spiel vertieft, das uns gleich auf den ersten Blick das einzig wahre Spiel für diesen Tag zu sein schien, ja sogar das Spiel, ohne das man diesen ganzen Tag hätte abschreiben können. Enthusiastisch setzten wir uns neben sie und spuckten in die Hände.
Unter ihren Kleidchen aus indischer Baumwolle waren Loes’ Knie immer verschrammt, ihre Füße schauten schmuddlig aus Plastiksandalen hervor, und unter ihren Nägeln saß der halbe Grabenrand. Sie war genauso alt wie wir, aber sie hatte schon viel mehr erlebt. In einer Schlossruine hatte sie in einer verrosteten Kiste Golddukaten gefunden, sie hatte mit Säbelzahntigern gekämpft, war mit einem grasgrünen Papagei auf der Schulter auf einem Piratenschiff gefahren und hatte unzählige Gläser Limonade umgestoßen, ohne dass es eine Katastrophe gegeben hätte. Das hätten wir mal zu Hause versuchen sollen. Bei uns zu Hause machte Limonade Flecken ins Tischtuch.
Darüber, wie sich das mit den Flecken verhielt, baten wir unsere Väter mehr als nur einmal um Aufschluss. Papas wussten ziemlich viel. Aber das verstanden nicht einmal sie. Außerdem bekamen sie immer einen eigenartig starren Blick, wenn wir schilderten, wie es im Pfarrhaus zuging, und erklärten, dass Loes’ Mutter einfach nur lachte, wenn jemand kleckerte. Und dann erhoben sie sich hüstelnd und gingen mit unserem King oder unserem Whiskey oder unserer Blondie Gassi.
Loes berichtete, dass unsere Väter manchmal den halben Abend mit dem Hund in der Anlage herumlungerten. Sie starrten zu den erleuchteten Fenstern des Pfarrhauses hinauf. Sie kratzten sich im Schritt. Und dann verzogen sie sich wieder. In ihr wundervolles Eigenheim zurück. Fort von den Gefahren, die das Wohnen in einem Denkmal mit sich brachte: Betonfäulnis, Mörtelermüdung und sich senkende Balken. Man musste verrückt sein, wenn man heutzutage noch in so etwas wohnen wollte, dachten unsere Väter, und sie tippten sich an die Stirn.
Loes sah das. Ihr entging nicht die kleinste Kleinigkeit, denn sie hatte nicht nur eine Dachgaube, sondern auch Adleraugen. In dem großen, verwilderten Garten hinter dem Pfarrhaus teilte sie uns jeden Nachmittag ihre Beobachtungen mit. Wir saßen auf dem Rand der Sandkiste, die die Lucos für sie gebaut hatten, und lauschten ihren Analysen. Näherte sich ein Erwachsener, blickte sie mit Grübchen in den Wangen und schief gelegtem Kopf herzig zu ihm auf.
»Spielt ihr was Schönes?«
»Ja«, brabbelten wir voller Ungeduld.
»Was denn?«
»Eskimo«, sagte Loes.
Nein, diese Kinder! Was sie heute wieder gesagt haben! Köstlich! Auf so etwas können auch nur Kinder kommen!
Und so tauschten wir ungestört eine Menge Informationen aus, während wir unsere Milchzähne verloren, zum ersten Mal Knöpfe zuknöpften und unseren Omas erzählten, was wir alles machen würden, wenn wir erst vier wären. »Dann gehe ich zur Schule«, lispelten wir resolut. Und im Stillen dachten wir hoffnungsvoll: Und dann passe ich nicht mehr in mein altes Kinderbettchen. Mann, wenn man vier wurde! Dann wachte man morgens auf, und die Füße ragten plötzlich meilenweit durch die Stäbe des Gitterbettchens. Das wusste jeder.
Die Grundschule lag sieben Werst von unserem Viertel entfernt. Wir gingen jeden Tag die ganze Strecke zu Fuß dorthin, stoisch wie Seehundjäger, und wir lernten dort ausschneiden und kleben und Untersetzer flechten. Wir machten auch eine Klassenfahrt zum Utrechter Dom. Beim Anblick der riesigen Orgel fragte Loes entzückt: »Ist das jetzt die Freiheitsstatue?«
Auf dem Rückweg sangen wir ein russisches Seemannslied.
Wir brauchten keine Tarotkarten, um in die Zukunft blicken zu können, nicht einmal die Drei der Becher. Für uns stand unumstößlich fest: Wir würden immer Freunde bleiben.
B ist eine Brennnessel
In den Sommerferien, in denen wir sechs wurden – zwar alle einzeln und nacheinander, aber schon mehr oder weniger gleichzeitig –, regnete es unaufhörlich. Es regnete so stark, dass uns die Zehen in den Gummistiefeln schimmelten und die Haut unserer Fingerkuppen dauernd schrumplig war. Es regnete morgens, mittags und abends, es regnete bei jedem Geburtstagsfest und auch danach noch, wenn unsere Eltern uns abholten. Jeder wusste, dass es ein böses Vorzeichen war, wenn am Geburtstag Regenschirme aufgespannt wurden. Dann hing etwas in der Luft, dann stand etwas Schlimmes bevor.
Nur nachts blieb es manchmal einige Stunden lang trocken, als sammelten die Elemente im Dunkeln, unbeobachtet, neue Kräfte. Aber eine Verschnaufpause war uns auch dann nicht vergönnt, denn über das laut in der Dachrinne gurgelnde Wasser drang der Regen nach wie vor in unseren Schlaf ein. Wir träumten, dass der Graben bei der Brache, auf der wir immer spielten, über die Ufer trat und zu einem tosenden Strom anschwoll. Mit einem Höllentempo donnerte das Wasser über die Straßenschwellen in unser Viertel hinein. Es klatschte gegen die Haustüren. Es stieg und stieg. Als wir aus unserem Schlafzimmerfenster nach draußen schauten, glupschten uns Fischaugen gleichgültig an. Verschreckt zogen wir einen Stuhl heran, um durch das Oberlicht sehen zu können. Auf den mondbeschienenen Wellen sahen wir für immer unbrauchbar gewordene Lampenschirme vorübertreiben, Töpfe, in denen Zimmerpflanzen geprunkt hatten, Tischtücher mit schon verlaufendem Kreuzstichmuster von unseren Omas, Fußmatten mit der Aufschrift WILLKOMMEN, zerlesene Zeitungen und die Polster des Sofas, für das unser Papa so hart gearbeitet hatte. Da dümpelte sogar ein Herd vorbei, auf dem noch die Töpfe klapperten, gefolgt von einer ganzen Familie im Emailleseiher, die panisch paddelte. Nicht mehr lange, und es würde uns an den Kragen gehen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!