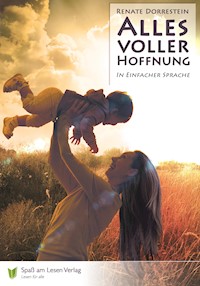10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wenn die programmatische Aussage in «Die Mühlen der Liebe» um die Funktion der Frau als «Hüterin und Ernährerin» der Menschheit kreist, so ist in «Von schlechten Müttern» die weibliche Funktion des «Gebärens und Säugens» Zielscheibe von Renate Dorresteins scharfzüngiger Kritik. Mit diesem Roman rückt sie in gewohnter Bravour mit schwarzem Humor, bissig-witzigen Formulierungen und skurrilen Einfällen einem weiteren tabuisierten Fundament unserer Gesellschaft zu Leibe: der heiligen Rolle der Frau als Mutter.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 354
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Renate Dorrestein
Von schlechten Müttern
Über Renate Dorrestein
Über dieses Buch
Inhaltsübersicht
Von allen Frauen, von allen Zeiten
Gestern abend sah ich in der Hotelhalle einen Mann, der aussah wie Zwier, und mit einem Schock stellte ich fest, daß mein Herz bei diesem unerwarteten Anblick noch immer einen Takt lang aussetzte. Der Mann saß unter einer Kübelpalme in einem Armsessel. Er blätterte in einer Zeitschrift.
Ich kam gerade aus der Cocktailbar, wo ein deutscher Geschäftsmann mich gefragt hatte, was eine Frau wie ich so ganz allein in diesem Teil der Erde täte. Ich war auf dem Weg zur Rezeption, um mir meinen Schlüssel zu holen und mich für den Rest des Abends in meinem Zimmer zu verkriechen, was das Vernünftigste ist, was eine Frau so ganz allein in diesem Teil der Erde tun kann, sobald deutsche Geschäftsleute auf der Bildfläche erscheinen. Dieser schien mir einer von der Sorte zu sein, der sein eigenes Blutplasma im Koffer für den Fall dabei hat, daß ihm – im Hilton von Nairobi – etwas zustoßen sollte. Er bot mir einen Whisky Soda an, als er mir diese Frage stellte. Ich saß noch keine zwei Minuten an der Bar, ich hatte mich auf einen Drink gefreut, wozu begibt man sich sonst schon in die bewohnte Welt, folglich blieb mir nichts anderes übrig, als dem Mann zu gestatten, neben mir Platz zu nehmen. Aber er meinte es auch noch ernst: Er wollte wirklich wissen, was meine hübschen Beine veranlaßt hätten, bis nach Afrika zu marschieren. Also sagte ich, daß ich gerade zwei Monate auf dem Mount Kenya verbracht hätte, wo die spektakuläre Flora des Großen Grabens ihren absoluten Höhepunkt erreicht: Die Hänge sind mit einer Vegetation bedeckt, die infolge der klimatischen Bedingungen ungeheuerliche Dimensionen annimmt. Ich war gerade rechtzeitig dagewesen für die gewaltigen Blütensäulen der Riesenlobelie, die nur alle sieben Jahre blüht, mit Fackeln von gut sechs Meter Länge.
Während ich das dem Deutschen erzählte, sah ich die gigantischen Kampferbäume wieder vor mir, zu groß und zu schwer für ihr eigenes Wurzelsystem, so daß sie früher oder später umstürzen, um ruhmlos vor sich hin zu modern, und in diesem Moment war mir klarer denn je zuvor, daß ich die hilflosen Gewächse des Feldes mehr liebe als Menschen mit einem Siegelring an jedem kleinen Finger. Ich gehöre nicht unter deutsche Geschäftsleute, und wahrscheinlich gehöre ich auch nicht in Hilton-Hotels. Vielleicht hätte ich nie hierher kommen sollen. Ich meine, ich bin nicht gerade die Frau, die im kleinen Schwarzen, mit getuschten Wimpern und geschminkten Lippen auf einem Barhocker zu sitzen pflegt – so überzeugend ich diese Rolle auch spiele. Und es ist wirklich ein nützliches Kleid. Ich habe es schon seit Jahren.
Die Konvention verlangte, daß ich nun meinerseits den Deutschen fragte, was er hier eigentlich tue, aber das ließ ich bleiben, weil Deutsche meiner Erfahrung nach ja doch alle in der pharmazeutischen Industrie tätig sind. Obwohl sie noch nie eine Malariamücke aus der Nähe gesehen haben, produzieren und verkaufen sie wie die Weltmeister die fürchterlichsten Antimalariapillen. Na ja: Leben und leben lassen, das ist meine Devise.
Wir tranken noch einen. Und währenddessen geriet das Gespräch keineswegs ins Stocken. War der Mann vielleicht interessiert an meinen Riesenlobelien! Das Interesse, das er für sie an den Tag legte, ließ mich das Schlimmste befürchten: Dieser war einer von der Sorte, die bereit war, an meinen Lippen zu hängen, bis er schwarz wurde, was in seinem Fall einige Zeit dauern würde. Vermutlich war er nicht im geringsten auf die Verlockungen meines Körpers aus – bei näherer Betrachtung schien er mir eher ein Mann zu sein, der in der Fremde eine warme Hand zum Festhalten braucht; Vati ist in Afrika, Vati ist ein wenig ängstlich, außerhalb des Hilton lauert ein wahrer Hexenkessel von Stadt, eine Stadt wie eine Gehirnerschütterung, mit ebenso vielen Elendsvierteln, verstümmelten Bettlern und stinkenden Märkten wie weißen Appartementhäusern und breiten Boulevards. Am liebsten würde er sich an mir festklammern, mit diesen fleischigen Tentakeln, vor allem, wo sich zeigt, daß ich so eine beherzte Person bin, eben zurück aus einem tropischen Wald. Vati möchte einen Babysitter. Will er sich freilich meine Gesellschaft sichern, so müssen rasch neue Gesprächsthemen her! Ehe ich mich’s versehe, wird er von der Lobelie auf mich zu sprechen kommen. Wie verschlägt es eine Frau wie mich in die tropische Botanik, könnte die Überleitung lauten. Nun, das ist eine lange Geschichte.
Natürlich spielt es keine Rolle, was ich darauf antworte. Solange er nur meine Stimme hört. Von ihm aus kann ich bei meiner eigenen Empfängnis anfangen. Mein Vater, könnte ich ihm ruhig erzählen, zeugte mich kurz nach der landesweiten Sammelaktion «Geldbeutel auf, Deiche zu». Es war die Zeit der Solex, der Wohnungsnot, der Regierung Drees und der Auswanderung nach Kanada; und Paragraph 451 des Strafgesetzbuchs verbot den öffentlichen Verkauf von Kondomen. Leider war meine Mutter nicht so fruchtbar, wie von den Frauen der Nachkriegszeit erwartet wurde; nach ihrer ersten Tochter mußte sie achtzehn Jahre auf mich warten. Das war nichts für sie! Meine Mutter ist ein Mensch, der das Schicksal am liebsten in die eigene Hand nimmt. Ihr eigenes Schicksal plus das anderer. Auch mit mir hatte sie Pläne. Ich sollte es weiter bringen als meine Schwester. Nicht, daß das so schwer gewesen wäre: Die hatte mit achtzehn, kurz nach meiner Geburt, geheiratet, und das war alles.
Meine Geburt, Herr Sticklebauer, war übrigens kein Kinderspiel, obwohl ich, wie es heißt, von dem Moment an, da die Spermien meines Vaters endlich den Weg in die Eizelle meiner Mutter gefunden hatten, besorgniserregend unter dem als wünschenswert erachteten Gewicht geblieben war. Der Brutkasten stand sozusagen schon bereit: Ich muß so ein blutarmer, mitleiderregender Embryo gewesen sein, wie man sie auf den Bildern sieht, mit denen Abtreibungsgegner Ehrfurcht vor dem Leben zu erzwingen versuchen, so ein spindeldürrer Fetus mit verzweifelten Händchen, an denen bereits zehn Fingerchen zu erkennen sind, wenn das ganze Wesen noch nicht größer ist als eine Erbse. Kennen Sie die?
Kurz und gut, man würde meinen, ein derart mickriges Kind wie ich ließe sich schnell und leicht auf die Welt bringen, aber von wegen. Es fehlte nicht viel und meine Mutter wäre bei der Entbindung verblutet. Sie erzählte oft nachgerade entzückt, daß ich sie beinahe umgebracht hätte. Literweise Blut verloren zu haben und irreparable Risse erlitten zu haben, das waren Großtaten, mit denen man als Mutter in den fünfziger Jahren noch ordentlich Ehre einlegen konnte. Schlimme Entbindungen waren ein beliebtes Gesprächsthema – bei einer gemütlichen Zigarette. Mutterschaft kam mir daher von klein auf als eklige, blutige Angelegenheit vor. Ohne mich!
Was aber hat ein Wildfremder in einer Hotelbar in Nairobi damit zu tun? Mein Leben gehört mir, und andere sollen sich gefälligst an ihr eigenes halten. Als ich also kommen sah, daß er gleich einen dritten Whisky bestellen würde, wonach mein gesamtes Tun und Treiben auf den Tisch käme, da verließ ich rasch die Bar, ging zur Rezeption, um meinen Zimmerschlüssel zu holen, und sah im Foyer einen Mann, der mich an Zwier erinnerte.
Einen Moment lang dachte ich, er wäre es wirklich. Was ja auch durchaus möglich gewesen wäre, denn er dürfte wohl ebensooft in Afrika sein wie ich. Das kann ich ihm schließlich nicht verbieten.
Während dieses kurzen Moments, als ich glaubte, ihm nach all den Jahren wieder gegenüberzustehen, stockte mir der Atem. Er war noch immer genauso attraktiv mit seinen dunklen Locken und diesem langen, mageren Körper, der athletisch ist, ohne auf ärgerliche Weise muskulös zu sein. Wie immer war er gebräunt und leicht unrasiert und saß, völlig in sich versunken, mit diesem schwülen Blick da, den ich so gut an ihm kenne. Kein Mann, der eine warme Hand braucht, o nein. Ein Mann mit erstaunlich hoher Voltzahl. Einer, von dem man denkt: Dich muß ich vor dir selbst retten. Nur ich kann dich verstehen und dir notfalls verzeihen. Welche Herausforderung stellt ein Mann wie Zwier dar! Wer wird den guten Kern unter der rauhen Schale erkennen und zur Entfaltung bringen? Wer schon, wenn nicht ich?
Als ich im nächsten Moment erkannte, daß es ein Unbekannter war, der sich hier wie ich im Hilton Nairobi aufhielt, war ich zu meinem eigenen Entsetzen enttäuscht. Aber was hatte ich denn gewollt? Lässig in meinem kleinen Schwarzen auf ihn zuschlendern? Er hätte mich nicht einmal erkannt mit meiner Wimperntusche und dem Lippenstift. Ich hätte mich ihm vorstellen müssen. He, Zwier, kennst du mich noch? Du bist mit mir verheiratet, weißt du noch?
Genaugenommen sollte ich lieber dankbar sein, daß es sich nur um einen Doppelgänger handelte. Der Himmel mag wissen, was in Zwier fahren würde, wenn ich plötzlich wieder in seinem Leben auftauchte. Nein, so war es viel besser.
Ich war immer der Meinung, daß es so besser war. Für alle.
Oder habe ich etwa kein erfülltes, befriedigendes Leben? Mein Gott, wenn es jemanden gibt, der sich als Schmied seines eigenen Glücks bezeichnen darf, so doch wohl ich. Situationen, die mich einengten oder einschränkten, bin ich immer aus eigener Kraft entronnen. Ich bin mit Energie für sechs und mit Mut für zehn gesegnet. Anders kann ich es nicht nennen. Mich kriegt keiner unter. Jetzt, wo ich siebenunddreißig bin, kann ich wohl mit Fug und Recht behaupten, daß ich einfach nicht unterzukriegen bin. Manchmal erfordert das Opfer, aber im großen und ganzen ändert es nichts an der Qualität meines Lebens. Wenn ich Riesenlobelien erforschen will, gehe ich auf den Mount Kenya. Und wenn ich nach so einem Projekt ein paar Tage zu überbrücken habe, dann gehe ich in ein gutes Hotel, wo man den Tee in silbernen Kannen serviert bekommt. Tee, der dem chai nicht das Wasser reicht, den die kleinen Jungs auf der Straße verkaufen, aber darum geht es hier nicht. Ich meine, ich kann tun und lassen, was ich will. Ich bin keinem Menschen Rechenschaft schuldig. Keinem. Und das ist mir eine Menge wert. Mehr als sich je in Worten ausdrücken ließe. Und ansonsten ist mein Leben eben mein Leben, und das geht niemand einen feuchten Dreck an.
Der Mann, der aussah wie Zwier, zumindest von weitem und eigentlich nur von der Seite, sprang auf, als eine Frau und zwei Kinder aus dem Lift traten. Alle drei trugen Safarianzüge. Europäer sind fast immer gleich lächerlich, sobald sie sich auf diesen Erdteil begeben. Ihre erste Frage lautet, ob es schwarze Mambas gibt, hier, im klimatisierten Foyer des Hilton Nairobi. Die Töchter, sah ich, als sie an mir vorbeigingen, waren obendrein Zwillinge. Wie gräßlich, ein Zwilling zu sein! Aber glaub bloß nicht, solche selbstzufriedenen Eltern wie dieser Zwier-Doppelgänger und seine blonde Göttin verschwendeten jemals einen Gedanken daran. Ständig davon reden, was gut für Kinder ist – aber sonst! So was bringt mein Blut nun wirklich in Wallung, obwohl ich eigentlich klüger sein müßte. Ehe man sich’s versieht, hat man irgendwo eine Verstopfung oder Embolie oder so was Ähnliches, und den Mount Kenya, mit dem eigenen Gepäck auf dem Rücken, kann man sich dann für den Rest seines Lebens abschminken. Und das ist doch das einzige, was zählt. Einmal habe ich mich auf mein Motorrad geschwungen, nur weil ich Tausende von Kilometern entfernt durch einen Mangrovensumpf wandern wollte, wo man zusehen muß, wie man über die Stelzwurzeln kommt. Unter diesen grünen Bäumen mit ihren glänzenden Blättern herrscht eine düstere, feucht-warme Atmosphäre, und das Wasser in den Sumpflachen ist dunkel, während überall – aber ich schweife ab.
Als die glückliche Familie in ihren bescheuerten Safarianzügen aus dem Hilton abgedampft war, bestimmt in so ein Nepplokal wie Under The Palm Tree, schnappte ich mir die Zeitschrift, in der der Mann, der mich an Zwier erinnerte, geblättert hatte. Es war eine mehrere Wochen alte Time. Die Titelstory handelte von dem Erfinder der Antibabypille, einen gewissen Dr. Gregory Pincus, und war aus Anlaß seines 25. Todestags verfaßt worden.
Nicht, daß ich mich jetzt noch erinnern könnte, wer entsetzter war, als sich herausstellte, daß ich die Pille vergessen hatte, Zwier oder ich.
Aber so ist es nun mal das beste.
Mama, Mama, rufen die Afrikaner, wenn sie eine weiße Frau sehen. Eine weißhäutige, muß man heutzutage übrigens sagen, und warum auch nicht. Wenn sie nicht wissen, daß man Swahili spricht, benutzen sie «Mama» für «Frau». Bestechend logisch, denn welche erwachsene Frau entrinnt schon der Mutterschaft? Eins zu null für Afrika. Mama, Mama!
Wenn ich ehrlich bin, fände ich es ganz nett, meinen Namen mal wieder in mein Ohr geflüstert zu hören. «Bonnie?» raunte Zwier manchmal. Und dann fragte ich: «Ja? Was?» Aber er sagte nur Bonnie, um Bonnie zu sagen. Das machte ihm Spaß, das törnte ihn an, oder vielleicht hatte er einfach schon wieder vergessen, was er hatte sagen wollen, was weiß ich.
In meinem Zimmer angelangt, rief ich den Roomservice an. Ein gleichgültiger, aber höflicher Ober brachte mir eine Flasche Whisky. Um ein Haar wäre ich der Versuchung erlegen, sie auf die Rechnung des deutschen Geschäftsmannes setzen zu lassen. Einfach so, zum Spaß. Aber ich sah ihn schon hoffnungsvoll die Treppe heraufstolpern und seine feuchten Hände nach mir ausstrecken. Ich selbst schwitze nie.
Die Flasche in Griffnähe, schlug ich die Time auf. Theoretisch sprach nichts dagegen, mich mal über die Geschichte der Antibabypille zu informieren. Wissen ist schließlich Macht. Oh, manchmal hänge ich mir selbst zum Hals heraus. Das kommt, wenn man allein lebt. Dann fängt man an, in ganzen Worten und Sätzen zu denken, als spräche man mit jemandem. Wissen ist Macht! Ach ja. Ich machte mich an die Lektüre.
Paläoanthropologen in ferner Zukunft, so der Artikel, werden dereinst, wenn sie auf unser Zeitalter zurückblicken, feststellen, daß die Erfindung des Ovulationshemmers von Dr. Pincus einer der revolutionärsten Marksteine in der Entwicklung der Menschheit war, vergleichbar vielleicht nur mit den Momenten, da der Mensch sich auf die Hinterbeine stellte, das Feuer zähmte, das Rad erfand und lernte, die Materie in Atome zu spalten: Nachdem Frauen dreieinhalb Millionen Jahre lang ihrer Fruchtbarkeit ausgeliefert gewesen waren, entdeckte Dr. Pincus Anno 1955, daß sich diese mittels Progesteron kontrollieren ließ. Dr. Pincus erlöste die Frauen von ihrer unabänderlichen biologischen Bestimmung. Von dem Augenblick an, als die Pille in der ersten Hälfte der sechziger Jahre auf den Markt kam, konnten die Frauen selbst bestimmen, ob und wie oft sie gebären wollten.
War also ausgerechnet ich an ausgerechnet diesem Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit geboren! Wenn das keine Ironie ist! Der Time zufolge gehörte ich zur ersten Generation Mädchen, die mit der beruhigenden Aussicht auf nahezu bombensichere Verhütungsmittel heranwuchs. War ich nicht ein Glückspilz?
An meine erste Pille erinnere ich mich noch ganz deutlich. Ich hatte dafür lügen, stehlen oder betrügen müssen, eins von den dreien, denn die Krankenkasse bezahlte die Pille damals noch genausowenig wie eine Abtreibung oder diese Schwangerschaftstests, bei denen man in ein Glas pinkeln und dann irgendwas mit einem Stäbchen tun muß, solche Tests, die man nicht kaufen kann, wenn man sich beispielsweise gerade im Hadar-Tal befindet. Das wäre doch was für so einen Sticklebauer. ’ne echte Marktlücke.
Ich nehme an, ich habe einen Griff in die Haushaltskasse meiner Mutter getan, um meine erste Pille zu kaufen. Drei Packungen in einer Schachtel, hergestellt von der Firma Organon in Oss. Die Deutschen sind clever, aber die Niederländer sind in dieser Hinsicht noch cleverer: Holland, so entnahm ich der Time, war eines der ersten Länder Westeuropas, in denen die Pille hergestellt wurde. Wie dem auch sei, als ich sie aus der Verpackung drückte, wußte meine Mutter natürlich nichts davon. Sie hätte geschlechtsreife Mädchen am liebsten bis zum Hals in kochender Lava eingegraben oder sie unten zugenäht. Mit ihr konnte ich folglich nicht über meine größte Sorge reden, daß nämlich diese gewichtige Pille so klein war. Man sah ihr den alles niedermachenden hormonalen Inhalt weiß Gott nicht an. Wenn sie bloß wirkte! Ich schluckte also sozusagen aufs Geratewohl und auch auf eigenes Risiko, denn keine zehn Jahre später sollten wir von Berichten aufgeschreckt werden, denen zufolge die Pille krebserregend war. Aber jetzt greife ich vor. Als ich meine erste Packung anbrach, war der Himmel noch wolkenlos und ich sechzehn oder siebzehn. Damit man sich ein Bild vom gesellschaftlichen Hintergrund machen kann: Als ich dieses höchst merkwürdige Alter erreicht hatte (nie mehr sechzehn oder siebzehn!), befanden wir uns in der Zeit der Dollen Minnas, der Aktion Tomate, dem Fegen des Dams durch Marinesoldaten und des Wirtschaftsnobelpreises für Prof. Jan Tinbergen.
Der Vater der Pille, Gregory Pincus, hat der Time zufolge nie einen Nobelpreis bekommen.
Daß Dr. Pincus das Hemmen der Ovulation zu seinem Forschungsgebiet machte, verdanken wir übrigens einer Frau. Für solche Details bin ich immer zu haben. Ich bin keine von denen, die sich stets beeilen, erschreckt zu erklären: «Aber nein, ich bin keine Feministin.» Sie hieß Singer oder so ähnlich, einen Moment, ich schau noch mal nach; hier: Margaret Sanger, Feministin und Pionierin auf dem Gebiet der Geburtenregelung in den Vereinigten Staaten. Bereits um den Zweiten Weltkrieg herum versuchte Sanger, dort die Verwendung des Pessars zu propagieren, bis sie einsah, daß das Scheitern ihrer Mission vermutlich mit der Tatsache zusammenhing, daß für die Benutzung des Pessars eine unsittliche Handlung erforderlich war. Sie war es, die den renommierten Biochemiker Pincus fragte, ob er nicht ein Verhütungsmittel entwickeln könne, das nicht das Geringste mit den Geschlechtsteilen zu tun habe: ein orales Empfängnisverhütungsmittel also. Keiner der beiden überlegte sich offenbar, ob nicht möglicherweise etwas an der Beweglichkeit der Spermien getan werden könne. Sie gingen anscheinend nach dem Sprichwort vor: Wer das Kind bekommt, darf es behalten. Also war es die Ovulation, die unterdrückt werden mußte.
Nun war meine immer schon unregelmäßig. Und in den Tropen ist auf den Hormonhaushalt schon gar kein Verlaß mehr. Okay, ich bin auch eine ziemliche Schluderliese, Tage im Kalender anzukreuzen ist nun mal nicht meine Sache, und da bin ich bestimmt nicht die einzige. Daher finde ich – alles zusammengenommen – die Behauptung dieses Time-Journalisten, seit Dr. Pincus seien nur noch Wunschkinder geboren worden, doch reichlich optimistisch.
Und was hat man schon davon, ein Wunschkind zu sein? Ich selbst war so ein sehnlichst erwünschtes Kind, und ich kann nicht behaupten, dieser Umstand hätte mein Leben einfacher gemacht. Ein Wunschkind wird der Lebensinhalt seiner Eltern. Der Durchschnittsmensch kann viel mehr Liebe vertragen, als er verdient, und das Durchschnittskind wurde gezeugt, um diesem Mangel abzuhelfen. Und dann tu mal was dagegen, als Kind. Ich mag zwar einiges auf dem Gewissen haben, aber solch sublimierten Egoismus habe ich mir zumindest nie zuschulden kommen lassen.
Aber abgesehen davon: Es ist das beste so. Egal, wie andere darüber denken. Ich selbst habe immer gewußt, daß es so wirklich das beste ist.
Also trank ich, eine Frau ganz allein in Afrika, ganz allein auf der Welt, noch einen Whisky auf den 25. Todestag von Dr. Pincus, gelobt sei sein Erfindergeist, obgleich das, was mich anbelangt, ein grundloser Glückwunsch war. Anyway, würde Zwier sagen. Wenn Zwier das Thema wechselte, sagte er immer: «Anyway.» Aber Zwier hatte noch einige andere Besonderheiten. Wenn es nur um seine Füllwörter gegangen wäre, wäre ich, wie jede sich langsam grau ärgernde Ehefrau, noch bei ihm. Aber ich bin gegangen. Und Zwier ist kein Mann, der es leichtnimmt, verlassen zu werden.
Anyway: Im Kielwasser der Bemühungen von Pincus und Sanger wurden in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch diverse andere geburtenregelnde Mittel entwickelt, so die Time. Hörst du, Zwier? Alter Schuft. Du glaubtest immer, ich verstünde nichts von Zahlen und Statistiken! Ha! Paß auf, mein Freund: Außer etwa hundert Millionen Pillenschluckerinnen laufen auf unserem guten Planeten Mutter Erde gegenwärtig auch noch sechzig Millionen Frauen mit einer Spirale herum, sechzig weitere Millionen haben sich sterilisieren lassen und etwa fünf Millionen verwenden ein implantiertes empfängnisverhütendes Präparat (Levonorgesterel der Marke Norplant) oder ein injizierbares Antikonzeptivum (Medroxyprogesteronacetat Depot der Marke Depo-Provera). Letztgenannte finden wir hauptsächlich in der Dritten Welt, dem räumlichen Äquivalent dessen, was zeitlich als Prähistorie betrachtet wird.
Daß sich der prähistorische Mensch groß von uns unterschied, glaubte Zwier nicht; das war eines seiner Steckenpferde. Er nahm schlichtweg an, daß sich eine geschichtliche Periode im Grunde nicht von der anderen unterscheide. Sein Arbeitsgebiet umfaßt rund dreieinhalb Millionen Jahre, dann betrachtet man ein Jahrhundert oder hundert Jahrhunderte nicht mit der Lupe. Im Gegenteil, dann sieht man nur, daß nahezu alle menschlichen Erfahrungen allen Menschen und allen Zeiten gemein sind.
Kurz und gut, auch der prähistorische Mensch liebte, haßte, schlug seine Feinde tot, arbeitete und gab das Erbgut seiner Ahnen an die Nachkommen weiter. Das einzige, das mich von ihm unterscheidet, ist die Tatsache, daß ich das Wunder der Befruchtung verstehe. Bloß – welche Frau, die jahrelang ein unbekümmertes, durch die Firma Organon ermöglichtes Liebesleben genossen hat, denkt denn schon jemals an das Wunder der Befruchtung? Eins zu null für mich!
Ich trank einen Whisky darauf an meinem Fenster in der dritten Etage des Hilton Nairobi, von dem aus man auf die brodelnde, dampfende Stadt sieht. Aus irgendeinem Grund fühle ich mich in afrikanischen Städten immer zu Hause. Fühle ich mich in Afrika zu Hause.
Zwier könnte das erklären: Stammt nicht die Urmutter der Menschheit aus diesem Erdteil? Auf diesem Kontinent hat die erste Menschenartige sich vor Millionen von Jahren auf den Hinterbeinen aufgerichtet. Fürwahr keine Kleinigkeit. Paläoanthropologen haben sie Lucy getauft, weil, als sie ihren unglaublichen Fund (die Knochen der ersten Hominiden!) sortierten, zufällig gerade ein Beatles-Band lief: Lucy In The Sky With Diamonds.
Lucy!
Amüsant, daß die Wissenschaft gegenwärtig davon ausgeht, daß die Menschheit ihre Existenz einer Frau zu verdanken hat und nicht einem Mann, nicht so einem Scheißkerl wie Zwier, verflucht seien seine Spermien! Der hatte zu lebendigen Samen, wenn man mich fragt.
Anyway, da saß ich also an meinem Fenster mit Blick auf Nairobi, während ich genausogut entspannt ein heißes Bad hätte nehmen können. Aber ich konnte meine Gedanken nicht von der Vergangenheit lösen, obwohl ich immer geglaubt habe, daß man ein Gedächtnis zum eigenen Nutzen und Frommen hat: Der Mensch braucht sich von ihm nicht an die Kandare nehmen zu lassen. Der Mensch muß sich weiterentwickeln, die Natur will voran, das sieht man auch an den Pflanzen: Bricht man sie ab, dann entwickeln sie irgendwo wieder einen komischen Trieb: Alles, was wächst und blüht, wird vorangetrieben.
Es brachte mich so durcheinander, daß Dr. Pincus und der Doppelgänger von Zwier mich dazu gebracht hatten, rückwärts zu blicken und alte Dinge wiederzukäuen, daß ich fast die ganze Whiskyflasche leerte. Dafür wurde ich nachts prompt mit einem schweißtreibenden Traum bestraft: Ich träumte, daß ich fünf oder sechs Kinder von verschiedenen Männern hatte und nur noch dabei war, Rotznasen zu putzen und tapsigen Fingerchen beizubringen, wie man Schuhe zubindet. Rührende Bilder. Herzerwärmend. Und daß Vati dann von der Arbeit nach Hause kam, und daß ich ihm einen Genever eingoß. Fünf bis sechs Gläser also, und die Kleinen alle auf dem Sofa aufgereiht.
Der Inbegriff von Gemütlichkeit!
Beim Frühstück ging’s mir dreckig. Ich trank gerade mein x-tes Glas Orangensaft, als es noch schlimmer kam: Mein deutscher Freund betrat den Frühstücksraum. Er schien sich riesig zu freuen, mich allein an einem Tisch zu sehen, und setzte sich ohne Umschweife dazu. Ob ich bereits etwas vorhätte für heute abend. Denn sonst würde er mich gern in einen dieser netten Clubs mitnehmen, von denen man soviel hörte, wie zum Beispiel Under The Palm Tree. Er sah sowohl verwegen als auch vorsorglich schon tödlich erschrocken drein, als er mir diesen Vorschlag machte. Ach, Herr Sticklebauer! Worüber sollten wir denn den ganzen Abend sprechen? Doch nicht schon wieder über mich? Na ja, über wen sonst. Die Alternative reizte mich noch weniger. Nur, wo waren wir stehengeblieben? Ach ja: bei meiner frühesten Jugend. Wir befinden uns also noch auf relativ sicherem Gebiete. Nun denn.
Ich war kein glückliches Kind – ich war böse und aufsässig. Bei mir zu Hause, müssen Sie wissen, gab es nämlich ein GEHEIMNIS, und nichts macht ein Kind so querköpfig wie die Tatsache, in der Nähe eines richtigen Geheimnisses leben zu müssen, ohne eingeweiht zu werden. Niemand erzählte mir, warum meine Schwester so sehr in Ungnade gefallen war, daß selbst ihr Name kaum noch erwähnt werden durfte. Und wie meine Mutter schweigen konnte! Ohrenbetäubend konnte sie schweigen, und mir war schon als Dreijährige klar, daß ihre Lippen bis in alle Ewigkeit versiegelt bleiben würden, wenn sie sich vornahm, über irgend etwas nicht zu sprechen. Um die normalsten Dinge zu erfahren, mußte ich bereits Himmel und Hölle in Bewegung setzen. Glauben Sie bloß nicht, so etwas Interessantes wie das Wunder der Befruchtung wäre je spontan zur Sprache gekommen! Wo ich herkam, blieb offen, bis ich eines Tages auf der ersten Seite der Zeitung, hinter der mein Vater sich versteckte, das Wort VERGEWALTIGUNG buchstabierte. Als ich fragte, was das bedeute, waren wir gerade im Begriff, uns zu Tisch zu setzen. Meine Mutter warf meinem Vater einen besonders scharfen Blick zu, woraufhin er sofort den Raum verließ und sie und ich ein Gespräch über die facts of life hatten.
Als Vorspiel klärte mich meine Mutter erst, in knappen Worten, über den freiwilligen Geschlechtsverkehr auf. Das hörte sich für meine Ohren höchst unwahrscheinlich an. Es wollte mir nicht in den Kopf, daß sie sich so etwas jemals von meinem Vater gefallen lassen würde, da sie es noch nicht einmal ertrug, wenn er manchmal für einen Moment die Hand auf ihren Arm legte. Beim Phänomen Vergewaltigung war sie dann noch einsilbiger. Das passiere nur Schlampen. Sie verzog ihren Mund zu einem Strich, als sie das sagte. Sehen Sie es vor sich?
Der Deutsche schmierte Butter auf sein Croissant und sah mich hoffnungsvoll an. Nein, sagte ich schnell, ich hätte heute abend etwas ganz anderes vor, leider.
Ich habe nämlich vor, mich hier noch einmal richtig zu amüsieren, bevor ich in ein paar Tagen ins Flugzeug steige. Und sei es nur aus dem Grund, weil ich daheim in den Niederlanden wieder die Rolle der gehorsamen Tochter zu spielen habe; die seltenen Male, die ich im Land bin, komme ich nun mal nicht umhin, meine Mutter zu besuchen. Sie macht mich wahnsinnig. Jedes Gespräch mit ihr endet über kurz oder lang beim selben Thema: Sie hat nie aufgehört, mich mit Vorwürfen zu überhäufen.
Aber zufällig habe ich nicht vor, mein Leben lang für einen einzigen Irrtum zu büßen. Erspar mir deine heilige Entrüstung, Mutter! Auf der ganzen Welt werden täglich Kinder vernachlässigt, ausgebeutet und ihrem Schicksal überlassen. Kümmere dich um die! Geh zu Unicef!
Und, zum Teufel, da stob die Familie Zwier auch noch in den Frühstücksraum. Pappi Zwier, Mammi Zwier und die entzückenden Zwillingsmädchen Zwier. Auch heute waren sie alle in geschmackvolle Tarnkleidung gehüllt. Unerträglich. Sie setzten sich und blickten hungrig um sich.
Sofort bestellte ich bei einem der zahlreichen weißgekleideten Kellner noch eine Tasse Kaffee, um mir selbst zu beweisen, daß ich mich von den Zwiers nicht vertreiben ließ, was dumm von mir war, denn Herr Sticklebauer faßte das als Beweis dafür auf, daß ich ihm gern noch etwas Gesellschaft leistete, und fing wieder von seinem kleinen Essen an, dann eben an einem anderen Abend. Wir waren als Europäer in der Diaspora inzwischen natürlich längst so intim, daß er unvermittelt sagte, er heiße Hubertus mit Vornamen.
Hubertus?
War das nicht der Schutzpatron der Jäger?
Unterdessen studierte Mammi Zwier zwei Tische weiter die Karte, als wäre es ihre Examensarbeit. Die Zusammenstellung eines möglichst gesunden Frühstücks für ihre Familie nahm sie völlig in Anspruch. Sie war eine, für die Mutterschaft eine heilige Berufung war, das sah man gleich. Sie war eine, die, wenn man ihr ein Mikrofon unter die Nase hielte, mit Zuckeraugen erklären würde, daß die Mutterschaft nun einmal die natürliche Bestimmung der Frau sei. Die Frau habe doch schließlich ein Loch zwischen den Beinen? Das sei doch kein Zufall? Es entspreche dem Schöpfungsplan, daß daraus Babies purzeln. Sonst hätte die Frau wohl kein Loch – ihre Biologie sagt es doch schon!
Hat sich denn in all den Jahrhunderten nichts geändert? Heutzutage darfst du zwar einen netten Nebenjob haben, gewiß doch, aber gebären und säugen sollst du, gebären und säugen sollst du, bloß weil Frauen das seit Anbeginn der Menschheit getan haben. Schier platzen sollst du vor mütterlichen Trieben, bloß wegen dieses Lochs zwischen deinen Beinen. Dieser Wahnsinn! Wenn wir so anfangen – da kann ich auch ein Wörtchen mitreden. Genausogut kann man dann zum Beispiel behaupten, Frauen seien in Anbetracht ihrer physischen Möglichkeiten dazu geboren, geschaffen, vorbestimmt, um vergewaltigt zu werden, und auf Grund ihres biologischen Potentials wollten sie auch nichts lieber als das.
Das ist was für Schlampen, sagte meine Mutter abfällig, als ich das Wort VERGEWALTIGUNG in der Zeitung gesehen hatte, meine Mutter, die der Ansicht ist, ich hätte die Naturgesetze übertreten. Mir aber scheint Vergewaltigung eine Erfahrung zu sein, der frau sich noch schwerer entziehen kann als der Mutterschaft. Finden Mann und Frau sich hier nicht auf verblüffende Weise? Wie ihre natürliche Bestimmung sich mit seiner natürlichen Berufung deckt!
Was wußte ich denn schon, als ich zur Zeit des Bikinis, des Farbfernsehers und der Mwst gemeinsam mit einem Freund einen kalten Dachboden bezog. Eines Tages fing er an mich zu schlagen. Ich war zwanzig. Ich sammelte Rabattmarken von Douwe Egberts; eine ganze Küchenschublade voll hatte ich schon, nicht wegen der Häuslichkeit, sondern aus Armut. Für 8000 Punkte bekam man einen Teelöffel geschenkt. Es war mir keineswegs bewußt, daß ich nicht allein dastand. Ich glaubte, ich sei die erste Frau in der Geschichte, die geschlagen wurde. Ich kam nicht auf die Idee, zurückzuschlagen. Erst als ich mit einer gebrochenen Nase dastand, war das Maß voll. Ich forderte meinen handgreiflichen Liebhaber auf, das Haus zu verlassen, was sich natürlich nicht eins, zwei, drei durchsetzen ließ. Aus Selbsterhaltungstrieb zog ich vorübergehend zu einer Kommilitonin und wartete, bis meine Etage geräumt wäre. Ein einziges Mal ging ich hin, um eine Regelung bezüglich des Hausrats zu treffen. Bei dieser Gelegenheit riß er mir die Kleider vom Leib.
Als ich gleich darauf auf meinem eigenen Fußboden lag, unter jemandem, der stöhnte, ich gehöre ihm und würde ihm immer gehören, als ich also zum erstenmal vernahm, daß mein Körper nicht mir gehöre, als mir mitgeteilt wurde, ich sei das Eigentum eines anderen, der, wie er sagte, das Recht habe, mit mir nach Gutdünken zu verfahren, da war meine Mutter natürlich nicht da, um mir beizustehen.
Bald schon war ich außen grün und blau und innen wund. Kniff ich die Augen einen Moment lang nicht zu, so sah ich, daß mein Vergewaltiger einen Pullover trug, den ich jahrelang für ihn gewaschen hatte. Den Kragen hatte ich einmal mit einem Wollfaden ausgebessert, der sich nach jeder Wäsche mehr vom Rest abhob. Als ich da auf meinem Fußboden lag, mußte ich jedesmal, wenn mein Blick auf die liebevollen, hingebungsvollen Stiche fiel, die Zähne zusammenbeißen, um nicht laut loszuschreien. Aber ein Kind würde ich wenigstens nicht als Andenken behalten, Dr. Pincus sei Dank.
Ich hoffte – zwanzig Jahre alt –, daß mir nicht noch einmal die Nase gebrochen würde, daß ich nicht noch einmal diesen scharfen Knacks spüren und dieses widerliche Krachen hören würde. Ich hütete mich aber, mich zu wehren. Falls möglich, hätte ich aufgehört zu atmen, um ihn nicht unnötig zu provozieren.
Vergeblich versuchte ich, genauso wie wenn ich geschlagen wurde, so zu tun, als ginge es gar nicht um mich. Aber was mir bei den Schlägen immer einigermaßen gelungen war, gelang mir jetzt nicht. Ich konnte mich nicht von mir abspalten. Ich mußte jede einzelne, eine Ewigkeit dauernde Sekunde miterleben. Tausendmal hätte ich sämtliche fünfzehn Strophen der Nationalhymne vorwärts und rückwärts singen können, so lange dauerte es. Mein Schild und Zuversicht bist du, o Gott, mein Herr. Ich versuchte, mit IHM einen Deal zu schließen. Mein gesamtes Stipendium für die Armen in Kalkutta, wenn es jetzt aufhörte. Mein Einsatz stieg und stieg, je länger die Drangsal dauerte.
Nicht Gott, sondern mir gelang es schließlich, der Sache ein Ende zu machen, als ich vor lauter Verzweiflung das Heft selbst in die Hand nahm: Ich wußte, daß dieser Mann in diesem Pullover praktisch immer sofort ejakulierte, wenn ich ihm in die Eier kniff.
Man kann wohl sagen, daß ich bereits in jungen Jahren einen Riecher für schlechte Männer hatte, aber das nur nebenbei.
Im übrigen betrachte ich meine Vergewaltigung so ungefähr als die undramatischste in der Geschichte der Menschheit: Leider wird jede Frau im Laufe ihres Lebens mal damit überrascht, daß jemand sie als sein Eigentum betrachtet. In der Zeitung lesen wir oft von bedeutend gräßlicheren Fällen. Ich wollte damit ja auch nur eines sagen: Mir braucht man wirklich nicht mit romantischen Sprüchen über meine natürliche Bestimmung zu kommen. An dem Tag, an dem ich meinem Vergewaltiger zu seiner Befriedigung verhalf, hörte ich auf, daran zu glauben. Und dadurch konnte ich später tun, was ich tun mußte.
Ich verließ meinen Mann, ich verließ meine Tochter. Na und?
Denn, damit wir uns richtig verstehen: Das Kind hat doch einen Vater? In all den -zigtausend Jahren, in denen es andersherum war, in denen es die Väter waren, die abhauten, hörten wir doch auch keinen Ton darüber? Den Ausdruck «Rabenväter», den gab es nicht mal, bis wir vor kurzem entdeckten, daß sie sogar ihre eigenen Töchter vergewaltigen. Aber als Mutter! Als Mutter gilt man gleich sehr viel schneller als «Rabenmutter». Als Mutter lebt man schließlich doch nur für sein Kind? Diese Instinkte, die sie einem andichten! Und wenn man sich nun weigert, sie zu haben? Zum Beispiel, weil man durchschaut, daß ihnen etwas Verlogenes anhaftet, etwas das – nur als Beispiel – mit Machtverhältnissen zusammenhängt? Ich bin doch weiß Gott nicht Lucy! Und ich brauche doch auch nicht, wie die durchschnittliche sich langsam grau ärgende Ehefrau, so zu tun, als sei ich verrückt?
Nein, für mich gehört dem Vater, sofern er nicht vergewaltigt, die Zukunft als versorgender Elternteil. Er ist dafür wie geschaffen. Er besitzt zwei Hände zum Schuhezubinden, einen Schoß zum Draufsitzen und per definitionem ein großes Gehirn, von dem mancher Knirps nur profitieren kann. Darüber werden wir in naher Zukunft noch Titelstories lesen, das können Sie mir glauben. Ich meine, zu meiner Zeit merkte man nicht einmal, daß man einen Vater hatte. Meiner war Vorarbeiter in einer Kiesgrube, er arbeitete hart und kam müde nach Hause. Das einzige, woran ich mich erinnere, war, daß er immer Prinzessin zu mir sagte. Wünschen Ihre Majestät Milch oder Buttermilch? Der Kanal, an dem entlang er nach Hause radelte, war tief, und ich war erst acht, als man ihn herausfischte. Am Tag zuvor hatte ich mich mit ihm gestritten – worüber, weiß ich nicht einmal mehr. Wenn er unser Mißfallen erregt hatte, dann sprachen wir nicht mit ihm, Mutter und ich. So hatte man mir das beigebracht. Meine letzte Erinnerung an ihn ist daher, wie er am Abend vor seinem Tod vergeblich versuchte, mich wieder gnädig zu stimmen.
Als man ihn aus dem Kanal gefischt hatte, nahm meine Mutter mich mit, um ihn zu identifizieren. Schließlich war ich, acht Jahre alt, ihre Stütze und ihr Halt. Ihr kostbarster Besitz. Können Sie sich darunter etwas vorstellen, Herr Sticklebauer? Hubertus?
Im Leichenhaus zogen sie eine Schublade heraus und schlugen das Laken ein Stück zurück. Niemand fragte: «Ist das eigentlich ein passender Anblick für ein Kind?» Aber ich sage ja schon nichts mehr.
Das Gesicht meines Vaters war so stark aufgequollen, daß es unkenntlich war. Darum wurde das ganze Laken entfernt, um nachsehen zu können, ob er eine Blinddarmnarbe hatte. Auch sein Körper sah aus, als hätte man ihn mit Gas aufgepumpt. Tot nahm er viel mehr Platz ein als lebend, und zwischen seinen Beinen lag eine monströse Geschwulst.
Ich hatte meinen Vater noch nie nackt gesehen und wußte genau, daß er auch jetzt nicht wollte, daß ich ihn ansah. Aber mir ging das Bild seines riesigen Geschlechts, das schwammig aus den Algen zwischen seinen Lenden hervorquoll, nicht mehr aus dem Sinn. Es war das Entsetzlichste, das ich je gesehen hatte. Damit war ich also gezeugt worden. Das Wunder der langersehnten Befruchtung hatte sich mit Hilfe dieser Geschwulst an meiner Mutter vollzogen.
Eine Zeitlang untersuchte ich mich vor dem Schlafengehen auf Beulen und Blasen. Als ich einige Jahre danach ein paar undefinierbare Verdickungen an der Brust bekam, dachte ich anfangs, mein verseuchtes Erbgut habe mich doch noch eingeholt und mein letztes Stündlein habe geschlagen. Hätte mein Vater noch gelebt, so hätte ich ihn zur Rechenschaft gezogen. Aber er hatte sich davongestohlen.
Nach meinem persönlichen Dafürhalten haben sich Väter generell schon viel zu lange davongestohlen. Während Vati sich in Nairobi ein paar schöne Tage macht, wischt Frau Sticklebauer in Frankfurt Rotznasen ab. Und später ist sie an allem schuld. Sämtliche Neurosen der kleinen Sticklebauers gehen dann auf ihr Konto. Das allein schon ist Grund genug, dankend zu verzichten: Als Mutter ist man in unserer, was die Geschlechter anbelangt, so streng getrennten Welt immer und ewig der Sündenbock. Hab ich die Rollen nicht schön vertauscht?
Später, wenn sie groß genug ist, wird sie mir dankbar sein. Sie wird in keiner erstickenden Symbiose aufwachsen – und glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin selbst einer Mutter ausgeliefert gewesen. Wir alle, nicht wahr? Wir müßten also alle klüger sein.
Und sonst muß sie sich eben mal überlegen, was die Gesetze der Reinkarnation lehren, nämlich, daß wir uns unsere Eltern selbst aussuchen: In dem Kreislauf unserer Daseinsformen suchen wir uns bei jeder Rückkehr zur Erde ganz bewußt die Verhältnisse aus, die erforderlich sind, damit wir die nächste Stufe unseres Karmas erreichen können. Ein relativierender Gedanke. Die Reinkarnationslehre neutralisiert sozusagen das Phänomen Eltern. Es ist nur dein Karma, Kind, weshalb du mutterlos aufwachsen mußt.
Und hör zu: Du wirst mir doch darin zustimmen, daß es nur sehr wenige Kinder gibt, die man ihrer Eltern wegen nicht bedauern muß? Du bist weiß Gott nicht die einzige. Eltern sind fast immer abscheulich. Sie kennen kein Maß. Sie tun immer zu viel oder zu wenig. Die meisten Erwachsenen stimmen dem aus ganzem Herzen zu, wenn sie auf ihre eigene Jugend zurückblicken. Bis ins hohe Alter hinein hadern sie mit ihren Eltern.
Unter diesem Aspekt betrachtet, mußt du einfach denken, ist es vielleicht sogar so, daß elterliches Versagen von Generation zu Generation weitervererbt wird und daß es folglich offenbar irgendwie zum Leben gehört. Vielleicht gibt es geheimnisvolle kosmische Gründe für dieses Phänomen, aber ich schließe auch nicht aus, daß es wahrhaftig ein Ding der Unmöglichkeit ist, ein guter Elternteil zu sein. Nur gibt es, zugegeben, natürlich kein Thema, von dem ich weniger verstehe.
Verstehst du, was ich dir damit sagen will?
Ich habe dir immer alles Gute gewünscht. Wirklich. Zwiers Gebiß zum Beispiel, denn von uns beiden hat immer er die besseren Zähne gehabt.
So, und jetzt werde ich eine ausgedehnte Siesta halten, um heute abend in Topform zu sein. So was Blödes – ich heule. Na ja, manchmal muß man eben heulen. Hat aber weiter nichts zu bedeuten. Ich muß ein Bad nehmen, mich zurechtmachen, was Nettes anziehen und mich vorsichtig an der Bar vorbeischleichen, wo Vati Sticklebauer ängstlich bei seinem Whisky sitzt und auf einen mütterlichen Typ hofft, der sich seiner erbarmt.
Pech, Hubertus.
Ein paar Stunden tanzen, und ich bin wieder okay. Nix für mich, mich in einem Hotelzimmer zu verkriechen – da kommt man nur auf dumme Gedanken. Wo das doch gar nicht meine Art ist, ehrlich. Ich bin immer so fröhlich, so unbekümmert, ich bin jemand, der nie Probleme macht. Wegen gar nichts.