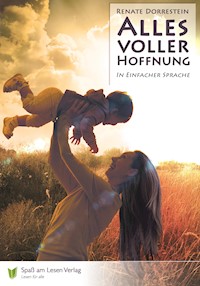10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Topas ist verschwunden, und zwar schon seit drei Wochen. Allmählich hat Justine die Nase voll von den Kassetten, die Topas bespricht und nach Hause schickt. Durch die wird man nämlich auch nicht klüger, ja man erfährt nicht einmal, wo sie steckt. Aber das ist wieder typisch für Topas: Anstatt endlich die längst fällige Erklärung für ihr Verhalten zu liefern, erzählt sie Geschichten. Sie versteht es wirklich, sich interessant zu machen. «Höre, höre, höre», beginnt Topas ihre Kassetten. «Heute ist ein Wal angeschwemmt worden. Das gilt hier auf der Insel als ein schlechtes Vorzeichen. Ein sehr schlechtes Vorzeichen.» Vorzeichen? Topas ist doch eine vernünftige, trinkfeste Rundfunkredakteurin. Aber hier auf der Insel scheinen die Gesetze der Vernunft außer Kraft gesetzt. Topas hatte gehofft, in dieser felsigen Einöde ihr inneres Gleichgewicht wiederzufinden. Seit sie – schuldlos – in einen Unfall verwickelt war, ist sie überzeugt, daß sie Tod und Verderben wie ein Magnet anzieht. Rasch wird ihr klar, daß sie mit dem Leben auf der Insel erst recht nicht fertig wird. Und als Topas versucht, dem uralten Abt des verfallenen Klosters ihre Schuld zu beichten, erntet sie nur Hohngelächter. Was wiegt ihr schlechtes Gewissen gegen die große Schuld, die wie ein dichter Nebel auf der ganzen Insel zu lasten scheint? Nur einem einzigen Menschen kommt Topas näher, Wants, dem vierzehnjährigen Sohn der so schönen wie herrischen Andrena. Er ist taubstumm und wird wie ein Tier an der Kette gehalten. Als Topas versucht, ihm das Sprechen beizubringen, entdeckt sie, daß er in Wirklichkeit sehr gut hören kann ... Topas versucht zu fliehen, vor den Stimmen, die sie hört, den Zeichen, die sie sieht, den Menschen, die sie bedrängen, und den Abgründen, die sie anziehen. Doch wird sie die Insel je lebend verlassen? Renate Dorrestein hat einen modernen Schauerroman geschrieben, in einer für dieses Genre sehr eigenen, sehr klaren Sprache. Dieses Buch, daran gibt es keinen Zweifel, hat den bösen Blick.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 323
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Renate Dorrestein
Mitternachtssohn
Aus dem Niederländischen von Dirk van Gunsteren
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Topas ist verschwunden, und zwar schon seit drei Wochen. Allmählich hat Justine die Nase voll von den Kassetten, die Topas bespricht und nach Hause schickt. Durch die wird man nämlich auch nicht klüger, ja man erfährt nicht einmal, wo sie steckt.
«Höre, höre, höre», beginnt Topas ihre Kassetten. «Heute ist ein Wal angeschwemmt worden. Das gilt hier auf der Insel als ein schlechtes Vorzeichen. Ein sehr schlechtes Vorzeichen.» Vorzeichen? Topas ist doch eine vernünftige, trinkfeste Rundfunkredakteurin.
Aber hier auf der Insel scheinen die Gesetze der Vernunft außer Kraft gesetzt. Topas hatte gehofft, in dieser felsigen Einöde ihr inneres Gleichgewicht wiederzufinden. Seit sie – schuldlos – in einen Unfall verwickelt war, ist sie überzeugt, daß sie Tod und Verderben wie ein Magnet anzieht.
Rasch wird ihr klar, daß sie mit dem Leben auf der Insel erst recht nicht fertig wird. Und als Topas versucht, dem uralten Abt des verfallenen Klosters ihre Schuld zu beichten, erntet sie nur Hohngelächter. Was wiegt ihr schlechtes Gewissen gegen die große Schuld, die wie ein dichter Nebel auf der ganzen Insel zu lasten scheint?
Nur einem einzigen Menschen kommt Topas näher, Wants, dem vierzehnjährigen Sohn der so schönen wie herrischen Andrena. Er ist taubstumm und wird wie ein Tier an der Kette gehalten. Als Topas versucht, ihm das Sprechen beizubringen, entdeckt sie, daß er in Wirklichkeit sehr gut hören kann ...
Über Renate Dorrestein
Renate Dorrestein, 1954 in Amsterdam geboren, ist eine niederländische Autorin, Journalistin und Feministin.
Inhaltsübersicht
Für Hannemieke, meine Patin
«Mache den Anfang mit dem Anfang», sagte der König ernst, «und lies weiter, bis du ans Ende kommst; dort höre auf.»
Lewis Carroll, Alice im Wunderland
1
Wieder einmal bekam Justine die Haustür nicht auf. Das Haus gab sich einfach nicht geschlagen, das Schloß widersetzte sich dem Schlüssel, den sie tastend hin- und herbewegte. Dieses tägliche Gestocher ging ihr auf die Nerven. Sie sah den Moment kommen, wo sie die Tür anflehen würde: «Ich tue doch schließlich nichts Unrechtes. Ich bin hier zu Besuch.» Vorsichtig drehte sie den Schlüssel. Sie hörte ein beruhigendes Klicken. Sie konnte hinein.
Auf der Fußmatte lag ein Päckchen. Sie wollte sich schon bücken, um es aufzuheben, als sie Topas’ Handschrift erkannte. «Scheiße», sagte sie. Sie ließ es liegen.
Sie ging in die Küche, um Teewasser aufzusetzen. Die Küche war hell und freundlich, aber schmuddelig, und überall stand schmutziges Geschirr herum. Sie angelte eine Tasse aus dem Spülbecken und wusch sie ab. Sie suchte die Streichhölzer. Sie machte den Herd an. Sie setzte Wasser auf. Sie warf die verbrauchten Teeblätter aus der Kanne weg. Und die ganze Zeit spürte sie, daß das Päckchen auf der Fußmatte lag. Es machte, daß die Espressomaschine und die Vorratsgläser mit Körnern und Grütze mit einem Mal wieder Topas gehörten, daß das fröhlich gelbe Geschirr Topas gehörte, daß sie all das, wovon Justine umgeben war, besaß, einschließlich des Wassers, das aus dem Hahn floß.
Justine fühlte sich durch die Gegenstände auf ihren Platz verwiesen. Sie war bloß vorübergehend hier, ein Gast, eine Passantin. Nach ihr würde das Haus wieder ganz und gar Topas gehören. Offen gestanden hatte sie das in den letzten Wochen einfach vergessen. Das Päckchen störte und verdarb alles.
Trotzdem würde sie einfach tun, was sie jeden Tag um diese Zeit tat: in einem seidenen Morgenrock im Erker sitzen und Tee trinken, bis das letzte Licht des Frühlingsabends verdämmert war. Aber als sie sich oben auszog, sah sie die ganze Zeit Topas vor sich: Topas in einem Abendkleid an Julius’ Arm, Topas in Regenmantel und Stiefeln auf einem Feldweg, Topas von ganz nahe, so daß einem die Sommersprossen auf ihrer Nase auffielen und außerdem zu sehen war, daß ihre Zähne schief standen. Dieses letzte gedankliche Bild gefiel Justine am besten. Man konnte darauf gut erkennen, daß Topas ihren dreißigsten Geburtstag hinter sich hatte.
Sie schnaubte. Sie selbst hatte regelmäßige, perlmuttweiße Zähne, einen reinen Teint und weißblondes Engelshaar, das lockig um ihr Gesicht fiel, und das alles bewirkte oft, daß man sie für lieb und wehrlos hielt. Sie mußte erst noch erwachsen werden. «Oje, Kindchen», hatte Topas gesagt, als Justine von ihrer Zimmerwirtin vor die Tür gesetzt worden war, «willst du vielleicht bei mir wohnen, bis du ein neues Zimmer gefunden hast?»
An dem Tag dieser großzügigen Einladung kannten sie sich genau drei Wochen. Ihre Beziehung war rein sachlicher Natur: Justine war die neue Sekretärin der Rundfunkredaktion, die Topas unterstand. «Leitende Dramaturgin» stand an Topas’ Tür. An Justines Tür stand nichts.
Zu ihren Aufgaben gehörte es, ein stenographisches Protokoll der Besprechungen aufzunehmen, die Topas mit ihren Hörspielautoren hatte. «Die Wirklichkeit?» pflegte Topas zu sagen. «Davon haben wir schon genug. Erzählen Sie mir lieber eine gute Geschichte. Die Qualität der Wirklichkeit lädt im allgemeinen nicht gerade dazu ein, sie wiederzugeben. Ist das, was einfach gegeben ist, dem, was wir glauben, nicht immer unterlegen? Träume, Ängste, Sorgen und Ambitionen nehmen uns nun einmal mehr in Beschlag als das, was sich vor unserer Nase abspielt. Beschreiben Sie mir also nicht die Wirklichkeit. Es gibt sie, und das genügt. Jenseits von ihr ist es interessanter.»
Etwas anderes sagte sie nie. Außerdem hatte Justine gemerkt, daß Topas über jede Menge Techniker und Regisseure verfügen konnte, die die eigentliche Arbeit machten. Ihr einziger eigener Beitrag bestand in endlosen Konferenzen und dem Einwurf: «Die Wirklichkeit? Hören Sie doch auf! Erzählen Sie mir lieber eine gute Geschichte.»
Justine saß dabei und stenografierte und fand, daß die Situation klar war. Topas verdiente dreimal so viel wie sie selbst – und zwar dafür, daß sie den ganzen Tag lang dieselbe Bemerkung wiederholte. Sie war sogar zu faul, ihr Geld und ihren Status auszunutzen. Sie besaß keinen schwarzen Alfa Romeo, und sie sprach nie vom Skifahren. Sie saß zwischen den langweiligen Aktenschränken hinter ihrem schäbigen Schreibtisch aus Stahlblech, als gäbe es keine stilvollen Büromöbel. Sie saß da, die Ärmel aufgekrempelt, die Ellbogen auf die Tischplatte gestützt, und redete. Oder sie lachte. Sie lachte laut und schlug dabei auf den Tisch.
Justine runzelte die Stirn. Der Fall war klar. Seit ein paar Wochen war Topas wie vom Erdboden verschwunden, einfach so, ganz plötzlich. Diesmal hätte Justine nichts dagegen, wenn sich an der Situation nichts änderte. Widerwillig hob sie das Päckchen auf. Sie trank zwei Tassen Tee und wog es dabei in der Hand. Es war klein und rechteckig. Natürlich: eine Kassette. Das sah Topas ähnlich.
Justine schob sie in den Kassettenrekorder, der im Wohnzimmer stand. Sie seufzte. Sie drückte den Startknopf.
«Höre, höre, höre», sagte Topas. Es folgte eine lange Stille, hin und wieder unterbrochen von einem Krachen und Knattern wie bei einem Ferngespräch. «Es war ein Knoten in der Schnur», sagte Topas schließlich. «Dieses Ding hat zu lange ganz unten in meinem Rucksack gelegen. Ich hoffe, daß die Batterien noch nicht leer sind. Der Stecker paßt nämlich nicht auf die Steckdosen hier. Hallo, Justine, ich bin’s. Entschuldige, daß ich so lange nichts von mir hab hören lassen. Es gab einfach nichts zu erzählen. Aber jetzt hab ich endlich gute Nachrichten. Ich bin, wo ich sein muß. Ich hab das Gefühl, daß bis jetzt alles stimmt. So ist mir gestern gleich bei meiner Ankunft ein Phantom begegnet, genau wie mir prophezeit worden war. Was vorhergesagt ist, muß in Erfüllung gehen. Ich werde dir erklären, wie das mit diesem Phantom war. Ich werde es dir haarklein erzählen. Setz dich bequem hin und hör zu.»
Gott bewahr mich, dachte Justine. Sie kannte Topas’ Geschichten. Ständig gab es darin spontane Verzweigungen und wuchernde Abschweifungen. Aus einer Geschichte quoll ganz von selbst die nächste hervor, bis sie sich wie ein Bündel Taue verknoteten und selbst Topas zugeben mußte: «Das wird wohl mehr ein kleines Knäuel.»
Von so jemandem wie ihr war ja zu erwarten, daß sie gleich mit einer Geschichte loslegte, anstatt erst einmal zu erklären, warum sie, wie Justine es ausdrückte, spurlos verschwunden war – obwohl Julius, der glaubte, er sei Topas’ Verlobter, lieber von «unerwartet verreist» sprach. Nachdem so viel Zeit vergangen war, wäre eine Erklärung wohl angebracht gewesen. Als Topas gerade erst wie vom Erdboden verschwunden gewesen war, hatte Julius selbst die Vermutung geäußert, sie müsse entführt worden sein, diesen Gedanken jedoch angesichts der Tatsache, daß Topas nicht die Frau war, die sich entführen ließ, schnell wieder fallengelassen. Außerdem, hatte Justine gemeint, deute der Umstand, daß ihr Auto ebenfalls weg war, auf ein freiwilliges Verschwinden hin. Das Auto fehlte ihr. Widerwillig setzte sie den Kassettenrekorder wieder in Gang.
«Ich war», sagte Topas, «nach einer langen Reise zufällig im Süden gelandet, wo der Wind schon warm war. Davon bekam ich eine trockene Kehle, und auch davon, daß ich andauernd sagen mußte: ‹Ja, der Frühling ist dieses Jahr wirklich früh dran.› Das sagte ich zu Gastwirten, Bäckersfrauen und zu dem Mann, in dessen Laden ich ging, um ein Stück Kräuterseife zu kaufen. Er war ein Mann, der sich nach dem Meer sehnte, aber er hatte sich in einem albernen Lädchen vergraben, das vollgestopft war mit bemalten Tannenzapfen, Aschenbechern, die mit einem Bild der Dorfstraße verziert waren, Kerzen, auf die alte Frauen Blumen geklebt hatten, und Kaffeehauben in Form von Eichhörnchen, alles handgestrickt und handgetöpfert.
Kräuterseife hatte er nicht, aber ich bin zwei Wochen bei ihm geblieben, weil ich mich ihm verwandt fühlte. Ich erzählte ihm, daß auch ich von einem unmöglichen Verlangen getrieben werde, und viel mehr brauchte ich nicht zu sagen. Seine blauen Augen wurden sanft, und um mich zu trösten, erzählte er mir vom Meer, von Flußgöttern und Wasserfeen und von dem Zauber, der dort herrscht, wo Wasser an Luft und Berge grenzt.
Er zeigte mir auch die Sehenswürdigkeit des Dorfes: den ältesten Baum der Welt. Der stand, umgeben von einem schmiedeeisernen Zaun, neben der Kirche. Eine riesige Eiche. Und das sei nicht bloß so eine Geschichte, sagte der Mann, der sich nach dem Meer sehnte: Unter diesem Baum sei vor langer, langer Zeit ein Bauernmädchen von einem römischen Soldaten vergewaltigt worden. Das Mädchen gebar einen Sohn, der später Statthalter in Judäa wurde. In dieser Eigenschaft sollte er im Jahre 33 den Sohn Gottes zum Tode verurteilen.
‹Dann ist dies also der Ort, wo Pontius Pilatus geboren wurde›, sagte ich.
Er lachte. Ich solle mir nichts dabei denken, sagte er, die Erde hier sei ganz gewöhnlich, nicht nasser beispielsweise als anderswo.
So liefen und redeten wir, oder wir saßen in seinem Lädchen und sortierten Spinnräder – es war eine schöne Zeit, ganz ohne Pläne und Versprechungen. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte es ruhig noch eine Weile so bleiben können, auch wenn es nicht das war, wofür ich auf die Reise gegangen war. Aber durch den kleinen Ich-ich-ich veränderte sich alles.
Du mußt wissen, Justine, daß vor dem Lädchen immer drei Gänse grasten: Samuel, Rodriguez und der kleine Ich-ich-ich. Ich konnte sie nicht ausstehen, und zwar weil mich das dumme Geschnatter, mit dem sie uns morgens früh weckten, an meine Dodos erinnerte. Die Abneigung beruhte auf Gegenseitigkeit: sobald sie mich sahen, wichen sie zischend zurück. Besonders der kleine Ich-ich-ich stürzte sofort davon, wenn er mich zu sehen bekam.
Eines Morgens, vor zwei Tagen, um genau zu sein, schien die Sonne so herrlich, daß ich mit Schwung aus dem Haus lief. Ich hätte mir fast das Genick gebrochen, weil ich über Samuel und Rodriguez fiel, die vor der Tür auf ihr Frühstück warteten. Der kleine Ich-ich-ich ergriff schnatternd die Flucht. Und in diesem Augenblick fuhr, wie jeden Tag, der Milchwagen vorbei.
Ich schlug die Hände vor die Augen, aber es war schon zu spät. Schon konnte ich mich nicht mehr gegen die Erinnerungen wehren, die mit derselben Schicksalhaftigkeit über mich herfielen, mit der der Milchwagen auf den kleinen Ich-ich-ich zufuhr. So war es damals auch gewesen. Auch damals hatte ich, lange bevor ich die Bremsen quietschen hörte, bereits gewußt, daß nichts mehr abzuwenden war. Es hatte sich so abgespielt, wie Autounfälle sich angeblich immer abspielen. Man hat keine Zeit mehr, etwas zu retten, aber selbst in dem Sekundenbruchteil vor dem schrecklichen Knall hat man noch ausgiebig Gelegenheit zum Nachdenken. Mir ist es nicht anders ergangen. Während der endlosen Augenblicke des Unfalls hatte ich jede Menge Zeit, über den unausweichlichen Gang der Dinge, über den gnadenlosen Ablauf dessen, was einmal in Gang gesetzt ist, zu grübeln. Wasser kann nur abwärts fließen, Rauch nur nach oben steigen. Ein Fehler kann nur Fehler nach sich ziehen. Aber wie kann man Böses tun, wenn man keine bösen Absichten hat?
Damals blieb mir noch eine Ewigkeit, um dieses Problem zu lösen, und die ganze Zeit schwebten Fahrrad und Auto bewegungslos in der Luft, fast Nase an Nase, aber noch ohne sich zu berühren. Ich konnte ihr Gesicht sehen, das Gesicht von der, die mit mir in dieser Schleuse jenseits von Raum und Zeit gelandet war. Dieses Gesicht von ihr. Dieses Gesicht von ihr, während wir dort hingen. Wir hingen so lange dort, wie ich über das Rätsel von Gut und Böse nachdachte. Ich hätte damit nie aufhören dürfen. Was man anfängt, muß man auch zu Ende bringen. Aber ich gab es auf. Ich fand keine Lösung. Ich dachte: Das kann gar nicht wirklich passieren, denn ich habe es nicht gewollt.
Da stießen wir zusammen.
Ich konnte diese Erinnerungen, die mit aller Macht auf mich eindrangen, nicht mehr ertragen. Ich öffnete die Augen, um das Gesicht, das – Augen und Mund entsetzt aufgerissen – auf mich zuschoß, nicht länger sehen zu müssen. Der Milchwagen donnerte über den kleinen Ich-ich-ich hinweg. Federn stoben, als seien sie durch eine Explosion aufgewirbelt worden.
Der Mann, der sich nach dem Meer sehnte, sagte, es sei nicht meine Schuld gewesen. Er konnte ja auch nicht wissen, daß ich seit dem Unfall nach Zeichen des Todes und des Verderbens Ausschau halte. Ich finde es nämlich bestürzend, Justine, daß man jemanden töten kann, ohne daß es einem anzusehen ist. Die Leute gehen mir nicht aus dem Weg, Kinder ergreifen nicht die Flucht vor mir, niemand verwehrt mir den Raum, den ich einnehme, und die Luft, die ich atme. Niemand wird vor mir gewarnt. Ich sehe genauso aus wie alle anderen. Nur der kleine Ich-ich-ich war nicht umsonst vor mir davongelaufen.
Als wir den toten Vogel bargen, betrachtete ich das nette Gesicht des Mannes, der sich nach dem Meer sehnte. Ohne eine Spur von Vorwurf in seinen freundlichen Augen sah er auf. Ich mußte meine Augen niederschlagen. Ich mußte meinen bösen Blick abwenden. ‹Ich werde dann wohl mal wieder weiterfahren›, sagte ich. Ich dachte an die Inseln im Norden, von denen er mir erzählt hatte. Kleine, abgelegene Zufluchtsorte mit gleichklingenden und doch sehr verschiedenen Namen. Die meisten, hatte er gesagt, seien nur von Robben und Albatrossen bewohnt. ‹Ich will auf eine Insel›, sagte ich. Im Laden entfaltete er seine Karte auf der Theke, wie er es so oft getan hatte, wenn ich nachprüfen wollte, ob es die Orte, von denen er erzählte, auch wirklich gab. Mit all seinen Inseln hatte es eine besondere Bewandtnis: Sie trieben davon oder versanken, und es sollte sogar eine geben, die nur die sehen konnten, die reinen Geistes waren. Das schien mir kein geeigneter Ort für mich zu sein.
Wir saßen nebeneinander auf der gemauerten Fensterbank hinter dem Ladentisch; ich spürte die Wärme seines Oberschenkels, und es kam mir so vor, als säße ich schon mein halbes Leben lang mit ihm dort, vor uns die Landkarte. Ich war viel zu lange hier hängengeblieben. ‹Was hältst du von der hier?› sagte er und deutete auf eine Insel. Er brauchte mich nicht an das zu erinnern, was er mir über diese Insel erzählt hatte. Ich wußte sofort, daß er mir kein besseres Reiseziel hätte vorschlagen können. Es gab keinen Grund, den Abschied noch länger hinauszuzögern.
Ich nahm einen Zug zur Küste. Ich sitze gern in Bummelzügen, und Badeorte außerhalb der Saison gefallen mir. Alle Stationen hatten Namen, die nach windigen Boulevards und verfallenen Pavillons klangen. Als der Zug gegen Abend den nördlichsten Punkt des Festlands erreichte, war er leer. Ich war die einzige Reisende. Allein stand ich auf dem Bahnsteig und fand die Berge rings um mich her hoch und düster. Ganz in der Nähe war die Felsküste. Als ich hinging, um mir die Seehunde anzusehen, die auf ihrem Felsen in der Bucht lagen, rutschte ich auf den schlüpfrigen Steinen aus. Das Geräusch, das ich dabei machte, schlug sie in die Flucht. Bellend tauchten sie im Wasser unter und blieben verschwunden. Genau wie der kleine Ich-ich-ich.»
Justine stellte den Kassettenrekorder ab, um ans Telefon zu gehen. Ihr Herz klopfte, und als sie am Spiegel vorbeikam, sah sie, daß sie errötete. Sie fühlte sich ertappt, weil sie Topas’ seidenen Morgenrock trug. Andererseits wäre es ja unsinnig gewesen, ihn unbenutzt im Kleiderschrank hängenzulassen. Sie nahm den Hörer ab und sagte Topas’ Namen.
«Topas?» rief Julius.
«Nein, ich bin’s.»
«Ach, du. Warum meldest du dich nicht mit deinem eigenen Namen?»
«Weil es Topas’ Anschluß ist», sagte Justine verärgert. Alles gehörte Topas. Selbst der Mann, mit dem sie jetzt sprach. Jedenfalls war das seine persönliche Überzeugung. Was Topas betraf, so aß sie die Pralinen, die er ihr mitbrachte, ohne daraus irgendwelche Verpflichtungen abzuleiten. Was in Justine den Verdacht wachsen ließ, es gebe keine Gerechtigkeit. Für so einen Verehrer hätte sie ihre Geschmacksnerven gegeben. Sie versuchte sich vorzustellen, wie er am anderen Ende der Leitung in seinem Sprechzimmer saß. Julius war ein gefragter Frauenarzt. Seine Spezialität war die Entfernung von Gebärmüttern. Eine Gebärmutter, ganz gleich ob krank oder gesund, brachte ihm dreitausend Gulden ein. Justine schätzte sich glücklich, daß sie die letzte gewesen war, die Topas gesehen hatte. Dadurch mußte sie in Julius’ Augen ein wichtiges Bindeglied sein.
«Gibt es Neuigkeiten?» fragte er.
«Ja», sagte sie. Sie hielt kurz inne. In den Zeitschriften, die sie las, stand immer, daß Männer geheimnisvollen Frauen gegenüber wehrlos waren.
Sie hatte einmal mit Topas darüber gesprochen. Die hatte gesagt: «Das einzig Rätselhafte an Frauen ist, daß sie meistens so gern abhängig sind.» Von solchen Dingen verstand Topas einfach nichts.
«Ich höre mir», fuhr Justine fort, «gerade eine Kassette von ihr an, die heute mit der Post gekommen ist.»
«Wo ist sie? Was sagt sie? Wie hört sie sich an?» rief Julius.
«Offenbar ist sie irgendwo im Ausland, aber ich weiß noch nicht genau, wo. Vielleicht sagt sie das noch.»
«Paßt es dir, wenn ich vorbeikomme und es mir auch anhöre?» fragte Julius. Er räusperte sich. «Sie hat ja keine Ahnung, was sie mir antut.»
«Aber ich», sagte Justine. Sie fragte sich, wie Julius auf den Mann, der sich nach dem Meer sehnte, reagieren würde. Sie sagte, sie erwarte ihn in einer Stunde. So hatte sie noch genug Zeit, um zu baden, sich anzuziehen und sich die Nägel zu lackieren. Sie nahm den Kassettenrekorder mit ins Badezimmer und stellte ihn zwischen Topas’ Töpfchen und Fläschchen auf den Waschtisch.
«Höre, höre, höre», sagte Topas. «Man kann immer etwas erleben, wenn man nur die Ohren aufsperrt. Nachdem ich die Seehunde verjagt hatte, ging ich in dem kleinen Hotel auf der Landzunge einen Kaffee trinken. Ich war dort die einzige, die Kaffee trank. Man mußte erst eine Tasse und Zucker für mich suchen. Die anderen Gäste, die allesamt glänzende schwarze Schnurrbärte hatten, waren mit Hingabe dabei zu trinken. Sie hießen vermutlich Ogg und Turd und Eoghann a’Chin Bhig, und sie sahen aus, als würden sie Flüche kennen, die ganze Geschlechter mit Taubstummheit schlagen könnten. Ich sperrte meine Ohren so weit wie möglich auf und hörte an der Art, wie Eoghann a’Chin Bhig sein Glas klirrend auf die Theke stellte, daß er seine Frau schlug und gut zu seinen Hunden war. Inzwischen versuchte Ogg, Turd von irgend etwas zu überzeugen, und zwar mit so viel Leidenschaft, daß ich jedes Wort verstehen konnte.
‹Nein, das war anders, ganz anders›, sagte er. ‹Ich schwöre dir, sie ist geflogen. Sie ist geflogen. Sie stieg auf in die Luft. Es war ein Wunder – oder vielleicht auch nicht. Sie hatte von Anfang an was Besonderes an sich. Auch Flata hat das gleich gemerkt. Wenn sie lacht, dann schneit es Rosen, hat sie gesagt.›
‹Ach, die Leute reden viel›, unterbrach ihn Eoghann a’Chin Bhig. ‹Das war letztes Jahr im Sommer. Das ist schon lange her. Lange genug, um es zu vergessen. Jetzt sind wir wieder zu Hause. Keiner kann uns was anhaben.›
Verträumt fuhr Ogg fort: ‹Wir haben Fisch geputzt, als sie mit der Fähre ankam. Sie trug ein blaues, schulterfreies Kleid.›
‹Nein, wir waren schon fertig mit dem Fisch. Wir saßen auf dem Anlegesteg und warfen kleine Steine ins Wasser, das abwechselnd blau und violett war. Und sie, sie trug einen feuerroten Regenmantel, einen Rucksack und schmutzige Stiefel. Man konnte ihr gleich ansehen, daß sie wußte, wo’s langgeht. So ganz allein unterwegs. So eine, die schon was vertragen kann›, sagte Eoghann a’Chin Bhig. ‹Aber wie ich schon sagte: Jetzt sind wir wieder zu Hause, und keiner kann uns was anhaben.›
‹Am Abend›, sagte Ogg, ‹gingen wir alle in Flatas Kneipe, um sie uns anzusehen. Sie trank Whisky wie ein Mann, und sie lachte die ganze Zeit. Mein Gott, was konnte das Mädchen lachen. Da kam man von ganz allein auf den Gedanken, daß so jemand schon einen Spaß vertragen kann. Und sonst war ja auch nie was los. Man war froh über jeden Spaß. Fischen ist schön, verdammt schön, aber von Fisch allein kann man doch nicht leben. Das Mädchen war eine nette Abwechslung. Wenn sie etwas sagte, kriegte sie diese großen, tiefen Augen. Genau wie schwarzes Wasser. Und dabei spielte sie mit ihren langen roten Haaren. Seejungfrauenhaar. Während sie sprach, drehte sie Flechten und Zöpfe hinein. Man mußte die ganze Zeit hinsehen. Man fragte sich ganz von selbst, wie sich das wohl anfühlte, dieses Haar.›
‹Ob wir immer bloß arbeiten, fragte sie uns. Und da sagt er nein, sagt er, sonntags wird nicht gefischt.›
‹Nein, das war einer von den anderen. Ich weiß nicht mehr, wer. Das ganze Dorf war da. Alle spulten ihr Seemannsgarn ab. Von dem Spukschiff in der Bucht und von den Seelen der Ertrunkenen, die heulend über das Meer jagen. Das gefiel ihr, so ein bißchen was Gruseliges. Also sagt einer: Komm doch am Sonntag mit, dann zeigen wir dir drüben in den Felsen den glatten Stein, auf dem die Druiden früher ihre Menschenopfer dargebracht haben. Und sie: Menschenopfer? Ich glaube, das denkst du dir bloß aus. Aber neugierig geworden war sie doch. Sie wollte mitkommen. Wißt ihr was, sagte sie – sie würde Brot und Bier mitnehmen, so daß wir ein Picknick machen könnten. Und sie klatschte in die Hände und lachte und lachte – und verdammt, es war wirklich, als ob es Rosen schneite.
Am Sonntag holten wir sie alle zusammen ab. Es war einer von den Tagen, an denen dieser pudrige Nebel in der Luft hängt. Genau das Wetter, das sie liebte, sagte sie. Sie kletterte uns voran. Nun hatte sie zwar lange Beine, aber sie trug eine viel zu enge Jeans, und darum ging sie viel zu langsam. So langsam, daß wir sie die ganze Zeit anrempeln mußten. Also hat ihr einer eins auf den Hintern gegeben, um ihr ein bißchen zu helfen. Und dann haben wir alle mitgeholfen und sie hinaufgeschoben. Und einer hat gesagt: In der Hose kannst du dich doch gar nicht bewegen, zieh sie doch aus. Oder soll ich es für dich tun?›
‹Nein nein, das hat sie selbst gesagt›, widersprach Eoghann a’Chin Bhig. ‹Sie sagte: Wißt ihr was? Ich zieh meine Hose aus, wenn euch das nicht stört, meine Herren. Ich sehe sie noch vor mir, wie sie da stand, weit hinter ihr der Leuchtturm. Der Wind hatte ihr Haar durcheinandergebracht.›
‹Soweit ich mich erinnere, saß sie da schon. Sie war bestimmt müde vom Klettern, denn plötzlich saß sie auf dem Boden. Na ja, sie lag. Und sie keuchte, also war sie wohl wirklich ganz schön fertig. Sie lachte überhaupt nicht mehr. Sie schrie: Warum laßt ihr mich nicht in Ruhe? Und was haben wir darauf nochmal geantwortet?›
‹Jemand – jemand anders – antwortete: Weil deine Augen so schön sind. Das ist doch ein nettes Kompliment, oder? Und er hielt sie auch noch in den Armen, um sie zu trösten. Aber sie kreischte und zappelte, und plötzlich schlug sie ihn. Mitten ins Gesicht. Das war ganz schön grob von ihr. Das war überhaupt nicht nötig.›
‹Moment mal – ich meine, daß sie einen Klaps gekriegt hat.›
‹Ja, logisch, danach. Aber das ist ja ganz unwichtig. Wir vergessen was viel Wichtigeres. Warum laßt ihr mich nicht in Ruhe? schrie sie, und jemand antwortete …›
‹Wir nicht, wir nicht, jemand anders.›
‹Jemand sagte: Weil deine Augen so schön sind. Und da – da sprang sie auf und riß sich die Augen aus und warf sie ihm vor die Füße. Sie warf sie einfach auf den Boden! Ich will tot umfallen, wenn es nicht wahr ist. Hier habt ihr meine schönen Augen, rief sie und fing an zu rennen.›
‹Das hätte wohl bewiesen werden müssen, das mit den Augen. Ich meine, wir hätten auf den Felsen nach ihnen suchen können, später. Und wenn sie nicht zu finden gewesen wären, dann hätte das bloß bedeutet, daß die Brandung sie weggespült und ein Fisch sie verschluckt haben mußte. Also, den Fisch, den hätten wir früher oder später wohl gefangen. Irgendwann hätten wir sie schon wieder aufgetrieben, die Augen, wenn man das von uns verlangt hätte.›
‹Aber weil sie nichts mehr sehen konnte, ist sie gestolpert, so daß sie ganz zerschunden und ramponiert war und überall grüne und blaue Flecken hatte. War ja ihre eigene Schuld. Sie konnte zwar nichts mehr sehen, aber sie mußte ja unbedingt hin und her rennen. Das war natürlich dumm von ihr: Sie ist über ihre eigenen Füße gestolpert und immer näher an den Rand der Klippe geraten.›
‹Und in dem Augenblick, als sie den glatten Stein erreichte, auf dem die Druiden früher ihre Menschenopfer dargebracht haben, löste sich der. Aber er stürzte nicht ins Meer! Er stieg in die Luft! Wie ein fliegender Teppich! Er ist über das Meer gesegelt, und das Mädchen saß obendrauf! Ihr Seejungfrauenhaar wellte sich hinter ihr wie Seegras in der Dünung. Und so ist sie im Nebel hinter dem Horizont verschwunden.›
‹Also nun sag selbst: Die tote Frau, die man am Strand gefunden hat – das konnte sie nicht sein. Das muß eine andere gewesen sein. Eine, die wir nicht kannten. Wir hatten sie noch nie gesehen. Was die Leute auch alles reden! Du darfst nie glauben, was die Leute so reden. Die Leute reden so viel.›»
Sie machte schon wieder ein komplettes Hörspiel daraus, dachte Justine. Sie stieg aus der Badewanne und stellte den Kassettenrekorder ab. In ein Handtuch gewickelt, setzte sie sich an den Frisiertisch. Sie schob die Pflanzen beiseite, die seit Topas’ Abreise kein Wasser mehr bekommen hatten. Sie suchte nach dem Nagellack und versuchte dabei zusammenzufassen, was sie bis jetzt gehört hatte. Man hätte ohne weiteres denken können, daß sie diesen Kassettenbrief in betrunkenem Zustand verfaßt hatte – wenn man nicht wußte, daß Topas seit ihrem Unfall keinen Tropfen Alkohol mehr angerührt hatte. Nicht daß das viel geändert hätte, weder an ihrer Weitschweifigkeit noch an irgend etwas anderem.
Als sie gerade erst bei Topas eingezogen war, hatte sie darüber noch anders gedacht. Zu ihrer Freude hatte sie festgestellt, daß Topas soff wie ein Loch. Gewissenhaft hatte Justine den Alkoholverbrauch registriert. Drei Gläser Sherry vor dem Essen und zwei beim Kochen. Keine Mahlzeit ohne eine Flasche Wein, kein Kaffee ohne Kognak und vor dem Zubettgehen noch ein doppelter Whisky.
Sie hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, morgens die leeren Flaschen aus dem Abfalleimer zu fischen und als Beweisstücke im Keller aufzureihen. Die grünen waren Weinflaschen, die braunen waren Whisky- und Kognakflaschen. Es war erstaunlich, daß Topas noch imstande war, ihre Arbeit zu machen.
Justine war gerade wieder einmal mit Zählen beschäftigt gewesen, als sie Schritte gehört hatte. «Oh, Justine», hatte Topas beim Anblick der Flaschenbatterie schuldbewußt gesagt. Wie immer hatte sie den Kopf ein bißchen schief gehalten, als hörte sie irgendwo etwas, das sie verwunderte. Aber eine von Topas’ irritierenden Eigenschaften war es ja gerade, daß sie sich nie über irgend etwas wunderte.
«Ich weiß, ich weiß», hatte sie beschwichtigend gesagt, «dafür gibt es keine Entschuldigung. Du hast vollkommen recht. Flaschen gehören nicht in den Abfalleimer. Ich bin einfach zu faul, um umweltbewußt zu handeln.»
Auf dem Weg zum Studio hatte das Geklirr der Flaschen eine Unterhaltung unmöglich gemacht. Während Justine sich auf die Nägel biß, hatte sich das Auto langsam mit alkoholischen Dämpfen gefüllt.
Sechsunddreißig Flaschen mußten dieses Mal in den Container geworfen werden, und sie hatten gerade erst angefangen, als neben ihnen ein Wagen hielt und der Rundfunkintendant mit einer klirrenden Kiste ausstieg. «Ich muß eben die Spuren meiner Sünden beseitigen», sagte er. «Gut, daß ich dich treffe, Topas. Wir müssen mal über die Sendetermine der nächsten Saison sprechen.»
«Hauptsache, ich kriege zusätzliche Sendezeit», sagte Topas, die eine Rémy-Martin-Flasche nach der anderen in den Container warf. «Hast du meine Serie über Mendelssohn gehört?»
«Mendelssohn?» fragte der Intendant. Bei ihm waren es hauptsächlich Johnny-Walker-Flaschen.
«Ja, du weißt schon, der berühmte Maler», sagte Topas.
Erst jetzt bemerkte der Intendant Justine. «Das Mädel ist ja ganz blaß. Bißchen zu tief ins Glas geguckt gestern?»
«Ich trinke nie Alkohol», sagte Justine.
«Dann sind Sie bei uns falsch. Es gehört einfach zu Ihrem Beruf, regelmäßig rosa Elefanten zu sehen.»
«Ich sehe immer Dodos», sagte Topas ernst.
Der Intendant lachte. «Das sieht dir ähnlich», sagte er anerkennend.
Und das war’s dann auch schon gewesen. Justine hatte eine Stinkwut gehabt. Sie hatte nicht gewußt, was Dodos waren. Im Büro hatte sie im Konversationslexikon nachgesehen. Der Dodo, auch Dronte genannt, hatte sie dort gelesen, war ein Vogel von der Größe eines Truthahns. Weil er nur rudimentäre Flügel besaß, konnte er nicht fliegen. Deswegen waren diese Vögel hilflos gewesen, als holländische Seeleute sie 1598 auf der Insel Mauritius entdeckt und massenweise abgeschlachtet hatten. Kurz nach 1681 war die Art dort ausgestorben. 1613 war auf der Insel Réunion eine verwandte Art entdeckt worden, die 1750 ausgerottet war. Eine dritte Art, die 1691 auf der Insel Rodriguez entdeckt worden war, hatte das Ende des 18. Jahrhunderts ebenfalls nicht erlebt. Angeberin, hatte Justine gedacht. «Du siehst sie wohl fliegen», hatte sie zu Topas gesagt. «Eben nicht. Das können sie nämlich nicht», hatte Topas triumphierend geantwortet.
Unausstehlich, dachte Justine am Frisiertisch. Sie fand ein Fläschchen Nagellack in einer Farbe, die ihr gefiel. Während sie ihre Nägel lackierte, konnte sie sich gut noch ein Stück von der Kassette anhören.
«Auf dieser Landzunge gab es irgend etwas, das mich unruhig machte», sagte Topas. «Ich schlief schlecht in dem kleinen Hotel, und ich war froh, daß ich mich bei Tagesanbruch aufmachen mußte, um das Fährschiff noch zu erreichen, das offenbar nur einmal pro Woche in Richtung meiner Insel fuhr. Eine direkte Verbindung mit dem Festland gab es nicht, so daß ich auf zwei Inseln umsteigen mußte. Der Tag verging, und ich entfernte mich immer weiter von der Küste.
Am späten Nachmittag frischte der Wind auf und fegte die Wolken vom Himmel. Das Meer sah hellblau, kobaltblau aus. Ich erreichte die letzte Fähre gerade noch rechtzeitig. Wie ein Geburtstagskuchen erhob sich die Insel in der Ferne aus dem schäumenden Meer. Aber während das Boot sich ihr näherte, veränderte sie ihre Form, bis sie genau wie ein Wal aussah, der, sobald ich den Fuß an Land setzte, wegtauchen und einen leeren Fleck auf der Karte hinterlassen würde.
Das Meer war so aufgewühlt, daß ich mich an der Reling festhalten mußte.
‹Hier ist es immer so windig›, schrie der Fährmann, der schielte und Kautabak kaute, ‹seit die Fischer so dumm gewesen sind, an der Quelle oben am Dun-I dem Gott des Nordwinds ein Opfer zu bringen, weil sie unbedingt einen Heringsschwarm nach Süden verfolgen wollten. Ihre Gaben haben das Wasser aufgewühlt, und seitdem ist die See nie mehr ruhig gewesen.›
‹Und haben sie die Heringe gefangen?› fragte ich.
Der Fährmann drehte sich um und hantierte mit rostigen Hebeln. Das Boot verlangsamte seine Fahrt. Ich hatte einen kleinen Hafen erwartet, aber es gab bloß eine Pier aus Beton, die weit ins Meer ragte. An ihrem Ende wand sich ein Weg in die Hügel hinein. In der Bucht dümpelte ein Ruderboot, und auf dem schmalen Sandstreifen lagen ein paar Ölfässer.
‹Sie sind nie zurückgekehrt›, antwortete der Fährmann schließlich. Er fing an, Kisten und Kartons mit Lebensmitteln auszuladen und achtlos auf die Pier zu werfen.
Ich wußte, daß es klug gewesen wäre, ihm alle möglichen Fragen zu stellen, aber den Menschen in diesem Land fällt es leichter, über Meerjungfrauen zu reden als über praktische Dinge. ‹Also›, sagte er, ‹ich muß wieder zurück, bevor die Ebbe einsetzt.›
Aber ich mußte doch zumindest wissen, wo das Dorf war. ‹Warten Sie›, rief ich also. ‹Wohin muß ich jetzt gehen?›
Der Fährmann schielte von mir weg und sagte: ‹Das hängt davon ab, was Sie zu finden hoffen. Es gibt Leute, die glauben, daß die Insel denen, die suchen, etwas zu geben hat. Als ob man irgendwo etwas finden könnte, das man nicht schon in sich hat.› Mir fiel auf, daß das dieselben Worte waren, die der Mann, der sich nach dem Meer sehnte, gesagt hatte – als sei über beide derselbe Geist gekommen, der Geist eines Führers aus einer alten Geschichte. Er spuckte ins Wasser, kletterte an Bord und legte ab. Er fuhr genau unter einem Regenbogen hindurch, der sich über den glitzernden Wellen erhob.
Als ich mich umdrehte, sah die Insel aus wie ein Ort, wo nie etwas passiert. Kleine weiße Wölkchen zogen träge über die Dünenkette am Fuß des Berges, der Dun-I hieß. Dahinter mußte das Dorf liegen, in einem Tal voller Lämmer und wilder Veilchen, wie ich hoffte. Ich blieb aber zögernd auf der Mole stehen. Es war, als hätte ich mit dem Wunsch, hierher zu kommen, all meine Energie verbraucht. Jetzt, da ich mein Ziel erreicht hatte, wußte ich nicht mehr, was ich tun sollte. Im Süden sagt man, daß man, wenn man sich so fühlt, zu einem Baum gehen soll. Man muß sich an ihn schmiegen und ihn umarmen, und dann durchströmt einen neue Lebenskraft.
Am Strand gab es keine Bäume, und so setzte ich mich hin, lehnte mich gegen einen Stapel Kisten und sah aufs Meer hinaus. Die Sonne stand tief über dem Wasser, das mit jedem Wellenschlag seine Farbe veränderte. Da saß ich also, auf der Insel, auf der ich mich von meiner Last würde befreien können. Ich will dir sagen, warum, Justine. Ich werde dir sagen, was der Mann, der sich nach dem Meer sehnte, mir über diese Insel erzählt hat.
Seit Menschengedenken steht hier ein Kloster, in dem heilige Männer über den Sinn und Zweck des Lebens meditieren. Dieses Kloster hat eine bewegte Geschichte. Wikinger legten die Gebäude in Schutt und Asche, aber die Mönche bauten sie wieder auf. Mißgünstige Druiden zerstörten die Kirche, aber die Mönche setzten sie wieder instand. So leisteten sie Widerstand, bis ein Blitz einschlug und alles abbrannte. Das war das Werk des Himmels, und da gaben sie auf.
Jahrhundertelang standen die Ruinen verlassen am Strand, und die Inselbewohner behaupteten, daß es dort spuke, aber das tut es in diesem Teil der Welt nun einmal schnell. Um die Jahrhundertwende hatte ein Missionar eine Vision: Kein anderer als Pontius Pilatus erschien ihm, rang die Hände und beschwor ihn, das Kloster wieder aufzubauen und so alle Fehler, die die Menschheit in ihrer Geschichte begangen hat, wiedergutzumachen und alle Sünden zu tilgen. Der Missionar machte sich auf die Reise zu der Insel und sah, daß der Auftrag undurchführbar war: Die Wiederherstellung des Klosters würde ein Vermögen kosten. Wieder erschien Pilatus und ließ in dem Bemühen, sich von seiner Schuld reinzuwaschen, einen Sturzregen auf die Ruine niedergehen. Es muß ein Wolkenbruch gewesen sein, der alle Keller unter Wasser setzte, die Boote in der Bucht versenkte und Dutzende von Schafen ins Meer spülte. Vierundzwanzig Stunden lang lagen die Inselbewohner auf den Knien und beteten Rosenkränze, bis der Missionar Pilatus sein Wort gab. Da legte sich der Sturm.
Kurze Zeit später erhielten die drei reichsten Männer der Welt Briefe, in denen sie gebeten wurden, die Restaurierung des Klosters zu finanzieren. Der erste machte sich nicht einmal die Mühe zu antworten, der zweite telegrafierte die Adresse seines Psychologen, der dritte aber schickte einen Blankoscheck. Er hatte einen guten Grund, sich um die Vergebung seiner Sünden zu bemühen. Er war Senf gasf abrikant.
Als dank der Senfgasmillionen das Kloster in seiner alten Pracht wiederhergestellt war, erfuhr der Missionar, daß früher in der Kirche ein silbernes Kreuz gestanden hatte. Es gab davon zwar keine Abbildungen, aber die Überlieferung war eindeutig. Der Schulmeister konnte es ohne zu zögern aufmalen: ein monumentales, verziertes Kreuz im keltischen Stil. Es gab weit und breit nur einen einzigen Schmied, der ein solches Kreuz anfertigen konnte, einen alten Mann, der auf einer anderen Insel lebte, drei Tagesreisen vom Kloster entfernt.
Als der Missionar nach der langen Reise an die Tür des Silberschmieds klopfte, öffnete ihm eine alte Frau. Sie war schwarz gekleidet, und ihre Augen hatten rote Ränder. In der Nacht zuvor war ihr Mann gestorben.
Die Werkstatt stehe aber voller Kreuze, sagte die Witwe. Wenn der Missionar wolle, könne er sich eins aussuchen. Also ging er hinein und untersuchte aufgeregt ein Kreuz nach dem anderen. Aber keines war mit dem Ornament verziert, das er suchte.
Als er sich niedergeschlagen von der Frau verabschieden wollte, verfinsterte sich der Himmel. Ein heftiger Regen ging nieder, und der Wind drückte gegen die Fenster. Klirrend flog eines davon auf, Eiseskälte wehte herein und fegte einen Stapel Lumpen beiseite. Unter ihnen lag das keltische Kreuz.
Mit Tränen in den Augen verglich der Missionar es mit der Zeichnung des Schulmeisters. Es stimmte in allen Einzelheiten mit ihr überein.
‹Dieses Kreuz ist nicht zu verkaufen›, schrie die Frau gegen das Brüllen des Sturmes an. Ihr weißes Haar war zerzaust und stand wie eine Krone rings um ihren Kopf – hinter dieser Bö muß der Teufel gesteckt haben.
Inständig flehte der Missionar sie an, aber die Witwe ließ sich nicht erweichen.
‹Zwölf Jahre lang hat mein Mann daran gearbeitet, und zwölf Jahre lang hat er mir immer wieder gesagt, daß wir es nie hergeben dürften›, rief sie.
‹Ich werde Ihnen den zehnfachen Preis bezahlen›, versprach der Missionar verzweifelt.