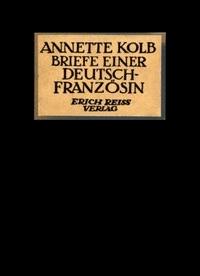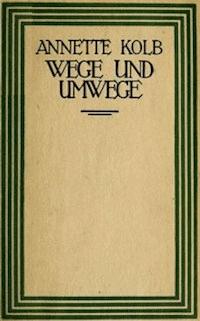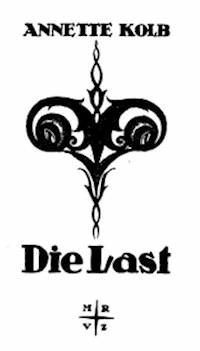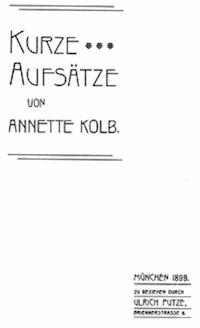0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Project Gutenberg
- Sprache: Deutsch
Gratis E-Book downloaden und überzeugen wie bequem das Lesen mit Legimi ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 305
Ähnliche
Das ExemplarRomanvonAnnette Kolb
1913S. Fischer, Verlag, Berlin
Zweite Auflage Alle Rechte, besonders das der Übersetzung, vorbehalten. Copyright 1913 by S. Fischer, Verlag, Berlin
Das Exemplar
Erstes Kapitel
Zwei Monate aus Mariclées seltsamem Leben seien hier preisgegeben und der Vorhang weit davon zurückgeschlagen; dann falle er wieder zu, und sie mag wieder ihres Weges ziehen. Man nannte sie Mariclée. Niemand wußte, wer sie zuerst so nannte, aber keiner nannte sie anders. Und es war bezeichnend, denn sie hatte etwas Namenloses, Unzuständiges, wie es auch stets ihr Los war, mit gesellschaftlich denkbar verschiedensten Leuten in Kontakt zu kommen und selbst keinem einzigen Kreis anzugehören. Dies führte so weit zurück, als sie sich erinnern konnte, und fügte sich so allerorts, als müßte es so sein.
Denn in unserem Leben stehen wir wie inmitten einer Landschaft, und mögen unsere Schicksale noch so bereichert wiederkehren, sie weisen doch einen höchst gleichartigen Charakter auf; wie etwa ein Gletscher nicht auf einer Düne steht: diese Art von Uniformität, meine ich, trägt unser Leben zur Schau.
Und das ihre glich einer Bergstraße. Wo nur ein Ausblick lag, da würde sie stehen; da zog sich ihr Weg hin, doch lenkte er nie bis ins gelobte Land hinein. Nur eines anzuführen: Mariclée kam leicht in Palästen zu wohnen, wie die Steinnelke gern an steilen Anhängen wächst. Aber sie hatte kein Geld. An ihr war alles wie hingeflogen und wieder abgerissen: ihr Verhältnis zum Leben, zur Natur, zu den Menschen, zu sich selbst. Sie stand sich nicht sehr nahe. Und darum gehörte sie zu jenen heute nicht mehr seltenen Menschen, von denen behauptet wird, daß sie nicht lieben können.
Mariclée hatte viele Freunde und dachte sie diese zu einer Garbe zusammengestellt, so hielt sie eine Probe der verschiedensten, seltensten Blumen, die’s heute gibt. Denn auch dies war ihr Geschick, daß sie spät oder früh, dauernd oder flüchtig auf ihrem Wege blühten. Darum stand sie zu ihnen wie ein Kunstsammler zu seinen Raritäten: daher ihr Spleen, vielleicht auch ihre Blasiertheit. Denn wer die Menschen ihrem Wert nach liebt, der schätzt den einen gegen den anderen ab, und das schrankenlose Aufgehen in einem einzigen vermag er nicht mehr.
Doch auch die besten Auktionen haben ihre Glanznummern. Und plötzlich war es über sie gekommen, daß sie im August des Jahres 1909 nach London fuhr, um nach Jahren ein Wunderexemplar ihrer Sammlung wieder vorzunehmen. Allein es fing gleich damit an, daß sie einander verfehlten. Das „Exemplar“ — es soll nicht anders heißen in dieser halb leidenschaftlichen, halb kuriosen Geschichte — hatte sich eingefunden, aber Mariclée hatte sich unbegreiflicherweise im Datum geirrt und traf erst am folgenden Morgen ein. Jetzt mußte sie zehn Tage bleiben, wenn sie ihn erwarten wollte.
Es war ihr erster Abend. Wie mit einem gelben, welken Schleier umwob die Hitze den Himmel und den träumerischen Park von St. James. Über die Brücke gebeugt, hingen ihre Blicke an den Wasserflächen und tauchten unter wie gebannt. Die Schwäne glitten, nie emporblickend, dahin, und so schwermütig und weit vibrierte da die müde Stunde, so riesig waren ihre Schauer, daß Mariclée sich hastig losriß und zur Ablenkung, und weil sie London überblicken wollte, das Dach des ersten Motorwagens bestieg, der ihr entgegenfuhr.
Allein er trug sie unversehens in eine entsetzliche Welt. Denn jene selbe Gleichförmigkeit, die ihr an den glatten, großfenstrigen Häusern der Reichen so würdig, stilvoll und motiviert erschien, wie schmachvoll ist sie in den Slums! Und Sklaven waren das, die hier mit gemordeter Phantasie, ja, wie Geblendete in solch unerhörten Häusern zu wohnen einwilligten, an denen nicht ein Fenster, nicht eine Tür von der des Nachbarn sich unterschied, sondern die in ihrer schmählichen Gleichförmigkeit wie Sträflinge dastanden, ihre meilenlangen, niedrigen Reihen verzweifelt ausgestreckt, Händeringende, Lebendig-Begrabene, Bilder der Hölle!
In dieser Woche sollten viele Leute an Hitze sterben, ihr aber war am nächsten Morgen, als sei London eine riesengroße gelbe Schlange, die sie unbarmherzig immer fester an sich drücken und ersticken wollte. Aber es war etwas anderes: es hatte sie so hart und unvorbereitet getroffen, das Exemplar verfehlt zu haben, daß sie, um den Schlag aufzuhalten, sich sagte, sie spüre ihn nicht, die Verzögerung passe ihr sogar. Nun rächte sich die Lüge. Was wollte sie in London und was nützte ihr jetzt die zierliche, nahe an Westminster gelegene Wohnung, die ihr von Freunden überlassen worden war? Selbst die Sonne konnte es ihr nicht mehr recht machen, ob sie grell schien oder wie durch Alabaster: Spleen, Neurasthenie sind ja nichts anderes als ein Erkranken unserer Eindrücke, und jeder ist da sein eigener Arzt und weiß allein, ob er dem Leiden gebieten kann, oder ob es über ihn hinschlägt und wie eine Sturzwelle ihn hinabreißt. Mariclée hatte einen Brief an eine irische Dame in Hampstead — einem Vororte — ganz zu unterst in ihrem Koffer liegen, denn sie hatte nie beabsichtigt, sich seiner zu entledigen. Statt dessen gab sie ihn nun auf der Stelle auf. Sonst war — im August — von allen ihren Bekannten nur der deutsche Botschaftsrat in London und ihm hatte sie ihr Hiersein erst recht zu kaschieren gedacht, statt dessen stürzte sie ans Telephon und es fiel ihr ein Stein vom Herzen, als sie die wohlbekannte Stimme hörte und er sie für denselben Abend zu sich lud. Sie nahm sogleich einen Hansom und blickte mit fiebernden, wie erweiterten Augen in den gelb verglühenden Tag.
Bei ihm sah es übrigens auch recht verlassen aus: sein Hausstand unterwegs und alle Möbel in Überzügen. Aber die rationelle Art, mit der Mariclée ihm jetzt eine Menge Eindrücke, von denen sie nichts zu wissen glaubte, Beobachtungen und Vergleiche mitzuteilen hatte, frappierte sie. Sie hatte doch geglaubt, sie sei krank! Und jetzt ging sie so munter das weite Zimmer auf und nieder, blieb wieder stehen, rauchte Zigaretten vor dem Kamine, warf sich in einen Armstuhl, sprang wieder auf, und war ganz Bewegtheit und Bewegung, wie der vom Windstoß gekräuselte See.
„Ich finde London verändert wieder,“ rief sie. „Wie individuell, wie wesenhaft ist doch die Seele einer Stadt. Diese hier gleicht einer Blume, die sich jetzt voll entfaltete, einem vollen Kelche, einer fast überreifen Frucht. Neu ist auch in dem alten Zauber, der alten Glut, die über London ausgegossen liegt, der nachsommerliche Puls. Aber die Worte wie überschrittener Höhepunkt, absteigende Linie sind hier viel zu bequem! Der Maßstab des Altertums ist an unsere Ära nicht anzuwenden, in uns liegt ein zu großer Vorrat treibender Kräfte der Umwandlung und der Verjüngung. Auch unsre gefährlichsten Phasen führen nicht mehr zum Verfall.“ Und dabei erhob sie sich, denn gewagte Dinge pflegte sie immer sehr bestimmt zu sagen; hier lag ihre ganze Sicherheit.
„Ein Etwas auf diesem Boden,“ fuhr sie fort, „heimelt mich immer so unsäglich an. Man ist hier viel weniger intellektuell, aber wie viel vergeistigter ist dennoch das Tierische. Auserlesene Organismen dürfen sich gewiß am glücklichsten potenzieren, wo das äußerliche Leben den adligsten Zuschnitt findet, als hätten die Engländer nicht nur mehr ästhetischen Sinn, sondern ästhetischere Sinne. Auge, Nerv und Sensibilität des Gebildeten erfahren so im vornherein mehr Würdigung und Schonung, weil die Zivilisation in ihrer untersten Stufe — der dienenden Klasse — um einige Schichten höher fundiert. Ich ließ mir heute von einer housemaid eine Adresse aufschreiben und war von ihrer schönen, ja eleganten Schrift gerührt.“
„Dafür ist bei uns die Mittelklasse entschieden schmucker geraten,“ sagte der Botschaftsrat. „Hier nennt man ja auch middle-class,“ sagte Mariclée, „was wir auf deutsch untergeordnet heißen würden. Wie anders bei uns! Insofern ist es zutreffend, dies überfüllte London leer zu nennen, wenn die vornehmen Leute nicht zugegen sind. Ich habe noch keine schönen Menschen gesehen.“
Und immer lebhaft, immer von neuem angeregt, fuhr sie zu plaudern fort. Wie ein Feuer, das zusammensank, und dann plötzlich wieder zu knistern, zu prasseln und zu lodern anfängt, so war sie jetzt mächtig in Schwung geraten, die Dinge nahmen wieder ihre rechten Verhältnisse an, und ihr Spleen und alles was sie selber betraf, schrumpfte zu einem so unwichtigen Punkte ein, daß sie ihn nicht mehr gewahrte. Die beiden aßen dann allein in dem großen Speisesaal am verkleinerten Tisch und im Raum verloren wie auf einer Bühne. Der Faden ging ihnen nie aus, und sie waren einander zugetan und vertraut. Allein sie waren zu jung, um nicht zu fühlen, daß der Rahmen etwas zu romantisch war für die Situation, weil sie nie aneinander dachten.
Dies war Mariclées zweiter Abend in London.
Tags darauf gedachte sie einer Freundin, auf welche sie sich bisher nicht hatte besinnen wollen. Denn ihre Wege lagen so abseits. König Eduard verbrachte alljährlich eine Woche bei ihr; sie hielt auf einem der schönsten Schlösser Englands großen Staat, und Mariclée scheute aus vielen Gründen das Drum und Dran eines solchen Besuches. Und nun schrieb sie ihr doch. „Wie gerne würde ich kommen,“ schrieb sie ihr, „sofern es sich in einem Tage machen läßt, denn leider ist es mir ganz unmöglich zu übernachten.“ Nachträglich riß sie den Brief noch einmal auf, um die Worte „ganz unmöglich“ zweimal zu unterstreichen.
Diese wenn auch noch fiktive Unterbrechung ihrer Tage mußte sie sich jetzt schaffen, denn der Spleen saß ihr immer tiefer im Nacken. Wem er nie widerfuhr, wie könnte der begreifen, daß eine ledigliche Stimmung in dem Maße unsere Energie lähmen darf? Ein paar vor uns liegende Tage nehmen da die bedrohliche, unübersehbare Länge finsterer Jahreszeiten an, und man entschließt sich nicht eine Straße hinabzugehen, weil einem vor der weiten Reise graut. In Westminster Abbey hatte Mariclée die Flucht ergriffen, weil in dem grasigen Hofe das Sonnenlicht so qualvoll stille auf dem Gemäuer lag und die etwas rudimentäre englische Gotik (sie feiert keine heimlichen Minnelieder in luftigen Balustraden, tröstlichen Pfeilern und Koloraturen) ihr das Herz zermalmte. Ihre Fenster sahen auf einen grünen Hof, eine gotische Kirche und ein paar Bäume. Und auch hier steigerte sich der helle Tagesschein, der darüber leuchtete, zu einem so kranken, unerträglich wehen Licht, daß sie die schweren Vorhänge gesenkt hielt, um es auszuschließen. Mariclée lag im Dunkeln auf dem Diwan ihres geborgten Salons, als plötzlich ein Pfiff ihre stillen Räume durchdrang. Sie stürzte an die Tube. Der Liftjunge meldete einen Besuch und fragte an, ob sie empfing.
Es war die Dame aus Hampstead, die als Antwort des eingesandten Empfehlungsbriefes erschien und ehe Mariclée die Vorhänge zurückschlagen konnte, stand sie schon an der Schwelle. Sie war sehr provinzlerisch, hatte Zähne, vor denen man sehr erschrak, und auf ihrem Hute schwankten rote, lächerliche Blumen. Aber den Ausschlag gab eine anheimelnde Begrenztheit, die Mariclée unverweilt zu Herzen ging. Sie war die Gutherzigkeit in Person, hielt sich nicht lange auf, und lud Mariclée ein, den morgigen Sonntag nach Hampstead zu fahren und den Nachmittag und Abend mit ihrer Familie zu verbringen. Gewiß, natürlich, mit Vergnügen würde sie kommen. Es war ein kurzer Besuch und weil ihr bangte, so schnell wieder allein zu bleiben, und sie ihren Brief aufgeben wollte, gab sie dem Gast zur naheliegenden Victoriastation das Geleite. Erst auf der Straße im Sonnenlicht bemerkte sie deren erhitztes und ermüdetes Gesicht. Sie hatte die Mühe nicht gescheut, in dieser Glut so weit zu ihr herauszufahren und Mariclée hatte nicht einmal daran gedacht, ihr eine Tasse Tee anzubieten. Dies war unverzeihlich. Allein es stand geschrieben, daß sie sich mit dieser Familie stets schlecht benehmen würde.
Und der Sonntag kam: auf heißen, bleiernen Sonnenrädern kreiste er über die Stadt. Mariclée mußte an Münchener Freunde denken, die ein junges Krokodil in einem Glaskasten aufgezogen hatten: an einem schönen Frühlingsmorgen stellten sie ihn auf die Veranda, und vergaßen ihn dort; die Sonne prallte gegen das Glas, und nach Verlauf von ein paar Stunden lag hier, verdurstet und verdorrt, ein in dem kalten Deutschland vor Hitze verendetes Krokodil. Und so ward ihr die Einsamkeit, der sie sich zur Unzeit in die Arme geworfen hatte, zum erstickenden Glaskasten.
Sie wohnte in einem sogenannten mansion das heißt, es fehlte die persönliche Bedienung, aber läutete man, oder blies in die Tube, so meldete sich ein Stubenmädchen oder ein Liftboy oder ein Kellner, und wer nicht ausgehen mochte, konnte zu Hause essen, vorausgesetzt, daß er auf den Sonntag nicht vergaß. Als sie da um zwei Uhr klingelte, hieß es, die Küche sei gesperrt und sie hätte nichts bestellt. Sich aber in den heißen Häuserozean zu stürzen, und nach einem Hotel zu fahnden, dazu fehlte ihr ganz und gar die Kraft. Zur Teezeit würde sie ja in Hampstead sein, und so lange hielt sie es schon aus. Später beim Umkleiden fror sie, woraus sie schloß, daß es kühler geworden sei, und sie zog sich herbstlicher an.
Aber draußen wehte keine Luft, nur heißer Benzinhauch, und die Häuser begannen zu schwanken und zu brausen, und wie Wellen sich zu häufen, unbarmherzig und uferlos. Die Dächer glitzerten, die Fenster blendeten . . . so kam sie nach Hampstead. Das Haus der irischen Familie aber war luftig und groß, der kühle Salon fast ein Saal. Er überblickte einen flachen, reizenden Garten, und schweres Silber schimmerte vom Teetisch. Mariclée warf einen raschen Blick auf die hot-cakes und nahm sich vor, eine hübsche Anzahl davon zu essen, aber sie brachte, so vorzüglich sie waren, kaum das erste hinunter und zerbröckelte es mit etwas zitterigen Fingern.
Die Familie war sehr zahlreich und bestand aus alten Eltern und gereiften Söhnen und Töchtern. Nach dem Tee wurde gefragt, ob sie lieber zur Hampsteader Heide oder zum Tennisklub ginge. Ach! sie schielte nach dem Garten! aber der Tennis, sie merkte es gleich, stand auf dem Vergnügungsprogramm des Tages und so zog sie denn mit, und in der Sonne, auf einem unbequemen Klappstuhl placiert, sah sie den Spielenden zu. Was sie da vor Augen hatte, war gute Bourgeoisie, abseits des Snobismus, wie der Eleganz. Wer immer zu ihr sprach, sprach ihr mit einer herzhaften Breitspurigkeit, die wir fast schamlos fänden, ausschließlich vom Wetter. Aber Wetter, Politik und Sport sind eben die drei brennenden Themen in England. Und dann war von diesen spielenden Männern keiner von des Gedankens Blässe angekränkelt; sie fanden im Ballwerfen nicht Erholung, sondern Beschäftigung, und selbst die schon Ergrauten hatten etwas von sympathischen Kindern an sich. Nur für den Schneider machte es einen Unterschied.
Mariclée saß in ihrem heißen Kleide in der Sonne, unbeweglich mit aufgespanntem Schirm und von den Wettergesprächen grenzenlos ermattet, als plötzlich ein neues Klubmitglied in Gestalt eines Franzosen auf dem Platze erschien. Darob entstand nun — der Entente cordiale zum Trotz — allgemeine Verwirrung und Konsternation. Ein Ring des Schweigens zog sich um ihn; verstohlene Blicke gingen hin und her, zögernde Mienen umgaben ihn: er war wie unter die Wilden geraten. Mit einer Geste selbstloser Entschlossenheit legte endlich eine Spielerin ihr Rakett hin und begann mit dem neuen Ankömmling ein wundervolles Gespräch. Der Franzose, der sehr höflich, aber aus Bordeaux war, gab sich erst alle Mühe zu verstehen, dann aber zu vertuschen, wie wenig er von dem entlegenen Französisch dieser Engländerin erriet, und statt ihr beizuspringen, hielt Mariclée ihren Schirm etwas tiefer und horchte so ergötzt, daß sie alle ihre Leiden darüber vergaß.
Als es endlich kühl und angenehm im Freien wurde, brach alles auf, um sich für den Abend umzuziehen. Sie indessen blieb wieder in dem luftigen Salon, bald von diesen, bald von jenen Mitgliedern der Familie unterhalten. Und jetzt sprach man nicht mehr vom Wetter zu ihr, sondern von den Kriegsplänen der Deutschen gegen England. Sie raffte sich auf, sie abzuleugnen, und voll Eifer zu versichern, daß wir die Engländer liebten. Dann fragte alles, ja wozu wir dann in so wütendem Tempo unsere Kriegsschiffe bauten?
„Weil es nichts Rückständigeres gibt, als die Gegenwart,“ sagte sie plötzlich. Der Satz gehörte nur weitläufig hierher, aber sie hatte ihn irgendwo einmal mit Erfolg geäußert, und half sich schnell damit aus. Die Worte fingen nämlich jetzt an denselben Tanz aufzuführen, wie vordem die Dächer und Häuser. Mein Gott! dachte sie, wann essen diese Menschen zu Abend? Jetzt wollte gar der Hausherr den Gedanken näher erörtert haben, und seine Tochter setzte hinzu: o, sie hätte schon vernommen, was für eine geistreiche und interessante Person sie sei. Mariclée wollte etwas darauf erwidern, aber statt dessen streckte sie die Hand aus, und fiel zurück.
Es war jedoch keine Ohnmacht. Denn sie sah genau, wie die alte Mutter dieser gereiften Söhne und Töchter ihrem Manne und ihren Kindern ein Zeichen gab, daß sie das Zimmer verlassen sollten; und sie blieb allein mit ihr zurück. Mariclée sprach eine Zeitlang nichts, dann sagte sie, es sei die Hitze, die ihr solche Kopfschmerzen gebe. Aber die Alte wollte nicht dulden, daß sie sich aufrichtete, sondern hieß sie schweigen, und ergriff ihre Hand. Dabei murmelte sie Worte wie zu sich selbst, mit einer leisen, veränderten Stimme. Mariclée betrachtete sie mit einem Male voll Neugier. Ihre Schlichtheit hatte etwas so Edles — wem in aller Welt glich nur diese Frau? an wen erinnerte dies gebleichte Haupt und diese unbewegte und versteinerte Gestalt? Ja wahrhaftig, jetzt hatte sie’s, sie hatte etwas rein Antikes, sie gemahnte an die alte Schaffnerin der Odyssee.
Mariclée sank wieder zurück und ließ sie gewähren, ihre Hände streicheln und ihre Worte murmeln. Denn ihre Gedanken wanderten jetzt weit von hier. Ach wie ferne stand ihr dieses Haus, und diese gütige Alte! und sofern das Leben ein Wandern ist, hatte sie nicht Jahre winterlichen Bodens überschritten, und war sie nicht traurig und fremd wie Demeter unter diesem Dache eingekehrt? Sie weinte nicht, ihre Züge verhielten sich ja unbeweglich: es war nur als quoll ein heißer Saft tropfenweise aus ihren geschlossenen Augen. Warum hatte sie ein falsches Datum angegeben? welch freudloser Stern hatte es so gewollt? und was hatte sie vermocht, sich selber vorzulügen, daß es sie nicht beträfe? Nichts fällt ja so schwer auf unsere Schultern zurück, als wie ein abgeworfenes Kreuz.
Dies war ihr vierter Tag in London. Jedoch der Wein und der Schinken, den es an diesem Abend gab, blieben ihr unvergeßlich.
Zweites Kapitel
Bis jetzt war Mariclées Reise ein fortwährendes Fiasko gewesen, und zwar gleich von der Überfahrt an. Sie hatte sich nicht vorgesehen, und alle Einzelkabinen besetzt gefunden. Im Ankleideraum aber boten — wie auf Order hier eingeschifft — die häßlichsten Damen des Kontinents ein wahrhaft tückisches Bild. Und die Abscheulichste, mit hornharten, zielsicheren Augen, seifte und striegelte ihre Arme, die Sünderin, als wären sie schön. Mariclée wich vor ihrem Anblick erschrocken zurück und floh an Deck. Denn lieber als mit den häßlichen Frauen verbrachte sie die kalte Nacht (das schöne Wetter setzte erst am folgenden Tage ein) ohne Mantel auf einer harten Bank. Dort hatten sie gegen Morgen recht trübselige Träume heimgesucht . . . .
Am Montag zog die Sonne wieder am wolkenlosen, gelb umdunsteten Himmel, wie inmitten eines Strahlenkranzes, auf und drückte wie eine feurige Krone auf London hernieder. Auf den Simsen der Fenster lag überall ein feiner Ruß, doch standen am Vormittag ihre Zimmer im angenehmsten Licht, und ganz erfüllt von Londons penetrantem und rauchigem, jedoch so stimulierendem Geruch. Freilich durfte man jetzt nicht denken: ein paar Stunden von hier, da frohlockt eine beschauliche Luft, da summen Bienen, da atmen Wälder und das glückliche Meer — — — und wie sie eben dennoch daran dachte, pfiff und klingelte es wieder in ihrer Wohnung, und ein kleiner Telegraphenjunge stand mit einer Depesche vor ihrer Tür. Jene Freundin, auf die sie sich nicht hatte besinnen wollen, von der sie sich vergessen glaubte, und der sie dann doch geschrieben hatte, lud sie dringend bis zum Samstag zu sich ein. Mariclées Herz stockte vor Freude. Vor Sonntag hatte sie keine Aussicht das Exemplar in London zu sehen. Wie sich das traf! Auch zauderte sie keinen Augenblick, schrieb eine Zusage und reichte sie dem Boten. Erst als er mit ihrer Antwort abgezogen war, fiel ihr das dickunterstrichene „ganz unmöglich“ aus ihrem Briefe ein.
Den Abend verbrachte sie mit dem Botschaftsrat. „Eigentlich wollte ich morgen nach Glenford,“ teilte sie ihm mit.
„Wie amüsant!“ sagte er.
„O nein!“ seufzte Mariclée. „Wenn viele Gäste dort sind, setzen sie des Abends ihre Tiaren auf, und meine Situation ist dann unhaltbar. Fürs erste wäre ich natürlich die einzige, die nicht ihre eigene Jungfer brächte. Wie stehe ich dann da?“
„Ich versichere Sie, wegen Ihrer Pretiosen ladet Sie niemand ein.“
„Wie herzlos Sie oft reden!“ sagte sie. Aber er ließ sich nicht aus seiner Ruhe bringen.
„Ich bin auf Ihre Eindrücke gespannt,“ gab er zurück.
„Aber ich kenne den Schauplatz, und weiß, was ich riskiere.“
„Ich meine, daß Sie es dennoch riskieren sollten,“ sagte er.
Und sie sprachen von etwas anderem.
Von allen gedankenlosen Aussprüchen ist der gedankenloseste: „Les extrêmes se touchent“. Zum mindesten bei Individuen. Wo Kontraste sich berühren, geschieht es immer durch irgendwelche geheime Ähnlichkeiten. So bestand zwischen den Beiden infolge ihrer Kontraste eine Kluft, aber die Gleichheit ihrer Interessen war ein starkes Band.
Mariclée war vorhin einem sehr komischen Herrn begegnet, der mit fliegenden Frackschößen seiner Mahlzeit entgegeneilte. Von ihm erzählte sie nun. Er schien so ohne jeglichen Vorbehalt und auf so groteske Weise mit dem Leben einverstanden und eine so froschhafte Befriedigung machte sich auf seinem alten Gesichte breit, daß zu ihm gehalten selbst der dümmste Deutsche denkerisch veranlagt schien. Und sie vertieften sich wieder in ihr übliches Gespräch. Er meinte, selbst die gescheiten Engländer dächten sehr oft nicht. „Aber,“ rief sie, „wie haben es dafür die paar Nachdenklichen hier schön! Und wie früh gelangen sie zur Macht. Sie haben nicht wie bei uns wider die überhitzte Intellektualität jener Legion von Halbgescheiten anzukämpfen.“
Von draußen wogte und brauste die mächtige Stadt wie von der Ferne herein. Mariclée hatte sich behaglich in eine Sofaecke zusammengerollt und starrte vor sich hin. „Ich habe eine große Entdeckung gemacht,“ hub sie an, „aber es ist so hart, daß ich für meine Entdeckungen nie etwas bekomme!“
„Was denn für eine Entdeckung?“ forschte er.
„Ich entdeckte etwas, indem ich etwas wissen wollte,“ sagte sie. „Ich wollte wissen warum die deutsche Dummheit sich so gar nicht zur englischen Borniertheit verhält, da der englische und der deutsche Geist einander doch so zugänglich, so verwandt, ja in mancher Hinsicht fast identisch sind. Während der französische und der deutsche Geist solche Not haben einander zu durchdringen, und zwar am fühlbarsten wohl in der Politik, wo Ihr beim besten Willen vor Reibereien zwischen der Gloriole Française und dem deutschen Starrsinn nicht vom Flecke kommt. Dies Kompliment muß ich Euch en passant schon machen.“
„Aber die Entdeckung?“
„Ferner wollte ich wissen,“ fuhr sie fort, „warum dagegen bei so großer Divergenz des Geistes die Sottise française und die Bêtise allemande so stammverwandt sind, und so ausgezeichnet harmonieren, daß sie die reine Terz abgeben! Dies ist meine Entdeckung. Was geben Sie mir dafür?“ und sie streckte lachend die Hand aus. Denn Mariclée wurde stets sehr aufgeräumt, wenn man auf ihre Worte achtete. Vor leidlich klugen Leuten konnte sie nicht bestehen. Es bedurfte wirklichen Scharfsinns, denn sie war allzu elektrisch: wer nicht fest auf die Klinge drückte, vernahm keinen Ton.
Als sie nach Hause kam, lag schon ein Brief ihrer Freundin vor, der genaue Angaben betreffs ihres Zuges enthielt, und ebensowenig wie das Telegramm auf das bewußte „ganz unmöglich“ einging. Sie las ihn noch unten in der Halle. „Es wird, wie’s wird,“ dachte sie, „zum Absagen ist es zu spät.“ Und sie betrat den Fahrstuhl, vor dessen Tür ein Junge wartete. Den Dienst besorgten zwei Liftboys, von welchen der eine häßlich war und untersetzt, der andere einen eleganten Kopf auf einem hochgewachsenen Körper trug. O Macht der Schönheit! Immer zog sich ihr Herz zusammen, wenn sie der Häßliche hinaufzog.
Drittes Kapitel
Früh am nächsten Nachmittag fuhr sie statt in einem Taxameter aus Liebhaberei in einem Hansom zur Bahn, weil es sie jedesmal optimistisch stimmte, wenn sie in diesem so geschmackvollen und würdigen Vehikel einherzog. Der Londoner Himmel sah aus, als ob er überhaupt nie wieder zu regnen, noch je ein Wölkchen aufzubringen gedächte. Ihr Hansom fuhr recht gemächlich, so daß sie Zeit hatte, eine Revision ihres Geldbestandes vorzunehmen. Denn Mariclée notierte nie eine Ausgabe, weil es sie deprimierte, und ihre Rechenkünste beschränkten sich darauf, daß sie hin und wieder zusammenzählte, was ihr noch blieb. Man hatte ihr versichert, in England sei es akzeptiert dritter Klasse zu fahren, selbst für die reichsten Leute; sie fand das zwar im höchsten Grade merkwürdig von diesen reichen Leuten, allein die Fahrt war teuer, sie trug sich noch mit ungewissen Plänen, und mußte in petto die sehr bedächtige Ameise spielen, wollte sie auf ein Weilchen den Schein der zirpenden Grille vertreten. Sie lief also erst auf den Perron, sah mit Späherblicken umher, und musterte alle Reisenden. Es war ein denkbar philiströses Publikum, und sie löste beruhigt eine Karte; kaum schritt sie aber wieder den Zug entlang, als eine Dame vor ihr stand, die genau aussah, als führe sie nach Glenford. Ihr Haar war wundervoll aufgebaut, in der Hand hielt sie ein Safrantäschchen (ihre Tiara?) und nicht nur eine Jungfer, es summte auch, halb Hofprediger, halb Monsignore, der distinguierteste aller Kammerdiener um sie her. Mariclée wollte an das andere Ende des Zuges gehen, aber der Schaffner beschied sie, daß nur ein einziger Wagen bis nach Ollerton lief. Es war derselbe, den die Dame bestieg. Ihre Reisegefährten, ein borstiger alter Brite und seine unschöne ältliche Tochter waren vielleicht sehr reich, elegant waren sie nicht. Sie sahen aus als bewohnten sie in irgendeinem geisttötenden Nest ein phantasieloses Cottage. Und so war es auch. Als der Zug vor einem öden, roten Städtchen hielt, befanden sich die beiden offenbar zu Hause. Statt ihrer zog jetzt eine große Hutschachtel in das sehr schäbige und schmutzige Kupee, gefolgt von einem Fräulein in Filosellhalbhandschuhen und mit zerstochenen Fingern. Aber vielleicht war sie sehr reich und nähte nur zu ihrem Vergnügen. Die Dame mit der Tiaratasche fuhr noch immer mit. Schon wurde Leicester ausgerufen. Da — o unverhoffte Freude! Wahrhaftig sie entstieg dem Zuge, auf Nimmerwiedersehen überschritt sie die Plattform, von ihrer Jungfer, ihrem päpstlichen Legaten und Mariclées Segenswünschen gefolgt. Bald darauf kam ein Fluß und ein Hügel, der sich ganz für sich allein am Ufer hinzog und hier stieg auch das Fräulein mit der Hutschachtel aus und Mariclée war allein. Wie eine schimmernde Schale breitete sich das Land vor ihren Blicken aus, und der Tag schien in seinem eigenen Glanze versunken. Die Sonne goß jetzt ermattet Ströme silbernen Lichtes über die umfriedeten Äcker und die in biblischer Ruhe gelagerten Schafe. Und die umflitterten Bäume, das wellige Land, die schwimmenden Fernen, sie alle schienen zum Meere hinzuwallen oder zu rufen: „Als eine Insel liegen wir im Meeresschoß!“
In den leeren Wagen drang bald darauf der Abend mit köstlicher Frische herein; niemand störte sie mehr. Der Zug fuhr durch das versonnene Land wie im Traume dahin und erfüllte die stille Luft mit seinem Gerausch. Wälder tauchten empor, Dörfer, verlorene Städtchen richteten sich auf, doch unaufhaltsam eilte er jetzt an ihnen vorbei. Über den schlicht gepolsterten Sitzen hing ein Spiegel. Mariclée band sich einen neuen Schleier um, und fing an sich zu richten. Ihr halb gejagter, halb duldender Blick machte ihr nichts weis. Sie wußte, das Wesen, das sie da mit so ernster Miene ansah, war jetzt doch in seinem Element und liebte es halb als Heldin, halb als Abenteuerin sich zu fühlen. Bald kam es jetzt, das prunkende, ewig umdüsterte Haus, Englands berühmtes Geisterschloß mit seinen trauernden Fenstern. Würde man ihr wieder dasselbe Zimmer geben? sie erschrak bei dem Gedanken. Weiß Gott! der Gespenster hatte sie vergessen.
Der Zug näherte sich wieder einer kleinen Station, aber statt durchzufahren hielt er diesmal an. Ein Lakai im langen weißen Mantel lief hin und her, während ein großer Herr in hellem Überrock auf jemanden zu warten schien. Es stieg aber niemand aus.
Da riß ein Schaffner an ihrer Türe, rief heftig: „Ollerton“ und im Nu sprang Mariclée heraus. Die Station war erweitert worden, sie hatte sie nicht wieder erkannt. Geschwind war sie beim Gepäckwagen und zeigte dem weißen Lakaien ihren Koffer, der mit großer Eile ausgeladen wurde. Schmerzlich fielen ihr dabei alle Gegenstände ein, die in ihrem Kupee für die nächste Millionärin, die dort einsteigen würde, zurückblieben: ein Sonnenschirm, ein Täschchen, Handschuhe und ein Buch. Sie hatte noch Zeit. Sollte sie sie schnell aus der bekannten Dichterklasse hervorholen? Nein, gewiß nicht. Dazu war sie viel zu feig. Stand der Herr noch hinter ihr? hatte er sie gesehen, oder hatte er sie nicht gesehen? Aber natürlich hatte er sie gesehen. Sie war ja das einzige, was auf dieser Plattform zu sehen war. Nicht nur, daß er sie gesehen hatte, er sah sie an.
Mit einem halben Lächeln nähertretend, zog er den Hut und sie erwiderte seinen Gruß.
Wenige Schritte vor ihnen stand ein Auto, der weiße Lakai hatte sich schon zum Chauffeur geschwungen und sie stiegen ein.
„Ein heißer Tag,“ begann er. „Ich war über Land und kam von einer anderen Seite.“
Das Auto fuhr, leise schwirrend wie ein Pfeil.
Plötzlich sagte Mariclée: „Ich hoffe nur, mein Gepäck ist nicht zurückgeblieben!“
Er drückte an den Knopf, ließ sofort halten, versicherte sich, daß alles in Ordnung war und sie fuhren wieder zu. Er hatte es so angelegentlich getan, daß sie ihm hätte danken sollen, und es lag ihr auf der Zunge. Aber etwas hielt sie zurück und sie schwieg; denn es war ihr nicht gegeben, zwei Dinge auf einmal zu tun und die Art, wie er sich einer so geringfügigen Sache als wäre sie von großer Wichtigkeit, annahm, hatte sie zu sehr frappiert. Denn die „Manier“ war unverkennbar die des Don Juan.
Sie flogen im hellen Abendlicht die weite Schloßallee entlang, perlmutterfarbene Wolken schwammen am sonnenlosen Himmel über die Wälder hin. Und wie damals ging ein Rufen, Schlagen, Wehen, wie von Tieresstolz über Boden und Gezweig. Wie damals tauchte wieder aus einer Mulde, und keinem unbefugten Auge sichtbar, ein riesengroßer, schweigsamer und strenger Bau empor, der auf finsteren Gedanken, wie auf Pfeilern gegründet schien; — hinter einer breiten kurzen Brücke zuerst der niedere Teil des ehemaligen Konvents, und unter steinernen, wappentragenden Löwen, der offene Eingang in der gedämpften, gemütlichen Pracht seiner kostbar ausgeschlagenen Wände.
„Sind viele Gäste hier?“ fragte Mariclée mit verhaltenem Atem.
Sie hatte im Park helle Silhouetten und wallende Hüte bemerkt.
„Für den Augenblick fast niemand.“
„Aber wer ist das Mädchen?“ Und sie deutete auf eine hohe Gestalt mit einem bebänderten Schleierhut, die ruhigen Schrittes dem Portale zuging.
„Das ist Ihre Freundin,“ sagte er. Sie hatte jedoch schon eine verheiratete Tochter.
Einen Augenblick später begrüßten sie sich. „Und dasselbe Zimmer sollst du wieder haben,“ verkündete sie ihr. Mariclée nickte wie jemand, dem man etwas mitteilt, was er schon weiß. Denn vom Moment an, wo sie wieder über diese Schwelle gezogen war, hatte sie dies gewußt.
Viertes Kapitel
Don Juan zeigte sich bei Tische, wo er Mariclées Nachbar war, als ein ungewöhnlich begabter und vielseitiger Mann und wie einer selbstgefällig seine Hand ausstreckend, geschliffenes Glas im Lichte dreht und wendet, so drehte und wendete er ihr alle Fazetten seines Geistes zu und ließ sie funkeln und gefiel sich mit viel Natürlichkeit und noch mehr Geschick an seinem eigenen Feuer. Es trug niemand eine Tiara und sie waren nur zu sechs: Don Juan und Mariclée, ihre Freundin, deren Gatte Lord S., seine Mutter und seine Schwester. Mariclée hatte nicht gedacht je wieder hier zu sein, und wie fühlte sie sich doch wieder mit ihren innersten Fibern an dies prunkvolle und interessante Haus gewöhnt, als sei etwas von ihrem Geiste all die Weil in diesen Mauern zurückgeblieben. Wie hatten sie selbst die Schauer der oberen Zimmer wieder angeheimelt, da sie die alten Eindrücke so unverändert wiederfand. Die Pracht der Möbel, der Gobelins und Kamine war es ja nicht allein, denn in Museen sieht man vereinzelt, wie ausgestopft, solche Stücke. Sondern überall das Zusammentönen und -leben dieser stillen Truhen, dieser alten Teppiche, dieser seidenen Draperien und Quasten, mit den schlanken Fachkästen und Stühlen und dem kunstvoll so rein und naiv gewundenen oder skulptierten Holz. Wo an den niedern Wänden der Raum nicht von den Wappen mit den ausgehauenen Löwen ausgefüllt, oder köstliche Schreine eingelassen waren, zogen sich durch jene oberen Zimmer hindurch früh mittelalterliche Gobelins. Lange Prozessionen schritten da einher, Könige, Bischöfe und Heilige; edle Jungfrauen blickten rührend und ernst, und hinter dem Stuartbett heute wie damals eine geheimnisvolle schöne, eine große, weinende Gestalt. Alles dies hatte sie schon erlebt und ihr stilles Wiedererkennen war ein inneres Grüßen. Ob es die Gespenster schon wußten, daß sie wieder gekommen war?
Man hatte sich nach Tische in den großen Saal verfügt, und Mariclée war mit ihrer Kaffeetasse an das äußerste Ende gegangen, und staunte wie die Beauvais, die alten Möbel und Bilder, die ausgeschüttete Pracht kostbarer Dinge hier wie zu leuchtender Musik zusammenflossen, als sie plötzlich merkte, daß Don Juans schwerer Blick auf ihr ruhte. Aber sie hielt ihn aus und lächelte ein wenig, ein Lächeln, das ihn intrigierte, weil er es nicht verstand.
Und dann saßen sie alle beisammen und man sprach für den Rest des Abends von nichts anderem mehr, als von Politik. Es war der Sommer, in dem es in ganz England nur ein einziges Thema gab: Das Budget; und Mariclée dachte für den Rest des Abends nur mehr an dies Budget, das sie nichts anging.
Es war schon vorgeschrittene Nacht, als sie auf ihr Zimmer kam. Der weiche Glanz der mächtigen Hänglaternen vermochte so wenig wie die Morgenstrahlen die Düsterkeit dieser Gänge zu verscheuchen, als könnten Jahrhunderte nichts daran rücken. Sie dachte an den jungen Mann, der damals ihr gegenüberwohnte. Was mochte wohl aus ihm geworden sein? Da öffnete sich dieselbe Türe und Leporello glitt mit einer Wasserkanne aus dem Zimmer seines Herrn: sie sah im Fluge schimmernde Spiegel, anheimelndes Kerzenlicht, und wohl an die zwanzig Schuhe am Boden hingereiht. Ach, morgen früh würde er Glenford schon verlassen! sollte sie denn wieder wie damals diesen Flügel ganz allein bewohnen? Aber gottlob, neue Gäste waren ja erwartet! mochten sie drei Diademe übereinander tragen!
Und sie betrat ihr Zimmer; blickte auf ihr Bett, auf die maskierte Türe. Wie illusorisch war die Zeit! es gibt vergangene Dinge, die nicht vorüber sind, ob wir sie auch vergaßen. Und eine Nacht von ihren damaligen Nächten war geblieben. Denselben Ton, dieselbe Stimmung nahm sie wieder mit innerem Erblassen wahr. Aber sie traf ihre Maßregeln, drehte das Licht nicht ab, sondern umflorte es mit einer rosa seidenen Schärpe.
Am nächsten Morgen hörte sie die Stimme ihrer Freundin, die vom Garten aus nach ihr rief. Sie folgte ihr und beide gingen plaudernd die Terrassen auf und nieder, als Don Juan aus dem Hause trat und sich zu ihnen gesellte; es hatte sich ein Irrtum mit seinem Zuge herausgestellt und vor Nachmittag konnte er nicht fahren.
Die Sonne stieg höher und sie setzte sich mit den beiden unter einen Baum, dessen mächtiges Gezweige einen weiten Schattenring am Rasen zog. Sie gerieten bald sehr eifrig ins Gespräch. Das intellektuelle Prestige der Deutschen ist in England ebenso enorm, wie ihre Unbeliebtheit; so viel hatte Mariclée schon heraus. „Daß die Engländer die Deutschen nicht kennen,“ sagte sie, „ist nämlich gar nicht wahr: Deutsche und Franzosen kennen einander nicht, aber zwischen uns und England besteht nichts anderes, als ein durch das Tantengetratsch der Zeitungen immerwährend hin- und hergetragner Bruderhaß. Wenn wir einmal zu einer Verständigung kommen, gibt es eine Familienfeier, wie sie kolossalischer nie dagewesen ist.“
„Und inzwischen das Tempo, mit dem ihr eure Dreadnoughts beschleunigt!“ warf ihre Freundin ein.
„Und inzwischen euer Argwohn!“ seufzte Mariclée.
„Unser sehr berechtigter Argwohn,“ schloß Don Juan.
Und wohin sie in England kam, es hallte ihr über die Deutschen nirgends ein anderer Ton entgegen!
Zum Schluß natürlich — wie wäre es anders möglich gewesen? — sprachen sie von Liebe.
Es war zuvor von Politik die Rede gewesen, und es reizte Mariclée, Don Juan gegenüber die These zu verfechten, die Politik sei eine passionelle Ader und ein großer Staatsmann könne nicht zugleich eine Laufbahn als homme à bonnes fortunes verfolgen; sie zitierte dabei Bismarck, Beaconsfield und Gladstone.