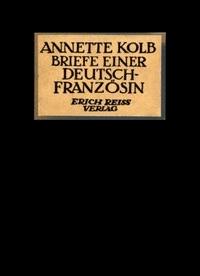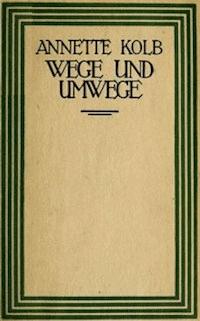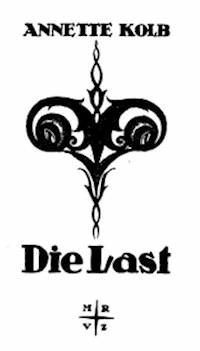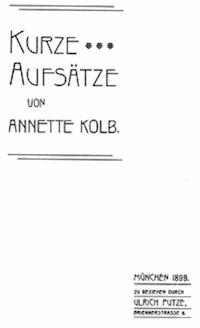0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Project Gutenberg
- Sprache: Deutsch
Gratis E-Book downloaden und überzeugen wie bequem das Lesen mit Legimi ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 128
Ähnliche
L’ÂME AUX DEUX PATRIESSIEBEN STUDIENVonANNETTE KOLB
Das scheinbar kränkste Volk kann der Gesundheit nahe sein, und ein scheinbar gesundes kann einen mächtig entwickelten Todeskeim in sich bergen, den erst die Gefahr an den Tag bringt.
Burckhardt: Cultur der Renaissance, II. Band
Verlegt bei Heinrich Jaffe München 1906
Von den folgenden Studien sind drei in der „Neuen Rundschau“, beziehungsweise der Wiener Wochenschrift „Die Zeit“ erschienen.
D. V.
I.
Zwei Stunden von Paris liegt zu Füßen einer hohen Ruine ein altes Städtchen, das an einem Hügel herumklettert. Und ringsumher einsiedlerische Wälder, sonnige Gefälle, lauernde Teiche, an deren Rande dunkle Vögel mit unheimlichen Schritten spazieren gehen; und ringsumher verträumte, weltentrückte Auen.
Ein sonniger Spätsommertag ging zur Neige, als mein Zug vor diesem Städtchen hielt, das mir allzu stille Tage zu verkünden schien.
Aber in ein Milieu, in dem es ausschließlich Diplomaten, Abgeordnete, Direktoren politischer Revuen und Vertreter großer Zeitungen zu sehen gab, sah ich mich da plötzlich wie hineingeschneit. Mein Tischnachbar war gleich am ersten Abend ein ganz schief gewachsener und ergrauter, aber sehr strammer Herr, der mich übrigens gänzlich ignorierte. Dabei sprach er fortgesetzt, richtete aber seine Worte nur an den Hausherrn. Der Blick seiner Augen, die wie zwei Sterne leuchteten, war starr wie ein Scheibenherz. Mit größter Präzision wußte er eine Reihe von Themen so eindringlich und zugleich so eilig durchzunehmen, als gälte es, innerhalb der wenigen Stunden, die er hier verbrachte, seine Gedanken für Jahre hinaus und auf Jahre zurück zusammenzufassen. Es war dem Uneingeweihten nicht möglich, ihm zu folgen, oft auch nur zu erraten, wovon er sprach.
Nach dem Essen fuhr er im Salon in derselben glänzenden und gedrungenen Weise zu berichten fort. Seine Augen sahen jetzt aus wie zwei große Monocles. Die Damen stickten schweigend, oder sprachen leise unter sich. Vor dem brennenden Kamin lag ein englischer Jagdhund ausgestreckt und seufzte vor Müdigkeit. Die Lampen warfen milde Scheine auf die eingelassenen Louis XIII-Spiegel und die laubreichen Tapisserien der Wände. Durch die hohen Fenster und die schmalen wurmstichigen Türen blies der Wind. Ich war noch auf keine Stickerei eingerichtet, saß in einer Sofaecke und hörte den Herren zu; denn ob ich auch ihren Gesprächen nicht viel entnehmen konnte, interessierte es mich, sie zu betrachten.
Als es 10 Uhr schlug, schnellte der graue Herr empor, empfahl sich den Damen mit großer Korrektheit, aber auch mit denkbar größter Kürze, und gleich darauf rollte sein Wagen, der noch den letzten Zug nach Paris erreichen sollte, in aller Eile davon.
Mich hatte diese Konversation, von der ich nichts verstehen konnte, in große Aufregung versetzt; und mit der Belletristik oder gar mit Werken der schönen Beschaulichkeit war es mit einem Schlage vorbei. Ich holte sie so wenig wie die Stickerei aus meinem Koffer hervor. Denn Zeitungsartikel, Berichte und Telegramme waren das einzig Spannende für mich geworden.
In dem weitläufigen Garten, der zu dem Hause gehörte, gab es eine Auswahl von Bänken, Lauben, steinernen Nischen und Terrassen. Steil und verwildert fiel er die sonnige Felsenwand herab, um sich wie in einem Graben geheimnisvoll und schattig auszubreiten. Dorthin schleppte ich denn auch mein neues Steckenpferd: die Zeitungen und politischen Abhandlungen aller Länder.
Man stand im Zeichen der ersten sonoren Pendelschwingungen der Entente cordiale mit England einerseits, des rapprochements mit Italien anderseits; sie und l’Isolement de l’Allemagne bildeten die Parole des Tages. Eines Nachmittags, — den Morgen hatte ich in Paris verschwärmt — saß ich wieder in einer versteckten Mauernische meiner Gartenwildnis und hielt die letzte Nummer der „Renaissance latine“. Sie brachte den ungemein schneidigen Entwurf einer politischen Karte Europas, mit sensationellsten geographischen Neuerungen. Der Wunsch war darin Vater aller Voraussetzungen, und Deutschland rückte er kühn bis in die Polargegenden hinauf, so daß es mit grönländischer Kälte von allen Seiten darauf einblies.
Ich notierte Titel und Nummer des Blattes und sah verdrießlich zum feingetönten französischen Himmel empor.
Ach, dachte ich, wie wenig weißt du von Deutschland! — und dachte dann hinüber zu uns, unseren Brücken und Häusern, unseren Mondscheinnächten und Wäldern.
Ach wie viel tausend Meilen lagen auch sie von hier entfernt, und wie wenig wußten sie dort von den Franzosen!
Und ich wußte es wohl, hier war keine unüberlegte, instinktive und impulsive Liebhaberei, wie sie England gegenüber oft bei mir im Spiele war, sondern ich vermochte einfach nicht, die Geschicke jenes Landes mit einem gleichgültigen oder unbeteiligten Bewußtsein zu erwägen. Von französischen Naturen in zu mannigfacher Weise verschieden, empfand ich die Franzosen zugleich als meine Angehörigen, und es schnitt mir oft ins Herz, wie gut ich sie kannte! Denn leider ist es ja noch immer keine Anmaßung, wenn heute der Deutsch-Franzose — und umgekehrt — sich für den allein Befugten hält, die Kluft zu messen, die zwei so große Nationen voneinander scheidet, die unzulängliche Kenntnis voneinander, in der sie leben, wie die Sehnsucht, die sie zueinander zieht!
Aber noch nie war mir so deutsch zumute gewesen, wie heute morgen, denn nirgends fühlten sich meine Augen so heimisch, mein Herz so eifersüchtig wie in Paris!
Nicht die neuen Viertel hinter dem Trocadéro und der Barrière de l’Etoile, die den neuen Stadtteilen anderer Städte so ähnlich sehen, noch die neuen Monumente, noch die grands und petits Palais, die in dem Sardanapalischen Stil gewisser moderner Architekten wohl nur ein minus von Geschmacklosigkeit aufweisen, sondern das Paris der Früh-Renaissance bis zum zweiten Empire ist es, das unsere junge und werdende Kultur auf immer distanziert.
Und doch so jung nicht, als daß sie nicht schon einmal des Sterbens Bitterkeit, die triste Mühsal gekostet hätte, aus Verwüstung und Schutt zerfallene Türme wieder aufzurichten. Hoch über den stillen Garten hin profilierte sich da vor meinem inneren Auge, intakt in ihrem entflohenen Leben, wie der einbalsamierte Leichnam eines Jünglings, eine deutsche Stadt in ihrem unterbrochenen Wachstum. Ihr langentschwundener Frühling prangt an den Marktplätzen, den Pforten und Brücken, den Erkern und Laternen. Er weht von den Türmen und Brunnen, durch die Häuser und Stuben. Er flutet in den Kirchen und von den Glasgemälden, und in dem verwitterten Stein umrauscht er Jungfrauengestalten mit ihrem unbeschreiblichen Gemisch deutscher Morbidezza und deutscher Lauterkeit.
Ich sah die Marienkirche und atmete wieder ihre berückende Luft. Und vor den Toren der Stadt jenen anderen Zeugen reinster und raffiniertester Kunst: das Tuchersche Jagdschloß mit dem verhaltenen Lauschen seiner Fensternischen und Türen, der holden Strenge seiner Räume, den verschwiegenen Schwellen, der verträumten Stiege. Denn die ganze Burg in ihrem herben, heimlichen Reiz ist reich an Widerhall wie ein Vers von Walther von der Vogelweide, und wir stehen inmitten ihrer Stille wie an einer Brandung.
Aber scholl da nicht von der Burg hernieder, von Dürers Hause, weithin durch alle Gassen, Hans Sachsens eherner Ruf: Habt acht! uns dräuen üble Streich? —
Mir war als könnte ich da nicht länger das Mitgefühl verantworten, das auf der Fahrt nach Frankreich mich ergriff, als ich von meinem Zuge aus im Morgengrauen französisch aussehende Häuser auf deutschem Boden sah und unvermutet alle Trauer, die an dieser verlorenen Erde haftet, mitempfand, von jener Flut von Trübsal eingeholt, mit ihrem universalen, geisterhaften Anrecht: jenem geheimnisvoll, zeitlos elementaren Etwas — der Zeit bittersten Rest! —, den sie als unser Erbteil zurückläßt! — Ah, dachte ich, wann wird der Tag anbrechen, an welchem zwischen Ländern, wie den unseren, der letzte Schlachtenplan zum letzten Ritterharnisch sich als Museumsstück gesellen wird, weil unter Nationen, wie den unseren, der Gedanke in Stücke gerissener oder zerschossener Glieder mit der menschlichen Würde nicht länger verträglich, geschweige denn rühmlich erschiene!
Und seufzend hatte ich da in die regnerische Dämmerung hinausgestarrt und der dilettantischen Betrachtungen noch eine große Menge angestellt. Sie kosteten mich nichts! Hatte ich doch zur Zeit des Burenkrieges fanatisch zu den Engländern gehalten, weil nach meinem Empfinden das Fesselnde, ja Ergreifende der englischen Tapferkeit in ihrer unmilitärischen Kriegführung lag, und nach meinem Empfinden das moderne und dramatische Moment dieses Krieges darin beruhte, daß hier die weitaus zivilisiertere, schönere und fortgeschrittenere Nation sich als die strategisch ungeübtere erweisen mußte. —
Allein, wie immer bei geschichtlichen Problemen, war es am Ende wieder Bismarcks gigantische Gestalt, auf die sich meine Mutmaßungen konzentrierten. Drei Jahre, glaubte Bismarck, seien das äußerste, was sich in der Politik voraussagen ließe, und: „für drei Jahre haben wir heute vorgebaut,“ meinte er nach einem seiner größten diplomatischen Erfolge der achtziger Jahre.
Und darum wissen wir heute nicht, wozu er damals sich entschlossen hätte, welchen Plan er damals entworfen und ausgemeißelt, ob er dem deutschen Volke nicht einen gleichwertigen anderen Entgelt ersonnen hätte, wenn er damals schon einer deutschen Kolonialpolitik hätte Rechnung tragen müssen?
Jene Worte am Abend seines Lebens haben in ihrer tiefen Nachdenklichkeit einen so echt Bismarckischen Klang: „Das westliche Glacis, das wir ihnen nehmen mußten, was sie uns nie vergessen werden.“
Es ist der Gedanke an unser zuversichtliches Bewußtsein alles dessen, was er heute, angesichts der vielen veränderten Faktoren unternehmen, an die Initiativen, die ein Mann wie er heute ergreifen würde, der ihn uns so unersetzlich groß erscheinen läßt. Denn der vorbildliche Geist seines Wirkens schuf ihn zu einem so großen Lehrer der Menschheit, weit mehr noch als seine Taten, die das Schicksal und die Zeit ereilen können. Und wer tiefer in jenen Geist einzudringen suchte, wie könnte der noch zweifeln, daß ein heutiger Bismarck, gleichviel welcher Nation er angehörte, jene große Einigungsidee, die einst ein kompaktes Italien und ein kompaktes Deutschland schuf, in erweitertem Sinne zu vertreten und aktuell zu gestalten wüßte? Wer könnte zweifeln, daß ein heutiger Bismarck, ob er unser eigener, oder Cavours, oder Gambettas Landsmann wäre, zum Vorkämpfer eines föderierten Europas würde?
Eins aber konnte nur Paris in seinem überlegen verführerischen Reiz mich lehren, dies edle, schimmernde Paris, das herrlich sich vollenden durfte, wie inmitten einer Welt des Friedens! Nie wieder, schien mir, konnte, durfte ich umflorten Auges, wie an jenem Morgen, Frankreichs Trauer bebend nachempfinden und beklagen! Denn nicht um eine Minute hatten wir die Kultur dieses Landes zurückgeworfen, das als ein unerhörter Feind der unseren in der Geschichte steht.
Ich war empört in meiner Mauernische aufgesprungen: und nicht länger hielt es mich da in dem verlassenen Garten. Der Zwiespalt, der mich bewegte, ließ mir dies Land, mein eigenes, die ganze Welt beengt erscheinen.
Unsichtbare Schatten glitten schon durch das Tageslicht und hielten die alten Bäume umschlungen. In peinigender Flüchtigkeit und Süße durchschauerten sie die Luft, und die Psyche längst vergangener Dinge umhallte mich. Wir waren Brüder! Noch stehen sie überall, die Spuren unserer einstigen Gemeinschaft, unsere umdüsterten Kathedralen, unsere alten Minnelieder und Novellen. Und heute sind wir Nationen, die sich schon lange insgeheim langweilen, weil gerade in der Reife, zu der unsere nationalsten Züge und Besonderkeiten gediehen sind, das Bewußtsein unserer Halbheit und in der Verschmelzung unserer Qualitäten der Keim vollkommenerer Typen liegt. Denn ach, wozu sich betören? Von Herzen froh wird man ja heute nirgends. Kläglich veraltet und vermorscht sind heute unsere tausendjährigen Familienzwiste, als könnte ihrer Asche allein der neue Phönix unseres Erdteils entstrahlen: nur einem greater Europe ein greater England, greater Germany und greater France.
II.
Im Laufe jenes selben Herbstes fuhr ich mit einem der klügsten Männer Frankreichs von Vendôme nach Paris. Schlösser und Hütten, Riesenwälder, lichte Pappelgruppen an langweiligen kleinen Flüssen waren an uns vorübergeflogen, und ich dachte zurück an den verflossenen Abend, an eine nächtliche Fahrt nach einem wundervollen mittelalterlichen Schloß, und an ein vollendetes, und wenn ich so sagen darf: erhebendes Diner, denn Götter hätten hier tafeln können, ohne sich zu schämen.
Nur die Konversation war nicht auf der entsprechenden Höhe gewesen. Die üblichen Gesprächsthemen in der Provinz: die Jagd, das Automobil und die religiösen Zustände waren ergiebig und einmütig verhandelt worden; von dem damals eben erfolgten Besuch des italienischen Königspaares in Paris gelangten dafür nur einzelne Verstöße beim Empfang in Versailles zu ausführlicher und höhnischer Erörterung, und der Rest war Schweigen. Nun hatte ich Paris während der Festlichkeiten gesehen, und nach meinem Empfinden nahm es sich ja, gerade in diesen Tagen, in der verhältnismäßig etwas naiven Schmückung der Häuser und Straßen, am wenigsten zu seinen Gunsten aus. Was sollen auch Fähnchen und provinziale Jubeltransparente auf einer Place Vendôme viel ausrichten? Vollends am Gala-Abend, im Lichtermeer der illuminierten Kugel-Girlanden und Triumphbögen schien es, als zöge sich für den Abend das stolze herrliche Paris hinter einem riesengroßen funkelnden Kasperltheater zurück.
Ich erzählte meinem Tischnachbarn, daß ich der Einfahrt des Königs von einem Hause der Champs Elysées aus zugesehen und mich über die verhältnismäßige Stille in der Avenue gewundert hatte. Er belehrte mich jedoch: das Demonstrative läge nicht in der Natur der Franzosen. Ein Zufall hatte aber gewollt, daß mir noch an jenem selben Abend ein ganz anderes Paris: das der Revolution, auf das grellste und lebhafteste veranschaulicht wurde.
Einige Stunden nach dem Einzug hatte mich mein Weg durch eine jener schmalen Gassen geführt, die das Elysée umgrenzen, und ich dachte für den Augenblick nicht an die Anwesenheit des italienischen Königspaares, als ich auf die denkbar peinlichste Weise daran erinnert wurde. — Von einem Strom von Menschen plötzlich fortgerissen und umringt, gab es für mich kein Vorwärts noch Zurück. In der Angst, zu fallen, und von dem schrecklichen Dunst bedrängt, sah ich ratlos umher und erblickte da zu meiner Verwunderung und Freude in nächster Nähe, friedlich an einen Baum gelehnt — einen unbesetzten Stuhl. Rasch darauf springend und so dem Haufen einigermaßen entzogen, wollte ich hier ruhig warten, bis er sich zerstieb.
Wer die Franzosen nicht für demonstrativ hielt, der wurde nämlich hier eines anderen belehrt. Weder nach rechts noch nach links sehend, schrien sie da gerade hinaus, halb betäubt, halb wie die Wilden, nach der Königin. „Kommen sie bald?“ fragte ich beklommen einen wenig anziehenden beschürzten Vertreter des stärkeren Geschlechts. — „Sie sind schon vorüber,“ gab er mir zur Antwort.
Dies erklärte nun zwar den disponiblen Stuhl. Warum aber beharrte diese Menge nach wie vor an der Stelle, belagerte alle Ausgänge und schrie mit heiserer Stimme: „La reine! nous voulons voir la reine!“ Und plötzlich, von meinem erhöhten Posten auf sie herabsehend, war mir, als erkannte ich sie genau wieder als jenes selbe kopfscheue, schnell überschäumende Volk, das unfähig sich zu besinnen, die Köpfe so mancher harmloser, zur Unzeit geborener Opfer zu höllischen Bildsäulen erhob und in diesen Straßen wütete. Ich erkannte den furchtbarsten Pöbel innerhalb der kultiviertesten und feinsten Nation.
Allein ich hütete mich wohl (aus Widerspruchsgeist), bei jenem Diner irgendwelche zustimmende Kommentare zu liefern: sie hätten allzu bereiten Erfolg gefunden. Denn an die hundertjährigen Hecken, die das Dornröschen von der Außenwelt trennten, sah ich mich in diesen Schlössern gemahnt, und weit genug war ich hier von meinen Pariser Erlebnissen getrennt. Man muß sie gesehen haben, Frankreichs politische Mumien, im Leben oft so reizende Menschen! Eine Dame in einem beneidenswerten Perlendiadem äußerte sich, es sei unbedingt heroisch vom König von Italien, ein so heruntergekommenes Land wie Frankreich offiziell zu betreten, und fragte mich über den Tisch herüber, ob wir im Ausland gegenwärtig die Franzosen nicht sehr von oben herab behandelten?