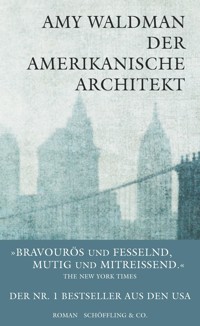14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schöffling & Co.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Die ehrgeizige Berkeley-Studentin Parvin Schams fühlt sich zwischen den liberalen Ideen ihrer charismatischen Professorin und den Erwartungen ihres konservativen afghanisch- amerikanischen Umfelds hin- und hergerissen. Da eröffnet ihr ein Buch eine ungeahnte Möglichkeit, die Theorie in die Praxis umzusetzen und ihre Bestimmung zu finden: Ein Arzt erzählt darin von seinem humanitären Engagement für afghanische Frauen. Parvin ist so begeistert, dass sie für seine Stiftung arbeiten und zugleich ihre Wurzeln erkunden will. Doch vor Ort entdeckt sie, dass die von ihm erbaute Geburtsklinik leer steht und die Bewohner des Dorfes sich seltsam abweisend verhalten. Nach und nach findet Parvin im Gespräch mit ihnen heraus, was es damit auf sich hat. Als Parvins Professorin vertrauliche E-Mails ungefragt veröffentlicht, eskaliert der schwelende Konflikt zwischen Einheimischen und ihren selbsternannten Wohltätern. Erneut muss Parvin entscheiden, wo sie steht.Was bestimmt, wer wir sind und wo wir hingehören? Wie formen die Medien unseren Blick auf die Welt? Und können wir unsere Vorurteile je ablegen? Wie in ihrem gefeierten Roman "Der amerikanische Architekt" stellt sich Amy Waldman den brennenden Fragen unserer Gegenwart in einer packenden und überraschenden Geschichte."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 625
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
[Cover]
Titel
Widmung
Zitat
Teil 1
1. Kapitel: Ankunft
2. Kapitel: Vertrödelte Zeit
3. Kapitel: Eine existenzielle Bedrohung
4. Kapitel: Das ferne Feuer
5. Kapitel: Die Welt bewegen
6. Kapitel: Zwei Melonen
7. Kapitel: Eine Blume ist von allen Seiten schön
8. Kapitel: Noch weiter weg von zu Hause
9. Kapitel: Ein Eselsschwanz
10. Kapitel: Der Hund und der Schuster
11. Kapitel: Der Obstgarten
Teil 2
12. Kapitel: Der Geruch von Milch
13. Kapitel: Im Haus einer Ameise
14. Kapitel: Der Pakt
15. Kapitel: Eine arrangierte Ehe
16. Kapitel: Ein halber Laib Brot
17. Kapitel: Elvis
18. Kapitel: Der Kahlkopf
19. Kapitel: Kismet
20. Kapitel: Neuraths Schiff
21. Kapitel: Recht und Ordnung
22. Kapitel: Junge Hirsche
Teil 3
23. Kapitel: Klare Sicht
24. Kapitel: Auge des Nichts
25. Kapitel: Tränen aus blinden Augen
26. Kapitel: Blut mit Blut waschen
27. Kapitel: Zwischen weitem Himmel und harter Erde
28. Kapitel: Ferne
Dank
Autorenporträt
Übersetzerporträt
Kurzbeschreibung
Impressum
Für Alex, Ollie und Theo
»Antimachos war mit Paris befreundet Der sich für den Krieg einsetzte Er öffnete eine Tür in der Erde Und eine ganze Generation ging hinein«
Teil 1
1. Kapitel
Ankunft
Sobald sie die Straße sah, wusste sie, was ihn daran gereizt hatte. Unausgeschildert und unbefestigt stieg sie zwischen malvenfarbenen Gebirgsausläufern an und glitt dann zwischen ihnen hindurch. Wenn man sich langweilte – so wie Gideon Crane –, mit seinem Begleiter, mit der ganzen (wohin eigentlich führenden?) Reise, die man so unbedingt hatte unternehmen wollen –, hätte die Abzweigung einen geradezu angesprungen. Wie Crane hätte man den Fahrer gebeten, die Hauptstraße zu verlassen, und als der sich weigerte, seinen Laster mit der Fuhre Melonen aufs Spiel zu setzen, nur um die Neugier eines Ausländers auf eine dämliche Nebenstraße ins Nirgendwo zu befriedigen, wäre man ebenfalls ausgestiegen und hätte versucht, mit Eseln weiterzukommen.
Parvin Schams wurde in einem weißen Land Cruiser auf eben diese Nebenstraße kutschiert, was sie mit noch größerer Bewunderung für Cranes Risikobereitschaft erfüllte. Ihr war fast schwindlig vor Aufregung, weil sie sechs Jahre nach Cranes ursprünglicher Reise seinen Spuren folgen konnte. In seinen Erinnerungen – dem Buch, das sie hierher geführt hatte – hatte er von seiner »Sehnsucht nach Abenteuern« gesprochen, die ihn auf diese Straße gelockt hatte, und von seiner Überzeugung, tiefer ins Innere Afghanistans vorzudringen, würde ihn tiefer in sein eigenes Inneres führen: Was wir als Annehmlichkeiten betrachten, sind nur Puffer, die uns daran hindern, uns selbst kennenzulernen, zu uns selbst zu werden. Ich wollte mich von innen nach außen kehren, meine Taschen ausleeren und herausfinden, was in mir steckte. Mit ihren einundzwanzig Jahren – etwa halb so alt wie Crane zur Zeit seiner Reise – glaubte Parvin, ähnlich gestrickt zu sein, war sie doch unterwegs in ein abgelegenes Dorf, wo sie sich Cranes Kreuzzug, afghanische Frauen davor zu bewahren, im Kindbett zu sterben, anschließen wollte. Sie würde bei einer Familie leben und ihre ärmlichen Lebensumstände mit ihnen teilen. Ganz unverkennbar teilte sie Cranes Sehnsucht.
Diese Selbsteinschätzung wurde jedoch schon bald von den Steinen durcheinandergerüttelt, mit denen die Straße übersät war. Crane hatte sie als »grauenhafte, kaum passierbare Zumutung« beschrieben, was sich in der Realität weit weniger romantisch anfühlte als bei der Lektüre. Die Straße war ein Hindernisparcours aus Geröll, über das man rumpeln, Felsbrocken, die man umfahren und tiefen Schlaglöchern, durch die man sich vorsichtig hindurchmanövrieren musste. Schlammpfützen saugten an den Reifen, als wollten sie Mark aus Knochen schlürfen. All das verlangsamte den Wagen auf holperige Schrittgeschwindigkeit. Auch die Zeit schien sich zu verlangsamen, und während die Minuten dahinkrochen und Parvins Unruhe wuchs, fing sie an, ihren eigenen Mut zu hinterfragen. Sie war zwar in Afghanistan geboren, doch ihre Eltern hatten das Land mit ihr und ihrer älteren Schwester verlassen, als sie ein Jahr alt war. Seitdem war sie nie wieder dort gewesen, sondern hatte ein behütetes amerikanisches Leben geführt – wie behütet, erkannte sie erst jetzt, als seine Annehmlichkeiten in weite Ferne rückten. In weiser Voraussicht hatte sie kaum etwas getrunken, ehe sie vor vier Stunden losgefahren waren, aber das Geholpere des Land Cruisers schickte unangenehme Erschütterungen durch ihre Blase.
Sie ließen das Vorgebirge hinter sich. Über Haarnadelkurven hangelten sie sich an einer Schlucht mit hoch aufragenden Schieferwänden entlang. Überwältigt von einem Gefühl des Eingeschlossenseins vergaß Parvin für kurze Zeit ihr körperliches Unbehagen. Dann jedoch fiel ihr auf, dass die sogenannte Straße zu einem höchstens für ein einziges Fahrzeug geeigneten, aus den Felsen herausgehauenen Pfad geworden war. Als sie einen Blick aus dem linken Fenster wagte, sah sie – nichts. Es war, als hingen sie in der Luft. Tatsächlich krochen sie hoch oben an der Felswand entlang, die steil zu einem Fluss abfiel. An die Armlehne geklammert, sah sie das Auto jeden Augenblick über den Rand kippen und in das dumpfgrüne Wasser tief unten stürzen, wo Dunkel herrschte, obwohl der Tag sonnig war. Nur über der gegenüberliegenden Wand war ein Streifen erstaunlich blauen Himmels zu sehen. Ihr war kalt, sie hatte Hunger, ihre Muskeln waren völlig verkrampft, alles tat ihr weh. An jeder Biegung hielt sie Ausschau nach dem Dorf, aber das einzige erkennbare Anzeichen von Behausung, hoch oben auf einer Felsspitze, war ein Nest.
»Wie lange noch?«, schrie sie dem Fahrer, Issa, zu.
Er antwortete nicht, was sie inzwischen auch gar nicht mehr von ihm erwartete. Seit er sie in Kabul abgeholt hatte, hatte er auf voller Lautstärke Musik laufen lassen – größtenteils Bollywood-Soundtracks, die er mit überraschend angenehmer Kopfstimme mitsang. Für Parvins Fragen war er taub. Wenn überhaupt, redete er mit ihrem Cousin Fawad, der noch studierte und als ihre Begleitperson fungierte. Ihm hatte Issa den Beifahrersitz angeboten, während er Parvin behandelte wie ein Paket, das er ausliefern musste.
Issa, Cranes rechte Hand in Afghanistan, war anders, als sie ihn sich vorgestellt hatte. Das Buch beschrieb ihn als findigen, mit allen Wassern gewaschenen Helfer, der eine Karriere als Antiquitätenschmuggler aufgegeben hatte, um sich für afghanische Mütter einzusetzen. Als Crane in dem Dorf, das Parvins Ziel war, eine Klinik errichten wollte, hatte Issa ihm unermüdlich beigestanden, verbissen mit Bürokraten, Banditen und Taliban verhandelt, gesagt und getan, was immer erforderlich war, um mehr Frauenleben zu retten, wohl auch, weil seine eigene Mutter bei seiner Geburt gestorben war. Als Junge, hatte Crane geschrieben, habe Issa nur einschlafen können, wenn er ihr Kopftuch umklammerte; als Mann träumte er immer noch von ihrer Berührung. Lange bevor Parvin ihn kennenlernte, hatte sie den mutterlosen Jungen in ihm bemitleidet, allerdings war dieses Thema zu persönlich, um es anzusprechen. Es war eigenartig, aus einem Buch mehr über einen Menschen zu wissen als das, was er selbst von sich preisgab – praktisch nichts.
Für Parvin hatte Issa mit seinen gleichgültigen Augen und dem mürrischen Mund überhaupt nichts Findiges. Sein buschiger schwarzer Schnurrbart war bei Weitem das Lebhafteste in seinem Gesicht. Bei ihrer Begegnung an diesem Morgen hatte er eine Begrüßung gegrummelt und ihre Kleidung gemustert – lange, rote, weit geschnittene Tunika, Jeans, marineblaues Kopftuch –, als seien diese Sachen ein für ihn unlösbares Rätsel. Mit Blick auf ihre drei Koffer hatte er gesagt: »Die Frauen in den Dörfern kleiden sich sehr schlicht.« Normalerweise reagierten Männer auf Parvins Schönheit – lange, dunkle Haare, lebhafte, ebenfalls dunkle Augen, volle Lippen –, oder zumindest auf eine Sinnlichkeit, die sie anscheinend besaß. Issa zeigte nicht einmal einen Hauch von Interesse.
Sie versuchte zu erkennen, ob auch Fawad so nervös war wie sie, aber sie saß genau hinter ihm. Für ihn war diese Fahrt die erste, die ihn mehr als nur ein kurzes Stück aus Kabul herausführte, und er war nur höchst widerstrebend auf Beharren seines Vaters, Parvins Onkel, mitgekommen. Und nur unter der Bedingung, dass er, sobald er Parvin bei ihren Gastgebern abgeliefert hatte, sofort zurückkommen könne. Parvin fand seine Lederjacke, die gefälschte Designerjeans und die Edelsneaker für eine Fahrt ins ländliche Afghanistan ein bisschen lächerlich. Als sie Kabul hinter sich gelassen hatten, hatte er eine Weile wie besessen gesimst, es inzwischen aber aufgegeben. Die Berge hatten jedes Signal verschluckt.
Als hätte die Sonne einen Damm durchbrochen, flutete in genau diesem Augenblick Licht in die Schlucht, färbte den Fluss smaragdgrün und verwandelte den schmalen Streifen Himmel in feuriges Orange und grelles Pink. Zwei Vögel kreuzten ihren Weg und flogen die Schlucht entlang; ihre Schatten schwebten über die in warmes gelbes Licht getauchte gegenüberliegende Felswand. Parvin war hingerissen, gleichzeitig aber auch beunruhigt, da die untergehende Sonne bedeutete, dass sie das Dorf vielleicht nicht vor Einbruch der Dunkelheit erreichen würden.
So plötzlich, wie die Farben gekommen waren, verschwanden sie wieder. Violett-blaues Zwielicht, ätherisch, flüchtig, breitete sich aus und wurde kurz darauf von der Nacht verschluckt. Parvin hatte noch nie einen so angespannten Fahrer oder eine so absolute Dunkelheit erlebt. Die Scheinwerfer des Land Cruisers kamen kaum dagegen an. Issa machte die Musik aus, die noch eine Weile in Parvins Ohren nachhallte, und umklammerte das Steuer so fest, dass seine Knöchel im schwachen Schein der Armaturenbeleuchtung totenbleich aussahen. Dazu waren er und Fawad verstummt, und die plötzliche Stille ängstigte sie.
Der Fluss und überhaupt die ganze Welt außerhalb des Autos waren verschwunden. Die Straße oder das, was Parvin im Licht der Scheinwerfer davon erahnen konnte, wurde noch schmaler, ihr Tempo noch langsamer. Parvin hatte Angst und kam sich gleichzeitig dumm vor, weil sie sich in diese lebensbedrohliche Situation gebracht hatte, andererseits fühlte sie sich beim Gedanken an ihren möglichen Tod erregend lebendig. Sie warf einen Blick auf ihre Uhr mit dem im Dunkel leuchtenden Zifferblatt. Von der Hauptstraße zum Dorf waren es laut Issa fünfundzwanzig Kilometer, aber sie waren jetzt schon über zwei Stunden unterwegs, ohne dass ein Hinweisschild oder überhaupt eine Wegmarkierung zu sehen gewesen wäre. Gerade fing sie an zu zweifeln, ob das Dorf überhaupt existierte, da leuchtete ein weißes Gebäude im Scheinwerferlicht auf.
»Dr. Gideons Klinik«, rief Issa.
»Fereschtas Klinik«, verbesserte sie ihn scharf und drehte sich nach dem Gebäude um, das aber bereits nicht mehr zu sehen war. In seinem Buch hatte Gideon Crane betont, dass er darauf bestanden hatte, die von ihm errichtete Klinik nach Fereschta zu benennen, der Frau, deren Tod der Grund für den Bau gewesen war. Issa, einer von Cranes wichtigsten Helfern, musste das wissen. »Es hat nicht ausgesehen, als sei sie geöffnet«, rief sie, denn sie hatte sich die Klinik rund um die Uhr hell erleuchtet und von Leben erfüllt vorgestellt. Eine Art Leuchtturm. Völlig anders als dieses stille, verschlossene, dunkle Gebäude.
Doch da erreichten sie den Dorfbasar. Die Scheinwerfer beleuchteten leere Marktstände. Issa schaltete auf Parken, dankte Allah, klatschte Fawad ab und sagte, ab hier würden sie zu Fuß gehen. Erst jedoch verschwand er in der Dunkelheit, und sie und Fawad durften ihm beim Pinkeln zuhören.
Nach seiner Rückkehr überreichte er Parvin eine Taschenlampe und ihren kleinen Koffer, gab ihrem Cousin einen der beiden schweren, nahm selbst den anderen und bedeutete ihnen, ihm zu folgen. Parvin zitterte ein bisschen. Obwohl der Frühling allmählich in den Sommer überging – es war die erste Juniwoche –, war die Temperatur gesunken, je höher sie kamen.
Nach einer Weile blieb Parvin stehen und schaltete die Taschenlampe aus, um diesen Augenblick in ihrer Erinnerung festzuhalten. Sie hörte das Ticken ihrer Uhr. Klare, saubere Luft füllte ihre Lungen. Pechschwarze Berge ragten ringsum über ihnen auf. Offenbar befanden sie sich am Rand eines Plateaus. Auf der darunterliegenden Ebene fiel Mondlicht auf eine schwarze Wasserfläche. Über ihnen war der Himmel von einem Gewirr aus Sternen in Konstellationen übersät, die zu Hause nicht sichtbar gewesen waren. Fast hätte man meinen können, diese nächtliche Welt sei erst vor wenigen Momenten erschaffen worden, so wenig entsprach sie irgendeiner Version von Nacht, die Parvin je gesehen hatte.
Issa und Fawad warteten. Langsam fand Parvin in die Realität zurück. Verlegen knipste sie die Taschenlampe wieder an, und gemeinsam gingen sie weiter durch ein Labyrinth von Gassen, gesäumt von Mauern aus Lehm, hinter denen sich die Wohngebäude verbargen. Parvins Taschenlampe erhellte kaum mehr als Issas Rücken, das Mondlicht schaffte es lediglich, das Labyrinth zu streifen, und die Dunkelheit verstärkte jedes Geräusch: Das Knirschen von Erde unter den Füßen, das Rumpeln der Kofferräder, das Geraschel unsichtbarer Tiere, die sich im Schlaf bewegten, Parvins Atem. Alle Hauswände sahen gleich aus, ebenso ihre Holztüren, einschließlich der, vor der Issa irgendwann stehen blieb. Er hämmerte laut dagegen.
»Fereschtas Haus?«, fragte sie.
»Das ihres Mannes.«
Eine Laterne auf Beinen, so jedenfalls wirkte es auf den ersten Blick, öffnete die Tür. Dann nahm der Mann hinter der Laterne Gestalt an. Er musste Wahid sein, dachte Parvin aufgeregt, der Mann, den Fereschta zurückgelassen hatte. In Gideon Cranes Mutter Afghanistan spielte er eine so zentrale Rolle, dass Parvin das Gefühl hatte, eine Märchenfigur ins Leben gerufen zu haben.
Das Buch ging nicht sehr schmeichelhaft mit Wahid um. Crane hatte ihn als »jämmerlichen Schwächling« beschrieben, als bärtigen, nervösen, geschwätzigen, vom Leben gebeutelten Mann, der nichts unternommen hatte, um die Mutter seiner sechs Kinder davor zu bewahren, bei einer weiteren Geburt zu sterben. Ob sie am Leben blieb oder nicht, liege in Gottes Hand, hatte er gesagt. Das einzige Foto von ihm, das Parvin kannte – es tauchte in jedem Artikel über die von Crane erbaute Klinik auf und war auch im Buch selbst abgebildet –, bestätigte den Eindruck von Schwäche. Auf diesem Foto hatte der viel größere Crane den Arm um die Schultern Wahids gelegt, dessen Augen halb geschlossen waren.
Nun begrüßte er Parvin, Fawad und Issa und winkte sie in einen Innenhof. Parvin konnte kaum etwas sehen, aber vielleicht aus diesem Grund umso mehr riechen: Den erdigen Geruch von Tieren und Dung, Heu und Holzrauch. Dann hörte sie hinter sich ein Geräusch und spürte einen heißen tierischen Atemstoß im Nacken. Erschrocken quietschte sie auf, was sie sofort bereute, weil sie die anderen nicht zusätzlich darauf aufmerksam machen wollte, wie fremd das alles für sie war. Vorsichtig sah sie sich um. Es war eine Kuh. Issa lachte.
Das kleine Zimmer, in das Wahid sie führte, nachdem sie ihre Schuhe ausgezogen hatten, wurde nur von zwei Laternen erhellt. Die Wände bestanden aus mit Stroh vermischtem Lehm, die Möblierung war spärlich – ein Läufer, der sich kühl anfühlte, Kissen entlang der Wände.
In diesem Raum wurden männliche Besucher empfangen, um die Parda der Frauen des Hauses zu wahren. Issa und Fawad setzten sich auf den Boden und lehnten sich in die Kissen. Parvin tat es ihnen nach. Wahid entrollte eine Wachstuchdecke, und zwei Söhne – dem jüngeren fehlte eine Hand –, brachten das Essen herein und stellten es vor sie. Parvin war die einzige anwesende Frau, aber von irgendwo oben waren andere weibliche Stimmen zu hören. In diesem Grenzland zwischen Männern und Frauen würde sie von nun an leben.
Das Hauptgericht war eine Platte Reis unter einer Schicht Rosinen und Möhren. Parvin wusste, dass im Inneren Fleisch verborgen sein musste, weil sie im nördlichen Kalifornien mit eben diesem Gericht aufgewachsen war. Kabuli Palau wurde bei allen Familientreffen aufgetischt, egal ob es sich um einen freudigen Anlass oder um ein Begräbnis handelte, das Lamm im Dampfkochtopf gegart, die Karotten zu dünnen Stiften geschnitten, die Rosinen gedünstet, bis sie prall waren, der Reis unter Zugabe von Brühe gekocht. Gewürzt wurde mit Zucker, Salz und Kreuzkümmel. Manchmal hatte sie die vielen erforderlichen Arbeitsschritte als mühselig empfunden, jetzt jedoch war es ihr ein Trost, sie im Kopf durchzugehen. Es war, als vermischten sich Vergangenheit und Gegenwart, als seien die beiden Familien, ihre zu Hause und diese hier, Teil desselben Clans mit gemeinsamen, unsichtbaren Wurzeln. Ihrem Magen zuliebe verzichtete sie auf das inzwischen zu Tage geförderte Fleisch und hoffte, dass es niemandem auffallen würde.
Auch während des Essens ignorierte Issa Parvin und redete in einem fort mit Wahid. Seine Gesprächigkeit ärgerte sie umso mehr, weil sie längst nicht alles verstand, obwohl ihr Dari ziemlich gut war und sie in den zwei Wochen in Kabul mit ihren Verwandten daran gearbeitet hatte, es noch besser zu machen. Jetzt aber bekam sie nur Bruchstücke und Satzfetzen mit, so wie sie vorhin auf der kurvigen Straße nur flüchtige Ausblicke erhascht hatte. Es lag daran, dass sie immer wieder einnickte, erkannte sie peinlich berührt, und war dankbar, als Issa irgendwann aufstand, gähnte, seinen Schnurrbart glatt strich und sagte, sie würden jetzt zur Moschee gehen, wo Fawad und er übernachten konnten.
»Wann bringst du hier endlich mal eine Glühbirne an?«, sagte er mit einer Handbewegung, die das ganze Zimmer umschloss, zu Wahid.
»Warum? Damit ich dein hässliches Gesicht besser sehen kann?«, gab der zurück.
Die schlagfertige Reaktion ließ Wahid in Parvins Achtung steigen.
Beim Abschied von ihrem Cousin, der am nächsten Morgen mit Issa zurückfahren würde, stiegen Parvin die Tränen in die Augen. Sie hatten sich zwar erst vor zwei Wochen kennengelernt und waren sich auch auf der Fahrt nicht unbedingt nähergekommen, aber er war ihre letzte, wenn auch noch so flüchtige Verbindung zu ihrer Familie.
Anschließend führte Wahid sie eine Treppe hinauf in ein so hell erleuchtetes Zimmer, dass sie schier geblendet war. Als sich ihre Augen an das Licht gewöhnt hatten, sah sie, dass es von einer einzelnen Glühbirne an der Decke kam. Es war der Kontrast zu Laternen- und Mondlicht, der es so grell erscheinen ließ. Ehe Parvin sich orientieren konnte, war sie von Wahids Frau und Kindern umringt, die ihr flüchtige Küsse auf die Wangen drückten und mit rauen, schwieligen Händen nach ihren griffen. Sie trat einen Schritt zurück, um sie besser sehen zu können, aber sie drängten sofort nach. Lange Kleider streiften sie.
Ob sie wohlauf sei?, erkundigten sie sich. Ihre Familie auch? War sie bei guter Gesundheit? Hatte sie eine angenehme Reise gehabt? Wie in Afghanistan üblich, dauerten die Begrüßungen eine ganze Weile. Parvin hörte Namen und vergaß sie sofort wieder. Dagegen blieben die Gerüche, die von allen ausgingen – nach Rauch, Schweiß, gebratenem Fleisch, Öl, Muttermilch, Küche –, bei ihr haften. Mit ihren 1 Meter 65 war sie nicht sonderlich groß, überragte die ganze Gruppe aber trotzdem. Wäre sie mit der dorfüblichen Ernährung aufgewachsen, dachte sie, wäre sie wahrscheinlich genauso klein.
»Wir haben den Generator extra länger angelassen«, setzte Wahid den Begrüßungen ein Ende. Alle verstummten.
Seine Unverblümtheit zeugte nicht gerade von Liebenswürdigkeit. Im Gegensatz dazu, wie Crane ihn beschrieben hatte, nämlich als übermäßig geschwätzig, fühlte er sich augenscheinlich nicht verpflichtet, mehr als das Nötigste zu sagen. Im grellen Licht konnte sie ihn zum ersten Mal richtig sehen. Wie bei den meisten Afghanen vom Land war seine Haut von der Sonne gegerbt und voller Falten. Komisch, dass seine Augen auf dem Foto mit Crane fast geschlossen waren, denn sie waren sein auffälligstes Merkmal, geradezu schön, von der Farbe dunklen Bernsteins.
Parvin überlegte, ob er ihr mit seiner Bemerkung zu verstehen geben wollte, sie solle den zusätzlich verbrauchten Treibstoff bezahlen. In Gelddingen wusste sie nicht so recht, was über die fünfundsiebzig Dollar hinaus, die Cranes Stiftung als ihren monatlichen Beitrag zu den Aufwendungen der Familie vorgeschlagen hatte, von ihr erwartet wurde. Natürlich wollte sie Fereschtas Familie nicht ausnutzen, andererseits wollte sie sich aber auch nicht ausnutzen lassen.
Die Kinder breiteten mit geübten Handgriffen Bettzeug und Decken auf dem Boden aus und legten sich hin. Malerisch dahingelagert, warteten sie auf den Schlaf.
Parvin bat Wahid, ihr ihr Zimmer zu zeigen.
Das hier sei ihr Zimmer, sagte er. Alle schliefen hier.
Nicht sie, schwor sie sich bei der Vorstellung, in verbrauchter Luft inmitten all der ineinander verknäuelten Leiber aufzuwachen, und sagte, sie sei von einem eigenen Zimmer ausgegangen. »Ich würde mich damit wohler fühlen«, fügte sie hinzu, ohne sich zu fragen, wieso ihn das interessieren sollte.
»Niemand im Dorf hat ein eigenes Zimmer. Wir teilen alles miteinander«, antwortete er.
Erst später wurde ihr klar, dass alle es seltsam, sogar traurig fanden, dass westliche Menschen lieber allein schliefen, und noch seltsamer und trauriger, dass sie auch ihre Kinder schon sehr früh dazu zwangen. Während ihrer Zeit im Dorf sollte auch sie lernen, dieses Für-Sich-Sein infrage zu stellen.
Aber noch nicht. »Ich zahle gerne mehr, wenn ich ein eigenes Zimmer haben kann«, sagte sie in dem Moment, in dem der Generator stöhnend verstummte und das Licht ausging. »Vielleicht das Besucherzimmer, in dem wir gegessen haben?«
Aufgeregtes Geflüster in der Dunkelheit. Dann wurden Laternen angezündet, und Wahid griff sich eine Bettrolle und bedeutete ihr, ihm nach draußen und die Treppe hinunter zu folgen. Sie war stolz auf ihr Durchsetzungsvermögen, und auf ihren vermeintlichen Erfolg. Aber statt ins Besucherzimmer führte Wahid sie in eine winzige, stinkende Kammer, verscheuchte mit Schreien und Tritten eine Ziege und mehrere Hühner, deren Hinterlassenschaften überall herumlagen, legte das Bettzeug auf das Stroh auf dem Boden und sagte, morgen würde er versuchen, eine Tür zu finden. Er ließ ihr eine Laterne da, und in ihrem Schein zitterte Parvin vor Wut, überzeugt davon, dass es ein furchtbarer Fehler gewesen war, hierherzukommen. Auch Gideon Crane hatte bei dieser Familie gelebt und sie als überaus liebenswürdige Gastgeber beschrieben. Vielleicht war er ein besserer Gast gewesen? Vielleicht hatte er klaglos da geschlafen, wo man es ihm sagte?
Irgendjemand knallte draußen einen Wasserkrug hin, dann wurde es still. Parvin blies die Laterne aus, und die Nacht schloss sich um sie. In so einem Moment muss man nicht nur gegen das Ersticken ankämpfen, sondern auch gegen die Angst vorm Ersticken, hatte Crane über seine Entführung aus dem Dorf geschrieben, während der man ihm einen schwarzen Sack über den Kopf gestülpt hatte. Denn die Panik ist eine ebenso große Gefahr wie der Sack an sich. Es war die Panik, die den Stoff an meine Nase zog und mir die Luft nahm, woraufhin ich noch mehr in Panik geriet, bis ich mich zwang, mich zu beruhigen. Da konnte ich wieder atmen.
Der Gedanke, ihre Sachen auszuziehen, so schmuddelig sie auch von der Reise waren, war ihr unerträglich. Vollständig angezogen kroch sie in ihr Bett, das noch den Abdruck anderer Körper trug.
2. Kapitel
Vertrödelte Zeit
Gegen Morgen träumte Parvin, ein Kind zupfe fast liebevoll an ihren Haaren, musste beim Aufwachen aber feststellen, dass es eine Ziege war. Das Tier schien fast ebenso überrascht, etwas Lebendiges am Ende seiner kleinen Zwischenmahlzeit vorzufinden, wie Parvin es war, angeknabbert zu werden. Sie schrie auf, stieß die Ziege weg, jagte sie hinaus und kauerte sich an die rückwärtige Wand des Raums. Die Dämmerung sickerte durch die Tür und mischte sich mit der Dunkelheit wie Milch mit Kaffee. Kaffee. Dass sie keinen hatte, war die erste kleine Enttäuschung des Tages.
Die Ziege war in der Tür stehen geblieben und ermöglichte Parvin einen ausgiebigen Blick auf ihre gelben Augen, großen Ohren und unansehnlichen Zähne. Sie griff nach ihrem Handy, in Gedanken bereits bei der Überschrift – Meine neue Zimmergenossin – für ihren Facebook-Post. Dann fiel ihr ein, dass sie keine Möglichkeit hatte, irgendetwas zu posten. Im Dorf gab es kein Internet, keine Computer, keine Fernseher, überhaupt kein Netz. Es ist kein einfacher Ort für jemanden, der an amerikanische Annehmlichkeiten gewöhnt ist, hatte Crane in einem seiner Vorträge gewarnt, was nur dazu führte, dass Parvin erst recht fahren wollte. Jetzt jedoch, ohne Publikum, mit dem sie ihre Erlebnisse teilen konnte, fühlte sie sich verloren. Zeugenlos. Wahllos tippte sie auf dem Handy herum und scrollte dann durch die Fotos ihrer College-Abschlussfeier vor gerade einmal zwei Wochen, die ihr allerdings viel länger vorkamen. Dass sie damals so glücklich ausgesehen hatte, machte sie nun nur noch unglücklicher. Sie warf das Handy auf ihr Bettzeug.
Als es heller wurde, trat sie auf den Hof und machte eine Art Bestandsaufnahme: Drei Ziegen, mehrere Hühner, vier Kühe, ein Esel; Heuhaufen; ein Gemüsegarten; ein Weinstock; ein Granatapfelbaum; ein Klohäuschen; übereinander gestapelte, getrocknete Dungfladen, die ein bisschen wie luftige braune Pfannkuchen aussahen und als Brennmaterial verwendet wurden. Zwischen Haus und Klohäuschen spannte sich eine Wäscheleine. Die daran aufgehängten Männerhosen bauschten sich im Wind, als wollten sie im nächsten Augenblick davonspazieren.
Sie hob den Kopf und wäre fast hintenübergekippt, so schwindelerregend war die Veränderung des Maßstabs. In der Nähe zeichneten sich die hoch über allem aufragenden Berge scharf und präzise ab, wurden mit zunehmender Entfernung aber weicher und wechselten die Farbe – von Braun, Rot und Grün zu Grau und Lavendel. Die entferntesten waren von einem rauchigen Blau und schneegekrönt. Auf dem Weg von Dubai nach Kabul war Parvin über diese, oder vielleicht andere, aber ähnlich aussehende Berge geflogen. Aus der Luft betrachtet hatten sie majestätisch gewirkt, von hier unten machten sie ihr Angst, und sie war dankbar, als ein Kind die Treppe heruntergelaufen kam und ihre Träumerei unterbrach. Einen Moment starrten sie sich an. Parvin registrierte das schorfige Gesicht, die ungekämmten Haare und die leuchtenden, leicht schielenden Augen des Mädchens und lächelte die Kleine an, die daraufhin kehrtmachte und die Treppe wieder hinaufrannte. Parvins Lächeln erstarb, und sie nahm sich vor, nicht immer so empfindlich zu sein. Sie durfte sich nicht von jeder kleinen Zurückweisung kränken lassen.
Nach mehreren tiefen Atemzügen ging sie die Treppe hinauf und betrat den Hauptraum. Alle Gesichter wandten sich ihr zu, doch sie war so nervös, dass sie ineinander verschwammen und nur die Besonderheiten herausstachen. Das Mädchen von gerade eben schien sich verdoppelt zu haben; ganz unverkennbar gab es eine eineiige Zwillingsschwester. Und dann war da noch der Junge, der nur eine Hand hatte.
Ein halbes Dutzend Münder murmelte simultane Fragen: Ob sie gut geschlafen habe? Ob ihre Träume ihr etwas Neues mitgeteilt hätten? Ob die Ziegen sie warmgehalten oder die Sonne sie geweckt habe? Ob sie ein Ei möchte, Brot backen und kochen könne, baden wolle?
Dahinterzukommen, wer was gesagt hatte, fühlte sich an, als wolle man die Schnur eines fliegenden Drachens entwirren. Parvin wusste nicht einmal, ob überhaupt Antworten von ihr erwartet wurden. Sie hatte die meisten der Namen vergessen, die ihr am gestrigen Abend genannt worden waren, bis auf einen, vielleicht weil das dazugehörige Gesicht schwer zu vergessen war.
Wahid hatte Bina ein Jahr nach Fereschtas Tod geheiratet. Sie war Fereschtas jüngere Schwester und folglich sowohl Tante als auch Stiefmutter für Fereschtas sechs Kinder. Issa, der Parvin über diese Veränderung informiert hatte, hielt es für eine gute Sache, dass Fereschtas Kinder von ihrer Schwester großgezogen wurden. Allerdings ließen Binas fahle Haut und tiefliegende Augen vermuten, dass es für sie selbst nicht unbedingt gut war. Ihr Mund schien permanent zu einer Mischung aus gequältem Viertellächeln und Zähnefletschen verzogen, als wolle sie die Welt beißen, bevor die als Erste zubeißen konnte. Dieser sicherlich unbeabsichtigte trotzige Ausdruck bewahrte sie davor, völlig besiegt auszusehen. Ihr Alter war schwer zu bestimmen. Parvin schätzte sie auf Anfang zwanzig, also etwa in ihrem eigenen Alter, was wahrscheinlich die einzige Gemeinsamkeit zwischen ihnen war. Ein Baby in einem Tragetuch schmiegte sich an ihre Brust, ein kleines Mädchen und ein etwa vierjähriger Junge klammerten sich an ihren Rock.
Der Anblick dieser Kinder weckte in Parvin eine schmerzliche Sehnsucht nach ihrem einjährigen Neffen. Ansar war von allen Familienmitgliedern derjenige, den zurückzulassen ihr am schwersten gefallen war. Ihr Verhältnis zu ihm war absolut unkompliziert, eine reine, sehr körperliche Liebe. Sie war immer wieder aufs Neue hingerissen von seinen Speckröllchen, seinen langen Wimpern und seinen Babyzähnchen und liebte es, ihn zu knuddeln und zum Lachen zu bringen.
Die kleinen Kinder hier, magerer und schmutziger, hatten nicht die gleiche Wirkung auf sie. Bina bestätigte, dass es ihre waren. Fereschtas Kinder mitgerechnet, war sie also neunfache Mutter, und wie es aussah, war sie gleichzeitig damit beschäftigt, dem einen die Brust zu geben, das nächste zu füttern und allen nebenbei die Gesichter abzuwischen. Sie war schon seit Stunden auf, betonte sie, war schon vor Anbruch der Morgendämmerung aufgestanden, um Feuer für den Tee zu machen, den Brotteig zu kneten und ein halbes Dutzend anderer Dinge zu erledigen, bevor die anderen wach wurden.
Mein Gott, musst du müde sein, dachte Parvin, sagte aber: »Sie müssen Fereschta sehr vermissen.«
Ihre Worte stießen auf Schweigen, als habe sie einen Ball geworfen, den weder Bina noch sonst jemand fangen wollte. Natürlich war es anmaßend von ihr, ihre Bekanntschaft mit etwas so Persönlichem zu beginnen, und sie bedauerte ihre Bemerkung sofort, aber für sie, und für Millionen andere, die Binas Schwester aus Cranes Buch kannten, war ihr Tod noch neu, die Erinnerung an sie noch frisch. Parvin hatte das Gefühl, den Tod einer Frau, die sie nicht einmal gekannt hatte, persönlich miterlebt zu haben.
Der Hauptraum, in dem sie sich befanden, war rechteckig, vielleicht fünf mal zehn Meter groß, mit kleinen, hohen Fenstern. Er war die Bühne für das Leben der ganzen Familie, hier saßen sie beisammen, hier aßen und schliefen sie. Tagsüber wurde das Bettzeug zusammengerollt und in einer Ecke verstaut, die einzige andere Möblierung bestand aus einem großen Aluminiumkoffer, einem Ofen und einer Wiege, die an Seilen von einem Balken baumelte. Aluminiumtöpfe hingen an den Wänden, die stellenweise mit einem dunkleren Lehm ausgebessert worden waren. Der Teppich, auf dem Parvin saß, war fadenscheinig. Auf einem schmalen Holzregal stand ein kleines, batteriebetriebenes Radio.
Sie lehnte sich in die Kissen, die die Wand säumten, und schlug die Beine unter. Bina und die Mädchen bedienten erst Wahid, Wahids ältesten Sohn und Parvin, bevor sie selbst zugriffen. Beim Essen – es gab Brot, Tee und Joghurt – machten die auf sie gerichteten Blicke Parvin das Kauen schwer. Die Musterung ihrer Jeans und ihrer blaugrün lackierten Zehennägel, die das kleine Mädchen so faszinierend fand, dass es zu ihr gekrabbelt kam, um sie zu berühren, machten die Sache auch nicht besser.
Zwischen Brotbissen schoss Wahid Fragen auf sie ab, als seien sie, wie Holzhacken, eine Aufgabe, die er zu erledigen hatte. »Wer sind Ihre Eltern?«
Parvin nannte ihre Namen und fügte hinzu, ihr Vater sei Professor an der Universität von Kabul gewesen. Nach ihrer Mutter wurde sie nicht gefragt, und obwohl sie das als Kränkung empfunden haben könnte, war sie erleichtert. Der Tod ihrer Mutter war bereits drei Jahre her und daher nicht mehr ganz so schmerzlich. Aber die Vorstellung, mit diesen Menschen über ihre Mutter zu sprechen, löste in ihr das unerwartete Gefühl aus, verletzlich zu sein. Sollten sie kein Interesse zeigen oder das Falsche sagen, könnte sie das nicht ertragen. Da war es ihr lieber, ihre Mutter blieb hier noch eine Weile am Leben.
»Und was wollen Sie hier tun?«, wollte Wahid dann wissen.
Parvin hatte angenommen, Cranes Mitarbeiter hätten das längst erklärt. »Ich möchte in der Klinik helfen«, begann sie.
»Dann sind Sie Ärztin?«
»Nein, nein, bin ich nicht. Ich bin gerade erst mit dem Studium fertig geworden.«
»Aber Sie wollen Ärztin werden?«
»Nein. Ich hoffe, das heißt, ich habe vor, als Akademikerin zu arbeiten. Ich möchte an einer Universität lehren. Und forschen.«
»Dann scheinen Sie sich verirrt zu haben, weil es hier keine Universität gibt.«
Die ganze Familie, einschließlich der Kinder, lachte. Inmitten der allgemeinen Belustigung presste Parvin die Hände auf ihre Knie, als wolle sie sich fester verankern. Ihr einziger Trost war, dass sie mehr verstand als am gestrigen Abend.
»Wir haben nicht einmal eine richtige Schule«, sagte Wahids ältester Sohn, der Dschamschid hieß, wie Parvin wieder einfiel. Er war etwa fünfzehn und hatte die unverwechselbaren Augen seines Vaters. Die kleineren Kinder wurden in der Moschee unterrichtet, fuhr er fort, für die älteren, so wie ihn, gebe es nichts.
Parvin beeilte sich zu erklären, dass sie keineswegs jetzt sofort an einer Universität arbeiten wolle, sondern gekommen sei, um herauszufinden, wie sich die von Gideon Crane erbaute Klinik auf die Gesundheit und die Geburtensituation der Frauen im Dorf ausgewirkt habe und welchen Gefahren sie immer noch ausgesetzt seien. Sie holte zu weit aus, strapazierte ihr Dari über ihre Fähigkeiten und jede Verständlichkeit hinaus. Das erkannte sie an den Gesichtern der anderen, konnte aber einfach nicht aufhören. Immer wieder musste sie sich mit Englisch behelfen, um Lücken zu füllen: »Ich habe medizinische Anthropologie studiert, was heißt, dass man sich damit beschäftigt, wie Menschen in anderen Kulturen leben und auf welche Weise die Strukturen dieser Kultur bestimmen, wie man mit medizinischen Problemen umgeht, und mit welchen Ergebnissen –«
»Sind Sie verheiratet?«, unterbrach Wahid.
»Verlobt«, log Parvin.
»Und der Mann, den Sie heiraten wollen, hat Ihnen erlaubt, hierherzukommen?«
Sie spürte, dass Dschamschid sie beobachtete. Alle beobachteten sie. »In Amerika braucht eine Frau keine Erlaubnis eines Mannes, um auf Reisen zu gehen«, sagte sie mit einem Lächeln in Richtung der Mädchen. Sie hoffte, ein positiver, vielleicht sogar motivierender Einfluss auf sie zu sein. Nur eine von ihnen, die Älteste, im Teenageralter, auffallend hübsch, mit glänzenden Haaren, blitzenden Augen und einem Mund wie eine blassrosa Lilie, lächelte zurück.
»Und Ihr Vater – hat er es erlaubt?«, ließ Wahid nicht locker.
»In Amerika können Frauen alles tun, was sie sich erträumen«, antwortete Parvin, inzwischen gereizt. Alles, was Wahid sagte, passte zu einem Mann, der es nicht für nötig befunden hatte, um das Leben seiner Frau zu kämpfen. »Frauen können sogar für die Präsidentschaft kandidieren. Oder ins Weltall fliegen. Einfach alles. Und wir brauchen dafür keine Erlaubnis.«
»Und obwohl das alles möglich wäre, haben Sie davon geträumt, hierherzukommen?«, fragte Wahid und erntete weiteres Gelächter.
Wahid baute Weizen und Alfalfa an; außerdem hatte er Maulbeerbäume. Nach dem Frühstück würde er wie üblich mit Dschamschid auf die Felder gehen, erst jedoch fragte er Parvin nach dem Geld, das sie ihm für Unterkunft und Verpflegung schuldete. Seine Nachfrage ärgerte sie, weil sie bedeutete, dass er ihr nicht traute, obwohl sie keine Möglichkeit hatte, ohne seine Hilfe von hier wegzukommen. Sie lief in ihr Zimmer, um das Geld zu holen. Die Kinder machten Anstalten, ihr zu folgen, aber Wahid befahl ihnen, zu bleiben, wo sie waren.
Über Cranes Stiftung hatte sie vereinbart, Wahid monatlich fünfundsiebzig Dollar zu zahlen. Inzwischen hatten er und sie sich darauf geeinigt, dass sie ihm weitere fünfundzwanzig Dollar für den Luxus eines eigenen Zimmers geben würde, beziehungsweise, dachte Parvin, für den Luxus eines so penetranten Gestanks, dass sie die ganze Nacht kaum Luft bekommen hatte. Sie kniete sich auf den Boden und fing an, einen riesigen Stapel Afghanis abzuzählen, weil sie drei Monate im Voraus zahlen wollte, um weiteren Forderungen Wahids zuvorzukommen und sich gleichzeitig an das Leben hier zu binden. Das Unbehagen, das sie beim Frühstück empfunden hatte, würde sich legen, tröstete sie sich, obwohl sie nicht wirklich daran glaubte. Im Kopf ging sie die Unterhaltung mit der Familie noch einmal durch und versuchte, dahinterzukommen, was ihr so gegen den Strich gegangen war. Darüber vergaß sie, wie weit sie beim Zählen gekommen war – sie hätte mehr große Scheine mitbringen sollen –, und musste noch einmal von vorn anfangen. Ihre Frustration wuchs, und als ein Huhn hereinspazierte, trat sie danach und schrie: »Willst du mir auch die Haare abfressen?« Peinlicherweise standen Wahid und Dschamschid nicht weit von ihrem Zimmer im Hof und warteten auf sie. Sie griff sich das Geld, marschierte zu ihnen und sagte zu Wahid: »Hier. Für drei Monate.«
Er nickte und ging in die Hocke, um nachzuzählen. Sie betete, dass sie sich nicht zu seinen Ungunsten verzählt hatte – er würde denken, dass sie ihn übers Ohr hauen wollte. »Ich hoffe, es stimmt«, sagte sie vorsichtshalber, aber er konzentrierte sich aufs Zählen und antwortete nicht.
»Der ist zu viel«, sagte er schließlich und gab ihr einen Hundert-Afghani-Schein zurück.
Immerhin war er ehrlich. Fast hätte sie gesagt, er könne den Schein behalten, wusste jedoch auch ohne bisherige Auslandserfahrung, dass sie auf keinen Fall den Eindruck erwecken durfte, Geld habe für sie keine Bedeutung.
Als Wahid zu den Feldern aufgebrochen war, lichtete sich Parvins Bedrückung ein wenig, als habe sie, wie der Rest der Familie, unter seiner Fuchtel gestanden. Auch die anderen schienen sich freier zu fühlen, denn kaum dass die Tür hinter ihm zugefallen war, kamen die Kinder die Treppe hinunter und in Parvins Zimmer gerannt.
»Ich packe jetzt aus«, verkündete sie gutmütig und kauerte sich hin, um ihre Koffer zu öffnen. Die Kinder drängten näher und begafften die sorgfältig gepackten Sachen: Tunikas, Jeans, lange Röcke; mehr als genug Toilettenpapier für einen Basar, Kopfschmerztabletten, Tampons, Sonnencreme, Unterwäsche, Feuchtigkeitscreme, Insektenschutzmittel, Wimperntusche, Kosmetiktücher, Energieriegel, Notizhefte, über ein Dutzend Bücher, darunter auch Mutter Afghanistan. Föhn. Springseil. Yogamatte. Ein aufblasbarer blauer Gymnastikball, der ihr jetzt besonders absurd vorkam. Die Blicke der Kinder landeten wie Fliegen auf all diesen Dingen. »Wie reich sie ist«, piepste eine schüchterne Stimme.
Nein, nein, nein, hätte sie gern protestiert, aber der springende Punkt war, dass der Inhalt ihrer Koffer für eine Amerikanerin absolut nichts Ungewöhnliches war. Ganz gleich, wie knapp es um ihre persönlichen Finanzen bestellt war, ihr Land war nun einmal reich, und sie kam nicht umhin zuzugeben, dass sie im Vergleich zu Gideon Crane, der nach allem, was man aus seinem Buch schließen konnte, mit kaum mehr als seiner Arzttasche hier angekommen war, sehr schlecht abschnitt. Zwischen den Beinen der Kinder hindurch sah sie sich im Raum um, aber es gab nichts, wo sie irgendetwas hätte unterbringen können. Daher packte sie alles wieder ein, als bereite sie sich darauf vor, die erste Möglichkeit zu ergreifen, von hier wegzukommen. Was, so bedrückt, wie sie sich fühlte, verlockend klang.
»Raus mit euch!«, verjagte Bina die Kinder, kam herein und bedachte Parvin mit ihrem gequälten Viertellächeln.
Erst jetzt fiel Parvin auf, wie klein und schmal Bina war. Es schien unmöglich – geradezu beängstigend –, dass sie drei Kinder zur Welt gebracht hatte.
»Ist irgendwas davon für uns?« Bina deutete auf die Koffer.
Natürlich. Natürlich hatte Parvin Unmengen an Geschenken für die Familie mitgebracht, angefangen bei Büchern bis hin zu Süßigkeiten. Aber Binas Ton, eine Mischung aus Feindseligkeit und Anspruchshaltung, weckte ihren Widerstand. Ja, sie hatte Geschenke mitgebracht, sagte sie, würde damit aber warten, bis die ganze Familie versammelt war.
Auch Bina fragte, weshalb Parvin gekommen sei, und sie wiederholte, was sie bereits gesagt hatte, und fügte hinzu, es habe sie traurig gemacht, vom Tod von Binas Schwester zu lesen. Sie wolle einfach helfen.
»Wollen alle Amerikaner helfen?«
»Nicht alle, aber viele. Wir hatten nun einmal – Glück.« Außerdem wolle sie mehr über das Leben der Frauen hier erfahren. Über Frauen wie Bina.
»Und wenn Sie es erfahren haben, gehen Sie wieder.«
Es war eher ein Befehl als eine Frage. Parvin nickte und versuchte, sich nicht anmerken zu lassen, wie verletzt sie war. Sie weinte, leise, aber erst, als Bina gegangen war. Das hier war nicht der Empfang, den sie erwartet hatte. Sie wusste, dass sie sich glücklich schätzen konnte, weil sie als Amerikanerin aufgewachsen und ihr ein Leben im Krieg erspart geblieben war. Andererseits jedoch hatte sie sich entschieden – aus freien Stücken entschieden! –, hierherzukommen, um etwas zurückzugeben. Sie hatte angenommen, dass diese Großherzigkeit – ihre Aufopferung – nicht gerade bejubelt, aber doch zumindest begrüßt werden würde. Auf jeden Fall hatte sie doch wohl etwas Besseres verdient als die Gleichgültigkeit oder sogar Feindseligkeit, die ihr bisher entgegengebracht worden war. Gideon Crane war seiner eigenen Aussage zufolge von dieser Familie mit offenen Armen aufgenommen worden. Vielleicht lag der Unterschied in den Charakteren von Wahids Frauen. Während Bina verhärmt und misstrauisch war, war Fereschta liebenswürdig und warmherzig gewesen.
Wie um diese Theorie zu bestätigen, tauchte Fereschtas älteste Tochter, die Hübsche, lächelnd vor Parvins Zimmer auf. Wie Bina trug sie ein weit geschnittenes Kleid aus einem leichten, leinenähnlichen Material, aber während Binas Kleid in einem dumpfen Braun gehalten war, war ihres schimmernd blau und besser geschnitten. Sie würde jetzt die Kühe melken, sagte sie, und als Parvin sich kurz darauf zu ihr gesellte, saß sie schon mit einem Blecheimer neben einer Kuh. Ihr Name, Shokooh, erzählte sie Parvin, bedeute »Herrlichkeit«.
Parvin fragte sie nach ihrem Alter. Sechzehn, antwortete Shokooh und beklagte sich gleich anschließend darüber, dass Bina sie jeden Tag zwang, die Kühe zu melken, und dann schimpfte, weil sie zu lange dafür brauchte. Dass Shokooh keine besonders großartige Melkerin war, war sogar Parvin klar. Beim Reden setzte sie mit dem Melken aus, und wenn sie dann weitermachte, schaffte sie es höchstens, ein paarmal unsanft an den Zitzen zu zupfen, bevor sie erneut aufhörte, um sich die Hände zu massieren. Währenddessen trippelte die Kuh ungeduldig hin und her und erwischte Shokooh gelegentlich mit ihrem Schwanz, mit dem sie nach den Fliegen schlug. »Das ist noch gar nichts«, sagte Shokooh, als Parvin eine Bemerkung darüber machte. Sie sei schon mehr als einmal getreten worden. Die Kühe könnten sie einfach nicht leiden.
»Weil du sie nicht leiden kannst«, kam es von Bina, die hinter ihnen aufgetaucht war. Beim Klang ihrer Stimme zuckte Shokooh zusammen. »Die Kühe interessieren sich nicht für dein Gerede. Sie wollen einfach nur ihre Milch loswerden.«
Arme Shokooh, dachte Parvin: Erst die Mutter zu verlieren und dann eine lieblose Stiefmutter zu bekommen!
Das Mädchen ging zurück ins Haus, und Bina übernahm das Melken mit gleichzeitig schnellen, geschickten und effektiven Bewegungen. Auch sie klagte: Wenn Shokooh gemolken hatte, musste sie hinterher immer kontrollieren, ob die Euter auch wirklich geleert waren, damit die Kühe keine Entzündungen bekamen. Nur eine Frau, die gestillt hatte, wusste, wie schmerzhaft so eine Entzündung sein konnte. Ein Kind wie Shokooh hatte davon natürlich keine Ahnung. Sie vergaß auch oft, die Euter abzuwischen, bevor sie mit dem Melken anfing, sodass Stroh und Schmutz und Dung in die Milch gerieten. Außerdem konnte sie sich nicht merken, dass diese Kuh wollte, dass ihre vorderen Zitzen zuerst gemolken wurden, während jene es vorzog, wenn man mit denen auf der rechten Seite anfing, oder dass diese Kuh nie trat, jene aber schon. Oder sie passte nicht auf und ließ die Milch neben den Eimer laufen … und so weiter und so weiter, während sie molk, mit den Kühen redete, sie tätschelte und ihnen wie nebenbei den Rücken, den Bauch, das Euter kraulte.
Kühe seien so unterschiedlich wie Menschen, sagte Bina, während sie die weiße Stirn einer weiteren Kuh streichelte. »Vor ein paar Jahren hat die hier ein Kälbchen bekommen, dunkler als sie, aber auch mit einem weißen Fleck hier« – sie berührte ihren eigenen Nasenrücken. »Als es ein paar Monate alt war, entfernte es sich beim Grasen von den anderen und brach sich ein Bein, und als Wahid es fand, mussten wir es schlachten. Wir reden noch heute von diesem Kalb – wie es beim Schlafen aussah, wie schlampig und gierig es trank, oder ob es in den Bergen Angst hatte. Wenn wir schon nicht vergessen können, dass ein Kälbchen gestorben ist, wie könnte ich da meine Schwester vergessen? Wie könnten diese Kinder ihre Mutter vergessen?«
Diese Wendung kam für Parvin völlig unerwartet. Sie gab einen bedauernden Laut von sich.
Als Fereschta starb, fuhr Bina fort, war sie schon seit zehn Jahren von ihrer Familie fort. Die viel jüngere Bina war sieben gewesen, als ihre Schwester wegging. Sie hatte sie nie wiedergesehen.
»Wie ist denn das möglich?«, fragte Parvin bestürzt.
Das Dorf sei zu Fuß zwei Tage von ihrem Heimatdorf entfernt, erklärte Bina. Wenn Frauen vom Land heirateten, gingen sie für gewöhnlich für immer von ihren Familien fort. Sie hatten weder die Zeit noch das Geld für Reisen, und wer sollte sich während ihrer Abwesenheit um die Kinder kümmern? Die Männer interessierten sich nicht sonderlich für die Familienbande ihrer Frauen.
Vor vier Jahren hatte Parvins ältere Schwester, Taara, geheiratet und war nach San José gezogen, fünfundzwanzig Meilen von der elterlichen Wohnung in Union City entfernt. Als ihre Mutter im Sterben lag, war Taara für mehrere Monate nach Hause zurückgekommen, und auch danach hatten Parvin und ihr Vater sie fast jedes Wochenende gesehen, vor allem seit der Geburt ihres kleinen Sohns. Außerdem telefonierten und simsten die Schwestern die ganze Zeit – fast zu oft für Parvin, die vollauf mit ihrem Studium beschäftigt war, insgeheim dachte, dass Taara offenbar einsam oder gelangweilt war, und ihre Anrufe manchmal auf die Mailbox gehen ließ. Ihre Schwester hatte getan, was in der afghanisch-amerikanischen Gemeinde erwartet wurde: jung einen afghanisch-stämmigen Amerikaner geheiratet und innerhalb eines Jahres ein Kind bekommen. Taara hatte den asphaltierten Weg eingeschlagen, dachte Parvin, während sie selbst sich auf einem unbefestigten sah, ähnlich dem, der sie in dieses Dorf geführt hatte. Sie hatte mit ihrer feministischen Verachtung für Taaras Entscheidungen nicht hinter dem Berg gehalten, so wie die vier Jahre ältere Taara keinen Hehl daraus machte, dass sie die von Parvin missbilligte. Sie gerieten oft aneinander. Nun jedoch, wo sie es nicht konnte, empfand Parvin das plötzliche Bedürfnis, mit ihrer Schwester zu sprechen. Bina und Frauen wie sie mussten immer damit leben.
»Habt ihr euch geschrieben?«, fragte sie.
»Wie denn?«, antwortete Bina. Sie konnten beide nicht schreiben. Wie die meisten Dorfmädchen hatten sie mit neun mit der Schule aufgehört. Über Umwege hatten sie, mit beträchtlichen Verzögerungen, von Fereschtas Kindern erfahren. Aber Bina hatte oft an ihre Schwester gedacht – dass sie sie nicht sehen konnte, hatte sie nicht weniger lebendig gemacht. »Dann jedoch wurde uns eine andere Nachricht überbracht. Die ganze Zeit, die sie brauchte, um zu uns zu gelangen, dachten wir, Fereschta sei am Leben.«
»Es tut mir so leid«, flüsterte Parvin. So qualvoll es für sie gewesen war, ihre Mutter sterben zu sehen, musste es noch viel schlimmer sein, eine solche Nachricht völlig unerwartet zu erhalten.
Bina griff sich den vollen Milcheimer und trug ihn zur Küche auf der Rückseite des Hauses. Unter ihrem dünnen Kleid zeichneten sich die Rückenmuskeln an ihrem winzigen Körper überdeutlich ab. Sie war stark, wie sie es sein musste.
»Ich dachte, in der Nachricht geht es nur um das Schicksal meiner Schwester«, warf sie über die Schulter zurück. »Aber es ging auch um meins.«
Nämlich darum, dass sie Wahids Frau und die Mutter seiner und Fereschtas Kinder werden sollte. Parvin erschauderte bei dem Gedanken, einfach so an ihren Schwager ausgehändigt zu werden. Sie und er kamen nur miteinander aus, weil sie nicht verheiratet waren.
»Hat Shokooh Ihnen erzählt, dass sie lesen und schreiben kann?«, fragte Bina unvermittelt.
Nein, antwortete Parvin. Sie hatte angenommen, alle in Wahids Familie seien Analphabeten.
»Kann sie aber«, kam es verbittert von Bina. Unüberhörbar fühlte sie sich ihrer Stieftochter unterlegen, die gebildeter oder intelligenter war als sie, oder beides. In Parvins Augen trug dieser Neid dazu bei, Binas abweisende Haltung zu erklären, wenn auch nicht zu rechtfertigen.
»Vielleicht könnte Shokooh es Ihnen beibringen«, schlug Parvin vor. Sie waren inzwischen in der Küche angekommen. Bina, die die Milch in einen großen Topf seihte, gab ein Schnauben von sich. Sie war diejenige, die Shokooh alles beibringen musste, alles! Wahid hatte gesagt, er werde sich eine andere Frau nehmen, weil Bina nicht gut genug kochen könne. »Dabei kann Shokooh überhaupt nicht kochen!«, schimpfte Bina. »Und sie vertrödelt die Zeit.«
Parvin glaubte, sich verhört zu haben. »Eine andere Frau? Ich dachte, Shokooh ist Fereschtas Tochter. Sie ist noch so jung.«
Bina lachte rau auf. Oh nein, Shokooh war Wahids Frau, sagte sie und stellte den Milchtopf auf ein niedrig brennendes Feuer. »Ich war auch nicht viel älter, als ich hierherkam. Es ist für die meisten von uns dasselbe.
»Aber –« Parvin verstummte. Sie wusste nicht, was sie sagen sollte. Dass eine solche Heirat in Amerika nicht einmal erlaubt wäre? Was hätte das für einen Sinn? In Afghanistan waren Kinderehen nun einmal keine Seltenheit. Sie wusste auch nicht, was sie fragen sollte, außer, wann die Hochzeit gewesen sei.
Letztes Jahr, vor dem ersten Schnee, sagte Bina. Nachdem Wahid ihr gesagt hatte, er werde sich eine neue Frau nehmen, war er weggegangen, um zu heiraten, und als er mit seiner jungen Braut zurückkam, wurde von Bina erwartet, dass sie sie in den Haushalt eingliederte. »Sie hat immer noch eine Mutter gebraucht«, bemerkte Bina abfällig, als sei diese Bedürftigkeit eine Charakterschwäche. Ihr Gesichtsausdruck verriet, dass Wahids Entscheidung immer noch eine Wunde war, vielleicht immer eine bleiben würde.
Benommen setzte sich Parvin auf den Lehmboden. Im Kopf paarte sie Shokoohs junges, frisches Gesicht mit Wahids ledrigem. Abscheu war das natürliche Ergebnis. Als Außenstehende wollte sie nicht die Richterin spielen; es schien zu einfach, zu vorhersehbar, über die Rückständigkeit des ländlichen Afghanistan entsetzt zu sein. Aber Shokooh konnte höchstens fünfzehn gewesen sein.
Wieso überraschte es sie, dass Wahid nicht in seiner Trauer erstarrt war? Sie hatte erwartet, die Familie so vorzufinden, wie Crane sie verlassen hatte, als habe sein Buch die Zeit zum Stillstand gebracht. Vielleicht war das das Problem, wenn man jemanden durch ein Buch kennenlernte – sie kannte Wahid kaum, und doch hatte er sie bereits enttäuscht.
3. Kapitel
Eine existenzielle Bedrohung
Als Parvin anfing, sich mit Mutter Afghanistan zu beschäftigen, war sie in ihrem letzten Studienjahr in Berkeley und das Buch stand seit drei Jahren auf der Taschenbuch-Bestsellerliste. Natürlich hatte sie davon gehört und immer wieder Hinweise darauf gesehen – alles andere wäre so gut wie unmöglich gewesen –, war aber überzeugt, dass es nur ein weiterer Versuch war, den Informationsdurst der Amerikaner in Bezug auf ein Land, das auf neue und gefährliche Weise für sie relevant geworden war, zu Geld zu machen. In den über sieben Jahren seit den Anschlägen vom 11. September waren die akademischen Wälzer über Afghanistan durch Unmengen von Erlebnisberichten ergänzt worden – geschrieben von westlichen Ausländern, die geheime Nähkreise für Frauen oder Kosmetikschulen ins Leben gerufen oder als Soldaten, CIA-Agenten oder Reporter dort gearbeitet hatten. Viele von ihnen taten so, als hätten sie Afghanistan so entdeckt, wie Kolumbus Amerika entdeckte. Parvin hatte keins dieser Bücher gelesen und alle als belanglos abgetan.
Als sie in dem Café, in dem sie lernen wollte, ein liegengelassenes Exemplar von Mutter Afghanistan auf dem Tisch fand, hatte sie es in der Erwartung in die Hand genommen, es furchtbar zu finden. Der Einband zeigte eine Frau mit feucht schimmernden dunklen Augen und schwarzen Haaren, die fast vollständig unter einem schwarzen Kopftuch verschwanden, vor dem Hintergrund des blattähnlichen Umrisses des Landes. Aber der Text auf der Rückseite versetzte ihr einen unerwarteten Stich. Gideon Crane, hieß es dort, habe sich »in Afghanistan verliebt«.
Dass Afghanistan in seinem derzeitigen desolaten Zustand ein Land zum Verlieben sein könnte, war für Parvin eine Überraschung. Ihre Eltern liebten das Land, sehnten sich danach, aber schließlich war es ihr Heimatland, und sie hatten sich nie wirklich damit abgefunden, es verloren zu haben. Doch sie erinnerten sich an ein anderes Land, idealisierten es vielleicht sogar – das friedliche, ländliche Afghanistan und das weltstädtische Kabul vor der sowjetischen Invasion. Ihr Afghanistan war ein Land, in dem man freitags unter blühenden Mandelbäumen picknickte, in dem Musikveranstaltungen und Dichterlesungen stattfanden, ein Land mit einer jahrtausendealten Geschichte, in der viele der großen Zivilisationen der Welt eine Rolle gespielt hatten. Jetzt jedoch wurde Afghanistan mit schöner Regelmäßigkeit in den Nachrichten als steinzeitlich dargestellt, was Parvin, fast von Geburt an Amerikanerin, nur schwer mit den schwärmerischen Erinnerungen ihrer Eltern in Einklang bringen konnte.
Falls überhaupt, war Afghanistan seit dem Tag, an dem al-Qaida die Zwillingstürme zum Einsturz brachte, für Parvin ein Albtraum gewesen. Sie war damals vierzehn, ging erst seit wenigen Wochen auf die Highschool, und ihre für Teenager typische Unsicherheit befand sich auf einem absoluten Höhepunkt. Die neue Feindseligkeit Muslimen gegenüber fühlte sich an, als sei sie gegen sie persönlich gerichtet, und die über Afghanistan zirkulierenden Bilder von burkatragenden Frauen und gewehrschwingenden bärtigen Männern stellten für sie eine fast existenzielle Bedrohung dar. Unter keinen Umständen wollte sie mit diesen Bildern in Verbindung gebracht werden, und wenn sie in den nächsten Jahren von neuen Bekannten gefragt wurde, wo ihre Familie herkomme, log sie (aus Italien, aus Indien; ihre dunklen Augen und Haare ließen ihr die Wahl). Als sie 2005 in Berkeley anfing, ging sie bereits etwas entspannter mit der Situation um und engagierte sich sogar eine Zeit lang in der Afghanisch-Amerikanischen Gesellschaft, wo sie bei der Organisation von Festen und Tanzveranstaltungen half, die anderen Studenten ihre Kultur näherbringen sollten. Dennoch hielt sie das Land selbst auf Distanz. Als sie später über eine internationale Karriere an der Universität oder der Entwicklungszusammenarbeit nachdachte, sah sie sich in Afrika, in den Appalachen, in Brasilien – überall, bloß nicht in Afghanistan. Und nun kam dieser Amerikaner daher, der keine vorherige Bindung an das Land hatte, und fand dort seinen Lebensinhalt. Diese Diskrepanz – diese Verkehrung –, brachte sie aus dem Konzept. Crane hatte sich Afghanistan geöffnet. Wieso war sie aus Scham davor zurückgeschreckt?
Im Zug zurück nach Union City schlug sie das Buch auf und verschlang die ersten, eindringlichen Kapitel über Cranes Kindheit in Afrika, wo seine Eltern gearbeitet hatten. Als er beschrieb, wie er im Alter von dreizehn Jahren als »Missionarskind« nach Amerika zurückkam, gehörte Parvins Sympathie ihm. Sein Gefühl der Entfremdung, das Gefühl, immer ein Außenseiter zu sein, war ihr vertraut, obwohl sie viel jünger gewesen war, als sie nach Amerika kam.
Beim Abendessen mit ihrem Vater, Ashraf, bei dem sie lebte, lag das Buch aufgeschlagen neben ihr. Seit dem Tod ihrer Mutter hatten sie beide sich angewöhnt, bei Tisch zu lesen, so wie sie oft einfach etwas aufwärmten, was Taara für sie gekocht hatte. Ashraf konnte nicht kochen, und die vollauf mit ihrem Studium beschäftigte Parvin hatte keine Zeit dafür.
Sie versuchte, ihrem Vater zu erklären, was sie dazu gebracht hatte, Cranes Buch zu lesen und wieso sie sein Gefühl der Fremdheit nachempfinden konnte. Da sie ihn nicht kränken wollte, sagte sie nicht, dass die fehlende Leichtigkeit ihrer Eltern Amerika gegenüber auf sie abgefärbt hatte, sondern sprach stattdessen darüber, dass sie sich in der afghanisch-amerikanischen Community fremd fühlte, für die ihr hoher Notendurchschnitt weit weniger zählte als ihre Ehre, ihre sexuelle Reinheit und ihre Heiratsaussichten. Das konnte sie ohne Schuldgefühle sagen; ihr Vater hatte sie in ihren akademischen Zielen immer bestärkt.
»Man könnte meinen, es wäre etwas Schlimmes, einen Hochschulabschluss statt eine Ehe anzustreben«, sagte sie.
Da derartige Bemerkungen für Parvin nichts Neues waren, nickte ihr Vater nur. Überhaupt schien er sich nur vage für Cranes Geschichte zu interessieren, vielleicht weil der in Parvins Erzählung noch nicht in Afghanistan angekommen war. Aber vielleicht, dachte sie, war auch Cranes Verbindung zu Afghanistan das Problem. Selbst nach dem 11. September hatten ihre Eltern nie davon gesprochen, zurückzugehen, obwohl andere aus ihrem Umfeld es taten. War ihr Heimweh nicht echt gewesen? Aber der eigentliche Grund, wusste Parvin, war die Tatsache, dass ihr Vater alles andere als ein Tatmensch war. Es war die Kehrseite seiner Sanftheit. Anders als viele der zurückgehenden Exilanten besaß er keinerlei Unternehmungsgeist, keinen Ehrgeiz, einen Regierungsposten zu ergattern. Dann wurde ihre Mutter krank, womit die Frage einer Rückkehr endgültig vom Tisch war.
Da das Gespräch mit ihrem Vater ins Stocken geraten war, wandte sich Parvin wieder Mutter Afghanistan zu. Seinem eigenen Eingeständnis nach war Crane ein Betrüger, was es noch überraschender machte, dass so viele Menschen sein Buch gelesen hatten. Er hatte Medizin studiert und sich auf Augenheilkunde spezialisiert. Dann aber hatte er sich auf Betrügereien verlegt und zusammen mit anderen die halbstaatliche Krankenversicherung Medicare durch die fälschliche Inrechnungstellung ärztlicher Leistungen um Hunderttausende betrogen. Dazu kam, dass er, obwohl verheiratet, einen Teil seiner unrechtmäßigen Gewinne darauf verwandt hatte, nicht nur eine, sondern gleich zwei Schwestern des Krankenhauses, an dem er operierte, zu verführen. Nachdem eine der beiden ihn und seine Mitverschwörer verpfiffen hatte, entdeckte er die Religion, beziehungsweise fand sie wieder, und trat der Mega-Kirche eines einflussreichen Predigers bei, dessen Schäfchen sich für ihn einsetzten. Parvin verdrehte die Augen bei dieser vorhersehbaren Wendung – der zu Fall gebrachte Mann, der zu Gott findet. Als Crane dann auch noch mit den Ermittlern kooperierte und dafür einen Deal aushandelte, der es ihm ermöglichte, gemeinnützige Arbeit im Ausland zu leisten, sträubten sich Parvins Nackenhaare angesichts der Nachsicht gegenüber Wirtschaftskriminellen weißer Hautfarbe, während Millionen junger schwarzer Männer für weit weniger ins Gefängnis gesteckt wurden. Nur Cranes Selbsterkenntnis ließ sie weiterlesen. Ich hatte Unrecht getan und war praktisch ungeschoren davongekommen, schrieb er.
Crane entschied sich für Kabul. Man schrieb das Jahr 2003, und Afghanistans Zukunft sah vielversprechend aus. Niemand ahnte, dass die vor zwei Jahren so vernichtend geschlagenen Taliban zurückkommen würden, und der Zustrom ausländischer Hilfskräfte und internationaler Hilfsgelder veränderte die Hauptstadt. Crane bezog ein Zimmer in einem komfortablen Gästehaus und verbrachte die nächsten Wochen damit, mittellose Afghanen mit Grauem Star oder Aderhautmelanom zu operieren.
Sein Verlangen, seine eigenen Tiefen auszuloten, veranlasste ihn anschließend dazu, in Begleitung eines nur als »A.« bezeichneten Dolmetschers auf Reisen zu gehen. Parvin war in ihrem Zimmer, als sie an diesem Punkt anlangte, demselben Zimmer in der Dreizimmerwohnung über einem Ein-Dollar-Laden, in der ihre Familie seit ihrer Ankunft in Union City vor zwanzig Jahren lebte. Es enthielt immer noch die beiden Einzelbetten, die ihnen von der Flüchtlingshilfe zur Verfügung gestellt worden waren, und auch im Wohn-Esszimmer standen noch die ursprünglichen Möbel: ein klobiger Esstisch aus zweiter Hand und eine wuchtige Couchgarnitur von der Sorte, die man auf Raten in Geschäften kaufen kann, die die Hälfte ihrer Waren auf dem Bürgersteig ausstellen. Das Einzige, was sich verändert hatte, abgesehen davon, dass das Burgunderrot der Couchgarnitur zu Rosa verblasst war, waren die Bewohner. Parvins Schwester, mit der sie sich dieses Zimmer geteilt hatte, wohnte jetzt in San José, ihre Mutter war gestorben, und Parvin und ihr Vater bewegten sich seitdem durch Räume, die über Nacht unerträglich riesig geworden waren. Das Buch in der Hand sah Parvin sich um und konnte Cranes Rastlosigkeit nachempfinden. Auch sie sehnte sich schon lange nach einem Leben, in dem sie nicht wusste, was als Nächstes kommen würde.
Das Tal, das Crane am Ende der Straße erreichte, war eine Art Paradies, ein idyllisches, von Ausländern unberührtes Fleckchen Erde, das selbst den meisten Afghanen völlig unbekannt war. Parvin versuchte sich vorzustellen, was sie tun würde, wäre sie die erste Ausländerin, die, so wie Crane, ein Dorf betrat. Sie fand, er hatte alles genau richtig gemacht:
Ich wurde seit damals oft gefragt, ob ich Angst hatte, und ich kann ehrlich sagen: Kein bisschen. Was hätte ich fürchten sollen? Es gab keine Extremisten, sondern nur ganz gewöhnliche Menschen, die friedlich vor sich hinlebten. Die Freundlichkeit der Gesichter, die sich uns zuwandten, als wir ins Dorf kamen, war nicht zu verkennen. Diese Leute standen Amerikanern nicht feindselig gegenüber. Ich war der Erste, den sie je zu Gesicht bekamen, und da ich mich als eine Art Botschafter für mein Land sah, versuchte ich, weder vorschnell zu urteilen noch Forderungen zu stellen. Ich wolle den Dorfbewohnern behilflich sein, sagte ich, und ihre Sitten und Bräuche kennenlernen, damit ich anderen Amerikanern ein zutreffendes Bild von ihnen vermitteln könne.
Wahid und Fereschta, arm, aber großherzig, hatten ihn bei sich aufgenommen. Fereschta, eine »schimmernde afghanische Rose« voller Grazie und Großmut, bereitete ihm schmackhafte Mahlzeiten, versorgte ihn mit Tee und Decken und kümmerte sich um ihre sechs Kinder, während sie ein siebtes unter dem Herzen trug.
Aber als sie in die Wehen kam, gab es Probleme, wie bei vielen afghanischen Frauen, insbesondere auf dem Land. Allerdings steht den meisten afghanischen Frauen kein amerikanischer Arzt zur Verfügung. Sicher, Crane war Augenarzt, kein Gynäkologe, wusste aber trotzdem weit mehr als die »ignorante alte Schachtel«, die als die traditionelle dörfliche Geburtshelferin fungierte. Es gab also Hoffnung, zumindest hätte es Hoffnung geben sollen. Aber Wahid sagte, er brauche die Erlaubnis des Mullahs, bevor ein ausländischer Mann seiner Frau helfen könne. Der Mullah verweigerte die Erlaubnis. Crane drängte Wahid, ihn trotzdem helfen zu lassen, aber der lehnte ab. Was immer geschehe, sei Gottes Wille, sagte er. Crane konnte nur versuchen, Fereschta in ein Krankenhaus zu bringen, in dem es eine Ärztin gab, aber im Dorf gab es kein einziges Fahrzeug. In seiner Verzweiflung setzte Crane sie auf den Esel – den Esel! –, mit dem er ins Dorf gekommen war.
Parvin las weiter. Ihre Stimmung hob sich, als Fereschta, Crane und Wahid das Bezirkskrankenhaus erreichten, und stürzte ins Bodenlose, als sich herausstellte, dass es auch hier keine Ärztin gab. Immerhin war der männliche Arzt kein Ausländer, und Wahid willigte ein, ihn helfen zu lassen.
Ich tigerte um das kleine Krankenhaus herum, schrieb Crane, wo sich Ziegen an Müllhaufen gütlich taten, die mit medizinischen Abfällen durchsetzt waren. Fereschtas Schreie drangen aus einem Fenster und zerrissen mir das Herz. Ich warf mich zu Boden, breitete die Arme aus und flehte Gott an, mich an ihrer Stelle zu sich zu nehmen. Noch während ich betete, hörten die Schreie unvermittelt auf. Ich dankte Gott; das Baby war da! Dann durchbrach ein Laut, ein einziger langgezogener Schrei wie nicht von dieser Welt, der immer noch in meinen Ohren nachhallt, die Stille.
Parvin fühlte sich wie nach einem Schlag in den Magen. Wahrscheinlich hatte sie gewusst, dass Fereschta sterben würde, weil das Buch in aller Munde gewesen war. Aber Cranes Talent als Geschichtenerzähler hatte sie glauben lassen, dass Fereschta es schaffen würde. Außerdem endeten derartige Geschichten doch immer mit einem Happy End! Parvin hatte sich um Fereschta auf die Weise geängstigt, wie man es in einem Horrorfilm oder auf der Achterbahn tut, wo sich Vergnügen unter das Grauen mischt, zu dem das unterschwellige Wissen um die eigene Sicherheit untrennbar gehört. Natürlich würde Fereschta am Leben bleiben, und Crane, der sie ins Krankenhaus gebracht hatte, würde in seiner eigenen Geschichte als Held dastehen. Genauso funktionierten doch diese Bücher.
Ich rannte ins Krankenhaus, schrieb Crane, und durch die Flure, bis ich durch eine offene Tür sah, wie sich Wahid über den leblosen Körper seiner Frau beugte.