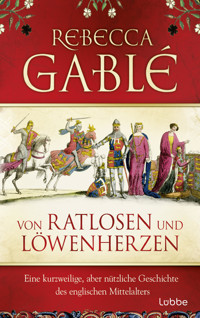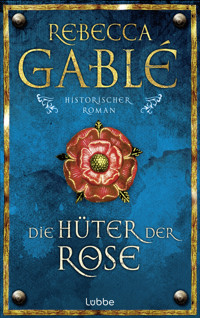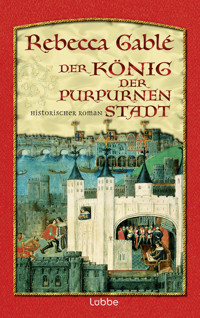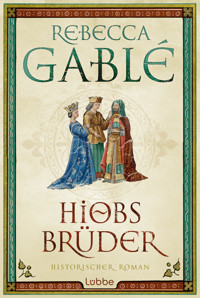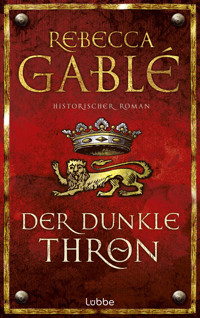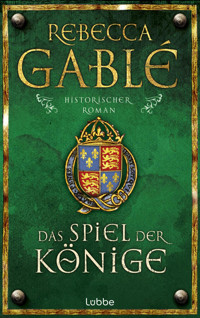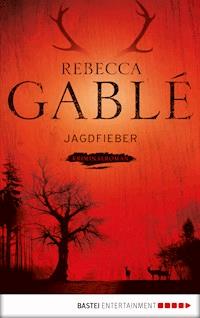4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
»Heiliger Florian, verschone mein Haus, zünde lieber das Dach meines Nachbarn an.« Nach diesem Prinzip entsorgt die Wohlstandsgesellschaft ihren Müll in der Dritten Welt. Als Mark Malecki einen Versicherungsbetrug aufklären will, stößt er auf einen Müllschieberring, der mit illegaler Entsorgung Millionen verdient und skrupellos jeden entsorgt, der das Geschäft gefährdet. Dann geschieht ein Mord, und Malecki erkennt zu spät, dass Giftmüll auch eine tödliche Waffe sein kann ...
Die Kriminalromane von SPIEGEL-Bestsellerautorin Rebecca Gablé bei beTHRILLED in der richtigen Reihenfolge (jeder Krimi kann für sich gelesen werden):
Jagdfieber
Die Farben des Chamäleons
Das letzte Allegretto
Das Floriansprinzip
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 368
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchTitelAnmerkungProlog1234567891011121314Über die AutorinWeitere Titel der AutorinImpressumÜber dieses Buch
Wenn Giftmüll zur gefährlichen Waffe wird …
»Heiliger Florian, verschone mein Haus, zünde lieber das Dach meines Nachbarn an.« Nach diesem Prinzip entsorgt die Wohlstandsgesellschaft ihren Müll in der Dritten Welt. Als Mark Malecki einen Versicherungsbetrug aufklären will, stößt er auf einen Müllschieberring, der mit illegaler Abfallbeseitigung Millionen verdient und skrupellos jeden »entsorgt«, der die Geschäfte gefährdet. Dann geschieht ein Mord, und Malecki erkennt zu spät, dass Giftmüll auch eine tödliche Waffe sein kann …
REBECCA
GABLÉ
DAS FLORIANSPRINZIP
KRIMI
Die Handlung dieser Geschichte und ihre Personen sind frei erfunden. Nur die Müllmenschen gibt es wirklich. Die Beschreibung ihrer Lebensumstände sowie der geschilderten Müllschiebertricks habe ich in Winfried Schnurbus’ hervorragendem Buch Deutscher Müll für alle Welt gefunden. Engagierten Journalisten wie ihm und den Aktivisten von Greenpeace und anderen Umweltorganisationen gehört meine größte Hochachtung.
R.G.
Prolog
Ich schlitterte den Abhang hinab. Der Wagen lag auf dem Dach, alle Fenster waren zersplittert, ein Reifen zerfetzt. Ich stolperte und fiel und rollte auf das brennende Wrack zu. Ehe ich dagegenstieß, kam ich wieder auf die Füße. Ich zögerte mit erhobener Hand. Ich wollte die Tür nicht öffnen, wollte es nicht sehen. Aber ich musste es sehen. Das musste ich immer. Ich wickelte die Jacke um meine Hand, damit ich mich nicht verbrannte, und riss die Wagentür auf. Angy hing mit baumelnden Armen in ihrem Gurt, ihr Kopf pendelte. Ich beachtete sie nicht weiter. Ich wusste, da war nichts mehr zu retten, es war Paul, um den ich mich kümmern musste. Er lebte noch, auch wenn er schon brannte. Ich packte ihn unter den Armen und zerrte ihn nach draußen, raus aus dieser Flammenhölle. Ich wollte ihn den Abhang hinaufzerren. Ich war sicher, wenn ich ihn nur schnell genug den Steilhang hinaufschaffen konnte, dann war es nicht zu spät. Denn ich konnte seinen Puls fühlen. Ich musste mich nur beeilen. Ich musste oben sein, ehe der Wagen in die Luft flog. Ich strengte mich an, bis das Blut in meinen Schläfen pochte, ich zerrte mit zusammengebissenen Zähnen. Dieser verdammte Abhang war so steil und glitschig, und er wollte überhaupt kein Ende nehmen. Es regnete mir in die Augen. Aber ich ließ nicht locker, ich packte fester zu, sah auf Pauls verbranntes Gesicht hinab und zerrte. Zwei weißgewandete Typen mit einer Bahre stürmten auf mich zu, stießen mich weg und hoben ihn auf. Ich wollte protestieren, wollte ihnen erklären, dass ich ihn nach oben schaffen musste, dass das seine und meine einzige Chance war. Aber ich brachte keinen Ton heraus. Stumm starrte ich auf ihre breiten Rücken, die mir die Sicht auf sein verunstaltetes Gesicht versperrten. Einer von ihnen drehte sich zu mir um, und ich sah ohne jedes Erstaunen, dass es nicht länger der Notarzt, sondern der Richter war. Er zog sich den Kittel aus, enthüllte seine Robe und sah auf einen Punkt über meiner rechten Schulter.
»Er ist tot, das steht mal fest. Er hatte keine Chance mehr. Er ist verbrannt. In Ihrem Wagen. Die Beweislage ist eindeutig. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil: Der Angeklagte wird in allen Punkten für schuldig befunden. Der Angeklagte wird zu einer Freiheitsstrafe von vierundzwanzig Monaten verurteilt. Die Strafe wird zur Bewährung ausgesetzt. Die Sitzung ist geschlossen.«
Ich wachte auf. Erleichtert. Ich war immer erleichtert, wenn ich aus diesem Traum erwachte. Mit geschlossenen Augen blieb ich reglos liegen und lauschte auf den rasenden Puls in meinen Ohren. Ich konnte mein Herz spüren. Es hämmerte, penetrant, viel zu laut und irgendwie bedrohlich, wie ein Kolben, der trotz eines Widerstands mit normaler Geschwindigkeit weiterzulaufen versucht. Im gleichen Rhythmus pulsierte es vor meinen geschlossenen Lidern, rot-schwarz, rot-schwarz, rot-schwarz. Als das Hämmern nachließ, schlug ich die Augen auf. Ich hatte keine Schwierigkeiten zu ergründen, wo ich mich befand. Dieser Traum konnte mich schon lange nicht mehr desorientieren. Ich war zu Hause, ich lag in meinem Bett, allein.
Es war immer noch mörderisch heiß. Mein Kissen und das zerknitterte Laken waren feucht. Es mochte drei oder vier Uhr sein. Ich wusste, ich würde nicht mehr schlafen. Eine kühle Dusche. Danach stand mir der Sinn. Eine Dusche. Eine Zigarette und ein Kaffee vielleicht. Es würde ohnehin bald hell werden.
Ich setzte mich auf und blinzelte. Mein Kopf tat weh. Nur ein bisschen. Dieser Traum verursachte mir immer einen leichten Kopfschmerz, begleitet von einer unterschwelligen, aber gleichzeitig schweißtreibenden Angst. Wie die Erinnerung an eine Panikattacke.
Ich stand auf, raufte mir die Haare und trat ans Fenster. Der Himmel leuchtete in einem seltsamen, matten Orange. Ich rieb mir die Augen, aber das Leuchten blieb. Entweder ging die Sonne heute im Nordwesten auf – drastische Veränderungen dieser Art sind schließlich nichts Außergewöhnliches mehr –, oder aber es brannte. Irgendwo am Rhein, vermutlich auf der anderen Seite. Ich blieb einen Moment am gekippten Fenster stehen und erwog, es weit zu öffnen und die Ohren zu spitzen. Aber es interessierte mich im Grunde nicht, meine Hände baumelten weiterhin untätig herab, keinerlei Anzeichen, dass eine sich heben wollte. Endlich mal eine Katastrophe, die mich nichts angeht, dachte ich gähnend.
Jeder kann sich mal irren.
Ich wandte mich ab, schlich ins Bad rüber und stellte mich unter die Dusche. Nach ein paar Sekunden unter dem kühlen Strahl hatte ich den Widerschein der Feuersbrunst am Nachthimmel schon vergessen. Stattdessen befasste ich mich wieder mit meinem Traum und fragte mich, was zur Hölle ich denn noch tun sollte, wie viel Zeit denn noch vergehen müsse, bis er mich endlich verschonte.
1
Sie will, dass ich mir die Haare abschneiden lasse.«
»Ah ja?«
»Hm.«
Gleißendes Sommerlicht fiel durchs Fenster und die offene Tür herein, Staubkörnchen wiegten sich träge darin. Es roch nach Öl. Über unseren Köpfen drehte sich der Ventilator, aber sogar er wirkte schlapp, und man spürte eigentlich keinen Hauch.
»Sie sagt, wenn ich mir die Haare abschneiden lasse, kauft sie mir ein Moped.«
»Tja. Was für Geschäfte du mit deiner Mutter machst, ist allein deine Sache, Daniel.«
Das sah ihr doch wirklich ähnlich. Im Grunde genommen war sie immer schon ein erpresserisches Miststück gewesen. Es stand derzeit nicht gerade zum Besten zwischen meiner Exfrau und mir, und während der vielen, einsamen Stunden in meiner Werkstatt vertrieb ich mir manchmal die Zeit damit, mich daran zu erinnern, was sie mir alles Grässliches angetan und wie unerschrocken ich alldem die Stirn geboten hatte. Ich kam jedes Mal zu der Erkenntnis, dass ich mich glücklich preisen konnte, dass sie ihren Hintern schließlich in das Bett ihres Tennistrainers gelegt hatte, und dann lächelte ich wie einer, der mit knapper Not einen Schiffbruch überlebt hat.
Ich machte mir ein Bier auf. »Was gefällt ihr nicht an deinen Haaren?«
»Sie sagt, ich seh aus wie ein trauriges Überbleibsel aus längst vergangenen Tagen. Und sie sagt, ich seh aus wie du vor zwanzig Jahren.«
»Vor zwanzig Jahren kannte sie mich überhaupt noch nicht. Sag ihr, wenn sie gelegentlich mal wieder die Augen aufmacht, wird sie feststellen, dass die Welt sich ein gutes Stück weitergedreht hat, seit sie zuletzt hingesehen hat.«
Ich fragte mich verdrießlich, ob’s ihr lieber wäre, er würde sich den Schädel rasieren und in Springerstiefeln rumlaufen. Ich betrachtete ihn verstohlen. Morsche, mit System zerfetzte Jeans, ein ärmelloses T-Shirt undefinierbarer Farbe, Ohrring, Lederarmbänder, nichts Besonderes. Für meinen Geschmack sah er völlig in Ordnung aus. Vielleicht hatte sie recht, vielleicht schmeichelte es mir, dass er mit seiner Erscheinung das gleiche rebellische Statement abgab wie ich in seinem Alter. Aber was immer seine Gründe sein mochten, ich hatte ihn ganz sicher nicht dazu verleitet, denn ich wusste inzwischen, dass das letztlich nur ein schwaches, bedeutungsloses Aufbäumen war. Trotzdem hätte ich nicht übel Lust gehabt, es ihm gleichzutun und mir die Haare noch mal wachsen zu lassen. Aber einem Typen von beinah achtunddreißig kauft das ja keiner mehr ab. Und ich wollte lieber nicht wissen, was Goldstein dazu zu sagen hätte. Zwischen Goldstein und mir stand es auch nicht zum Besten, und ich hatte nichts zu verschenken.
»Könntest du mal eben mit anfassen?«
Er stieg über das Werkzeug, das am Boden verstreut lag, und hielt die weiße Ledersitzbank fest, so dass ich sie festschrauben konnte. Das war eins der tausend Dinge, für die man wenigstens drei Hände brauchte.
»Ich weiß nicht, was ich machen soll. Haare wachsen wieder. Und ich brauche ein Moped. Aber irgendwie …«
»Ich sag dir was, Daniel. Wenn ich zwölftausend für dieses Motorrad hier kriege – und das werd ich –, dann kauf ich dir ein Moped. Spätestens von dem nächsten. Ohne Bedingungen. Ich misch mich ja sonst nicht ein, ich bin ja nicht lebensmüde, aber das geht einfach zu weit …«
Er reichte mir eine Schraube an. »Letzte Woche hast du gesagt, wenn du die Harley gut verkauft kriegst, fliegen wir in Urlaub.«
»Tun wir.«
»Aber in der Küche liegt ein Brief von der Bank. Und der sieht haargenau so aus wie die Briefe, die dich höflich dran erinnern, dass du die Hypothek nicht bezahlt hast.«
Die Sitzbank saß fest. Ich trat einen Schritt zurück und betrachtete mein Werk. Was vor drei Wochen noch als stumpfes, räderloses Skelett in der Garage eines gichtgeplagten Altrockers gestanden hatte, sah beinah schon wieder aus wie eine Harley Davidson Heritage, Baujahr 91, ein chromblitzender Augenschmaus.
Ich setzte mich auf den Boden. Es war egal, ich war sowieso schon dreckig. Heutzutage machte ich mich bei der Arbeit immer dreckig. Das machte mir Spaß.
»Wirf mal die Kippen rüber, ja.«
»Wenn du nicht so viel qualmen würdest, würden wir ’ne Menge Geld sparen.«
»Oh, nicht schon wieder …«
»Ich sag ja nur …«
Ich steckte mir eine an, nahm einen Schluck aus der Flasche und warf noch einen verliebten Blick auf das Motorrad. Es war jedes Mal ein Wermutstropfen, dass ich sie nicht behalten konnte.
»Die Hypothek ist bezahlt, nur keine Bange. Es ist jetzt über zwei Jahre gut gegangen, willst du nicht endlich mal aufhören, dir Sorgen zu machen?«
Es reichte schließlich, wenn ich mir gelegentlich Sorgen machte.
Beinah zehn Jahre lang hatte ich einen relativ sicheren, relativ gut bezahlten Job als Bankrevisor gehabt, und sosehr ich die Bank auch manchmal gehasst hatte und sie mich, hatten wir uns doch irgendwie aneinander gewöhnt. Bis eine meiner Ermittlungen einen grandiosen Steuerschwindel enthüllte, von dem niemand etwas wissen wollte. Unsere Hartnäckigkeit brachte meinen Freund und Partner Paul auf den Friedhof und mich in den Knast, weil ich den Vorstandsvorsitzenden der Bank, der die ganze Schweinerei unter den Teppich kehren wollte, krankenhausreif prügelte. Da war’s dann natürlich aus mit meinem ›sicheren‹ Job.
Ich weinte meiner bürgerlichen Existenz keine Träne nach, aber die Situation stellte mich vor einen Haufen Probleme, denn ich hatte einerseits eine Hypothek und zwei Kinder am Hals, auf der anderen Seite keine Frau und keinen Job mehr. Eine Zeit lang war unsere Lage wirklich düster, und die Existenzangst wurde meine vertrauteste Bettgenossin.
Inzwischen hielt das Geschäft mit den Motorrädern uns meistens ganz gut über Wasser. Es war lange her, seit ich mich zuletzt dem demütigenden Ritual unterzogen hatte, meine Exfrau zu überreden, ihren Kindern mal für einen Monat das Dach über den Köpfen zu bezahlen.
Daniel setzte sich mir gegenüber an die Wand. Unsere Füße berührten sich fast. Die Garage war klein, und wir hatten beide lange Beine.
»Ich könnte dir helfen, jetzt in den Ferien«, schlug er vor.
»Ferien sind dazu da, um zu tun, was einem Spaß macht.«
»Es würd mir Spaß machen.«
Ich fiel aus allen Wolken. »Was ist mit …« Gott, wie hieß sie doch gleich wieder? »Anette?«
Er runzelte die Stirn. »Reden wir über was anderes, ja?«
»Oh. Tut mir leid.«
Er fuhr sich verlegen über die lange Matte. »Also, was ist jetzt? Wenn du mich helfen lässt, verdien ich mir mein Moped.«
»Bitte, wenn du es so haben willst …«
»Ja.«
»Abgemacht.«
Es hörte nie auf, mich zu verblüffen, dass die Kampfhandlungen zwischen meinem Sohn und mir zum Stillstand gekommen waren. Ich hätte unmöglich sagen können, was dazu geführt hatte, es war einfach so passiert. Wir konnten immer noch nicht besonders gut miteinander reden, aber wir konnten problemlos im selben Raum sein, ohne einen Ton zu sagen, und uns einigermaßen wohl dabei fühlen. Vermutlich konnte die Sache jederzeit wieder kippen, ich machte mir da keine Illusionen. Aber ich war ziemlich sicher, dass er mir nicht auf die Eier gehen würde, wenn wir hier die nächsten Wochen zusammen arbeiteten. Die Vorstellung bereitete mir sogar ein eigentümliches Vergnügen. Ich hatte ihn gern. Viel lieber als früher, musste ich gestehen, ich fand es leichter, je älter er wurde.
»Wo steckt deine Schwester?«
Er hob vielsagend beide Hände. »Drinnen. Sie liest. Heut ist sie besonders zickig. Besser, du lässt sie zufrieden.« Ich nickte, und er sagte, was ich dachte: »So ist sie immer, wenn wir ein Wochenende bei Ilona waren. Diese Besucherei ist Gift für Anna.«
»Ich kann’s nicht ändern.«
Gemeinsames Sorgerecht war das Äußerste gewesen, wozu die Richterin sich hatte breitschlagen lassen. Am liebsten hätte sie es Ilona allein zugesprochen, sie befürchtete, die Kinder würden in der Obhut ihres vorbestraften Vaters verwahrlosen. Zum Glück hatte Ilona kein Interesse. Zum Glück gab sie sich mit dem Alibi-Wochenende pro Monat zufrieden. Und selbst das war ihr oft lästig. Wenn ihr Tennisass zu einem Turnier fuhr, war sie immer dabei und ließ das Wochenende erleichtert sausen.
Das Licht nahm einen schwachen Kupferton an. Der Nachmittag ging zur Neige.
Daniel holte sich eine Cola aus dem Kühlschrank. Light. Daniel lebte so gesund, dass einem glatt schlecht davon werden konnte.
»Jedenfalls, als Ilona mein Zeugnis gesehen hat, ist ihr die Farbe aus dem Gesicht gefallen, aber sie hat eigentlich keinen Ton gesagt. Nur, dass sie mir ein Moped kauft, wenn ich mir die Haare abschneiden lasse.« Er schüttelte ratlos den Kopf. Offenbar bereitete es ihm Unbehagen, dass er die Strategie seiner Mutter nicht durchschaute. Ich erinnerte mich nur zu gut daran, was für ein Gefühl das war, aber ich ging nicht darauf ein.
»Dein Zeugnis war besser, als ich im Winter zu hoffen gewagt hätte. Kein Grund, sich aufzuregen. Eine Fünf kann man sich schließlich immer leisten, oder?«
Er schüttelte den Kopf. »Es gibt eine Menge Leute, die das anders sehen.«
»Tja, bestimmt. Aber rechne lieber nicht damit, dass ich dir Dampf mache. Wenn du einen Physiknobelpreis gewinnen oder ein großverdienendes, nützliches Mitglied der Gesellschaft werden willst, musst du dich schon selbst dazu antreiben.«
»Ja, ja. Ich weiß. Du willst nicht schuld sein, wenn ich irgendwann feststelle, dass ich ein goldenes Kalb anbete.« Ich sah ihn verdutzt an, das war so gar nicht sein Wortschatz.
Er grinste. »Das hast du zu ihr gesagt. Am Telefon. Als ihr euch mal wieder angebrüllt habt.«
»Kann sein.« Und in diesem Fall konnte ich auch gut zu dem stehen, was ich gesagt hatte. Trotzdem plagte mich mal wieder mein Gewissen, weil ich meine väterlichen Pflichten so sträflich vernachlässigte. »Wenn du denkst, dass du was gegen die Fünf in Englisch tun solltest, dann fahr ein paar Wochen zu Sarahs Bruder.«
»Ihr Bruder? Wohnt er in England?«
»In Israel. Aber seine Frau ist in England geboren, und sie sprechen nur Englisch. Sarah meint, wenn du willst, ruft sie ihn an, das wär sicher kein Problem.«
Er dachte darüber nach und sagte eine Weile nichts. Dann fragte er: »Was ist eigentlich mit Sarah? Ich hab sie seit Tagen nicht gesehen.«
Ich winkte mit meiner ölverschmierten Rechten ab. »Reden wir über was anderes, ja.«
»Stimmt was nicht?«
Ich schüttelte den Kopf. Ich hatte kein Bedürfnis, ihm zu sagen, dass meine Freundin im Begriff war, mich für einen geschniegelten, glatt rasierten Versicherungstypen mit Zukunft abzuservieren. Es laut auszusprechen hätte bedeutet, eine Grenze zu überschreiten. Derzeit konnte ich mir noch einreden, das Problem würde vielleicht von selbst verschwinden, wenn ich die Augen nur fest genug zumachte.
Er stand auf und trat auf die Harley zu. Mit ehrfürchtigem Blick strich er über den schwarzen, glänzenden Tank.
Anna erschien am Garagentor. Sie blieb einen Augenblick stehen, bis sie uns im dämmrigen Innern entdeckte. Dann kam sie näher, kauerte sich neben mich an die Wand und legte das Kinn auf die angezogenen Knie.
»Ich wollte Pudding machen, aber die Milch ist angebrannt«, verkündete sie der Welt im Allgemeinen.
Daniel stöhnte. »Klasse, Anna. Ich hab dir gesagt, du sollst die Finger vom Herd lassen, wenn du allein im Haus bist.«
»Lass mich zufrieden«, fauchte sie, so giftig, dass ich sie verwundert ansah.
Ganz im Gegensatz zu ihrem Bruder stand Anna neuerdings auf kurze Haare. Eigenhändig hatte sie sich Anfang des Jahres ihre langen Engelslocken abgeschnitten. Ich hatte mich zu der Tat nicht geäußert, aber ich wurde das Gefühl nicht los, dass sie sich verstümmelte. Ich war einigermaßen sicher, dass ich ihre Motive durchschaute: Sie war es satt, Papis kleiner Liebling zu sein, und sie war es ebenso satt, die einzige Frau im Haus zu sein. Also hatte sie sich darangemacht, sich selbst, mich und den Rest der Welt zu überzeugen, dass sie weder das eine noch das andere war. Sie prügelte sich in der Schule rum, vergraulte ihre Freundinnen und tat alles, was ihr einfiel, um mir das Leben schwer zu machen. Wenn gar nichts anderes half, erpresste sie mich damit, dass sie nichts aß. Sie war gerade mal acht Jahre alt, aber wenn es darum ging, mich fertigzumachen, war sie genauso erfinderisch wie ihre Mutter. Dass ich sie trotzdem nach wie vor anbetete, machte es für uns beide nicht leichter.
»Hast du wenigstens Wasser in den Topf getan?«, fragte Daniel ohne viel Hoffnung.
Sie nickte und fuhr sich mit der Hand über die Stirn, als seien dort immer noch Haare, die es wegzustreichen gelte. Das hatte sie sich noch nicht abgewöhnt. Sie nahm Daniel die Coladose ab und trank.
»Hast du’s ihm erzählt?«
Er zog gereizt die Stirn in Falten. »Nein. Ich hab dir gesagt, das Thema existiert für mich nicht.«
Sie stellte die Dose auf den Boden, drehte sie zwischen den Händen und warf mir von der Seite einen rätselhaften Blick zu.
Angriffslustig und resigniert zugleich.
»Er traut sich nicht, es dir zu sagen. Er hat Angst, du rastest aus.«
Mein Mut sank. Alles in allem wollte ich lieber nicht wissen, was sie wieder getrieben hatten, um ihre Mutter davon zu überzeugen, dass ein Wochenende mit ihnen echt kein Spaß ist.
Ich wappnete mich. »Also?«
»Sie will mit uns in Urlaub fahren. Nach … verdammt, wie heißt das, Daniel?«
»Keine Ahnung. Schon vergessen«, log er.
»Sag doch.«
»Barbados.«
Ich pfiff unwillkürlich vor mich hin. »Tja, Leute, da kann ich nicht mithalten.«
Ich war nicht ganz sicher, welche Art von Reaktion sie von mir erwartet hatten, mehr Entrüstung, vermutlich. Aber ich hatte mich von Anfang an bemüht, all das vor ihnen verborgen zu halten, meine Entrüstung, meinen Zorn, und ich fand, es war auch jetzt besser, wenn sie nichts von meiner Eifersucht ahnten.
»Willst du das etwa zulassen?«, verlangte Daniel zu wissen.
»Keine Ahnung. Ich bin nicht mal sicher, ob ich eine Wahl hab. Du willst nicht, nein?«
»Pah. Von mir aus kann sie sich ihren Schickimicki-Karibiktrip in den …«
»Daniel, es ist deine Mutter, von der wir hier reden. Also bitte.«
Er verdrehte die Augen. »Vorhin hast du gesagt, wir fahren zusammen weg.«
»Das war auch meine Absicht.«
»Aber du hast noch nichts gebucht, oder? Was glaubst du eigentlich, wie wir in den Ferien noch an einen Flug kommen sollen? Du bist so hoffnungslos unorganisiert, ich meine, da ist es echt kein Wunder, dass sie andauernd ihren Willen kriegt, und manchmal, ehrlich, manchmal macht ihr mich krank.«
»Schön, du hast recht, ich bin hoffnungslos unorganisiert. Aber ich sehe nicht, was das mit dieser Sache hier zu tun hat.«
»Wenn du wie normale Leute im Januar für uns gebucht hättest, stünde die Sache überhaupt nicht zur Diskussion.«
Im Januar hatte der Pleitegeier seine Kreise über unseren Köpfen gezogen. Der Winter war immer die Durststrecke fürs Motorradgeschäft.
Daniel hatte offenbar beschlossen zu vergessen, dass ich mir die eisigen Januarnächte als Nachtwächter in einem zugigen Lagerhaus um die Ohren geschlagen hatte. Und ich hatte keine Lust, ihn daran zu erinnern.
»Hat sie denn schon gebucht?«
»Weiß der Henker. Ich fahre sowieso nicht mit.«
»Kann ich vielleicht auch mal meine Meinung sagen?«, fragte Anna.
Ich atmete tief durch. Was für eine Misere. »Und? Wie stehst du dazu?«
»Ich will nicht mit ihr fahren. Und mit dir auch nicht. Ich will hierbleiben und den Ferienkurs bei der DEG mitmachen.«
Sie sah wohl an meinem Gesicht, was ich davon hielt, und verkündete herausfordernd: »Das hab ich dir schon vor Monaten gesagt. Aber du hast es vergessen, stimmt’s?«
»Nein, nein. Nur …« Ich suchte nach einer diplomatischen Formulierung, die nicht verriet, dass ich der chauvinistischen Auffassung war, dass Eishockey kein Mädchensport ist. »Mir ist nicht wohl dabei, das hab ich dir gleich gesagt. Ich find’s gefährlich.«
»Quatsch. Hör mal, ich wollte im Winter schon, und da hast du gesagt, es wär zu teuer. Aber der Sommerkurs kostet nichts, und ich will da mitmachen. Es ist mein Ernst.«
»Ja, das bezweifle ich nicht. Trotzdem …«
Das Telefon klingelte. Daniel stand auf, sah sich suchend um und entdeckte es unter einem Stapel öliger Lappen. Mit einem strafenden Blick in meine Richtung nahm er ab. »Hallo?«
Er lauschte einen Moment, dann reichte er es mir herüber.
»Für dich. Sarah.«
Mein Herz schlug einmal kurz in meiner Kehle. Ich nahm das Telefon. »Goldstein, sieh an.«
»Hättest du vielleicht Lust vorbeizukommen?«
»Ich dachte, du willst zu einer Ausstellungseröffnung. Sag nicht, der Ehrenhof ist schon wieder abgebrannt.«
»Das würde mich nicht wundern. Also ja oder nein?«
Mir ging auf, wie seltsam ihre Stimme klang. Ich schickte meinen Sarkasmus auf die Reservebank. »Ist was mit Tobias?«
»Nein. Ich … Es ist nichts weiter.«
Aber ich spürte, dass das nicht stimmte. »Na schön. Ich komm. Halbe Stunde oder so.«
»Okay.«
Ich drückte die kleine lila Taste und sah Daniel und Anna entschuldigend an. »Das war ein Notruf.«
Sie wechselten einen vielsagenden, genervten Blick.
Ich stand auf und steckte meine Kippen ein. »Ich muss mir die Sache durch den Kopf gehen lassen. Und ich werde mit Ilona reden. Wir entscheiden in den nächsten Tagen, okay?«
Daniel verschränkte die Arme. »Ich hab mich schon entschieden.«
Anna nickte nachdrücklich. »Ich auch.«
Ich seufzte. »Wenn ihr älter werdet, werdet ihr lernen, dass die Dinge selten so einfach sind, wie sie auf den ersten Blick scheinen.«
Vier Hände hoben sich mir abwehrend entgegen. »Keine Sprüche!«
2
Sarah Goldstein war in gewisser Weise das letzte Bindeglied zwischen mir und meinem alten Leben. Sie war als Kollegin zur Bankrevision gekommen, kurz bevor alles zum Teufel ging und Paul ums Leben kam. Als ich im Knast landete, hatte sie mich zusammen mit unserem Chef Dr. Ferwerda rausgeboxt. Beide hatten bei der Bank gekündigt und waren zu einer Versicherung gegangen, beide hatten im Gegensatz zu mir einen nahtlosen Übergang gefunden, denn das Leben geht schließlich weiter, man darf sich nicht gehen lassen und so weiter und so fort. Und Sarah war ohne mit der Wimper zu zucken in Pauls Wohnung gezogen. Warum auch nicht, sie stand schließlich leer. Aber ich hatte sie beinah ein Jahr lang nicht besucht.
Inzwischen ging’s. Ich konnte mich dort aufhalten, sogar eine Nacht dort verbringen, ohne permanent an Paul zu denken. An den brennenden Wagen und sein Gesicht mit dem schiefen Brillengestell. Sarah hatte die Wohnung vollkommen verändert, Pauls eher fade Gemütlichkeit war wagemutigen Farbkombinationen und ihrem erlesenen Geschmack gewichen. Pauls kleines, mit Computerschrott vollgestopftes Arbeitszimmer, wo wir uns meistens aufgehalten hatten, wenn ich dort war, hatte jetzt eine Tapete mit blauen Schmetterlingen und ein Flugzeugmobile am Fenster. Es war Tobias’ Zimmer, das er bewohnte, wenn Sarah ihn gelegentlich übers Wochenende aus seinem Behindertenheim holte, und ich hatte selten Grund, es zu betreten. Pauls zusammengewürfelte Junggesellenküche ohne Herd war durch ein ergonomisch perfektes Einbauwunder in Pastelltönen ersetzt worden, seine nervtötende Wohnzimmerschrankwand durch ein paar spärliche, asiatisch angehauchte Designermöbel. Es war Sarahs Wohnung durch und durch.
Nur im Treppenhaus überfielen mich immer noch hin und wieder höchst unwillkommene Zustände, wenn der Teil meines Gehirns, der einem Paar ausgetretener, karierter Filzpantoffeln entspricht, mir vorgaukelte, ich steige die Stufen rauf, um ihn zu besuchen. Regelmäßig blieb ich dann mitten auf der Treppe stehen, wie geohrfeigt von den Realitäten, eine Hand auf dem Geländer, und rührte mich eine geraume Zeit nicht mehr.
Nicht so an diesem Abend. Ich beeilte mich auf der Treppe, weil ich ihre Stimme im Kopf hatte. Als ich den Schlüssel ins Schloss steckte, machte sie mir auf.
»Danke, Mark.«
»Keine Ursache.«
Sie stand in der kleinen Diele, hatte die Arme gekreuzt und die Hände auf die Schultern gelegt. Sie trug eins von diesen Kleidern, die mich so mühelos in Hochstimmung versetzen konnten, kurz und eng, aus dunkelblauem Leinen, das selbst an Tagen wie diesem kühl aussah. Ihre dunkelrote Löwenmähne war im Nacken zu einem lockeren Knoten aufgesteckt. Sie ließ sich nie ganz bändigen, ein paar Strähnen stahlen sich immer heraus, aber ihre gesamte Erscheinung wirkte distinguiert, ein klein wenig erhaben und auf mich unwiderstehlich.
Ehe ich eine Hand nach ihr ausstrecken konnte, wandte sie sich ab und ging ins Wohnzimmer. Ich folgte ihr, und mein Herz sank. Er war da.
»Hallo, Mark.«
Ich nickte. »Bodo.«
Er saß auf dem filigranen, schwarzen Sofa, hatte die Krawatte gelockert und hielt ein Weinglas in der Hand. Sein Gesichtsausdruck war von Natur aus eher ernst, ein bisschen versonnen vielleicht, und er redete nie viel. Das Katastrophale an diesem Kerl war nämlich das: Er war wirklich sympathisch. Unter anderen Umständen hätte ich ihn wohl gern gemocht.
Er lächelte schwach. »Ziemlich heiß für eine Krisensitzung, was.«
»Hm.«
»Willst du was trinken?«, fragte Sarah.
»Ich geh schon. Setz dich. Rauch dir eine, mach Musik an. Komm, so furchtbar kann es nicht sein.«
Sie schüttelte ungeduldig den Kopf. »Du hast keine Ahnung …«
»Nein. Stimmt.«
Ich ging in die Küche, holte mir ein Bier und machte ihr einen Wodka-Lemon. Weil ich ihr einen Gefallen tun wollte, aber auch, musste ich einräumen, um klarzustellen, dass ich derjenige war, der hier Hausrechte genoss und der wusste, was sie jetzt brauchte. Ich belächelte mich, und die Flaschen beschlugen, kaum, dass ich sie aus dem Kühlschrank nahm.
Ich stellte ihren Cocktail vor sie auf den Tisch und setzte mich neben sie auf den Boden. »Also?«
Sie schwiegen beide, ihre Augen schienen den cremeweißen Teppichboden nach nicht vorhandenen Mustern abzusuchen.
Ich streckte die Beine aus und trank von meinem Bier. Es heißt ja allgemein, ich sei geduldig.
Schließlich gab sie sich einen sichtlichen Ruck. »Es sieht so aus, als hätte ich so ungefähr zwei Millionen in den Sand gesetzt.«
Ich kannte mich in ihrem neuen Geschäft nicht gut genug aus, um einzuschätzen, ob das ein kleines Missgeschick oder eine Katastrophe war. Aber für meinen Geschmack klang es eher nach Katastrophe.
»Dr. Ferwerda hat gesagt, ich hab mir nichts vorzuwerfen«, fügte sie hinzu. Es klang sarkastisch.
Ich wusste, dass diese Bemerkung ebenso gut eine Schuldzuweisung wie ein Trost sein konnte. Er war schließlich lange genug mein Chef gewesen, ich kannte seine Tour ganz genau.
»Das scheint dich wenig zu trösten.«
Sie winkte ärgerlich ab. »Das Verrückte ist, ich kann mir einfach nicht vorstellen, was ich hätte anders machen können.«
»Wie wär’s, wenn du mir erzählst, was denn eigentlich passiert ist?«
Sie verknotete nervös die Finger ineinander. »Die Abteilung Sachversicherungen kam vor zwei Wochen mit der Geschichte an. Jemand wollte eine Warenlieferung Rostschutzfarben und Speziallacke gegen Diebstahl, Feuer und Vandalismus versichern. Erst mal für dreißig Tage, bis dahin sollte die Ladung planmäßig verschifft sein.«
»Und weiter?«
Sie trank einen Schluck, und als sie nicht gleich antwortete, fuhr Bodo fort: »Den Leuten in der Sachversicherung war das Ding nicht geheuer. Der potenzielle Kunde war ein unbeschriebenes Blatt, und es ging schließlich um viel Geld, kurz und gut, sie riefen Ferwerda an, ob er die Sache durchleuchten könnte. Er setzte Sarah darauf an. Sie hat das Lager und die Ware besichtigt. Die Papiere gesehen. Den Kunden gesprochen. Erkundigungen eingezogen. Er schien in Ordnung, die Sicherheitsvorkehrungen schienen in Ordnung, sie gab grünes Licht. Daraufhin hat die Secura die Ware versichert. Der Versicherungsschutz begann am siebten um null Uhr.« Er legte eine kleine Kunstpause ein und warf Sarah einen ängstlichen Blick zu. Aber sie machte alles in allem nicht den Eindruck, als wolle sie zusammenbrechen. Sie wirkte eher wütend.
»Am achten, so gegen ein Uhr dreißig, ging das ganze Lager in Rauch auf.«
»Vorletzte Nacht? Lag das Lager zufällig im Neusser Hafen?«
Sie zog die Brauen hoch. »Erzähl mir nicht, du bist unter die Zeitungsleser gegangen, Malecki.«
»Bin ich nicht.« Aber ich hatte den Widerschein eines großen Feuers gesehen, als ich nachts aufgewacht war.
»Den ganzen Sonntag hat die Feuerwehr die Bevölkerung im Süden Düsseldorfs vor giftigen Dämpfen gewarnt«, erklärte Bodo ernst. Und ich war ganz froh, dass meine Kinder das Wochenende bei Ilona in Grafenberg verbracht hatten und ich allein in den Genuss dieser Dämpfe gekommen war.
Ich wandte meine Gedanken wieder ihrem Problem zu. »Also kaum vierundzwanzig Stunden nach Beginn des Versicherungsschutzes ist der Versicherungsfall eingetreten.« Ich fand ihren Kunden reichlich plump. »Was meinen die Experten der Feuerwehr?«
Sarah schüttelte den Kopf. »Sie haben die Untersuchung noch nicht abgeschlossen. Aber inoffiziell haben sie mir zu verstehen gegeben, dass keine Spuren von Brandbeschleunigern gefunden wurden, und wenn’s ein getürkter Kurzschluss war, wird niemand das jemals beweisen.«
»Und was sagt die Staatsanwaltschaft?«
»Mehr Glück beim nächsten Mal.«
Es war einen Moment still.
Ich ließ mir die Geschichte auf der Zunge zergehen. Neutral gesehen, war ich geneigt, die Meinung des Staatsanwalts zu teilen. Jemand hatte eine Warenladung versichert, und der Versicherungsfall war eingetreten. So weit kein Drama. Genau dafür sind Versicherungen schließlich da. Und die Secura war ein großes Unternehmen mit jährlich steigenden Gewinnen, zwei Millionen bezahlten die locker aus der Portokasse. In einem stillen Winkel meines Anarchistenherzens gönnte ich ihnen den Verlust. Vier Wochen hatte ich für sie gearbeitet, nachdem ich auf Bewährung rauskam. Um Sarah einen Gefallen zu tun, um Ferwerda einen Gefallen zu tun, um mein Leben wieder in die Hand zu nehmen. Aber es ging nicht. Ich konnte diese Arbeit einfach nicht machen. Krumme Versicherungsfälle aufzuklären hatte einfach zu viel Ähnlichkeit damit, dubiosen Bankgeschäften nachzugehen. Das hatte ich über zehn Jahre gemacht, sogar einigermaßen erfolgreich, aber letztlich hatte es meine Ehe zerrüttet, meinen besten Freund das Leben gekostet und mich um ein Haar auf unabsehbare Zeit ins Gefängnis gebracht. Und ich hatte meine Lektion gelernt. Also tat ich mein Bestes, um die Sache so schnell wie möglich hinter mich zu bringen. Ich kam betrunken und zu spät zur Arbeit und benahm mich so schlecht, wie ich nur konnte. Nach vier Wochen setzten sie mich vor die Tür. Wir trennten uns, wie sie es ausdrückten, in gegenseitigem Einvernehmen. Das war insoweit richtig, als beide Seiten gleichermaßen erleichtert waren, insofern falsch, als Ferwerda und ich uns anlässlich unserer letzten Unterredung so verkrachten, dass wir seither kein Wort mehr gewechselt hatten. Mit ein paar Beulen war ich endlich aus seinem väterlichen Schatten gekrochen. Dieser Meinung war ich jedenfalls heute. An dem Tag damals war ich allerdings so außer mir, dass ich mein Motorrad vor einen soliden Brückenpfeiler fuhr. Versehentlich natürlich. Der Schutzengel aller Trunkenbolde legte sich ins Zeug: Ich stand fast ohne einen Kratzer wieder auf, und niemand hatte zugesehen. Ich konnte die Spuren beseitigen, ehe irgendwelche Freunde und Helfer aufkreuzten. Die Trümmer meiner Goldwing brachte ich in meine Garage, holte mir auf dem Schrottplatz, was ich brauchte, und erweckte sie zu neuem Leben. So war ich in meine neue Existenz geschlittert.
Sarah Goldstein war hingegen immer noch auf Karrierekurs. Und sie hasste es, wenn damit irgendetwas schieflief. Nicht nur, wie sie sich selbst und mir immer einzureden versuchte, weil sie für ihr kostspieliges, behindertes Kind sorgen musste, sondern vor allem, weil sie sich davor fürchtete zu versagen. Erwartungen zu enttäuschen.
Sie sah mich an, und ihr Blick war beinah feindselig. »Verflucht, Mark, sag doch was.«
Ja, los, sag was, Mark. Ignoriere die Warnung deiner Instinkte und gleite in die alten Denkmuster zurück. Du kannst es bestimmt noch. Es braucht nur einen winzigen Schubs … Ich rieb mir die Nasenwurzel. »Das Lagerhaus. Bist du noch mal da gewesen?«
»Gestern Morgen, gleich, nachdem ich davon erfahren hatte. Es ist alles verbrannt. Die Rauchmelder haben einwandfrei funktioniert, aber als die Feuerwehr kam, stand schon alles in Flammen.«
»Tja. Bei Lacken und Farben kann man auf Brandbeschleuniger getrost verzichten. Man kann auch riskieren, die Brandmeldeanlage eingeschaltet zu lassen. Das Zeug brennt schneller als Benzin.«
»Du kennst dich mit so was aus?«, fragte Bodo.
Ich hob kurz die Schultern. »Ich lackiere hin und wieder Motorräder. Und der Typ, der mir dazu die Lackiererei in seiner Werkstatt zur Verfügung stellt, hat mir ein paar wilde Geschichten erzählt. Er wollte mir klarmachen, dass das eine Sache ist, bei der man wirklich besser nicht raucht.« Ich dachte wieder über ihr Farblager nach. »Und keiner hat was gehört und gesehen?«
»Nein. Es war ja mitten in der Nacht und Wochenende. Ein Nachtwächter einer Spedition auf dem Nachbargrundstück hat die Feuerwehr angerufen, als er durch ein Fenster die Flammen sah, aber da waren sie schon unterwegs.«
»Wem gehörte das Lagerhaus?«
»Einer Reederei. Und bevor du fragst, das Gebäude selbst war nicht bei uns versichert.«
»Wohin sollten die Farben verschifft werden?«
»Nach Ägypten.«
»Und euer Kunde? Die Herstellerfirma?«
»Nein, ein Zwischenhändler.«
Ich sah sie abwartend an und versuchte, nicht zu zeigen, was meine Vorurteile über Zwischenhändler besagten, dass sie sich in meiner Vorstellung nämlich ausschließlich in den Grauzonen zwischen Gesetzen und Märkten bewegten, dass sie die überflüssigsten Kreaturen der Schöpfung waren, die nichts weiter taten, als Käufer und Verkäufer zusammenzubringen, und die Preise in die Höhe trieben, damit sie eine umso fettere Provision kassieren konnten. Und sie kassierten nicht schlecht. Ohne je einen Finger krumm zu machen.
Sie las mal wieder mühelos meine Gedanken. »Nicht so, wie du denkst. Er vermittelt Handelsgeschäfte zwischen EU-Staaten und dem Mittleren Osten, aber er tritt oft selber als Käufer oder Verkäufer ein. Er hat Kapital. Der Lagerbestand gehörte seiner Firma.«
Im- und Export, dachte ich ironisch, aber ich sah, dass sie drauf und dran war, ihren Zorn an mir auszulassen, und auch in diesem Fall fand ich Brandbeschleuniger überflüssig und sagte deshalb nichts.
»Er ist Araber«, klärte Bodo mich auf. »Hasan Rashid.«
Sarah wollte einen Schluck trinken, aber ihre zittrigen Finger stießen das Glas um, Wodka-Lemon ergoss sich über den Tisch, tröpfelte auf den Teppichboden, und die Zitronenscheibe rollte wie ein Hula-Hoop-Reifen unters Sofa.
Sie schlug sich mit der Faust aufs Bein. »Ach, Scheiße!«
Ich stand auf, holte ein Tuch aus der Küche und versuchte, die Flüssigkeit aus dem flauschigen Velours aufzusaugen.
»Reg dich nicht auf. Hätte Rotwein sein können.« Sie lächelte angestrengt, Bodo zückte ein lupenreines Taschentuch und wischte über die gläserne Tischplatte. Ich sah ihn an und erwischte ihn dabei, dass er mich neugierig und vielleicht abschätzend betrachtete. Er hatte mir gegenüber noch nie den geringsten Unwillen oder gar Aggression gezeigt. Er war ein zurückhaltender Typ. Blond, sportlich, und er hatte eine Art, langsam und bedächtig zu reden, die Vertrauen erweckte. Solide wie eine hundertjährige Eiche. Ein Typ, auf den man sich verlassen konnte. Und ich war sicher, er kannte seine Vorzüge. Vermutlich hatte er sich ausgerechnet, dass er nur lange genug ausharren musste; irgendwann würde sie endgültig genug von mir haben. Es konnte nur eine Frage der Zeit sein. Aber jetzt erkannte ich, dass es ihm weitaus lieber gewesen wäre, sie hätte mich nicht angerufen. Ich gehörte nicht zur Firma, die Angelegenheit ging mich nichts an, und außerdem, ging mir auf, wollte er gern der unerschrockene Held sein und den Drachen mit eigener Hand erschlagen, der die Jungfrau bedrohte. Ich war verblüfft. Wenn er wirklich noch nicht kapiert hatte, dass diese Jungfrau jeden zum Teufel jagte, der ihr ihre Drachen abspenstig machen wollte, dann hatte ich von ihm vielleicht weniger zu fürchten, als ich angenommen hatte.
Aber er raubte mir meine Illusionen gleich wieder. Er steckte sein klebriges Taschentuch ein, trank seinen Wein aus und beugte seinen langen Oberkörper zu ihr herab, um sie auf die Wange zu küssen. »Ich muss los. Sei nicht so geknickt, Sarah. Wenn irgendwer sich diesen Flop leisten konnte, dann du. Und außerdem wär dir glatt zuzutrauen, dass du dem Drecksack die Geschichte nachweist.«
Sie seufzte, aber sie war besänftigt. »Dafür brauchte ich ein Wunder. Danke, Bodo.«
»Ich find schon hinaus. Macht euch einen schönen Abend.«
Er lächelte mir zu, und ich lächelte unwillkürlich zurück.
Wenn ich ihn vor mir sah, fand ich mich immer völlig entwaffnet. Es war nachts, wenn ich allein war mit all meinen Gespenstern, dass ich ihn hasste und ihm die Pest an den Hals wünschte.
Als die Tür ins Schloss fiel, nahm ich ihre Hand. »Er hat recht, weißt du. Es ist nur Geld. Und es ist keine solche Katastrophe. Du kannst nicht jedes Mal denken, es sei deine Schuld, wenn die Secura zahlen muss.«
»Aber Ferwerda denkt, dass es meine Schuld ist. Ich weiß es.«
»Er ist zu gerissen, um weniger von seinen Leuten zu erwarten als sie selbst. Das wäre Kapazitätsverschwendung.«
Sie nickte unwillig, befreite ihre Hand aus meinem Griff und zündete sich eine Zigarette an. »Trotzdem. Nächsten Monat wird in der Transportversicherung eine Abteilungsleiterstelle frei. Ich hatte mir echte Chancen ausgerechnet. Aber nach diesem Fiasko …«
»Mit welchem Recht könnten sie dir einen Vorwurf machen? Du hast nichts versäumt. Weiß der Teufel, vielleicht war’s ein Kurzschluss. Einfach Pech. Das ist immerhin denkbar.«
Sie hob die Schultern. »Es spielt letzten Endes keine Rolle, was den Brand verursacht hat. Entscheidend ist, dass alle denken, es sei Brandstiftung und Versicherungsbetrug. Und ich habe es nicht verhindert. Nur das zählt.«
Sie war jetzt ruhiger. Es wäre ein schmeichelhafter Gedanke gewesen zu glauben, dass ich das bewerkstelligt hatte. Aber so war es nicht. Sie verlor selten die Ruhe, und wenn es passierte, fand sie sie immer schnell wieder, in sich selbst. Nicht in mir. Für gewöhnlich machte sie bei mir das Krisenmanagement, nicht umgekehrt. Vielleicht deshalb, vielleicht, weil mir so sehr davor graute, dass sie mir durch die Finger schlüpfte, sprang ich mit weit geöffneten Augen ins tiefe, dunkle Wasser.
»Erzähl mir, was du über diesen Lagerbestand weißt. Wie er aussah. Sag mir alles, was dir aufgefallen ist. Mach die Augen zu und versuch, dich zu erinnern.«
Sie sah mich kopfschüttelnd an, stand auf und geisterte ein paar Minuten herum. Sie legte Tory Amos auf, leerte den Aschenbecher, holte sich ein Glas Wasser, schloss die Lamellen an der Balkontür. Dann setzte sie sich wieder zu mir und erhob keine Einwände, als ich mir einen ihrer Füße schnappte und ihn auf mein Bein legte.
»Ich bin nicht sicher, ob ich will, dass du dich in diese Sache reinhängst, Mark.«
Ich war auch nicht sicher, ob ich das wollte. »Die Entscheidung liegt allein bei dir.«
»Es ist hoffnungslos. Wir sollten unsere Zeit nicht damit verschwenden, auf einen toten Gaul einzuprügeln.«
»Da hast du zweifellos recht.«
»Herrgott noch mal, sag nicht zu allem Ja und Amen!«
»Was sagt denn der weise Dr. Ferwerda zu der Frage, was du unternehmen sollst?«
»Er sagt, ich soll nicht mehr dran denken. Berufsrisiko, man könne nicht immer gewinnen, blablabla.«
»Er muss es wissen. Ich erinnere mich an ein paar Gelegenheiten, wo sie ihn und mich an der Nase herumgeführt haben. Und wir haben’s genau gewusst, aber wir konnten nichts machen, weil wir es nicht beweisen konnten. Manchmal sind die Indianer eben schlauer als die Kavallerie. Und was diesen Fall hier betrifft, gilt wohl die Regel, dass der einfachste Plan immer der genialste ist.«
Sie stützte das Kinn auf die Faust. »Trotzdem. Ich würd mir das Schwein zu gerne schnappen.«
Hatte ich wirklich gehofft, sie würde mich wieder vom Haken lassen? Ich verkniff mir eine schmerzliche Grimasse. »Dann lass uns mit dem anfangen, was wir haben. Gib was zu schreiben, und wir stellen die Fakten zusammen.«
Sie angelte einen Block und einen Filzschreiber aus einer Schublade und reichte sie mir mit ironisch erhobenen Brauen. »Glaub lieber nicht, das hier wäre eine Untersuchung unter deiner Leitung und du könntest mich wie früher rumkommandieren und mir die Handlangerjobs aufhalsen.«
Ich ließ die Hand mit dem Stift sinken. »Das hab ich nie getan!«
Sie verzog spöttisch den Mund. »Los, bleiben wir bei den Fakten …«
Als ich auf die Straße kam, hatte ich einen staubigen Geschmack im Mund. Die Platten auf dem Bürgersteig waren von der Sonne aufgeheizt, ich konnte es durch die Schuhsohlen spüren. Die Nachtluft war wie heißer Brei. In der Straßenbahn waren alle Fenster offen, trotzdem konnte man mühelos riechen, dass während dieses langen Tages Hunderte schwitzender Menschen darin gefahren waren. Ich dachte oft, dass es eine hinterhältige Tücke des Schicksals war, dass ich eine so gute Nase hatte.
Ich fuhr bis zum Jan-Wellem-Platz und ging zu Fuß in die Altstadt.
»Hallo, Osman.«
»’n Abend, Mark.«
»Dein Vater nicht da?«
»Doch, oben. Er kommt gleich.« Er nahm die Hände aus dem Spülbecken. »Soll ich andere Musik machen?«
»Nicht wegen mir.«
»Du kannst ruhig zugeben, dass es sich für dich wie Gedudel anhört.«
»Stimmt. Aber manchmal hab ich arabisches Gedudel ganz gern.« Es war beruhigend.
»Willst du was trinken?«
Ich nickte, und er schenkte mir einen Bourbon ein.
Ich ließ mich auf meinem Hocker nieder. »Du wirst ein ebenso guter Wirt wie dein Vater.«
Er grinste und feuerte das Handtuch neben die Spüle. »Scheiß drauf. Hast du was zu rauchen für mich, Mark?«
»Junge, das hab ich nicht gehört.«
Er hüstelte spöttisch und machte Anstalten, durch die Tür hinter der Theke zu verschwinden. »Komm nicht auf die Idee, mich zu fragen, wenn du mal auf dem Trockenen sitzt.«
»Das könnt mir im Traum nicht einfallen. Gibt’s Schafskäseröllchen?«
»Klar. Ich bring dir welche.«
Er war ein netter Junge. Seit er achtzehn war, half er seinem Vater gelegentlich in der Kneipe und verschaffte ihm ein paar freie Stunden, obwohl er nichts von der Kneipe hielt. Er war nicht mehr so verbissen wie noch vor zwei Jahren, er war auch kein halbstarker Angeber geworden. Und er regte sich auch nicht mehr auf, wenn seine Schwester geschminkt zur Schule ging. Ich fand, er war abgeklärt für seine Jahre.
Tarik kam mit einem Teller fingerdicker, knuspriger Teigröllchen und stellte sie vor mich hin.
»Sie sagt, wenn du das Zeug weiter so frisst, wirst du fett.«
»Schön. Ich werd mich vorsehen.« Aber das war nur so dahergeredet. Ich war süchtig nach Schafskäseröllchen. Ich schloss die Augen und biss die Hälfte von dem ersten ab.
Tarik machte die Runde an den vier, fünf Tischen, die besetzt waren, kam mit leeren Gläsern zurück, zapfte ein paar Biere an und warf mir einen eulenhaften Blick zu. »Du bist nicht in Form.«
»Kann schon sein.«
»Lass mich raten. Sie hat schon wieder nicht angerufen. Junge, wenn du meinen Rat willst, stellst du sie ein paar Wochen kalt. Dann kommt sie schon von alleine drauf, was sie will.«
»Doch, doch, sie hat angerufen.«
»Also was ist es dann?«
Ich zündete mir eine Zigarette an und drehte meinen Deckel zwischen den Fingern der Linken. »Ilona will mit den Kindern in Urlaub fahren.«
»Und? Als sie sich nicht um sie gekümmert hat, hat es dir auch nicht gepasst.«
»Nein. Mir kann man’s einfach nicht recht machen.«
»So ist es. Was sagen die Kinder dazu?«
»Sie haben keinerlei Interesse.«
»Und das freut dich, ja?«
»Sag mal, für wie runtergekommen hältst du mich, he?«
»Damit hat es nichts zu tun. Es wäre nur natürlich.«
»Nein, es freut mich nicht. Wenn man’s mal genau betrachtet, ist es jammerschade. Und das Letzte, was mir fehlt, ist ein Familienkrach.«
Er nickte mitfühlend. Manchmal fragte ich mich, wie viele Typen außer mir noch ihren Schutt bei ihm abluden, wie er das aushielt, sich ewig all die Sorgen und Kümmernisse anzuhören, ob er trotzdem oder gerade deswegen so heiter und gelassen war.
»Sag mal, kennst du einen Hasan Rashid?«
Er schien einen Moment nachzudenken und schüttelte dann den Kopf. »Nein. Nicht einen. Drei.«
»Der, den ich meine, ist Geschäftsmann und hat ein Büro am Wehrhahn.«
Er zeigte keine Regung. Er nahm sein Tablett wieder auf, lieferte seine Biere ab, blieb hier und da stehen und redete ein paar Takte mit den Gästen. Als er wiederkam, murmelte er: »Was hast du zu schaffen mit diesem Hasan Rashid?«
»Noch nichts.«
»Dann lass es dabei.«
»Warum?«
Er machte ein finsteres Gesicht und alles in allem den Eindruck, als wolle er sich zu dem Thema nicht weiter äußern. Ich nutzte die Stille, um mein letztes Röllchen zu vertilgen. Schließlich verschränkte er die Arme und zog seine buschigen Brauen zusammen.
»Ich höre dich noch sagen, dass du nie wieder mit solchen Geschichten zu tun haben willst. Nie wieder. Du hast hier auf diesem Hocker gesessen und jeden heiligen Eid darauf geschworen.«
»Es war auch mein heiliger Ernst. Ich glaube nicht, dass Rashid zu ›solchen Geschichten‹ zählt. Wie ich höre, ist er ein angesehener Geschäftsmann.«
»Oh, sicher.«
»Tarik, verschon mich mit deiner Orakelnummer und klär mich auf, wie war’s.«
»Er ist aus Katar.«
»Nie gehört.«
»Ein Emirat. Sehr reich.«
»Öl?«
»Klar doch. Hasan Rashid hat einen Vetter, der ist Wirtschaftsattaché bei der katarischen Botschaft.«
»Meine Güte, was du alles weißt. Und?«
»Er kommt aus einer sehr einflussreichen Familie. Aber irgendwas hat er angestellt, und sie haben ihn verstoßen.«
»Sag mal, was erzählst du mir da?«
Er nickte nachdrücklich. »Seine Familie gehört zu dem erlesenen Kreis, der das Land regiert. Unter normalen Umständen hätte er es nicht nötig, hierherzukommen und Geschäfte zu machen. Aber sie haben sich von ihm distanziert, haben ihm vermutlich ein bisschen Geld gegeben und ihn weggeschickt.«
»Und was für Geschäfte macht er?«
»Er kauft. Er verkauft. Immer die richtige Ware zum richtigen Zeitpunkt.«
»Welche Waren zum Beispiel?«
Tarik hob vielsagend die Schultern.
»Öl?«
»Bestimmt.«
»Stinger-Raketen?«
Tariks Lider waren halb geschlossen. »Möglich. Und Teppiche und Edelmetalle und Mädchen und Rohopium, um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung. Wenn du ihn siehst, wirst du sagen, er ist ein wirklich netter Kerl. Sehr sympathisch. Aber wenn du ihm die Hand gibst, solltest du anschließend nachzählen, ob noch alle Finger dran sind.«
3
Daniel hielt Wort. Am Montag der ersten Ferienwoche half er mir, die Harley fertig zu machen, und brachte sie auf Hochglanz. Er war weder bockig noch besonders genervt und tat meistens kommentarlos, was ich ihm sagte. Das war ich nun wirklich nicht gewöhnt, normalerweise ließ er sich von mir nämlich rein gar nichts sagen, ohne nicht wenigstens seine Gegenargumente vorzubringen. Auf »Daniel, du bist dran mit Spülen«, hörte ich in der Regel »Wann lässt du die verdammte Spülmaschine reparieren?«, auf »Daniel, ich möchte, dass du in der Woche abends um elf zu Hause bist«, konterte er: »Soll Anna das überwachen, oder wirst du extra dafür anreisen?« Aber bei dieser Sache hier war endlich mal klar, wer der Boss war. Er hatte offenbar wirklich die Absicht, die Angelegenheit als Ferienjob anzusehen, der ihn ans Ziel seiner Träume bringen würde. Er redete schon seit Ewigkeiten von diesem Moped und hatte den Führerschein aus der eigenen Tasche bezahlt.
»Das war’s, Daniel. Ich denke, sie ist fertig.« Voller Stolz betrachteten wir unser Werk.
»Und wie geht’s jetzt weiter?«
»Morgen bringen wir sie zu Roland in die Werkstatt und lassen sie durchmessen. Wenn sie okay ist, bring ich sie durch den TÜV. Und dann setzen wir sie in die Zeitung.«
»Was heißt durchmessen? Die Leistung?«
»Nein, nein, den Rahmen. Sie darf nicht aus der Spur sein, sonst ist sie lebensgefährlich.«
»Warum lässt du sie nicht messen, bevor du die ganze Arbeit und das Geld reinsteckst?«
»Tu ich. Aber ehe ich sie verkaufe, lass ich sie noch mal messen, ich hab sie ja ganz auseinandergenommen. Sicher ist sicher.«
Er nickte zweimal kurz. Das hatte er schon als kleiner Junge gemacht, wenn ich eine Sache endlich zu seiner Zufriedenheit erklärt hatte.
»Und warum machen wir das erst morgen? Es ist grad mal Mittag.«
»Weil ich jetzt was anderes vorhabe.«
Er grinste. »Cooler Job. Mein erster Arbeitstag hat keine vier Stunden gedauert.«
»Ich bin vermutlich bis heute Nachmittag unterwegs. Würdest du Anna was zu essen machen?«
Sein Ausdruck verdüsterte sich. »Ich wusste, die Sache hat einen Haken.«
»Ich würd sie ja mitnehmen, aber …«
»Lass mal. Schon okay.« Wenn es um seine Schwester ging, konnte er grenzenlos großmütig sein.
»Danke.« Ich klopfte ihm nicht die Schulter. Das hasste er genauso wie ich.
Das Tennisass machte mir die Tür auf. Er trug weiße Shorts und ein Handtuch um den Hals. Ich hatte ihn noch nie ohne Handtuch um den Hals gesehen. Ich fragte mich, ob es da festgewachsen war.
»Ach, du bist’s.« Er war nicht besonders angetan. Aber das verlangte ja auch keiner. Ich fand ihn genauso zum Kotzen wie er mich.
»Ist Ilona da?«
Er nickte. »Im Garten.«
»Kann ich reinkommen?«
»Bitte.«
Er ließ mich in der Diele stehen und verschwand mit unbekanntem Ziel auf der Treppe. Es war ein fades, kleines Reihenhaus. Er hatte nie zu der auserlesenen Schar gehört, die mit dem Tennis das große Geld machten. Er verstand es lediglich, den Anschein zu erwecken. Vermutlich musste man Ilona zugutehalten, dass sie bei ihm geblieben war, nachdem sie seine Masche durchschaut hatte. Und sie kamen ja scheinbar ganz gut zurecht, wenn es in den Ferien nach Barbados gehen sollte. Sie arbeitete auch wieder, bei irgendeiner Unternehmensberatung.
Trotzdem war sie an diesem Dienstagmittag zu Hause, hockte zwischen ihren üppig blühenden Rosenbüschen und schnitt daran herum. Der kleine Garten war wie ein Stück vom Paradies.
Darauf verstand sie sich wirklich.
Sie bemerkte mich nicht gleich, und ich konnte sie einen Moment mit Muße betrachten. Ich hatte mich immer noch nicht daran gewöhnt, sie wiederzusehen. Unter den geänderten Verhältnissen. Es war verrückt, ich hätte für nichts in der Welt je wieder mit ihr zusammenleben wollen, und die Vorstellung, was sie mit ihrem Tennis-Hansel im Bett trieb, ließ mich völlig kalt, während mir schon die Galle überkochte, wenn ich nur daran dachte, dass Sarah mit diesem verfluchten Bodo im selben Büro saß. Aber Ilona war über zwölf Jahre meine Frau gewesen, ich hatte sie irgendwann mal wirklich geliebt, und ich hatte geglaubt, der Himmel stürzt ein, als sie mich verließ. Ein ganz schwacher Widerhall all dieser Empfindungen war jedes Mal spürbar, wenn ich sie sah. Als sähe man ein Urlaubsfoto und erinnere sich plötzlich an den Geruch von Meer und Sonne.
Sie hob den Kopf und erschrak. »Mark!«
Ich versuchte ein unverfängliches Lächeln. »Hallo.«
Sie stand auf und klopfte Erde von ihrer Jeans. Ich hatte sie seit Ewigkeiten nicht ungeschminkt gesehen.
»Du siehst toll aus.«
»Das sagst du jedes Mal.«
»Vermutlich, weil es jedes Mal so ist.«
»Wann wirst du lernen, dass deine Komplimente mir auf die Nerven gehen?«
»Wann wirst du lernen, dass mir das scheißegal ist?«
»Möchtest du was trinken?«
»Wenn du um diese Zeit schon Bier ausschenkst, gern.«
Sie setzte eine säuerliche Miene auf, die mir unglaublich vertraut war. Wenn man’s mal genau betrachtete, hatte ich sie während des letzten Jahres unserer Ehe nie anders gesehen. Was vermutlich daran lag, dass ich in diesem Jahr eigentlich permanent betrunken war.
Sie verschwand im Haus, und ich gönnte mir einen ungestörten Blick auf ihren kleinen, runden Hintern. Sie war immer zierlich geblieben, trotz der beiden Schwangerschaften.
Sie brachte mir eine Flasche warmes Alt. Das fiel eindeutig in die Kategorie psychologische Kriegführung. Ich bedankte mich artig wie ein gut dressierter Exmann und trank, als wäre nichts.
»Ich nehme an, du bist gekommen, um dich bitterlich zu beschweren«, mutmaßte sie.
Ich dachte einen Moment nach. Wenn es irgendwie möglich war, wollte ich diese Sache über die Bühne bringen, ohne dass es eine Szene gab. »Wie viel liegt dir wirklich an diesem Urlaub mit den Kindern?«
Das war der falsche Knopf. Sie lief rot an. »Das sieht dir ähnlich! Du mit deiner beschissenen Überheblichkeit! Mir liegt viel daran, verstehst du. Du hast sie mir total entfremdet, und ich will eine Chance, ihnen wieder näherzukommen.«
»Das stimmt nicht. Ich hab sie dir nicht entfremdet. Wenn es passiert ist, dann ohne mein Zutun.«
»O ja. Jetzt kommt wieder die Nummer von der Rabenmutter. Ich bin gegangen und hab mich nicht um sie gekümmert, und dann hab ich auch noch die Unverfrorenheit besessen, in Kalifornien zu sein, als du im Knast warst. Wirklich, wie rücksichtslos von mir. Davon, dass ich fliehen musste, dass es für mich praktisch ums nackte Überleben ging, wird nicht geredet.«
»Hör doch auf. Wen soll das heute noch interessieren? Jedes Mal kommst du mit denselben Schoten. Vermutlich, weil du dir selber Vorwürfe machst, dass du sie damals einfach hast hängen lassen ohne ein Wort. Wenn es so ist, sieh zu, wie du damit klarkommst, aber lass mich damit zufrieden.«
Sie sah mich mit halbgeschlossenen Augen an, beinah hasserfüllt. »Was bist du doch für eine erbärmliche Kreatur, Mark. Wenn du nur ein einziges Mal den Mut hättest, über dich selber nachzudenken, wüsstest du, was ich meine. Aber dazu bist du viel zu feige. Und darum trinkst du.«
Ihre Worte trafen mich weniger als die Erkenntnis, dass wir uns wirklich ganz und gar fremd geworden waren. Alles, was von mir in ihrem Kopf übrig geblieben war, war ein Klischee. Aber bitte, wenn sie es so haben wollte, war es ihr von Herzen gegönnt. Ich konnte ihr nur wünschen, dass sie niemals durch ein solches Fegefeuer der Selbsterkenntnis gehen musste wie ich.
Ich stellte die Bierflasche auf den Tisch. »Es ist nicht so schlimm mit mir, wie du glaubst, weißt du. Jedenfalls bin ich noch nicht so weit, dass ich Brennspiritus oder pisswarmes Altbier trinke.«
Sie zog eine verächtliche Grimasse. »Sag, wozu du gekommen bist.«
»Um dich zu bitten, es nicht zu tun.«
»Du bist so diplomatisch im Vortragen deiner Bitten wie eh und je.«
»Ja.«
»Warum nicht? Es sind meine Kinder so wie deine, und ich habe das Sorgerecht genau wie du.«
»Stimmt. Nur aus diesen beiden Gründen bin ich hier, um dich zu bitten.«
»Spar dir die Mühe.«
»Aber was ist mit ihren eigenen Wünschen? Sie haben schon Pläne für die Ferien gemacht.«
Sie hob kurz die Schultern. »Das Leben steckt voller Frustrationen. Sie können noch nicht übersehen, was gut für sie ist und was nicht.«
Ich rang eisern um Beherrschung. Aber es war hart, denn sie hatte so ganz offensichtlich keine Ahnung, wovon sie redete. Ich lehnte mich in ihrem dick gepolsterten Terrassenstuhl zurück und zündete mir eine Zigarette an. »Und wie kommst du auf den Gedanken, du seiest gerade jetzt gut für sie?«
»Weil ich jetzt so weit bin, dass ich mich ihnen widmen kann, ohne meine Gefühle für sie mit denen für dich durcheinanderzubringen.« Sie sah einen Augenblick auf ihre erdverschmierten Hände. »Sie bedeuten mir viel.«
»Ja, ich weiß.« Daran hatte ich nie gezweifelt. Dafür kannte ich sie zu gut. Das Problem war, dass Daniel und Anna sie längst nicht so gut kannten wie ich und es daher für sie viel schwieriger war, sie einzuschätzen.
»Es wäre besser gewesen, du hättest vorher mit mir darüber geredet, weißt du.«
Sie sah wieder auf. Und wenn ich eben geglaubt hatte, ein erstes Anzeichen von Einsicht in ihrer Stimme zu hören, dann hatte ich mich entweder geirrt, oder sie hatte sich blitzschnell anders besonnen. »Ich wüsste wirklich nicht, warum ich mit dir über diese Sache hätte reden sollen. Es geht dich nichts an.«
»Doch, Ilona. Es geht mich was an. Alles, was du dir Segensreiches für sie ausdenkst, ist von größtem Interesse für mich.«
Sie stützte die Hände auf die Armlehnen und beugte sich vor. »Hör mal, wenn du glaubst, du kannst sie gegen mich beeinflussen und verhindern, dass ich sie mit in Urlaub nehme, dann hole ich sie für das nächste halbe Jahr zu mir. Du könntest nicht das Geringste dagegen tun. Wenn’s sein muss, beschaff ich mir eine richterliche Verfügung.«
Ich stand auf. »Ich bin gespannt, was dein Tennisass dazu sagt. Er ist sicher ganz scharf auf ein Familienleben mit einem pubertierenden Fünfzehnjährigen und einer achtjährigen Kratzbürste.«
»Er wird sich mir zuliebe große Mühe geben. Er hat Charakter, Mark.« Sie winkte ab. »Davon verstehst du nichts.«
Ach, so war das also. In Wirklichkeit ging es um viel mehr als um ihren Karibiktrip. Das hier war eine Kampagne, von langer Hand geplant. »Und damit sein guter Wille nicht überstrapaziert wird, wolltest du Daniel ködern, sich die Haare abzuschneiden, ja? Und bei der Gelegenheit gleich mal feststellen, wie viel Macht du über ihn hast. Ob du ihn nicht so zurechtbiegen kannst, dass ihr ihn mit in den Tennisklub nehmen könnt, ohne dass er euch das Image ruiniert.« Ich konnte mir ein gehässiges Grinsen nicht verkneifen. »Ich sag dir, du wirst alle Hände voll zu tun haben.«
Sie schoss aus ihrem Sessel hoch. »Hau ab, Mark! Verschwinde! Und lass dich hier nicht mehr blicken, ohne vorher anzurufen! Oder noch besser, wenn du was willst, schreib meinem Anwalt.«
Ursprünglich hatte ich vorgehabt, von ihr aus zu Hasan Rashids Büro zu fahren. Ich hatte morgens dort angerufen, aber nur seinen Anrufbeantworter erreicht. Eine angenehme Stimme hatte mich aufgefordert, Namen und Nummer zu hinterlassen. Stattdessen hatte ich vage angekündigt, im Laufe des Tages vorbeizukommen. Jetzt hatte ich keine Lust mehr. Jetzt stand mir der Sinn eher danach, das zu tun, was ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht hatte: Ich spürte ein dringendes Bedürfnis, mich volllaufen zu lassen, dann bei Dämmerung vielleicht irgendwo ein bisschen zu randalieren und die schwüle Nacht mit einer Flasche am Rhein zu verbringen. Aber ich widerstand. Nicht, weil irgendein Ereignis in der Vergangenheit mich so geläutert hätte, dass ich zu so was nicht mehr imstande gewesen wäre. Aber ich wollte einfach nicht am nächsten Morgen mit der Erkenntnis aufwachen, dass sie mich dazu verleitet hatte.
Hasan Rashids Büro lag im zweiten Stock eines vierstöckigen Nachkriegskastens, der dringend einen neuen Anstrich brauchte. Direkt vor der Tür fand ich einen Parkplatz. Das musste einfach ein gutes Omen sein. Tariks Beschreibung hatte mich hoffnungsvoll gestimmt. Sympathische Gauner waren absolut nach meinem Geschmack. Wer weiß, dachte ich, vielleicht gelingt es mir ja, ihm ein paar Fakten über den Brand im Lagerhaus zu entlocken. Ganz inoffiziell, versteht sich. Und wenn ich wirklich Glück habe, kommen wir möglicherweise ins Geschäft.
Der Hausflur war von einem stechenden Geruch erfüllt, den die chemische Reinigung im Erdgeschoss verursachte. Er setzte sich beißend in den Atemwegen fest. Ich verzichtete kurzerhand auf den Aufzug und sah zu, dass ich die Treppe hinaufkam. Der zweite Stock war noch schäbiger als das Erdgeschoss. Keine Messingschilder an den Wänden, die einen darüber aufklärten, wer wo zu finden war. Nur zwei speckige Etagentüren mit billigem Furnier. Neben einer hing ein vergilbtes, handgeschriebenes Klingelschild. Karl-Heinz Müller. Detektei. Ich klingelte gegenüber, wartete ein paar Sekunden und klingelte noch mal.
Ich sah auf die Uhr. Viertel vor drei. Hasan Rashid war entweder noch in der Mittagspause oder zu Hause in Katar oder badete in Erwartung seiner Versicherungsmillionen in Champagner. Im Büro war er jedenfalls nicht. Ich zauderte einen Moment. Ich hatte keine rechte Lust, einfach so wieder abzuziehen. Der Zorn auf Ilona saß mir noch in den Gliedern, und wenn ich mir schon die große Dummheit versagte, zu der es mich trieb, durfte ich dann nicht wenigstens eine kleine begehen? Ich zog meinen Schlüsselbund hervor. Schlechte Gewohnheiten sind bekanntlich zäh und langlebig. Meine umfangreiche Dietrichsammlung, die mir in längst vergangenen Ermittlertagen überall Tür und Tor geöffnet hatte, schleppte ich immer noch mit mir herum. Ich fischte den mit der richtigen Größe heraus und versuchte mein Glück. Es ging reibungslos. Mit einem kurzen Blick auf die verschlossene Tür der Detektei Müller betrat ich ungebeten Hasan Rashids Geschäftsräume.