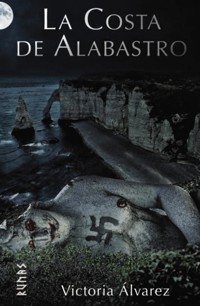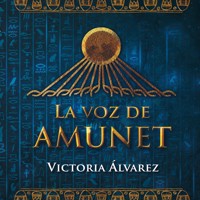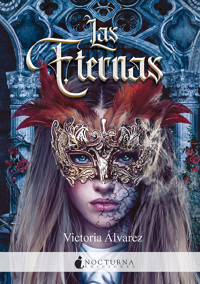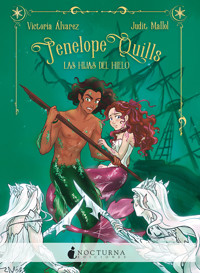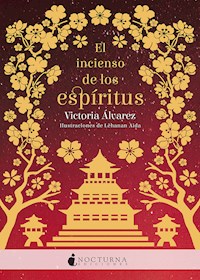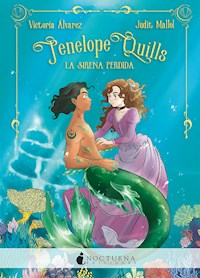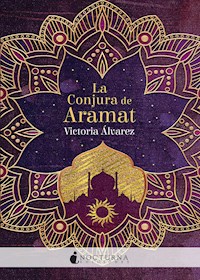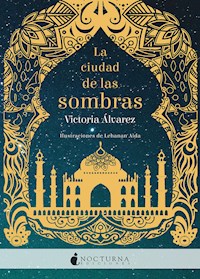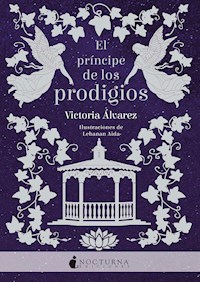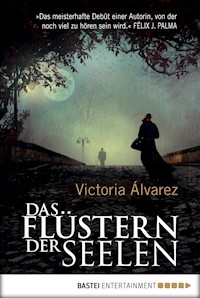
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
EINE AUSSERGEWÖHNLICHE GABE, EINE REIHE UNGEKLÄRTER VERBRECHEN UND EINE LIEBE ZWISCHEN ZWEI WELTEN.
London 1888: Die kleine Annabel wächst auf dem Friedhof Highgate auf, schläft in einem Sarg und rechnet damit, dass ihr Herzleiden ihrem kurzen Leben bald ein Ende setzen wird. Vielleicht ist dieses Dasein zwischen Leben und Tod schuld daran, dass sie mit Geistern in Kontakt treten kann.
Zehn Jahre später ist Annabel zum gefragtesten Medium Englands geworden, selbst Königin Victoria hat ihre Dienste schon in Anspruch genommen. Doch ihre Gabe ist gefährlich: Annabel deckt dunkle Geheimnisse auf und wird von Scotland Yard verfolgt. Einzig der Geist von Lord Victor Rosenfield steht ihr bei...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 727
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Zitat
Teil I – Die Fee von Highgate
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Teil II – Der Asphodeliengrund
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Teil I – Die Schatten von Rosenfield Park
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Epilog
Danksagung
Über die Autorin
Victoria Álvarez wusste schon mit neun Jahren, dass sie Schriftstellerin werden würde – genau wie ihr Vater und ihr Großvater. Seitdem hat sie unermüdlich neue Geschichten erfunden, die mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurden. Victoria Álvarez hat an der Universität von Salamanca Kunstgeschichte studiert und schreibt dort derzeit ihre Doktorarbeit. DAS FLÜSTERN DER SEELEN ist ihr Romandebüt.
Victoria Álvarez
DAS FLÜSTERNDER SEELEN
Roman
Aus dem Spanischen vonMatthias Strobel
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2011 Victoria Álvarez/© 2011 Ediciones Versátil S.L.
Titel der spanischen Originalausgabe: »Hojas de Dedalera«
Published in arrangement with Ediciones Versátil S.L. c/o The Ella Sher Literary Agency
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2014 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Kirsten Brandt, Offenbach
Titelillustration: © Caras Ionut/Trevillion Images
Umschlaggestaltung: Manuela Städele
E-Book-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-8387-4592-3
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Meinem Großvater
In memoriam
»Ohne Asphodille, Veilchen, Hyazinthen:
Wie soll man da mit den Toten sprechen?
Die Toten kennen nur die Sprache der Blumen,
also schweigen sie.
Sie wandeln umher und schweigen,
sie ertragen und schweigen,
im Reich der Träume, im Reich der Träume.«
GIORGOS SEFERIS
TEIL I
DIE FEE VON HIGHGATE
»Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde,
als Eure Schulweisheit sich erträumen lässt.«
WILLIAM SHAKESPEARE
Kapitel 1
Annabel hatte sich in den letzten Tagen nicht gerührt. Sie war so blass und ihre Haut so kalt, dass sie gut und gern auch eine Leiche hätte sein können, ein Eindruck, der noch dadurch verstärkt wurde, dass sie in einem Sarg schlief.
Aber Annabel war weder ein Vampir noch eine Untote. Seit sie denken konnte, was noch nicht so lange her war, denn sie war erst sechs Jahre alt, hatte sie ein Herzleiden. Im Sarg lag sie aber nicht, weil ihre Tage gezählt waren, sondern weil sie in Highgate lebte, einem mit Gräbern und verrosteten Kreuzen übersäten Friedhof im Norden Londons. Als Nichte des Friedhofswärters kam sie kaum in den Genuss dessen, was man unter einer normalen Kindheit versteht. Noch nie hatte sie eine Schule besucht oder mit gleichaltrigen Kindern gespielt, ja, überhaupt gespielt, jedenfalls nicht, soweit sie sich erinnern konnte. Was für andere die Straßen ihres Geburtsortes waren, das waren für sie die Wege des Friedhofs.
Niemand wusste, woher Annabels Krankheit rührte. Ein halbes Dutzend Stethoskope hatte bereits ihr Herz abgehorcht, sehr zum Unwillen ihres Onkels, der sich beklagte, dass seine spärlichen Einkünfte »in den Taschen von Quacksalbern« landeten. Kurz vor Beginn unserer Geschichte allerdings hatte sich ihr Leiden verschlimmert. An jenem Nachmittag besuchte Doktor Geoffrey Toole sie wie gewöhnlich im Wärterhäuschen; und wie gewöhnlich zog er seine buschigen Augenbrauen zusammen, weil sie in ihrem Sarg lag. Dem guten Arzt wollte einfach nicht in den Kopf, dass eine Familie, Geldsorgen hin oder her, einem schwerkranken Mädchen kein richtiges Bett besorgen konnte.
Er kannte Annabel, seit sie vier war. Immer wenn er sie sah, hatte er das merkwürdige Gefühl, einen der Engelsköpfe des Friedhofs vor sich zu haben. Ihre großen grünen Augen waren gesäumt von Wimpern, die so dicht waren wie kleine Bürsten, und ihr Haar war so zerzaust, als wäre gerade ein Orkan über Highgate hinweggefegt.
Doch es waren eben diese Haare, die Toole daran erinnerten, dass Annabel nicht so engelhaft war, wie es den Anschein hatte. Sie waren kraus wie wildes Dornengestrüpp und so rot, dass ihr Kopf aussah wie in Blut getunkt. Der schlechte Ruf, der Rothaarigen anhing, war im England des ausgehenden 19. Jahrhunderts noch weit verbreitet.
An jenen Nachmittag hätte Toole ein Herz aus Stein haben müssen, damit ihm nicht die Stimme zitterte, als er Annabels Tante erklärte, was mit Annabel nicht stimmte.
»Es ist unheilbar«, hörte ihn die Kleine in ihrem Sarg sagen. Heather, die Frau ihres Onkels, stand in der Tür, hatte ihr rundliches Gesicht in ihrer Schürze vergraben und schluchzte. »Was für ein Unglück! Ein so hübsches Mädchen!«
Annabel hörte nur halb hin. Die Worte drangen wirr an ihr Ohr. Es war, als wäre von jemand anderem die Rede.
»Und wir können gar nichts tun für unsere Annie?«
»Nur hoffen, dass der Himmel ihr noch etwas Zeit gewährt«, flüsterte Toole resigniert, »und beten, dass ihre letzten Tage nicht so schmerzvoll werden, wie wir alle fürchten. Ihre Krankheit ist selbst für gestandene Erwachsene verhängnisvoll.« Er setzte seinen Hut auf. »Es tut mir sehr leid, Mrs. Lovelace, mehr, als Sie sich vorstellen können.«
Unter großen Mühen gelang es Annabel, mit einem Auge über den lackierten Holzrand ihres improvisierten Betts hinwegzuspähen. Sie sah, wie der Arzt ein kleines Fläschchen in Heathers zitternde Hand legte, das eine blutähnliche Flüssigkeit enthielt.
»Digitalis«, erklärte Doktor Toole. »Geben Sie ihr ein halbes Dutzend Tropfen jeden Abend, aufgelöst in einem Glas Wasser. Das dürfte genügen, um das Ende einige Monate hinauszuschieben. Hoffe ich zumindest.«
Gemessenen Schrittes verließ er den Friedhof, wie Annabel es von ihrem Fenster aus schon oft beobachtet hatte. »Dieser Tom Lovelace kann nicht normal sein, meine Liebe«, würde er seiner Frau beim Abendessen klagen, wenn er sich daran erinnerte, wie das Kind ihn müde angelächelt hatte. »Sie einfach sterben zu lassen, als flösse in ihren Adern nicht auch sein Blut! Und nur, weil die Mutter nichts mehr von Annabel wissen will!«
Damit lag Doktor Toole nicht weit von der Wahrheit entfernt. Die Beziehung zwischen Annabel und ihrem Onkel hatte bis dahin auf einem nicht ausgesprochenen Pakt gegenseitiger Nichtbeachtung gegründet. Tom Lovelace war es egal, was sie den Vormittag über anstellte, und Annabel wusste das. Wenn er nicht einmal Wert darauf legte, sie auf eine Schule in Holly Lodge, dem nächstgelegenen Dorf, zu schicken, als man sie ihm anvertraute – was konnte man da schon von ihm erwarten, als Heather ihm in Tränen aufgelöst mitteilte, was Doktor Toole ihr eröffnet hatte? Und was konnte ein Mensch, der in Annabel nie etwas anderes als eine Last gesehen hatte, schon empfinden, wenn er erfuhr, dass sie nicht mehr lange zu leben hatte?
»Das war ja zu erwarten«, antwortete er und setzte eine Ginflasche an die Lippen. Tom hatte keinerlei Ähnlichkeit mit Annabel. Seine Haare waren nicht rot, sondern dunkelbraun, ebenso wie der Bart, der seine Wangen und einen großen Teil der Kehle bedeckte. »Sie ist die Tochter meiner liederlichen Schwester, solltest du das vergessen haben. Was kann man schon von jemandem erwarten, der zwischen Mülleimern geboren wurde?«
»Wie kannst du nur so grausam sein, Tom? Annabel ist doch nur ein kleines Mädchen!«
»Na und? Glaubst du denn, die Töchter der anderen Huren von Whitechapel leben länger?« Er schüttelte den Kopf und lachte, weil Heather ihn so bekümmert ansah. »Nimm’s nicht so schwer. Es ist ja nicht unser Kind!«
In jener Nacht warf ihm Heather vor, der unsensibelste aller Männer zu sein. Er solle sich schämen für das, war er gesagt habe, irgendwann werde auch sein Stündlein schlagen. Annabel brannten sich die Worte regelrecht ins Gedächtnis. Sie hatte ihr Ohr an die Bodenritzen pressen müssen, um dem Gespräch lauschen zu können, und in den folgenden Tagen war ihr nicht mehr aus dem Kopf gegangen, dass ihr Fall womöglich gar nicht so ungewöhnlich war an jenem schmutzigen Ort namens Whitechapel.
An ihre Mutter hatte sie kaum noch Erinnerungen. Sie war mehr ein Naturereignis als ein Mensch aus Fleisch und Blut gewesen, die Frau, die sie eines Tages in den Arm genommen, gekitzelt, an ihre Brust gedrückt und vielleicht, aber nur vielleicht, liebevoll geküsst hatte, bevor sie beschloss, dass ihr Lebenswandel nicht geeignet war, um ein Kind großzuziehen. Annabels Erinnerung nach war sie nicht sehr hochgewachsen und hatte genauso rote Haare wie sie, was aber auch daran liegen konnte, dass Heather wieder und wieder betont hatte, wie ähnlich sie sich sähen. Sie wusste noch, wie sie ihr vorgesungen hatte, wenn sie nicht einschlafen konnte, vorausgesetzt, sie war selber nicht zu müde, nachdem sie unzählige Freier hatte bedienen müssen. An mehr erinnerte Annabel sich nicht. Was sie Rosalie Lovelace bedeutet hatte, wusste sie nicht, und was ihrem namenlosen Erzeuger, noch viel weniger.
In jüngster Zeit dachte Annabel oft an ihre Mutter. Sie hatte von den Totengräbern schlimme Sachen gehört, Geschichten von einem blutrünstigen Monster, das sich im Schutz der Dunkelheit in Whitechapel herumtrieb, dem Ort, an dem sie das Licht der Welt erblickt hatte. Ausgerüstet mit den Werkzeugen eines Chirurgen, hatte es die Angewohnheit, über die ahnungslosen Damen der Nacht herzufallen, wenn sie allein waren. Wenn es zuschlug, dann immer tödlich. Keine der Prostituierten hatte die Begegnung mit ihm überlebt in jenem Herbst 1888, in dem Angst und Verzweiflung die wichtigste Metropole der Welt beherrschten. In London sprach man über nichts anderes mehr, und Highgate bildete da keine Ausnahme. Heather war genauso besorgt wie alle anderen Frauen.
»Warum kann sie denn nicht bei uns wohnen?«, flüsterte Heather nachts, wenn sie glaubte, Annabel sei in ihrem Sarg eingeschlafen. »Wäre es wirklich so schlimm, sie zu uns auf den Friedhof zu holen? Wir haben nicht viel Platz, das ist wahr, aber sie könnte im Zimmer oben schlafen, neben Annie. Hörst du mir überhaupt zu, Tom?«
Tom Lovelace stellte sich immer taub, wenn Heather ihm Vorwürfe machte. Seiner Ansicht nach wäre es eine große Dummheit, Rosalie aufzunehmen. Nicht weil sie den Zorn des Whitechapel-Mörders auf sich ziehen würden, indem sie ihm eines seiner Opfer entrissen, sondern weil es sowieso schon mühsam genug war, über die Runden zu kommen. Wenn sie ihrer Nichte nicht einmal ein Bett kaufen konnten, wie sollten sie da noch ein weiteres Maul stopfen?
»Sie kann ja gleich noch ihre Kolleginnen mitbringen«, erwiderte er einmal, ohne sich im Mindesten davon einschüchtern zu lassen, dass Heather die Stirn runzelte. »Je mehr, desto besser, so überwinden wir vielleicht unseren finanziellen Engpass. Dass ich nicht schon früher drauf gekommen bin!«
»Wie meinst du das?«, blaffte ihn Heather an.
Sie traute seinem unschuldigen Tonfall nicht. Einen finanziellen Engpass durchliefen sie seit ihrer Hochzeit vor fünf Jahren, die Heather, nebenbei gesagt, aus tiefstem Herzen bedauerte.
»Ich meine, dass wir mitten in Swain’s Lane ein Bordell eröffnen könnten«, ätzte Tom, »für die Witwer, die ihren verstorbenen Gattinnen Blumenkränze aufs Grab legen. Wetten, dass wir uns damit eine goldene Nase verdienen?«
»Du hast kein Herz«, flüsterte Heather. »Deins hat offenbar deine Schwester abbekommen.«
Tom wusste nicht, was er erwidern sollte, also schwieg er. Und dieses Schwiegen zog sich all die Wochen hin, in denen das Monster von Whitechapel sein Unwesen trieb, bildete einen weiteren Riss in ihrer Ehe, wuchs sich zu einer trennenden Kluft aus. Annabel tröstete sich mit dem Gedanken, dass niemand in London ihre arme Mutter vermissen würde, falls ihr etwas Schlimmes zustoßen sollte, einschließlich ihrer selbst, die sie nicht mehr lang zu leben hatte. Es war ihr deshalb ein Trost, weil sie Tag für Tag erleben musste, wie traurig die Hinterbliebenen waren, obwohl sie doch gar nichts von dem Ort wussten, an den ihre Liebsten gegangen waren. Noch nie war jemand von dort zurückgekehrt, um davon zu erzählen.
*
Ob es Annabel nun gefiel oder nicht, sie war dazu verdammt, als eines jener verrosteten Kreuze zu enden, die sich ihr entgegenneigten, wenn sie sich nachts auf den mit Blättern und Unkraut übersäten Wegen von Highgate herumtrieb. Annabel flüchtete nämlich aus ihrem Sarg, sobald ihr Onkel und Heather sich in ihr Zimmer zurückgezogen hatten. Das nächtliche Konzert der Krähen, die hoch über ihr den Himmel zerschnitten, war ihr tausendmal lieber als die ständigen Vorwürfe von Heather, die offenbar vergessen hatte, dass sie sich an der Seite dieses Tom Lovelace einst glücklich wähnte. Es war jetzt fast zwei Jahre her, seit ihre Mutter sie in die Obhut ihres jähzornigen Bruders gegeben hatte und für immer aus ihrem Leben verschwunden war. Annabel kannte bereits jeden Winkel des Friedhofs auswendig, der ihr privater Spielplatz geworden war. Egal, wie schlecht es ihr ging, egal, wie sehr sie der eine oder andere Aussetzer ihres Herzens daran erinnerte, dass ihre Tage gezählt waren: Annabel hielt ihre Verabredung mit Highgate jede Nacht ein. Wie ein Rehkitz hüpfte sie über die Gräber und saß stundenlang zusammengekauert zu Füßen der Engel, die mit Leidensmiene gen Himmel blickten. Ihre steinernen Finger waren vom Wind zerfressen, und Annabel liebte es, darüberzustreichen und sich vorzustellen, wie ebendiese Engel sie holen kamen, wenn sie ihre letzte Reise antreten musste. Im letzten Glanz der Sonne würden sie ihre großen Flügel ausbreiten, sie mit einem unmerklichen Lächeln auf den Lippen in die Arme nehmen und an einen unbekannten Ort bringen, an dem sie sich über den Zustand ihres schwachen Herzens keine Sorgen mehr zu machen brauchte und wo niemand, nicht einmal Heather, sie dazu zwingen konnte, weiterhin dieses widerliche Gebräu aus Fingerhutblüten zu sich zu nehmen, dessen Geschmack sie auch nach stundenlangem Schlaf noch im Mund hatte.
Highgate war ihre Schule gewesen und seine Grabsteine ihre Schulbücher. Annabel hatte das Abc gelernt, während sie an der Hand ihrer Tante über den Friedhof spaziert war. Später dann, als sie groß genug war, um allein lesen zu können, lieh Heather für sie ihre Lieblingsgeschichten aus der neu eröffneten Bibliothek in der Chester Road aus, der Straße, die am östlichen Rand des Friedhofs verlief. Sie musste es heimlich tun, denn Tom, der nicht einmal wusste, dass seine Frau den Mitgliedsbeitrag von seinem Gehalt abzwackte, sah es nicht gern, wenn Annabel ihre Zeit mit Lesen verbrachte. Sie werde noch dümmer, als sie eh schon sei, wenn sie dem Beispiel ihrer Tante folge, sagte er immer. Dabei flößte ihm die Vorstellung, es zu Hause mit zwei klugen Köpfen zu tun zu haben, mehr Angst ein als eine Attacke von Jack the Ripper, was er jedoch nie zugegeben hätte.
Noch konnte sich Annabel nicht vorstellen, wie in jenem Herbst, kurz nach dem Besuch von Doktor Toole, eine zufällige Begegnung ihr Leben von Grund auf verändern würde. Der schleichende Sonnenuntergang überraschte sie in ihrem Sarg mit einem Buch in den Händen. Es war später November, und die Bäume, die sich entlang der Swain’s Lane erhoben, hatten bereits ihre Blätter verloren; die wenigen, die noch in den Wipfeln hingen, waren so golden wie die Illustrationen der Bücher, die die Fantasie des Mädchens beflügelten.
Ihr Lieblingsbuch waren die Märchen von Charles Perrault. Stundenlang konnte sie mit ihrem Zeigefinger die Zeilen entlangfahren, sie wieder und wieder lesen, obwohl sie sie längst auswendig kannte. Heather war jedes Mal aufs Neue verwundert, wie gut sie sich konzentrieren konnte.
»Im wirklichen Leben hätte Dornröschen keine Ruhe gehabt«, sagte Annabel zu ihr. »Wenn alle Adligen und Diener, ja sogar die Tiere geschlafen hätten, wäre das ganze Schloss geplündert worden. Damals gab es jede Menge Schurken, die sich die Schätze unter den Nagel gerissen hätten, einschließlich des Spinnrads.«
Annabel war in die Betrachtung einer Zeichnung versunken. Die schöne Prinzessin lag prachtvoll gekleidet auf ihrem Bett, während der Prinz einen lächerlichen Hut auf dem Kopf hatte, mit einer Feder, die ihm ins Gesicht fiel. Annabel begriff überhaupt nicht, wie Dornröschen sich das Lachen hatte verkneifen können, als sie ihren Retter zum ersten Mal sah.
»So, wie der Prinz angezogen ist, hätte er sich an den Dornen die Ärmel aufgerissen«, befand sie mit kritischer Miene. »Der sieht ja aus, als wollte er auf einen Tanzball gehen!«
Erst nach einer Weile bemerkte sie, dass ihre Tante ihr nicht zuhörte. In der vergangenen Stunde hatte sie lautstark in der Küche herumhantiert, aber jetzt war es plötzlich still, unheimlich still. Hatte ihre Tante sie etwa allein gelassen?
»Heather?«, rief Annabel aus ihrer mit Samt verkleideten Kiste. »Bist du da?«
Sie schob das Märchenbuch unter ihre Kissen und erhob sich. Sie hatte keine Angst, allein in ihrem Zimmer zu sein, das sich im zweiten Stock befand, direkt unter dem schrägen Dach, aber sie musste immer wissen, wo Heather war. Sie rief noch einmal laut nach ihr, ohne Erfolg. Leise wie eine Katze schlich sie sich zu der klapprigen Tür, die nur angelehnt war, steckte ihre Nase hinaus und erstarrte zu Stein, weil sie jemanden sah, den sie nicht in Highgate erwartet hatte. Oder sonst wo.
Eine Frau hatte die Abwesenheit ihrer Tante genutzt, um sich ins Haus zu stehlen. Annabel beobachtete sie, ohne dass die Frau es bemerkte. Sie hatte sich auf die erste Stufe der Treppe gesetzt und strich sich über einen Ausschnitt, den Annabel, wäre sie einige Jahre älter, als typisch für die Prostituierten von Whitechapel erkannt hätte. Um den Hals trug sie ein ausgefranstes Tuch, das genauso rot war wie ihre Haare.
Es waren vor allem diese Haare, die Annabel stutzig machten. Sie stieß einen erstickten Schrei aus. Die Frau hob den Kopf und sah in ihre Richtung, und der Blick ihrer dunkelbraunen Mandelaugen prallte regelrecht auf den von Annabel, deren Augen so grün waren wie frisches Gras.
Annabel hatte gedacht, sie hätte dieses Gesicht vergessen, aber die Erinnerung war sofort wieder da. Nichts von dem, was sie in Highgate erlebt hatte, hatte sie tilgen können.
»Mama!«, murmelte sie, während sie sich mit zitternden Händen auf dem Geländer abstützte.
Rosalie antwortete nicht, erhob sich aber langsam. Sie hatte ihre Augen so weit aufgerissen, dass Annabel an eine Eule in einem zerrupften Federkleid denken musste. Ein Fuß war nackt, der andere steckte in einem mit Nägeln beschlagenen Schuh.
»Mama! Endlich kommst du mich holen!« Tränen traten ihr in die Augen bei dem Gedanken, dass ihre Mutter sie gleich an die Hand nehmen und mitnehmen würde. »Ich habe die ganze Zeit auf dich gewartet! Ich wusste, dass du mich nicht allein hier sterben lassen würdest!«
Vor lauter Glück begann sie zu lachen, rannte die Treppe hinunter, hin zu ihrer Mutter. Sie war zu aufgewühlt, um zu bemerken, dass Rosalie nicht einmal lächelte; dass sie sich auch dann nicht bewegte, als ihre Tochter ihr die Hände entgegenstreckte. Sie blieb einfach stehen, starr wie eine Statue, sah zu, wie Annabel die letzten vier Stufen übersprang, in ihre Arme hinein … und unsanft auf dem Boden landete, weil sie durch den Körper geflogen war, als wäre er ein Vorhang aus Rauch.
»Aua!«, heulte sie auf, dann wurde ihr schwarz vor Augen.
Sie war mit der rechten Gesichtshälfte auf den Holzdielen aufgeschlagen. Benommen spürte sie, wie ihr Blut warm auf die Finger tropfte. Sie sah zu ihrer Mutter, die lautlos auf sie zukam. Ihre Schritte erzeugten auf dem Holz keinerlei Geräusch. Vor Schmerz zog sie die Augenbrauen hoch, als spürte sie Annabels Wunde am eigenen Leib. Plötzlich ging Annabel ein Licht auf: »Das ist ein Gespenst!«
Vor Schreck bemerkte sie nicht einmal, dass das Blut, das ihr nun auch aus der Nase lief, ihren Kragen tränkte, den Heather ihr just an diesem Morgen an ihr abgetragenes graues Kleid genäht hatte. Sie keuchte, vor Entsetzen, vor Verblüffung.
Mama ist ein Gespenst!, dachte sie und presste beide Hände ans Gesicht. Sie ist tot! Und ich, ich bin gerade durch sie hindurchgesprungen!
Als das Gespenst ihrer Mutter sie fast mit den Händen berührte, die so unkörperlich waren wie der Londoner Nebel, richtete sich bei Annabel jedes einzelne Haar auf, weil von dieser unheimlichen Erscheinung eine eisige Kälte ausging. Sie stieß einen Schrei aus und krabbelte rückwärts. Aus der Nähe betrachtet, glich das Gespenst nicht mehr so sehr der Frau, an die sie sich erinnerte. Andererseits hatte sie auch noch nie erlebt, dass Umrisse alle paar Sekunden zu zittern begannen und sich auflösten oder dass ein Gesicht nach und nach seine Körperlichkeit verlor und den Blick freigab auf die Sammlung schartiger Töpfe und Pfannen an der Wand. Es kam ihr vor wie Küchendampf, der plötzlich die Gestalt einer Frau angenommen hatte. Und diese Frau legte gerade ihre Hände um ihren verletzten Hals und begann zu weinen. Irgendwie gelang es Annabel sich aufzurappeln und nach draußen zu rennen. Dass sie barfuß war und ihr Haar zerzaust, war ihr egal, Hauptsache weg von diesem Geist.
»Heather!«, schrie sie aus vollem Hals. »Heather! Heather!«
Sie rief immer noch ihren Namen, als sie in sie hineinrannte. Heather stand auf dem kleinen Vorplatz, wo sich für gewöhnlich die Trauergäste versammelten. Es handelte sich um eine halbkreisförmige Kolonnade aus Backstein, die von trockenem Efeu bedeckt war wie von einem Vorhang und zu deren oberem Teil man über eine kleine Treppe gelangte. Annabel zitterte so sehr am ganzen Leib, dass man Angst bekam, ihre Beine könnten brechen wie zwei dünne Zweige.
Heather sah zu Annabel hinunter und erschrak, als sie sah, in welchem Zustand sie sich befand. Sie ging neben ihr in die Knie.
»Großer Gott, Annie!«, rief sie und zog ein Taschentuch hervor, um ihrer Nichte das Blut aus dem Gesicht zu wischen. Annabels ganzes Kleid war mit Blutflecken übersät. »Was ist passiert?«
»Ich bin die Treppe runtergefallen«, schluchzte Annabel, »und habe mir weh getan, hier an der Nase.«
Weil sie immer noch benommen war, fiel es ihr schwer, scharf zu sehen. Trotzdem erkannte sie, dass neben Heather auch Onkel Tom stand, zusammen mit zwei weiteren Männern. Beide waren elegant gekleidet: Der eine war groß, trug einen Schnurrbart, der so fein war, dass er wie mit Bleistift gezeichnet wirkte, und hatte seine Haare mit Pomade nach rechts gescheitelt; der andere war dick, kahl wie eine Billardkugel und drehte nervös seinen Bowlerhut in den Händen.
»Wieso denn das?«, fragte Heather besorgt. »Ist dir wieder schwindlig geworden?«
Annabel schüttelte den Kopf. Die Temperatur der gerade aus dem Jenseits erschienenen Rosalie Lovelace war ihr bis tief in die Knochen gedrungen und hatte eine geradezu animalische Angst in ihr ausgelöst.
»Es war so …« Tränen traten ihr in die Augen, als sie an ihr Erlebnis dachte. »Ich war oben in meinem Zimmer und habe das Märchenbuch gelesen, das du mir mitgebracht hast. Und zwischendurch habe ich mit dir geredet.«
»Das kann nicht sein, Annie«, unterbrach Heather sie. »Ich war doch gar nicht im Haus.«
»Das wusste ich aber nicht«, schluchzte Annabel. »Ich dachte, du wärst in der Küche. Und weil du nicht geantwortet hast, wollte ich runtergehen, ich hatte nämlich Angst, du hättest mich allein gelassen.«
Heather war so bestürzt, dass sie ihr Taschentuch noch stärker gegen Annabels Nase presste, die nach wie vor blutete. Doch bevor Annabel ihre Geschichte zu Ende erzählen konnte, räusperte sich einer der Fremden theatralisch.
»Mrs. Lovelace, ich bin mir sicher, dass Ihre Nichte noch etwas warten kann«, sagte er. »Ich fürchte nämlich, dass das Anliegen, das uns nach Highgate geführt hat, wesentlich schmerzlicher ist als ein schlichtes Nasenbluten, so spektakulär es auch sein mag.«
»Geduld, Geduld, Barrington«, mischte sich sein Begleiter ein, der Annabel mitleidig ansah. »Die Nachricht ist schwer zu verdauen. Immerhin geht es um ihre Mutter …«
Annabels Tränen versiegten auf der Stelle. Sie blickte die Männer an. Weil sie so aufgeregt gewesen war, hatte sie ihnen nicht mehr Aufmerksamkeit schenken können als den Engeln, deren steinerne Flügelspitzen über den Kolonnaden aufragten.
»Was ist mit meiner Mutter?«, hauchte sie.
Das Taschentuch, das Heather ihr gegeben hatte, fiel ihr aus der Hand. Wenigstens blutete sie nicht mehr aus der Nase, was ihr allerdings nicht auffiel. Sie war leichenblass.
»Annie, reg dich bitte nicht auf«, flüsterte Heather und legte ihr die Hände auf die Schultern, als wollte sie sicherstellen, dass sie nicht wegrannte. »Du musst jetzt tapfer sein, wir können nun mal nicht ändern, was passiert ist.«
»Was ist denn passiert?«, fragte Annabel, in deren Stimme nun ein schriller Unterton mitschwang. Sie sah wieder zu den Fremden. »Was ist mit meiner Mutter?«
Der Dickere der beiden hörte auf, den Bowlerhut in seinen Händen zu drehen, und sah zu seinem Begleiter, in dessen Miene sich aber nichts rührte. Also stieß er einen Seufzer aus, der aus den Tiefen seiner Schuhe zu kommen schien, und sagte:
»Dann stelle ich uns am besten erst mal vor. Dieser Herr«, er zeigte auf seinen Begleiter, der nach wie vor nicht einmal blinzelte, »ist Inspector Barrington von Scotland Yard. Hast du schon mal etwas von Scotland Yard gehört?«
Annabel nickte erschrocken. Tatsächlich hatte sie schon jede Menge von Scotland Yard gehört, vor allem seit den Ermittlungen in den Whitechapel-Verbrechen. Die schiere Körpergröße Barringtons und sein gezirkelter Bart schüchterten sie mächtig ein, allerdings nicht so sehr wie eine arme Seele.
»Und wer sind Sie?«, fragte sie den anderen Gentleman.
»Herbert Higgs, ein einfacher Anwalt, der sich genötigt sieht, dir die schlechte Nachricht zu überbringen. Ich hätte dich lieber unter, wie soll ich sagen, weniger traumatischen Umständen kennengelernt.«
»Am besten, Sie kommen jetzt zum Punkt, Higgs«, murmelte Tom. »Sagen Sie, was Sie zu sagen haben, und verschwenden Sie nicht Ihre Zeit mit einem kleinen Mädchen.«
Der Anwalt sah ihn mit murmelgroßen Augen an.
»Wie Sie selbst gesagt haben, mein Freund: Wir haben es hier mit einem kleinen Mädchen zu tun.«
»Das aufgeweckt genug ist, um Sie zu verstehen.« Aus irgendeinem Grund wagte Tom nicht, seiner Nichte in die Augen zu sehen. Higgs zog die Brauen hoch.
»Sie wollen mir doch wohl nicht sagen, dass sie nie … Wie alt bist du, mein Fräulein?«
Annabels Lippen bebten, sie vergrub ihr Gesicht in der Schürze ihrer Tante.
»Sechs«, übernahm Heather die Antwort. »Seit März.«
»Erst sechs«, bemerkte Inspector Barrington. Er runzelte leicht die Stirn. »Lovelace, bitte versetzen Sie sich mal einen Augenblick in Ihre Nichte.«
»Es ist lange her«, brummte Tom. »Alter schützt vor …«
»Sie sind doch auch noch nicht so alt, dass Sie vergessen hätten, wann Ihre Frau Mutter gestorben ist«, wies Higgs Tom zurecht und legte ihm die Hand auf die Schulter. »Wir sind oft zu ungeduldig mit unseren Mitmenschen und vergessen, wie sehr wir selbst unter den gleichen Umständen gelitten haben. Wir waren alle mal Kinder.«
»Kommen Sie mir nicht so, Higgs. Oder wollen Sie andeuten, dass meine Mutter auch eine Hure war?«
Es sollte lustig klingen, aber die beiden Herren hatten sehr wohl bemerkt, dass Toms Lächeln gekünstelt war. Heather stieß einen Seufzer aus und drückte Annabel an sich, als fürchtete sie, jemand könnte aus den Gräbern steigen und sie ihr entreißen.
Annabel war noch blasser geworden, wirkte fast wie eine Wachspuppe.
»Dann … stimmt es also?« Sie hob den Blick und sah zu Heather. »Meine Mutter?«
»Noch wissen wir nicht genau, was passiert ist«, schluchzte Heather, die sich mit dem Zipfel einer Schürze die Augen trocknete. »Sie wurde heute in der Früh in einer Gasse von Whitechapel überfallen und bis zu den George Yard Buildings verfolgt, wo du auch mal gewohnt hast. Und dann ist derjenige, der sie verfolgt hat, bei ihr eingedrungen.«
»Derjenige?«, begann Annabel, die das Schlimmste fürchtete und bereits ahnte, was jetzt kam.
Alle schwiegen, keiner traute sich, ihr zu antworten. Heather streichelte Annabel mit ihren pummeligen Fingern übers Gesicht, als wäre das Blut, das darauf zu trocknen begann, das ihrer toten Mutter. »Jack the Ripper«, stammelte Annabel.
»Wir sind uns noch nicht ganz sicher«, warnte Higgs. »Man darf nichts überstürzen.«
»Scotland Yard wird alles unternehmen, was in seiner Macht steht«, versicherte ihr der Inspector, der seine Truppe offenbar ins beste Licht rücken wollte. »Als uns gemeldet wurde, dass man sie im Hinterzimmer des Pubs The Ten Bells gefunden hat, haben wir uns sofort an die Arbeit gemacht. Inspector Abberline, der die Ermittlungen führt, befindet sich in diesem Moment am Tatort.«
»Dann hat also Jack the Ripper sie umgebracht?«, murmelte Annabel. »Ich habe seinen Namen gelesen.«
»Welchen Namen?«, wunderte sich Higgs. »Den von Jack the Ripper? Der ist der Öffentlichkeit doch noch gar nicht bekannt!«
Annabel schüttelte den Kopf und sah zum Haus, in dem sich, soweit sie es durchs Wohnzimmerfenster erkennen konnte, nichts rührte. Nichts Lebendiges und auch nichts Totes.
»Nein, den von Frederick Abberline«, erklärte sie. »In der Zeitung.«
»Ich auch«, flüsterte Heather, ohne zu bedenken, wie überrascht die beiden Herren sein mussten, dass ein so kleines Mädchen Zeitung las. »Er bearbeitet alle Fälle des Rippers. Im Star war ein Foto von ihm, letzte Woche. Kurz nach dem Mord an Kelly …«
»Die auch in ihrem Zimmer überfallen wurde, wie Rosalie Lovelace.« Higgs wandte sich Barrington zu. »Ist Ihnen das gar nicht aufgefallen? Derselbe modus operandi, dasselbe Alter. Sogar die Haarfarbe stimmt überein. Womöglich kannten sich die beiden Frauen.«
»Alle ermordeten Prostituierten kannten sich«, sagte Inspector Barrington. »In Whitechapel treibt sich alles mögliche Gesindel herum, das ist ein regelrechter Sündenpfuhl. Und Prostituierte sind wie Kloaken: Früher oder später geht aller Dreck da durch. Verbrechen zieht Verbrechen an. Diese Frauen wissen ganz genau, worauf sie sich einlassen.«
»Wie viele Menschen leben in Whitechapel?«, fragte Higgs skeptisch. »Hundertausende? Oder gar eine Million? Was lässt Sie so sicher sein, dass zwischen Nicheols, Eddowes, Chapman und Stride die gleiche Verbindung besteht wie zwischen Kelly und Lovelace? Dass wir die richtige Spur verfolgen? Die beiden Ersteren sind ältere Frauen, die beiden Letzteren hingegen …«
»Wollen Sie damit andeuten, dass Ihre Kanzlei mehr weiß als Scotland Yard?«
Während die beiden sich stritten, sah Annabel sie weiterhin mit großen Augen an, die durch die Tränen leuchteten wie zwei mit Diamanten umfasste Smaragde. Heather schnaubte vor Wut und packte ihre Nichte an der Hand, um sie von diesen rücksichtslosen Gentlemen wegzuziehen, die sich nicht entblödeten, in Annabels Gegenwart über den Mord an ihrer Mutter zu streiten. Und Tom tat nichts, um ihnen Einhalt zu gebieten. Seine Miene war so undurchdringlich, als trüge er eine Theatermaske, und seine Augen glänzten matt.
Als sie gerade das Haus betreten wollten, sträubte sich Annabel. Entsetzen machte sich in ihrem Gesicht breit.
»Annie, um Gottes willen! Was ist mit dir?«
Sie musste so viele Seufzer zurückhalten, dass ihre Brust regelrecht anschwoll.
»Die arme Rosalie! Dabei hatte ich sie so lieb!«, rief sie schließlich und trocknete sich die Tränen ab.
»Heather, sag mir die Wahrheit«, flehte Annabel, die noch immer zur offenen Tür sah. »Was hat er ihr angetan? Hat er sie aufgeschlitzt? So wie die anderen?«
Sie konnte ein leichtes Zittern in der Stimme nicht verbergen. Heather sah sie traurig an, dann ging ihr Blick zu ihrem Mann, der den immer lebhafter werdenden Streit zwischen Higgs und Barrington unbeteiligt verfolgte.
»Diesmal ist er hektischer vorgegangen …«, begann Heather.
»… und hat ihr nur die Kehle aufgeschnitten«, vollendete Annabel, woraufhin Heather große Augen machte. »Ich habe sie gesehen. Mama war da, während ihr draußen mit diesen beiden Männern gesprochen habt.«
Heathers Hände schnellten zu ihrer Brust und von dort zu ihrem Mund. Sie war kreidebleich.
»Annabel, das ist nicht lustig. Ich verstehe ja, dass dich das Ganze schrecklich mitnimmt, aber …«
»Ich habe ihre Wunde gesehen!«, beharrte Annabel und zeigte auf ihren Hals. »Sie war genau da, über dem Ausschnitt, ein tiefer Schnitt wie mit einem …«
»Federmesser?«, fragte Heather wie gelähmt. »Ich fasse es nicht. Dieser Barrington …«
»Was ist ein Federmesser?«, fragte Annabel leise.
»Barrington hat uns davon erzählt«, fuhr Heather fort. »Man hat es in einem Gully in der Nähe des Tatorts gefunden. Mir ist schleierhaft, wie du das gehört haben kannst.«
»Ich habe es ja auch nicht gehört!«, protestierte Annabel. »Und jetzt sag: Was ist ein Federmesser?«
Heather hielt sich immer noch die zitternde Hand vor dem Mund, als sie sagte:
»Eine Art Messer, mit dem man Schreibfedern spitzt. So ähnlich wie das von deinem Onkel. Reiche Leute benutzen so was, Lords.«
Annabel war sprachlos. Heather wusste, wovon sie sprach. Londons Oberschicht faszinierte sie so sehr, dass sie alles verschlang, was in den Beilagen von Toms Zeitungen über sie stand, und ihrer Nichte vorlas. Annabel hingegen war es piepegal, ob zum Beispiel Lord Goring auf einem Ball von Mabel Chilterns Bruder um deren Hand angehalten hatte. Mit ihren sechs Jahren war sie fest davon überzeugt, dass sie nie einem Lord begegnen werde, wodurch sie den Geschichten aus der Oberschicht auch nicht mehr Wert beimaß als den Abenteuern ihrer Märchenhelden. Trotzdem war sie ins Grübeln geraten.
»Und wenn es gar nicht Jack the Ripper war? Sondern ein Aros… ein Aristomat?«
»Ein Aristokrat?«, fragte Heather. »Das kann ich mir nicht vorstellen, Annie. Was will denn ein Aristokrat in Whitechapel, wenn er sich doch die Nächte auf einem dieser rauschenden Feste um die Ohren schlagen kann? Außerdem hat Barrington gesagt«, fügte sie hinzu, als sie sah, dass Annabel protestieren wollte, »dass es sich um dieselbe Person handeln muss, die auch die anderen Frauen umgebracht hat. Du hast ja gelesen, was der Star über den Ripper geschrieben hat. Laut Scotland Yard muss der Täter jemand sein, der mit scharfen Instrumenten umgehen kann. Ein Fleischer, ein Barbier. Oder ein Chirurg.«
Annabel konnte sich nicht vorstellten, dass in den George Yard Buildings Chirurgen wohnten, aber sie hatte nicht genügend Kraft, um Heather zu widersprechen. Was geschehen war, wirkte zu stark in ihr nach. Ihre Tante stand immer noch da und sah sie, die Hand vor dem Mund, besorgt an; vor lauter Anspannung waren ihre Tränen versiegt. »Komm mal her«, murmelte sie und breitete die Arme aus, damit Annabel sich an sie schmiegen konnte, was sie auch tat wie in so vielen Nächten zuvor, wenn die Kinderängste sie in ihrem Sarg zu lähmen drohten. Nur dass es diesmal nicht so gut wirkte.
Hinter den Bäumen ging golden die Sonne unter. Durch die weit aufgesperrten Fenster und die Vorhänge, die sich in den Blumenstauden an der Hauswand verfingen, wirkte das von Grabsteinen umringte Wärterhäuschen wie ein matter Totenschädel. Bald würde auch Rosalie so aussehen. Annabel spürte wieder einen Stich im Herzen, einen Schmerz, der nicht von ihrer Krankheit oder sonst einem Kummer herrührte, der ein kleines Mädchen befallen konnte.
Ihre Mutter hatte also als Erste gehen müssen.
Kapitel 2
Der Tod war zu Rosalie Lovelace nicht gnädiger als das Leben. Gut möglich, dass jener Dämon, den alle Welt unter dem Namen Jack the Ripper kannte, niemanden mehr ermorden würde, aber das machte die sechs Frauen aus Whitechapel, auf die er sich mit seinen Messern gestürzt hatte, auch nicht wieder lebendig. Rosalie würde kein Grab in Highgate erhalten, so wie sie auch kein Haus in Covent Garden, Kensington, Berkeley Square oder Elystan Street gehabt hatte. Ein einsames Holzkreuz mit der Inschrift 15510 auf dem Friedhof von Plaistow würde der einzige Hinweis darauf sein, wo sie begraben lag. Und besuchen würden sie lediglich die Prostituierten aus den Vorstädten, ehemalige Weggefährtinnen, und ab und zu auch Heather, die Annabel aber nicht ein einziges Mal mitnahm. Das Mädchen war von der plötzlichen Erscheinung seiner toten Mutter so sehr geschockt, dass es sich kaum aus dem Haus traute.
Heather sorgte dafür, dass Doktor Toole ihnen vier Tage nach der Beerdigung einen Besuch abstattete. Annabel hatte sich nicht aus ihrem Sarg gerührt. Sie trug noch immer das Kleid aus grauem Stoff, das ihre Tante ihr genäht hatte, lag zusammengekauert da und starrte die Tierchen an, die sie auf ihre improvisierte Schlafstätte gezeichnet hatte. Jede einzelne Krähe betrachtete sie, die auf dem Samt des Sargs in V-Formation flogen, immer wieder, während Doktor Tooles Worte sich in den Windungen ihrer Gehörgänge verloren. Es schien ihr wesentlich einfacher, den Bildern, die sie im Laufe der vergangenen zwei Jahre mit Buntstiften gezeichnet hatte, bis ins Unendliche zu folgen, als ihm zuzuhören, wie er Auskunft über ihr Herz gab.
»Wenigstens hat man mir versichert, dass du das Digitalis nimmst«, hörte sie Doktor Toole sagen, als spräche er von ganz weit weg, aus London, der Stadt, in deren Straßen sich Menschen mit Messern herumtrieben, um sich gegenseitig aufzuschlitzen. »Aber ich habe auch gehört, dass du jedes Mal einen Aufstand machst. Niemand hat je behauptet, dass Arzneien gut schmecken. Schließlich habe ich dir keine Süßigkeit verschrieben, sondern das einzige Heilmittel, das dich gesund erhält. Wenn ich mitkriege, dass du dich davor drückst, und sei es auch nur ein einzige Mal …«
Die Vögel streckten ihre Flügel aus. Annabel hatte sie mit einer Art roter Stacheln versehen, die Federn darstellen sollten. Als sie mit der Fingerkuppe darüber strich, musste sie an eine Haarbürste denken.
»Ich sehe schon, du willst nicht mit mir reden.« Als Doktor Toole sein Jackett auf das Podest legte, raschelte es an ihrem Ohr. »Wir sind heute Morgen wohl etwas launisch, was? Oder soll ich dich lieber allein lassen, damit du in Ruhe weinen kannst?«
Sie schwieg. Ein Flügel der Krähe, die den anderen vorausflog, war durch die Berührung ihrer Finger verwischt. Den muss ich noch mal zeichnen, dachte Annabel, schließlich ist das die Mutterkrähe. Wer soll den anderen sonst sagen, wohin sie fliegen müssen?
»Deine Tante Heather hat mir berichtet, dass du kaum einen Bissen anrührst.«
Sie betrachtete weiterhin den Flügel. Essen war nicht wichtig. Sie hatte schon immer wenig gegessen.
»Ich hatte dich für klüger gehalten«, versuchte Doktor Toole ihr zu schmeicheln. Annabel hatte große Lust, mit der Zunge zu schnalzen, denn sie war klug genug, um zu begreifen, worauf er hinauswollte. »Reifer. Wie gesagt, ich verstehe deinen Schmerz, ich verstehe, dass du um deine Mutter trauerst, und das sollst du auch. Aber wenn wir nicht auf dein Herz aufpassen …«
»Ich trauere nicht«, murmelte Annabel. »Oder sehen Sie, dass ich schwarze Sachen anhabe?«
Doktor Toole seufzte. Draußen vor der Kapelle sangen die Totengräber A Violet From Mother’s Grave, während sie kraftvoll die schwere Erde aushoben. Die ersten Zeilen des Lieds taten Annabel so weh, dass sie sich noch stärker zusammenkauerte. Doktor Toole blickte sich um, ohne aufzustehen.
»Sie gehen jetzt besser, Milord.« Der Ton seiner Stimme verriet, dass er über die Schulter hinweg mit jemandem sprach. »Unser Sorgenkind ist heute so dickköpfig, dass Sie nur Ihre Zeit vergeuden.«
Plötzlich reagierte Annabel. Unter ihrem Arm hindurch sah sie noch einen schwarzen Haarschopf und gerade Schultern durch die Tür verschwinden. Sie war so sehr in ihre Betrachtung der Krähen versunken gewesen, dass sie die Anwesenheit eines Dritten nicht bemerkt hatte. Sie sah Doktor Toole an.
»Wer war das?«
»Ist nicht so wichtig«, erwiderte Toole ungerührt. »Aber ich freue mich, dass du dich endlich dazu durchgerungen hast, mich anzusehen. Ich muss dich nämlich untersuchen, ob dir das passt oder nicht, kleines Fräulein. Du hast etwas Schlimmes erlebt, da wäre es nicht verwunderlich, wenn dein Herz … Jedenfalls würde deine Mutter nicht wollen, dass du so schnell zu ihr kommst.«
Annabel antwortete nicht. Sie machte es sich so gut wie möglich in ihrem Sarg bequem und starrte zu den verwitterten Dachbalken, während Doktor Toole ihr das Stethoskop an die Brust hielt. Sie hatte eine Heidenangst vor dem Stethoskop. »Dieses Ding saugt die Seele weg, wenn man es direkt aufs Herz drückt«, sagte sie immer zu Heather, wenn der Arzt wieder weg war. Mehrere Wochen lang war sie wie besessen von dem Gedanken, dass der arme Geoffrey Toole, der noch nie einer Fliege etwas zuleide getan hatte, sich nachts daran ergötzen könnte, den Klagen der Menschen zu lauschen, die in der kleinen Silberkapsel des Stethoskops eingesperrt waren. »Was geht nur in deinem Kopf vor, Kind«, hatte Heather einmal erwidert. »Wie kann man nur mit sechs Jahren schon so gruselige Gedanken haben? Daran ist nur Highgate schuld! Ich hab’s ja schon immer gesagt!«
Für Annabel war nicht Highgate daran schuld, dass dieser Doktor Toole die Seelen seiner Patienten raubte. Sie sah da keinen Zusammenhang, und selbst wenn, wäre es ihr egal gewesen, so wie ihr inzwischen alles egal war.
Sie zog an ihrem Hemd.
»Kann ich auch mal hören?«
»Ich glaube nicht, dass dich das beruhigen würde«, murmelte Toole.
Er nahm die Stöpsel aus den Ohren und betrachtete Annabel so aufmerksam, dass sie schon fürchtete, er wolle so lange mit verschränkten Armen dastehen, bis sie tot war.
»Dein Puls ist wie immer«, sagte er verwundert. »Nicht die kleinste Unregelmäßigkeit. Wenn du weiterhin fleißig dein Digitalis einnimmst, spricht nichts dagegen, dass dein Zustand sich nicht verändert. Schau nicht schon wieder so.« Annabel hatte ihr kleines Näschen gerümpft. »Du weißt doch, dass es nur zu deinem Besten ist. Sag deiner Tante, sie soll dir Toastbrot mit Honig machen, wenn du deine tägliche Dosis schlucken musst, dann geht’s schon.«
Das infernalische Gerät noch immer in der Hand, hatte er sich so weit über den Sarg gebeugt, dass Annabel, vor allem auf seiner Nase, jede einzelne Pore erkennen konnte und in der Nase die sorgfältig gestutzten Härchen; und sogar die Fältchen um die Augen, die so dunkel waren wie von Heather. Wie immer roch der Doktor nach Talkpuder. Keiner der Totengräber roch so.
Noch bevor ihm bewusst wurde, was sie da machte, flüsterte sie:
»Glauben Sie an Gespenster, Doktor Toole?«
Die dunklen Augenbrauen des Arztes bogen sich nach oben wie zwei Accents circonflexes. Er schien ernsthaft über ihre Frage nachzudenken.
»Ich glaube, dass jeder sein eigenes Gespenst hat.«
»Wie meinen Sie das?«, fragte Annabel verwundert.
So etwas hatte sie noch nie gehört. Gab es so viele Gespenster?
»Jeder Mensch hat seine eigenen Sorgen«, erklärte der Arzt, während er die Kabel um das Stethoskop wickelte, »seine eigenen fixen Ideen, Ängste und Träume. Der menschliche Geist ist ein wunderliches Ding, mein Kind.« Er legte das Stethoskop in seinen Arztkoffer. »Es ist nicht ungewöhnlich, dass wir unsere Ängste auf Menschen projizieren, die nicht mehr bei uns sind. Und dann kann es passieren, dass wir sie leibhaftig vor uns sehen. Das sind aber keine Gespenster, Annabel, das ist unser eigener Wahn.«
So merkwürdig es dem Doktor auch erscheinen mochte, aber seine Erklärung beruhigte Annabel keineswegs. Wahn? Wenn ein Gespenst zu sehen bedeutete, dass man nicht ganz richtig im Kopf war, war dann nicht die halbe Menschheit verrückt? Und wenn sie an die vielen Horrorgeschichten dachte, die sie gelesen hatte, allesamt aus der Bibliothek in der Chester Road, die Heather so eifrig aufsuchte: War es womöglich so, dass die Helden nur fantasierten, dass sich die Autoren das alles nur ausdachten? Verzagt sah sie Doktor Toole mit ihren grünen Augen an.
»Finden Sie, dass ich allmählich verrückt werde?«, flüsterte sie.
»Aber nein«, antwortete der Doktor und lächelte. Dann gingen seine Mundwinkel wieder nach unten. »Dein Geisteszustand ist nicht das Problem, fürchte ich.«
Annabel erwiderte nichts. Sie machte sich nicht die Mühe, in Frage zu stellen, was Doktor Toole gerade gesagt hatte, dafür tat ihr der Kopf zu sehr weh. Sie murmelte nur »Bis bald«, als der Arzt, nachdem er ihr mit einer gewissen Zärtlichkeit durchs Haar gefahren war, aufstand, seinen Koffer und sein Jackett nahm und das Zimmer verließ. Das Klappern seiner Schuhe auf den Treppenstufen hallte schmerzhaft zwischen ihren Schläfen wider.
Sie seufzte und wollte nur noch eines: sich so lange in ihrem Sarg zusammenrollen, bis die Sonne hoch am Himmel stand, die Stiche in Kopf und Brust verschwunden waren und die Erinnerung an das Holzkreuz mit der Nummer 15510 in Plaistow sie nicht mehr quälte. Gerade wollte sie die Augen schließen, als sie bemerkte, dass sie wieder da war.
Rosalie Lovelace saß vor dem Fenster, auf dem kleinen, zehn Zentimeter breiten Sockel, der außen ums Haus verlief. Ihre Haare fielen offen auf ihre Schultern, und ihre Augen waren geradezu von Kummer getränkt, als sie ihr kleines Mädchen betrachtete, das wie gelähmt in seinem Sarg lag und die Fingernägel in den Samt bohrte.
»Ma… Mama!«, stammelte Annabel. Sie konnte nicht glauben, was sie sah. »Mama.«
Rosalie seufzte tief. Sie hatte das Tuch um ihren Hals ein wenig gelöst, aber die frische Narbe war kaum von den ebenfalls blutroten Haaren zu unterscheiden, die sich ihr um die Schläfen kräuselten.
»Mama!«, rief Annabel. »Ich bin’s!«
Rosalie verharrte in ihrem verwirrenden Schweigen.
»Sprich mit mir!«, flehte Annabel und richtete sich auf. »Ich weiß nicht, was du von mir willst! Und ich weiß auch nicht, warum nur ich dich sehe! So kann ich dir nicht helfen, Mama!«
Bevor Annabel am Fenster war, senkte Rosalie den Kopf auf die Brust und ließ sich auf die Beete fallen, in denen die verschiedensten Blumen wuchsen. Annabel schrie auf. Sie versuchte das Fenster aufzureißen, aber der Riegel klemmte. Als sie endlich den Kopf nach draußen strecken konnte, sah sie nur die Totengräber, die gerade lachend vom Ausheben eines Grabs zurückkamen. Die Hände zitterten ihr, und sie verstand gar nichts mehr.
Ob ich nicht mehr ganz richtig im Kopf bin?, überlegte sie. Plötzlich spürte sie, dass ihre Finger, die sie auf den Sims gelegt hatte, auf die Stelle, auf der gerade eben noch ihre Mutter gesessen hatte, mit einer kaum wahrnehmbaren Schicht Raureif überzogen waren. Sie betrachtete sie näher und rieb sie dann an ihrem Kleid, um sie zu wärmen. Bilde ich mir das alles nur ein?
Plötzlich meinte sie aus den Augenwinkeln zu sehen, wie eine weiß gekleidete Gestalt hinter der am weitesten entfernten Ecke des Hauses mal auftauchte, mal verschwand. Ihre Mutter hatte zwar ein braunes Kleid getragen, trotzdem wandte sie sich vom Fenster ab und stürmte die Treppe hinunter.
Sie rannte an Doktor Toole vorbei, der noch geblieben war, um mit Heather zu sprechen, und ihr verwundert nachblickte. Wie eine Mörsergranate schoss sie nach draußen und blieb keuchend in dem kleinen Garten hinter dem Haus stehen, wo keine Beete lagen, sondern die ersten, lange vor ihrem Einzug ausgehobenen Gräber. Die Grabsteine sprossen aus dem Gras wie Pilze, und die mit Moos überwucherten Kreuze neigten sich in alle Himmelsrichtungen, als wogten sie im Wind. Ihre Mutter war verschwunden, aber das spielte in diesem Moment keine Rolle. Ihr stockte der Atem, als sie die viele Menschen sah, die ernst und still auf sie warteten.
Männer und Frauen, Kinder und Erwachsene, Jugendliche und Greise, Menschen jeglicher Hautfarbe, manche in schwarze Seide und Krepp gehüllt, andere in zerrissene Leichentücher, standen barfuß auf dem Rasen und sahen sie mit Augen an, die in den Höhlen klackerten wie zwei Murmeln. Wenn ihr Blick auf den Annabels traf, lächelten sie, ohne ihre Lippen zu verziehen. »Hallo«, grüßten sie zwei Mädchen, kaum älter als sie selbst, die auf Baumstümpfen saßen. »Sie ist kleiner, als Elizabeth behauptet hat!«, sagte eine Dame in einem Brautkleid. »Und erst das Gesicht! Sieht aus wie eine Puppe!« Annabel wusste nicht, was sie sagen sollte. Reglos stand sie da und fragte sich, ob das alles real war, ob es in ihrem Garten tatsächlich von Fremden wimmelte (ob von toten oder lebendigen, war ihr herzlich egal) oder ob sie es nur träumte, wie der immer so vernünftige Doktor Toole ihr zu verstehen gegeben hatte; oder anders ausgedrückt: ob sie verrückt geworden war.
Als sie schon dachte, der Schrecken könnte nicht mehr größer werden, bahnte sich eine Frau ihren Weg durch die versammelten Seelen. Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass sie es mit Toten zu tun hatte, dann war er hiermit erbracht. Die Ellenbogen der Frau gingen glatt durch die Matrosen hindurch, die in der ersten Reihe standen, als wären sie aus Luft.
»Annabel Lovelace«, sagte die Frau feierlich. Annabel fand es eher beunruhigend, ihren Namen aus dem Mund einer Toten zu hören, die schon wer weiß wie lang unter der Erde lag, aber das Lächeln der Fremden heiterte sie auf. Die Frau hatte weiße Haare, die sie zu einer Art Dutt hochgesteckt hatte. »Wir haben auf dich gewartet. Alle oder zumindest die, die hier in Highgate liegen. Wir haben schon viel von dir gehört, mein Kind, hatten aber Angst, du wärst nur ein Traum.«
Annabel, die nach wie vor am Eingang stand, bibberte, weil sie barfuß war.
»Ich bin kein Traum«, flüsterte sie. Sie hatte Angst, etwas Falsches zu sagen. »Ich lebe. Aber ihr … ihr …«
Zu ihrer Überraschung begannen die Toten zu lachen. Einem der Mädchen fiel die Stoffpuppe aus der Hand. Annabel betrachtete sie eine Weile und überlegte, wie merkwürdig es doch war, dass ihre transparenten Körper nichts festhalten konnten, was aus der Welt der Lebenden stammte, jedenfalls nichts, was nicht mit ihnen begraben worden war. Diese Puppe musste also in einem der Familiengräber von Highgate liegen. In diesem Moment fiel ihr auf, dass nicht alle Gespenster gleich durchsichtig waren. Manche wirkten so körperlich wie Doktor Toole, ihr Onkel und ihre Tante, ja wie sie selbst. Wahrscheinlich waren das die, die erst kürzlich gestorben waren.
Bevor sie sich wieder bewegen konnte, stand die Frau direkt vor ihr. Trotz ihres Alters hatte sich ihre Schönheit erhalten, und ihr Lächeln war so liebevoll wie das der Großmütter in den Märchen, die Heather ihr aus der Bibliothek mitbrachte. Annabel spürte, wie ihre Beklommenheit wich.
»Hab keine Angst«, sagte die Frau, hob den Zeigefinger und stieß ihn ihr direkt durch die Nase. Erschrocken schrie Annabel auf, woraufhin die Frau noch mehr lächelte. »Jeder hier würde eher ein zweites Mal sterben, als dir etwas anzutun.«
Annabel fasste sich mit der Hand an die Nase, die ganz kalt geworden war. Und als sie sie verwirrt wieder losließ, bemerkte sie, dass ihre Finger mit Raureif überzogen waren.
»Und wo ist meine Mama?«, fragte sie mit dünner Stimme. »Will sie mich denn gar nicht mehr sehen?«
Die beiden Matrosen mit den braungebrannten Gesichtern blickten sich einen Moment lang an. Wäre Annabel etwas älter gewesen, hätte sie an diesen Blicken ablesen können, welchem Beruf ihre Mutter nachgegangen war. So wurde ihr nur klar, dass die beiden wohlinformiert waren, und sie sah das Mitleid in ihren Augen.
Ebenso die alte Frau. Ihre Augen leuchteten kurz auf, dann seufzte sie.
»Sie … Rosalie kann im Augenblick nicht bei uns sein, meine liebe Annabel. Sie kann noch nicht zu dir kommen, zumindest nicht hier in Highgate.«
Annabel erstarrte, aber keines der Gespenster schickte sich an, ihr die Gründe näher zu erläutern, auch nicht die nette alte Dame, die sie wieder liebevoll anlächelte.
»Komm mit«, sagte sie und streckte die Hand aus, obwohl sie wusste, dass Annabel sie nicht ergreifen konnte. »Wir erzählen dir, wer wir sind und warum wir sind, wer wir sind; und warum du die Einzige bist, die uns sehen kann. Deine Augen haben sich für immer geöffnet.«
Als hielte sie in ihren mit altmodischen Ringen bestückten Fingern Seidenfäden, mit denen sie jedes Körperglied steuern konnte, zog sie Annabel mit sich, die sich die Frage, ob das, was sie erwartete, irgendwie gefährlich war, gar nicht erst stellte. Sie verschwendete auch keinen Gedanken daran, was für ein verblüfftes Gesicht Heather machen würde, wenn sie ihr erzählte, dass sie wieder Erscheinungen gehabt hatte; oder daran, was ihr Onkel sagen würde, für den sowieso feststand, dass sie diese Hirngespinste nur von ihrer Mutter haben konnte. Angst hatte sie also keine. Außerdem verliehen ihr die Geister Kraft. Während Annabel ihnen schweigend folgte, vergaß sie das Holzkreuz, das am Grab ihrer Mutter stand, vergaß das blutgetränkte Tuch um ihren Hals, vergaß sogar den brennenden Schmerz, der sie in den letzten Tagen fast verzehrt hatte.
Sie mochte eine Mutter verloren haben, aber sie hatte eine Familie gefunden.
*
Zur ihrer Überraschung stellte Annabel im Laufe der Wochen fest, dass ihre neue Familie viel lebendiger war als ihre alte. An die ersten vier Jahre in Whitechapel erinnerte sie sich kaum noch, und in Highgate hatte sie keinen einzigen Freund gehabt, niemanden, der sich dafür interessiert hatte, was in ihrem Kopf vor sich ging, mit Ausnahme von Heather vielleicht. Die Totengräber waren Grobiane, deren größter Ehrgeiz es war, sich jeden Freitag im The Duke of St. Albans, dem Pub in der Swain’s Lane, volllaufen zu lassen. Über Tom Lovelace gab es auch nichts Angenehmes zu berichten, und Doktor Toole, na ja, der war nett zu ihr, das stimmte, aber letztlich tat er nur die Arbeit, für die man ihn bezahlte. Niemand hatte sie je nach ihrer Meinung zu den wichtigen Dingen des Lebens gefragt wie jetzt die Geister. Manchmal dachte sie, dass sie das Beste waren, was ihr je passiert war.
Obwohl ihre geheimnisvollen Besucher tot waren, blühte Annabel regelrecht auf, wenn sie bei ihnen war. Die beiden Mädchen, die auf den Baumstümpfen gesessen und sie begrüßt hatten, Marian und Laura Collins, wurden bald enge Freundinnen, und Annabel zeigte ihnen ihre Lieblingsstellen auf dem Friedhof, wo sie oft Verstecken spielten oder was ihnen sonst gerade einfiel. Manchmal rannten sie, was das Zeug hielt, durch das Dickicht im Westteil des Friedhofs und kamen in der Egyptian Avenue mit ihren großen, lotusblütenartigen Kapitellen heraus, deren lange Efeuranken sich in der aus London herwehenden Brise wiegten. Dann schlenderten sie an den Familiengruften vorbei, die sich zu beiden Seiten der Straße aneinanderreihten, bevor sie wie durch Zauberhand vor der großen Libanon-Zeder standen, die sich an der höchsten Stelle von Highgate erhob. Um seinen knotigen, sich in die Höhe reckenden Stamm lagen auf zwei Ebenen weitere Familiengräber in allen Größen, und als die drei Mädchen den Blick zum blauen Himmel hoben, fühlten sie sich klein wie Ameisen. »So sieht es aus, wenn man aus einem Grab rausschaut«, flüsterte Laura Annabel zu. Sie saßen auf den mit Moos überzogenen Stufen, die zum oberen Teil führten, »aber hier oben rumzulaufen macht viel mehr Spaß. Wenn man im Grab liegt, kann man nicht spielen!« Annabel lachte leise, damit es den Totengräbern nicht merkwürdig vorkam, schließlich war sie in deren Augen ja allein. Trotzdem dauerte es nicht lang, da machte in Highgate das Gerücht die Runde, die Arzneien, die Doktor Toole ihr verabreichte, seien dafür verantwortlich, dass sie mehr als bedenklich vor sich hin fantasiere.
Tom Lovelace war das alles egal. Er sagte nur zu Heather, sie solle sich wegen Annabel nicht den Kopf zerbrechen. »Viele Kinder in ihrem Alter erfinden sich unsichtbare Freunde«, versicherte er, »und ehrlich gesagt haben wir schon genug Probleme, als dass wir uns auch noch um die geistige Gesundheit der Kleinen Sorgen machen könnten. Lass sie doch spielen, mit wem sie Lust hat. Dann geht sie uns wenigstens nicht auf die Nerven!« Da nützte es auch nichts, dass Heather vor Ärger die Lippen zusammenkniff. Offenbar war ihr Mann immer noch verärgert darüber, dass er für das Digitalis so viel Geld ausgeben musste.
Eines Morgens, als Annabel wie üblich nach dem Frühstück in den Garten ging, um mit den Collins-Schwestern zu spielen, traf sie auf Mrs. Murphy, die ruhig vor der Kapelle saß und auf sie wartete. Mrs. Murphy war die alte Dame, die ihr bei ihrer ersten Begegnung mit den Geistern durch die Nase hindurchgefasst hatte. Was Annabel von ihr erfuhr, wirbelte ihre ganze Welt durcheinander. Am Abend zuvor hatten sich die Eltern von Marian und Laura mit einem Medium getroffen – Annabel wusste allerdings nicht, was ein Medium war -, um sich mit den armen Seelen ihrer Kinder in Verbindung zu setzen, die sie vor acht Jahren verloren hatten. Es war ihnen tatsächlich gelungen, Kontakt aufzunehmen. Worum es in dem Gespräch gegangen war, war nicht nach außen gedrungen, aber die Tatsache, dass die beiden auf einmal nicht mehr da waren, ließ nur einen Schluss zu: Sie hatten sich für immer aus der Dimension verabschiedet, in der sie, laut Mrs. Murphy, verankert gewesen waren. Das Medium hatte sie von ihren Ketten befreit.
»Wie meinen Sie das?«, fragte Annabel. Sie freute sich, dass ihre Freundinnen glücklich waren, begriff aber nicht, warum sie sie nicht mehr besuchen konnten. Waren sie denn nicht mehr so tot wie vorher? »Was bedeutet ›verankert sein‹?«
»Verankert sein«, antwortete Mrs. Murphy, »bedeutet, dass man sich auf halbem Weg zwischen der Welt der Toten und der Welt der Lebenden befindet.«
Geschlagene zwei Wochen lang grübelte Annabel über das nach, was sie von Mrs. Murphy erfahren hatte. Sie stellte sich vor, wie Marian und Laura Collins in einem Ozean unaufhaltsam in die Tiefe sanken, die Hände auf dem Rücken gefesselt und an den Füßen Anker aus Blei, die mehr wogen als ihre kleinen Körper. Mrs. Murphy musste sie an die elementarste Regel ihrer Dimension erinnern, dass nämlich kein Geist ihr jemals Schaden zufügen würde, damit Annabel sich wieder zu ihnen traute, denn außerdem wollte ihr nicht in den Kopf, dass Wesen, die zu zielloser Pilgerschaft verurteilt waren, so gut gelaunt sein konnten.
Mit Marian und Laura hatte sie die besten Freundinnen verloren, die sie je gehabt hatte. Niedergeschlagen ging sie dieselben Wege ab, streichelte dieselben Steinengel, manchmal allein, manchmal in Begleitung von Mrs. Murphy, bis abends die Dunkelheit über London hereinbrach und Heather nach ihr rief.
In den folgenden zwei Jahren änderte sich nicht viel: Manche Geister gingen fort, andere gesellten sich zu der großen Familie von Highgate hinzu. Der Kreislauf des Lebens ging seinen Gang … außer für Annabel Lovelace. Sie war die Einzige, die sich nicht veränderte. Noch konnte sie sich nicht im Entferntesten vorstellen, welche dramatische Wendung ihr Leben an einem unwirtlichen Nachmittag des Jahres 1890 nehmen würde, als sie zu einem Spaziergang über den Friedhof aufbrach, um ihre heraufziehenden Kopfschmerzen zu lindern.
Am Ende des östlichen Sektors erhob sich eine Mauer, die etwas niedriger war als die übrigen, und über diese Mauer hinweg konnte Annabel, wenn sie sich auf die Ziegelsteine stellte, einen Blick auf ein Herrenhaus erhaschen, das sie faszinierte. Es lag gleich neben der Bibliothek in der Chester Road. Entdeckt hatte sie es auf einem ihrer letzten Streifzüge mit Marian und Laura. Im Garten wucherte Rhododendron, dessen Blüten rund waren wie Weihnachtskugeln, und das Laub der Kastanienbäume war so dicht, dass man im Frühling, wenn an allen Ästen grüne Blätter hervorsprossen, die Umrisse des Daches mit den Wasserspeiern kaum noch erkennen konnte. Das Haus hatte etwas von einem Schloss aus einer alten Sage, vom Palast einer mysteriösen, allmächtigen Königin der Toten. »Wie gern wäre ich so eine Königin«, hatte sie einmal Marian zugeflüstert, der das Haus genauso gut gefallen hatte wie Annabel, »dann könnte ich nämlich in dem Haus da wohnen. Ich würde elegante Sachen tragen, jede Menge Schmuck. Und ich würde vor den Spiegeln auf und ab gehen wie eine Aristokratin.«
Marian hatte laut gelacht und ihre Stoffpuppe Elfride hochgehoben, damit sie auch mal einen Blick auf das Haus werfen konnte. Wer darin wohnte, wussten sie nicht. Manchmal, wenn sie Stimmen hörten, Schritte auf dem Weg zum Garten, stellten sie sich auf Zehenspitzen und erspähten die Bowler einiger Gentlemen, die sich angeregt unterhielten. Einmal sahen sie auch die Hutfedern einer Dame, die sich vergewisserte, dass niemand in der Nähe war, bevor sie an der Tür klingelte. Danach lag Annabel die ganze Nacht lang neidisch in ihrem Sarg. Sie würde alles dafür geben, auch einmal ein so teures Kleid tragen zu dürfen und eingelassen zu werden!
Aber Marian und Laura waren nicht mehr da. Sie musste wieder allein spielen, sich allein vorstellen, sie wäre die Hausherrin. Als sie wieder einmal die Nase über die Mauer reckte und sich in ihren Träumereien zu verlieren drohte, glaubte sie plötzlich gedämpfte Schritte zu hören.
Es war Herbst, und an den Ästen der Kastanienbäume baumelten die stacheligen Früchte, mit denen die Kinder aus dem benachbarten Örtchen Holly Lodge Conkers spielten, wenn sie den Kiesweg an der Friedhofsmauer entlangkamen. Annabel duckte sich schnell hinter die Mauer. Die Schritte waren zögerlich, unsicher, als wüsste zumindest eine der Personen nicht genau, in welche Richtung sie gehen sollte.
Annabel kam aus dem Staunen nicht mehr heraus, als sie über die Mauer hinwegspähte und erkannte, dass es ihr Onkel Tom war.
»Ich weiß nicht«, sagte er, dem offenbar unbehaglich zumute war. Sie schnappte noch den ungeduldigen Blick auf, den seine beiden Begleiter wechselten, bevor sie sich wieder ducken musste. Es waren vornehme Leute, Gentlemen, daran hatte Annabel nicht den geringsten Zweifel, denn sie trugen Hüte, die denen der Besucher ihres Traumhauses sehr ähnelten. »Es ist ja nicht so, dass ich Ihnen nicht helfen will, Mr. Harrington, Gott bewahre, aber wir dürfen nicht zulassen, dass sich die Geschichte mit Rossetti wiederholt.«
»Rossetti?«, riefen die beiden anderen Männer. »Malen Sie den Teufel nicht an die Wand.«
Und dann prusteten sie los. Annabel musste zugeben, dass die Bemerkung tatsächlich witzig war. Dante Gabriel Rossetti war ein bekannter Maler gewesen, der früh gestorben war, aus Trauer um seine Frau und an seiner Drogensucht.
»Sie wissen ja, wie es ihm ergangen ist.« Tom hatte nicht in das Gelächter seiner Begleiter eingestimmt. Er schien sich unbehaglicher denn je zu fühlen. »Ich habe damals in Highgate als Totengräber gearbeitet, wissen Sie? Und ich kann mich noch gut erinnern, was für ein Skandal es war, als die Polizei hier war und meine Kollegen verhört hat, die an diesem Abend die Friedhofstore verschlossen hatten. Wochenlang schrieben die Zeitungen über nichts anderes. ›Ophelias Exhumierung‹ nannten sie es.«
»Kein Wunder, dass alle Welt schockiert war, Lovelace«, bemerkte jener Harrington und stellte lächelnd seine Goldzähne zur Schau. Annabel zuckte zusammen. Dieser Mann gefiel ihr ganz und gar nicht. »Peinlich war das. Wirklich peinlich.«