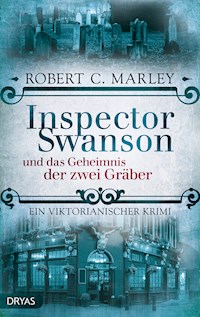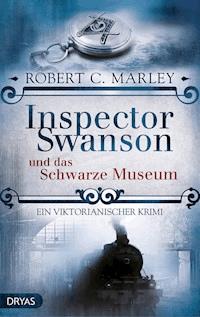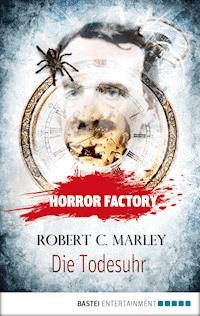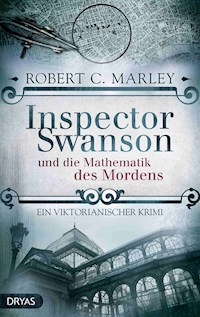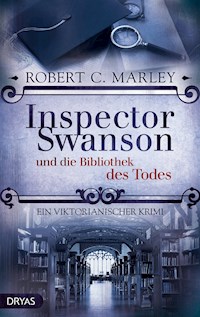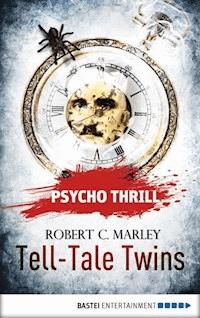13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Thienemann Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Als Adrian bei eBay einen geheimnisvollen Koffer ersteigert, ist nichts mehr, wie es vorher war. Seine Tante wird ermordet und auch Adrians eigenes Leben ist in Gefahr. Zusammen mit dem ehemaligen Agenten Talbot und der gerissenen Taschendiebin Isabella flieht er quer durch Europa, um das Geheimnis des Koffers zu ergründen. Dicht auf den Fersen ist ihnen nicht nur die Night’s Agency, der geheimste Geheimdienst Großbritanniens, sondern auch ein unsichtbarer Wissenschaftler und ein skrupelloser Killer. Enthält der Koffer wirklich das Vermächtnis des Doktor Frankenstein?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Buchinfo
Als Adrian bei eBay einen geheimnisvollen Koffer ersteigert, ist nichts mehr, wie es vorher war. Seine Tante wird ermordet und auch Adrians eigenes Leben ist in Gefahr. Zusammen mit dem ehemaligen Agenten Talbot und der gerissenen Taschendiebin Isabella flieht er quer durch Europa, um das Geheimnis des Koffers zu ergründen. Dicht auf den Fersen ist ihnen nicht nur die Night’s Agency, der geheimste Geheimdienst Großbritanniens, sondern auch ein unsichtbarer Wissenschaftler und ein skrupelloser Killer. Enthält der Koffer wirklich das Vermächtnis des Doktor Frankenstein?
Autorenvita
© Thienemann Verlag GmbH
Robert C. Marley, Jahrgang 1971, ist Goldschmiedemeister und fertigt als Mitglied des Magischen Zirkels Zauberapparate an. Er liebt Sherlock Holmes und besitzt ein eigenes Kriminalmuseum. Wenn er nicht gerade schreibt, neue Zaubertricks erfindet oder in geheimer Mission unterwegs ist, unterrichtet er Kinder und Jugendliche in Selbstverteidigung. Er ist verheiratet und hat zwei Söhne.
Für Merlin und Felix
(Nichts auf der Welt ist so geheim wie Abraham Carruthers.)
In respektvoller Erinnerung an
Lon Chaney Jr. und Claude Rains,
die Lawrence Talbot und dem Unsichtbaren
ein Gesicht gaben.
Und für Bud Abbott und Lou Costello,
die ihnen den Schrecken nahmen.
»’Tis strange but true …
But truth is ever strange,
Stranger than fiction.«
Lord Byron
PROLOG
Die elektrische Spinne
Church of St. Mary Magdalene,
Hucknall Torkard, Nottinghamshire,
England, Januar 2010
Schneeregen und Graupel. Draußen herrschte ein verdammtes Sauwetter.
Der Mann im schwarzen Mantel hatte seinen Kragen hochgeschlagen und seinen schwarzen Hut tief ins Gesicht gezogen, als er gegen 19:00 Uhr die Kirche durch eben jenes Portal betrat, durch das sie vor all den Jahren den verstorbenen Lord Byron getragen hatten.
Außer ihm war noch eine Handvoll anderer Personen anwesend. Der Küster war gerade damit beschäftigt, die Gesangbücher in die Regale zu stapeln. Ein seltsamer französischer Tourist, der in seinem zwei Nummern zu engen Anzug wie ein Bestatter wirkte und ständig Selbstgespräche führte, bestaunte die Byron-Sammlung am Fuße des normannischen Turms, dem ältesten Teil der ganzen Kirche. Und in der Sakristei unterhielt sich ein Pärchen, das ein kleines Kind an der Hand und ein anderes im Kinderwagen bei sich hatte, auf Deutsch über die Einzigartigkeit der von Charles Eamer Kempe geschaffenen Bleiglasfenster.
Die rechte Hand um die tischtennisballgroße, surrende Messingkugel in seiner Manteltasche geschlossen, schritt der Mann im schwarzen Mantel an der kleinen Taufkapelle vorbei den Mittelgang entlang auf den Altarraum zu.
Wie es schien, nahm keiner der Anwesenden zu diesem Zeitpunkt großartig Notiz von ihm. Schließlich konnte ja kaum jemand ahnen, dass es sich bei dem Mann, der sich zufälligerweise zum selben Zeitpunkt mit ihnen in dieser Kirche aufhielt, um einen Mitarbeiter der einflussreichsten Geheimorganisation der westlichen Welt handelte und dass er in den Kreisen jener, die von seiner Arbeit profitierten oder zumindest davon wussten, bereits zu Lebzeiten eine Legende war.
In einer der vorderen Bankreihen nahm er Platz. Vorsichtig griff er in seine Tasche, zog die polierte Messingkugel hervor und legte sie behutsam auf den Boden. Dann schaltete er sein vollkommen abhörsicheres Smartphone ein, tippte eine 23-stellige Tastenkombination aus Zahlen und Buchstaben in das Display und mit einem leisen, metallischen Klicken klappten sechs winzige Öffnungen an der Kugel auf, aus denen sich hauchdünne, teleskopartige Metallbeine schoben. Im Licht der Kirchenbeleuchtung glänzten sie wie Golddrähte. Sofort erhob sich die Kugel auf ihre Beine und krabbelte wie eine Spinne davon. Klick-klack, klick-klack, klick-klack machten die Beinchen auf dem uralten Steinfußboden der Kirche.
Zielstrebig und flink bewegten sie sich auf die marmornen Stufen des Altarraums zu, unter denen sich das Familiengrab der Byrons befand. Die Spinne hielt vor der untersten Stufe an. Ein kaum hörbares Sirren ertönte, als der diamantbesetzte, druckluftgekühlte Steinfräser ausgefahren wurde und seine Arbeit aufnahm. Innerhalb von wenigen Minuten hatte die Spinne ein faustgroßes Loch in den Marmor geschnitten, das herausgefräste Stück mit ihren Beißzangen beiseitegelegt und sich an den Abstieg in die Byron-Gruft gemacht.
All das beobachtete der Mann im schwarzen Mantel von seinem Platz aus auf dem Display seines Handys. Und er war sehr zufrieden. Den Messwerten zufolge, arbeitete die X-SPIDER10 einwandfrei. Nicht einen Augenblick lang war die Arbeitstemperatur der Einheit über 20° Celsius gestiegen.
Die Messingspinne ließ sich an einem dünnen Draht in die Tiefe, während das eingebaute Kameraauge auf Nachtsicht geschaltet hatte und nun ein in grünes Restlicht getauchtes Bild vom Innern der Grabkammer auf das Handy übertrug. Der Mann in Schwarz konnte eine Treppe sehen, an deren Fuß fünf mehr oder weniger gut erhaltene Särge standen. Auf zweien von ihnen lagen Kronen, eine davon war mit einer Anzahl großer Perlen besetzt.
Um ihn sich genauer anzusehen, lenkte der Mann die Messingspinne zu einem viereckigen Holzkasten, der sich in seiner Form deutlich von den Särgen unterschied. Seine Aufgabe war es, festzustellen, ob sich Lord Byrons sterbliche Überreste tatsächlich in dieser Grabkammer befanden oder nicht. Gerüchten zufolge hatte England das Herz des großen Dichters nämlich für immer verloren und es lag angeblich einbalsamiert in einer Bleischatulle auf einem Friedhof in der Nähe der griechischen Stadt Mesolongi, wo Lord Byron am 19. April 1824 gestorben war. Sollte sich herausstellen, dass das stimmte, würde das für die Agency einiges an Mehrarbeit bedeuten.
Mit einer Berührung des Touchscreens seines Smartphones schaltete er den Restlichtverstärker der Spinne auf die höchste Stufe und aktivierte den Klettermodus, wodurch einer der vier eingebauten hydraulischen Pfeile abgeschossen wurde. Eine hochelastische Drahtsehne hinter sich herziehend, flog die rasiermesserscharfe Spitze aus Damaszenerstahl in hohem Bogen zum Deckel des viereckigen Holzkastens und blieb darin stecken. Eine winzige Winde, die wie alles, was der Mann im schwarzen Mantel herstellte, ein Wunderwerk der Feinmechanik war, sprang an, und langsam zog sich die Spinne an der Wand des Kastens hoch.
Das Kameraauge tastete den Deckel ab und hatte gerade zwischen all dem Staub eine bronzene Gravurplatte mit einer Inschrift erfasst, als jemand den Mann im schwarzen Mantel am Ärmel zupfte.
»Hallo! Hallooo!« Es war der kleine, vielleicht sechsjährige Junge, der zu den deutschen Touristen gehörte. »Was machst du da?«
»Ein wissenschaftliches Experiment«, sagte der Mann in akzentfreiem Deutsch. »Sehr kompliziert. Und viel zu kompliziert für Kinder.«
»Bist du Dinoforscher?«
»So etwas Ähnliches.« Er berührte mit dem Zeigefinger den Touchscreen seines Handys und der Bildschirm wurde schwarz. »Ich glaube, du musst jetzt wirklich zu deinen Eltern zurück, mein Kleiner. Die machen sich sonst noch Sorgen. Außerdem soll man in deinem Alter nicht mit fremden Leuten sprechen. Hat man dir das nicht beigebracht?«
»Ich habe die Kugel gesehen«, sagte der Junge. Er trug ein graues Star-Wars-T-Shirt, und blonde Locken lugten vorwitzig unter seinem roten Winnie-the-Pooh-Käppi hervor. Er sah aus wie die typische Klette, die Schwierigkeiten machte. Genau die Sorte Kind, vor der sie im Training immer gewarnt wurden.
»Ist die aus echtem Gold?«
»Nein, ist sie nicht.«
»Und wie machst du, dass die laufen kann?«
Der Mann im schwarzen Mantel musste lächeln. Der Kleine gefiel ihm. Neugierde war die Grundvoraussetzung dafür, Neues zu erschaffen. Er sah den Jungen sehr ernst an und sagte: »Ich bin ein Außerirdischer vom Planeten Mars. Und ich bin mit einem Raumschiff auf die Erde gekommen, um das Leben der Menschen zu erforschen. Aber das darfst du niemandem verraten, hörst du? Sonst muss ich dein Gehirn einfrieren.«
Der blonde Junge sah ihn mit Augen an, die so groß wie Untertassen waren, und nickte ehrfürchtig und stumm. Dann rannte er, so schnell er konnte, zu seinen Eltern und rief: »Mama! Papa! Guckt mal! Da ist ein Mann, der ist aus dem Weltraum gekommen! Er will mein Gehirn einfrieren.«
Der Vater und die Mutter des Jungen sahen in seine Richtung. Der Mann in Schwarz lächelte und winkte ihnen zu. Denn wenn er etwas wusste, dann eins: Übertreibung bot in den meisten Fällen Schutz. Der Vater sah schuldbewusst auf seinen Sohn und erwiderte schüchtern den Gruß.
Eine weitere Berührung des schwarzen Touchscreens und das gestochen scharfe, grünliche Bild der Nachtsichtkamera war wieder auf dem Display zu sehen. Jetzt war auch die Inschrift der Gravurplatte deutlich zu erkennen:
In diesem Gefäß
werden das Herz & das Gehirn & etc.
des verstorbenen
Lord Noel Byron
verwahrt
Am besten gefiel ihm die Bemerkung »& etc.« – was immer das bedeuten mochte. Blieb nur zu hoffen, dass der Behälter über all die Jahre auch dicht gehalten hatte. Aber das würden andere überprüfen müssen.
Um einen letzten Test durchzuführen, gab er eine kurze Tastenkombination ein, und zwischen den Vorderbeinen der Spinne wurde, gleich neben dem Kameraauge, ein Sensor ausgefahren. Innerhalb weniger Sekunden erschienen Zahlenkolonnen mit Daten am rechten Bildrand.
Die Raumtemperatur des Gewölbes betrug 12° Celsius. Die Luftfeuchtigkeit lag bei 50 %. Und der Luftdruck betrug genau 1013,25 Hektopascal. Die Messung ergab keinerlei Schadstoffe, sah man mal von den üblichen Schwermetallen ab, die sich ohnehin in jeder Umgebung ablagerten. Ganz gewöhnliche Werte also.
Das stumm geschaltete Handy vibrierte. DARWIN NIGHT RUFT AGENT ABRAHAM CARRUTHERS stand auf dem Display. Auch wenn er es am liebsten hinausgeschoben hätte, drückte der Mann im schwarzen Mantel den roten OK-Button, auf dem sich eine 3-D-Animation des Night’s-Agency-Logos drehte – ein Monogramm aus den verschlungenen goldenen Buchstaben N und A. Darwin Nights besorgtes Gesicht erschien auf dem Display.
»Sir?«
»Wir haben gerade ihre Übertragung erhalten, Agent Carruthers«, sagte Night. »Großartige Arbeit. Erstklassig.«
Der Mann im schwarzen Mantel, der Abraham Carruthers hieß, war nicht gerade erfreut über die Unterbrechung. »Ich denke, wir können ganz beruhigt sein. Alle Werte sind zufriedenstellend, Sir. Allerdings stecke ich noch mittendrin.«
»Irgendwelche schädlichen Pilzsporen in der Luft der Kammer?«
»Nein, Sir. Aber Sie erhalten gleich per E-Mail ein ausführliches Memo.«
»Ganz ausgezeichnet«, sagte Night. »Hätte Carter Sie damals bei der Tutenchamun-Ausgrabung dabeigehabt, es hätte mit Sicherheit weniger Tote gegeben.«
»Schon möglich, Sir. Ich möchte Sie allerdings bitten …« Agent Carruthers unterbrach sich, als er sah, dass der Küster seinen Platz bei den Gesangbüchern unweit der kleinen Byron-Ausstellung im Turm verlassen hatte und nun den Mittelgang fegte. Von den Stufen des Altarraums war er nur noch wenige Meter entfernt. Wenn er dort ankam, würde er unweigerlich das Loch bemerken, das die elektrische Spinne in die unterste Stufe geschnitten hatte.
»Agent?« Nights Gesichtsfarbe hatte deutlich an Intensität verloren. »Ist bei Ihnen alles in Ordnung?«
Ohne eine Antwort drückte Abraham Carruthers das Gespräch weg und stand auf. Zügig durchmaß er das Mittelschiff und ging zu der Stelle bei den Stufen, an der sich das Loch im Marmor befand. Rasch stellte er den Fuß davor. Als der Küster wenige Augenblicke später den Besen vor sich herschiebend bei ihm ankam, sah Carruthers ihn kopfschüttelnd und mit missmutig zusammengezogenen Augenbrauen an und meinte: »Ist das nicht fürchterlich, wie manche Menschen so ticken?«
»Entschuldigung?« Der Küster stützte sich auf den Besenstiel, strich sich mit der Hand über den dichten Vollbart und sah Carruthers fragend an. »Was meinen Sie?«
»Na, den Ben-Caunt-Gedenkstein draußen im Kirchgarten natürlich.«
»Und was ist damit?«
»Oh, ich dachte, Sie wüssten schon davon. Irgendjemand hat ihn mit roter Farbe besprüht.«
»Was? Das gibt’s doch nicht! Diese Vandalen werden aber auch immer dreister!« Den Besen wie ein Gewehr über die Schulter geworfen, stapfte der Küster wütend davon, um den Schaden selbst in Augenschein zu nehmen.
Das war knapp!
Das Grab des berühmten englischen Boxchampions, nach dem übrigens die Glocke Big Ben im Londoner Parlamentsgebäude benannt worden war, lag hinter dem Nordquerschiff auf der Rückseite der Kirche. Der Küster würde also ganz um das Gebäude herumlaufen müssen und eine Weile beschäftigt sein. Das verschaffte Abraham Carruthers die nötige Zeit.
Binnen Sekunden manövrierte er die elektrische Messingspinne wieder aus der Byron-Gruft heraus und versteckte sie in den Tiefen seiner Manteltasche. Dann holte er ein faustgroßes, mit durchsichtiger Folie umwickeltes Päckchen hervor und wickelte es aus. Die an der Luft schnell aushärtende Spezialknetmasse, die sich darin befand, stopfte er in das Loch und strich sie glatt. Er schmierte ein bisschen Dreck vom Fußboden darauf und es war kaum noch etwas zu sehen.
Und nun nichts wie weg, bevor der Küster zurückkam. Noch im Weggehen rief er die Zentrale an. »Meine Arbeit hier ist erledigt. Die X-SPIDER10 hat ihren Probelauf erfolgreich beendet.« Agent Abraham Carruthers zog den Hut tiefer ins Gesicht und schlug den Mantelkragen hoch, während er zielstrebig auf den Ausgang zuging. »Jetzt ist es an Ihnen, den Koffer zu finden, Sir.« Ehe Darwin Night etwas darauf entgegnen konnte, schaltete der Mann im schwarzen Mantel sein Handy aus und steckte es wieder ein.
Der seltsame französische Tourist im zu kurzen Anzug stand nicht weit vom Eingang entfernt, als der Mann im schwarzen Mantel hinausging. Er sah ihm nach, bis er im Regen verschwunden war.
»Er ist weg, Monsieur.« Er nahm einen der zahllosen sich windenden Mehlwürmer aus der braunen Papiertüte in seiner Hand und steckte ihn sich genüsslich in den Mund. Kauend fragte er dann: »Können wir jetzt gehen?«
»Können wir nicht, Sie Idiot!«, sagte eine körperlose Stimme neben ihm. »Es regnet, falls Sie es noch nicht bemerkt haben, Renfield. Wollen Sie, dass man meinen nackten Hintern sieht?«
»Nein, Monsieur Rains, natürlich nicht.«
Man hätte den Mann glatt für einen Bauchredner halten können, der seine Puppe vergessen hatte, aber man hätte sich geirrt.
Regen und Graupel. Draußen herrschte ein verdammtes Sauwetter …
Der Koffer
Ingolstadt, Deutschland, 20. Juli 2011
Mr Lawrence Talbot saß in der Lobby des Hotels Zum wilden Eber am Tisch und nippte an einem Gin Tonic. Seit mehr als zwei Stunden schon wartete er vergebens darauf, dass ihn die junge Dame an der Rezeption mit dem Rumänischen Konsulat in London verband.
Mr Talbot war ein großer, dunkelhaariger Mann mit buschigen Augenbrauen, dem man ansah, dass er gern einen trank.
Augenblicklich studierte er einen Zeitungsartikel über den Tod einer jungen Frau, die am Tag zuvor in einem öffentlichen Park im Südlondoner Vorort Wandsworth ermordet aufgefunden worden war.
STARLET STIRBT UNTER MYSTERIÖSEN UMSTÄNDEN
London – Die Nachwuchsschauspielerin Megan Torring (23) wurde gestern gegen 14:00 Uhr von Passanten in einem Gebüsch im Uferbereich des Ententeichs auf dem Wandsworth Common gefunden. Die Leiche wies Schussverletzungen auf. Scotland Yard geht nach ersten Erkenntnissen nicht von einem Sexualdelikt aus. Wie aus Polizeikreisen verlautete, sei das Opfer möglicherweise bei einer misslungenen Drogenübergabe getötet worden. Torring, die erst vor wenigen Monaten aus Sudbury nach London gekommen war, feierte mit kleineren Rollen erste Erfolge in diversen Westend-Musicals. Die Ermittlungen dauern zur Stunde an.
Das schmale Gesicht auf dem Foto glich auf beunruhigende Weise dem seiner Auftraggeberin. Allerdings hatte er sie nur ein einziges Mal getroffen, und das in einer schlecht beleuchteten Kneipe in Soho – es war also durchaus möglich, dass er sich irrte. Fahrig fuhr sich Mr Talbot mit dem Hemdsärmel über den Mund. Er faltete die Zeitung zusammen und warf sie neben den überquellenden Aschenbecher auf den Tisch vor sich.
»Mr Talbot?« Die junge Dame berührte ihn zaghaft an der Schulter, als sie ihn ansprach. S. Mertens stand auf dem dezenten Namensschild an ihrer Bluse.
Talbot fuhr herum. »Ja? Haben Sie jemanden erreicht?« Er sprach Deutsch, mit starkem britischem Akzent.
»Nein.« Das Mädchen strich sich eine widerspenstige blonde Haarsträhne hinters Ohr und sah ihn ein wenig mitleidig an. »Tut mir leid, Mr Talbot«, fügte sie etwas leiser hinzu. »Den Anschluss gibt es gar nicht.«
»Was?« Talbots rechte Hand schoss vor und ergriff den linken Unterarm der Frau. »Das kann doch gar nicht sein. Haben Sie auch die richtige Nummer gewählt?«
»Au! Sie tun mir weh!« Sie versuchte, ihren Arm wegzuziehen. »Bitte lassen Sie mich los.«
»Sie haben doch die richtige Nummer gewählt, nicht wahr?«
»Ja. Ja, natürlich.«
»Bitte entschuldigen Sie.« Ruckartig ließ er sie los und versuchte ein Lächeln, aber alles, was er zustande brachte, war, den Mund zu einer Grimasse zu verziehen. »Es tut mir sehr leid. Ich wollte Ihnen nicht wehtun.«
»Ich weiß.« Sie schenkte ihm ein Lächeln. »Ist schon okay.«
»Wirklich?«
Sie sah ihn an. Er war jetzt seit über einer Woche bei ihnen. Kein wirklich gut aussehender Mann, fand sie, aber doch einer, den man nicht mehr so schnell vergaß. Lawrence Talbot war definitiv ein Mann, der einen gewissen Eindruck machte. Und eigentlich mochte sie ihn. Er war ihr und den anderen Angestellten gegenüber stets freundlich und unaufdringlich gewesen. Sie fragte sich, warum er heute so anders war.
»Wenn ich irgendetwas für Sie tun kann –«
»Danke«, sagte er. »Danke, ich weiß das zu schätzen.« Diesmal gelang das Lächeln. »Aber ich glaube, ich gehe jetzt besser zu Bett. Das wird ein anstrengender Tag morgen.«
»Ganz wie Sie meinen, Mr Talbot.« Sie sah ihn an, den Kopf leicht zur Seite geneigt und die Augen zusammengekniffen. »Aber wenn Sie doch noch etwas benötigen sollten, zögern Sie bitte nicht zu klingeln.«
Er nickte. »Das werde ich.« Er stand auf, steckte die Zigaretten ein und klemmte sich die zusammengerollte Zeitung unter den linken Arm. »Ach ja«, sagte er, »eines könnten Sie vielleicht noch tun. Schicken Sie mir doch eine Flasche Gin aufs Zimmer. Bitte.«
»Mach ich.«
»Danke Ihnen.«
Als er die Lobby verließ und zum Treppenhaus ging, konnte er in den Spiegeln erkennen, dass sie ihm nachsah. Er mochte sie, auch wenn er sie kaum kannte und sie bislang noch nicht einmal nach ihrem Vornamen gefragt hatte. Sie war nett. Ihre Blicke taten ihm gut. Sie waren wie ein warmes rotes Licht in seinem Rücken.
Talbot hatte das Zimmer 13 im ersten Stock. Wohin er auch kam, er nahm immer das Zimmer mit der Nummer 13. Oder eben irgendeine andere ungerade Zahl, wenn es nicht anders ging. Schließlich gab es sogar Hotels, in denen die 13 gar nicht existierte, obwohl sie Hunderte von Zimmern hatten; man übersprang die Zahl einfach.
Talbot war seit einer Woche in Deutschland und langsam gewöhnte er sich auch wieder an die Sprache. Früher – in einem anderen Leben, wie es ihm manchmal schien – hatte er öfter in Berlin zu tun gehabt. Er mochte die Stadt. Es gab eine kleine Kneipe dort, die er dann jedes Mal aufsuchte – nicht weit vom S-Bahnhof Friedrichstraße: Die ständige Vertretung. Was für grandiose Abende hatte er dort mit Bernie Taylor oder Maxwell Purdy verbracht, wenn sie gerade wieder einmal die Welt gerettet hatten. Bei dem Gedanken daran wurde er unwillkürlich ein bisschen wehmütig.
Irgendwie hatte er immer angenommen, die Agency würde über ein Gerät zur Auslöschung der Erinnerung verfügen, und als er damals seinen Abschied nahm, hatte er fest damit gerechnet, es nun zum ersten und letzten Mal zu Gesicht zu bekommen. Aber der alte Mr Night hatte ihm in seinem Büro lediglich die Hand geschüttelt, sich für seinen jahrelangen Einsatz bedankt und ihm für die Zukunft alles Gute gewünscht. Talbot war völlig überrascht gewesen.
Manchmal wünschte er, sie hätten tatsächlich ein solches Gerät gehabt.
Seit seinem Ausscheiden aus der Agency schlug er sich mehr schlecht als recht als Privatdetektiv durch. Gegenwärtig arbeitete er für eine junge Rumänin, die bei ihrer Botschaft in London untergekrochen war. So wie es aussah, war ihr ein Koffer mit kompromittierenden Unterlagen abhandengekommen, den er jetzt so schnell wie möglich wiederbeschaffen sollte. Dummerweise war das Ding bei einer Versteigerung im Internet aufgetaucht – was die Sache zusätzlich erschwerte.
Er erinnerte sich noch ganz genau an ihr Treffen. Es war kurz gewesen – 15, vielleicht 20 Minuten lang – und hatte im Wood Horse stattgefunden, einer kleinen, verwinkelten Kellerbar in Soho. Hier war alles auf rustikal getrimmt: von den geteerten Balken des Fachwerkimitats, über die rostigen Eisenlampen mit schwach flackernden Glühbirnen bis hin zu den Sägespänen, die den schmuddeligen Dielenfußboden bedeckten.
Sie war schon dort, als er ankam. Saß in einer dunklen Ecke wie ein Häufchen Elend und wirkte in dieser grob gezimmerten Umgebung so zerbrechlich, als sei sie aus hauchdünnem Glas. Auf dem wurmstichigen Eichenholztisch stand eine einzelne flackernde Kerze. Als Erkennungszeichen war eine auf dem Kopf stehende Zigarettenschachtel ausgemacht gewesen.
Er bestellte sich an der Bar ein Bier und ging damit zu ihrem Tisch hinüber.
Erschrocken sah sie auf, als er das Bierglas hinstellte. »Mr Talbot?«
»Ja, hallo.« Er zog sich einen dreibeinigen Schemel heran und setzte sich. »Miss Camataru, nehme ich an. Wir haben heute Vormittag telefoniert. Sie klangen sehr aufgeregt.«
Sie nickte und hielt ihm ihre schlanke Hand hin. Als er sie vorsichtig ergriff, sagte sie: »Ich bin Ilena Camataru. Danke, dass Sie so schnell kommen konnten, Mr Talbot. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Sie müssen mir helfen. Bitte!«
»Verraten Sie mir, wer mich empfohlen hat?«
Sie sah erstaunt aus. »Niemand.«
»Tatsächlich? Und woher haben Sie dann meinen Namen?«
»Aus dem Telefonbuch.« Sie blinzelte mit zusammengezogenen Augenbrauen, blickte verschämt auf ihre Hände. Dann schaute sie auf und sagte: »Ich habe einfach in den Gelben Seiten nachgesehen und dann die erstbeste Nummer gewählt.«
Er musste über sich selbst lächeln. Was hatte er sich gedacht, wie sie auf ihn gekommen war? Womöglich auf Empfehlung Ihrer Majestät? »Also schön, Miss Camataru, worum geht es denn?« Als sie nichts darauf erwiderte und ihn nur unverwandt anschaute, nahm er seine Zigaretten aus der Innentasche seines Jacketts, zog eine aus der Schachtel und steckte sie sich an. Dann hielt er ihr die Schachtel hin. »Möchten Sie auch eine?«
Sie schüttelte den Kopf. »Ich rauche nicht.«
»Na, dann schießen Sie mal los.« Er nahm einen kräftigen Schluck von seinem Bier. »Wie kann ich Ihnen helfen?«
»Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, Mr Talbot.« Abermals schlug sie die Augen nieder. »Es ist … es ist mir, ehrlich gesagt, sehr peinlich.«
»Das muss es nicht«, sagte er. »Das muss es wirklich nicht. Erzählen Sie einfach, was geschehen ist.«
»Ich habe einen schlimmen Fehler gemacht«, sagte sie. »Ich habe einem Mann vertraut, dem ich nicht hätte vertrauen sollen. Und diese Tatsache verfolgt mich jetzt. Wenn ich nicht sofort etwas unternehme, werde ich niemals wieder ein glückliches Leben führen können.« Sie sah ihn an, mit flackerndem Blick. »Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll.«
»Versuchen Sie es einfach, Miss Camataru«, sagte er. »Was ist denn so Schlimmes passiert, dass Sie nicht darüber sprechen können? Soll ich jemanden für Sie finden? Oder hat man Sie betrogen? Geht es um Geld?«
Augenblicklich, wenn auch fast unmerklich, veränderte sich ihr Gesichtsausdruck. Das Thema Geld war ihr also durchaus unangenehm. Talbot hätte wetten mögen, dass sich ihr Puls um eine Nuance beschleunigt hatte. Doch zu seinem Erstaunen sagte sie: »Nein, um Geld geht es nicht. Jedenfalls nicht im eigentlichen Sinn.« Ein nervöses Lächeln folgte. »Ich habe ein bisschen was gespart, wissen Sie? Es ist nicht viel, aber ich denke, es wird reichen, Sie zu bezahlen. Es geht um diesen Mann, den ich eben erwähnte; er hat etwas in seinem Besitz, das mir gehört.«
»Warten Sie, lassen Sie mich raten: Er hat ein Video von Ihnen gemacht, nicht wahr?«
Ihr Blick war auf die Tischplatte geheftet. »Fotos«, sagte sie leise und nickte.
»Und nun erpresst er Sie damit«, vermutete Talbot.
»Es geht ihm nicht um Geld, Mr Talbot. Er will mich einfach nur fertigmachen. Er will sich rächen, weil ich seine Drohungen und Gewaltausbrüche nicht länger ertragen und mit ihm Schluss gemacht habe. Wir haben zusammengelebt, seit wir aus Rumänien nach England kamen. Er hatte einen kleinen Job, aber er hat ihn verloren wegen seiner Trinkerei. Er hat den ganzen Tag nichts anderes mehr gemacht. Von morgens bis abends nur noch getrunken, getrunken, getrunken. Dabei hatte er versprochen, für uns zu sorgen. Und dann kam er eines Tages heim und sagte, er habe eine Arbeit für mich gefunden – als Bedienung in einem Lokal. Ich habe mich zuerst riesig gefreut, können Sie sich vorstellen. Doch als ich dort hinkam, entpuppte sich der Laden als Nachtklub.«
»Und, haben Sie den Job angenommen?«
Sie nickte, ohne ihn anzusehen.
»Die Aufnahmen sind auch dort entstanden?«
Wieder nickte sie stumm, fing an zu schluchzen und wischte sich mit dem rechten Ärmel über die Augen. »Ich habe von den Fotos erst erfahren, als ich drohte, ihn zu verlassen. Da hat er gesagt, er würde sie meiner Familie zeigen. Oh Gott, es ist alles so furchtbar.«
Er sah, dass sie log, zumindest etwas verschwieg, doch er ließ sich nichts anmerken. Was ging ihn das auch an? Schließlich war dies kein Verhör. Sie war seine Auftraggeberin, es war ihr gutes Recht, ihm nur das zu erzählen, was sie wollte. Während sie sprach, versuchte er, herauszufinden, wann sie die Unwahrheit sagte. Sehr deutlich konnte er erkennen, dass die Geschichte mit dem Mann, der ihr übel mitgespielt hatte, nur zum Teil stimmte. Sie sah immer wieder nach links oben, während sie sprach, pausierte, dachte nach, als würde sie in Erinnerungen nach ihrem Text kramen.
»Mal abgesehen davon, dass er diese Fotos hat«, sagte Talbot schließlich. »Belästigt Ihr Freund Sie noch? Oder bedroht er Sie sogar?«
»Nein.«
»Gut, das ist doch schon mal etwas Positives. Dann muss ich jetzt wissen, wie er heißt und wo ich ihn finde.«
»Das kann ich Ihnen nicht sagen.«
»Sie wissen nicht, wo er sich gegenwärtig aufhält?«
»Ich kann es Ihnen nicht sagen.«
»Ich verstehe nicht recht.« Talbot war irritiert. »Wenn Sie mir seinen Namen und seine Adresse nicht geben wollen – was, denken Sie, soll ich dann für Sie tun, Miss Camataru?«
Etwas stimmte nicht mit ihr. Trotzdem merkte Talbot, wie er von Minute zu Minute die Distanz verlor. Wie seine Professionalität angesichts dieses zerbrechlichen Wesens nach und nach flöten ging.
»Ich will ihm nicht schaden, wissen Sie? Ich will nur diese Fotos zurück. Wo er wohnt, ist jetzt sowieso zweitrangig geworden.« Ilena Camataru legte ihre Handtasche auf den Tisch, öffnete sie und entnahm ihr einen zusammengefalteten Zettel, den sie Talbot über den Tisch zuschob. »Allein das hier ist wichtig.«
Talbot betrachtete den Zettel, ohne danach zu greifen. »Was ist das?«
»Mein Problem.«
Talbot faltete das Blatt auseinander. Es war der Ausdruck einer laufenden eBay-Auktion. Es wurde ein kleiner, lederner Handkoffer versteigert, der sehr alt zu sein schien und nichts weiter enthielt als ein Notizbuch mit abgegriffenem Ledereinband und einige leere Blätter Papier. Talbot überflog den Text. Doch es kam nichts weiter Erhellendes dabei heraus. »Das ist ganz offensichtlich ein alter Koffer, Miss Camataru. Ehrlich gesagt verstehe ich nicht ganz, was das Ganze mit den Fotos zu tun hat, die Ihr Freund von Ihnen gemacht hat.«
»Er hat sie auf eine DVD gebrannt«, erklärte sie. »Und die ist in diesem Notizbuch versteckt.«
Talbot zog an seiner Zigarette, stieß den Rauch durch die Nase aus und drückte die Kippe in den Aschenbecher. »Und das wissen Sie genau?«
»Das Notizbuch hat er mir gezeigt«, versicherte sie. »Und er bewahrte es in diesem Koffer auf. Dessen bin ich mir ganz sicher.« Sie beugte sich über den Tisch und ergriff in einer plötzlichen, verzweifelten und seltsam anrührenden Geste seine Hände. »Sie besorgen ihn doch für mich, nicht wahr, Mr Talbot? Sie lassen nicht zu, dass jemand diesen Koffer ersteigert und die Bilder ansieht, oder? Ich flehe Sie an! Tun Sie das für mich? Bitte!«
»Ohne die Adresse Ihres Freundes wird es nicht gehen«, gab Talbot zu bedenken. »Nach meinem Dafürhalten wäre es das Beste, den Koffer von ihm zurückzufordern, solange er ihn noch in seinem Besitz hat. Ehe es überhaupt zur Versteigerung kommt«, fügte er hinzu.
»Ich möchte, dass Sie nach Deutschland reisen«, sagte sie, ohne auf seine Bemerkung einzugehen. »Einer der Bieter kommt von dort. Sie haben doch gesagt, Sie sprächen Deutsch. Sollte er den Zuschlag erhalten, sind Sie gleich an Ort und Stelle. Da ist noch ein weiterer Bieter hier in England, um den kümmert sich aber ein anderer.«
»Ein anderer?« Talbot fühlte den bitteren Stich verletzter Eitelkeit in der Magengrube. Und für einen kurzen Augenblick kam er sich tatsächlich wie der betrogene Rittersmann vor, der eben entdeckt hat, dass es noch einen Nebenbuhler um die Gunst der Prinzessin gab. Er versuchte, sich nicht allzu viel anmerken zu lassen. »Sie meinen, Sie haben noch jemanden auf den Koffer angesetzt, um ganz sicherzugehen?«
»Natürlich.« Sie sagte das, als sei es das Selbstverständlichste von der Welt. »Allerdings ist er ein Freund von mir, aus der Botschaft. Das sollte ich vielleicht dazusagen. Er macht das umsonst.«
Wie nett von ihm, dachte Talbot. Die ganze verworrene Geschichte kam ihm, gelinde gesagt, reichlich merkwürdig vor. Doch Geld stinkt nicht, und er konnte es gut gebrauchen. »Haben Sie eine Idee, woher ich die Adresse des deutschen Bieters bekomme?«
»Die gebe ich Ihnen, sobald ich sie kenne«, sagte sie. »Ich bin sicher, mein Freund in der Botschaft kann sie für mich herausfinden.«
»Beziehungen sind alles«, sagte Talbot, der sein Bier austrank und sich noch immer so durstig fühlte wie ein Kamel nach der Sahara-Durchquerung. »Okay. Kein Problem, ich fahre für Sie rüber zum Kontinent, Miss Camataru. Und wenn der Koffer in Deutschland ankommt und ich die Empfängeradresse kenne, fange ich ihn dort auch für Sie ab.«
»Danke, Mr Talbot. Danke, das werde ich Ihnen nie vergessen.«
»Schon okay«, sagte er. »Das wird aber nicht ganz billig. Denn dummerweise muss ich von etwas leben.«
»Um die Bezahlung machen Sie sich bitte keine Sorgen.« Sie klang etwas verstimmt. »Wie ich schon sagte: Ich habe ein bisschen was gespart.«
»Haben Sie ein Handy?«
»Nein, leider nicht.«
»Wie kann ich Sie dann erreichen?«
»Sie können mich in unserer Botschaft erreichen. Ich wohne dort, bis ich eine Wohnung gefunden habe.« Sie angelte sich das Blatt mit der eBay-Anzeige von der anderen Seite des Tisches und schrieb eine Nummer darauf. »Das ist die Durchwahl. Da haben Sie mich gleich am Apparat.«
Das war es gewesen. Dann war sie fort. Aufgestanden und verschwunden wie ein Geist. Wäre er nicht vollkommen nüchtern gewesen, er hätte im Nachhinein vielleicht geglaubt, sich alles nur eingebildet zu haben. Sie war fort und hatte ein Gefühl der Leere hinterlassen.
Die Zigarettenschachtel hatte noch auf dem Tisch gelegen und er hatte sie eingesteckt. Diese Frau war so dünn, so zerbrechlich gewesen. Mit glanzlosen Haaren, die wie staubige Fäden an ihrem schmalen Gesicht herabhingen. Ihre Kleider waren abgetragen und viel zu weit. Und dann diese Augen. Nie im Leben würde er sie vergessen können – diesen gehetzten Blick, diese Angst, diese Verzweiflung. Wenn all das gespielt war, dann musste sie eine verdammt gute Schauspielerin gewesen sein. Nun war sie vielleicht schon tot. Was für eine entsetzliche Verschwendung von Talent.
Im Nachhinein fragte er sich sogar, ob überhaupt ein Körnchen Wahrheit in dem steckte, was sie ihm erzählt hatte. Je länger er darüber nachdachte, umso absurder kam ihm das Szenario vor. Und doch hatte er den Wurm freiwillig geschluckt – mitsamt Haken, Blei und Leine.
Zum einen war er weder in der Position, noch hatte er den finanziellen Spielraum, einen Job ablehnen zu können – er wusste manchmal kaum, wie er die nächste Mahlzeit bezahlen sollte. Zum anderen war er von Ilena Camataru dermaßen gefesselt gewesen, dass er auf den Gedanken, ihr die augenfälligste aller Fragen zu stellen, erst nach ihrem Aufbruch gekommen war: Aus welchem Grund ersteigerte sie den verdammten Koffer nicht einfach selbst?
Talbot erreichte sein Zimmer im ersten Stock. Er trat ein, schloss die Tür hinter sich ab und ließ sich in den Sessel vor dem Fernseher fallen. Die Zeitung warf er neben sich auf den Boden. Heute konnte und wollte er sich nicht mehr mit der toten Schauspielerin befassen.
»Er hatte einen kleinen Job, aber er hat ihn verloren wegen seiner Trinkerei.«
Ilena Camatarus Worte klangen ihm noch immer wie ein unheilvolles Echo in den Ohren. Und die Erinnerung daran überflutete ihn nach wie vor mit einer Woge heißer Scham.
»Er hat den ganzen Tag nichts anderes mehr gemacht. Von morgens bis abends nur noch getrunken, getrunken, getrunken. Dabei hatte er versprochen, für uns zu sorgen.«
Sie hätte ebenso gut über ihn sprechen können. Ihn fröstelte.
Bald war es wieder so weit. Es kam jedes Mal wie ein Fieberanfall über ihn, und er konnte spüren, wie es kam. Es begann mit einem leichten Schaudern, mit Gänsehaut. Mit dem Gefühl, zu frösteln, obwohl es warm genug im Zimmer war. Und dann war da dieses schmerzhafte Ziehen in den Nieren. Ein Blick auf seine Hände genügte, um ihm zu zeigen, dass die Verwandlung kurz bevorstand. Zwar waren auf den Handrücken noch keine dunklen Haare zu sehen, ein untrügliches Zeichen jedoch waren die Monde seiner Fingernägel: Sie verfärbten sich bereits schwarz.
Lawrence Talbot, den seine wenigen Freunde »Larry« nannten, war drauf und dran, das Bewusstsein zu verlieren. Er gab sich noch etwa 45 Minuten. Nur in dieser Zeit vermochte er noch selbst zu kontrollieren, was er tat – alles, was darüber hinausging, lag jenseits seines Einflussbereiches.
In den zwei Nächten vor und nach Vollmond zeigten sich zwar immer noch Symptome der Wolfskrankheit, aber meist kam es während dieser Zeit zu keiner kompletten Verwandlung. Vorgestern war Vollmond gewesen. Wenn er Glück hatte, war es heute also nicht mehr ganz so schlimm. Nüchtern betrachtet, wäre es besser, der Sache ein für alle Mal ein Ende zu bereiten. Aber nüchtern betrachtete er die Dinge schon eine ganze Weile nicht mehr.
Es klopfte. Der Gin kam. Die junge Frau von der Rezeption brachte ihn selbst hoch. Sie trug die Flasche und einen Behälter mit Eis auf einem Tablett vor sich her.
»Danke.« Talbots finstere Miene hellte sich auf. Er wies auf die Anrichte. »Bitte stellen Sie es einfach da hin.«
»Ist das wirklich alles?« Sie sah ihn an, als befürchtete sie, er könne, wenn sie fortging, eine Dummheit begehen. »Ich meine …«
»Ja?«
»Es geht mich ja eigentlich nichts an, aber …« Sie stockte. »Sie sehen heute etwas … wie soll ich sagen? Etwas angeschlagen aus, Mr Talbot. Und da habe ich mich gefragt, ob Sie vielleicht noch einen Tee möchten oder …« Sie errötete und fuhr sich verlegen mit der Hand durchs Haar.
»Ich weiß Ihre Besorgnis zu schätzen«, sagte er. »Und ja, Sie haben recht. Ich fühle mich heute tatsächlich nicht besonders.« Allerdings schon sehr viel besser, seit Sie da sind, dachte er, sprach es jedoch nicht aus. »Möglicherweise liegt es am Wetter.« Schmunzelnd zog er die Augenbrauen hoch. »So viel Sonnenschein sind wir Briten einfach nicht gewohnt.«
Sie quittierte seinen kleinen Scherz mit einem Lächeln. »Okay, wenn es nur das ist, bin ich beruhigt. Ich sehe Sie morgen beim Frühstück, Mr Talbot.«
»Ganz bestimmt.« Und dann, als sie sich umwandte: »Warten Sie. Einen Augenblick noch, bitte.«
»Ja?«
Er hatte sie nach ihrem Vornamen fragen wollen. Doch plötzlich fand er, es sei doch nicht der richtige Zeitpunkt. Wer zum Teufel war er, dass er sich einbildete, sie könne auch nur einen Hauch von Interesse an ihm haben? Sie war blutjung – bestimmt 15 Jahre jünger als er –, eine bildhübsche, kerngesunde Frau, die nach Seife duftete. Und er kam sich klein und ekelhaft vor, mit der Flasche Gin dort auf der Anrichte, seinem verschwitzten Tweedanzug und den von Minute zu Minute dunkler werdenden Fingernägeln. »Ach, nichts«, sagte er schließlich.
»Dann wünsche ich Ihnen eine gute Nacht, Mr Talbot.«
»Danke. Gute Nacht.«
Talbot trank so lange, bis die Flasche leer war und er kaum noch stehen konnte. Irgendwie musste er auch noch diese Nacht hinter sich bringen, ohne die Zimmereinrichtung zu ruinieren. Morgen würde er sich um die Rumänin kümmern, das Gesicht in der Zeitung, die falsche Durchwahlnummer in der Botschaft. Bestimmt gab es für all das eine ganz plausible Erklärung. Morgen. Bei Tage betrachtet, sah meist alles viel freundlicher aus. Nur noch diese eine Nacht.
Aber auch die Tage schienen ihm mittlerweile unter den Fingern zu zerfallen.
Adrian
Night’s Agency, London, England
Mr Darwin Night, Seniorpartner der Agentur Night & Sons, stand im unterirdischen Rechenzentrum der Agency, tief unter dem Londoner Parlamentsgebäude, an einem der zahllosen Pulte und blickte fast gleichmütig auf den riesigen Hauptschirm an der Wand. Wobei die Betonung auf fast liegen sollte, denn Mr Night war ein Mann, auf dessen Schultern stets eine unglaubliche Verantwortung lastete. Daher sah er auch immer ein bisschen angestrengt aus, so als hätte er gerade einen Autoreifen mit dem Mund aufgeblasen oder vor lauter Konzentration fünf Minuten lang das Ein- und Ausatmen vergessen.
Der Raum, in dem sich Mr Night und etwa 30 weitere, mit Headsets ausgestattete Personen befanden, erinnerte an das Rechenzentrum für Weltraummissionen der NASA in Houston und war bis auf die Bildschirme und die LED-Lampen an den einzelnen Pulten abgedunkelt. Überall surrten Computer. Der Hauptschirm zeigte die aktuelle eBay-Seite, während der Countdown akribisch die letzten drei Minuten in Hundertstelsekunden bis zum Angebotsende herunterzählte. Eine reine Routinesituation, wie es schien. Eine, wie sie täglich hundertfach vorkam.
Alter Koffer – Dachbodenfund
Restzeit: 0 Tage 2 Min. 59 Sek. (20. Juli 2011 22:38:58 MESZ)
Verkäufer: xmouse29 (327)
Biete alten Koffer mit Messingbeschlägen. Enthält ein leeres Notizbuch (sieht sehr alt aus) und einige Blätter vergilbtes Papier mit div. Rissen (siehe Fotos). Koffer und Inhalt befanden sich, soweit ich weiß, seit Jahrzehnten auf unserem Speicher. Monogramm MWSH auf Kofferdeckel geprägt.
Artikelstandort: Horsham, UK Versand weltweit 1 Bieter
Das aktuelle Gebot stand bei £ 3,50 und niemand machte sich ernsthafte Sorgen. Außer Mr Night natürlich, dessen Hauptaufgabe darin bestand, sich Sorgen zu machen.
»Wie sieht es aus, Mr Purdy?«, fragte er, die Daumen in seine Westentaschen gehakt und ohne den Blick vom Hauptschirm abzuwenden. »Kommen wir zurecht?«
»Ja, Sir. Positiv.« Agent Maxwell Purdy, ein schlaksiger junger Mann mit glatten, etwas zu langen blonden Haaren sah kaum auf, während er sprach. »Alles im grünen Bereich, Sir.«
Sie sind zurzeit der Höchstbietende, stand in grünen Buchstaben in der oberen linken Ecke des Bildschirms.
Natürlich waren sie das. Schließlich ging es um Leben und Tod. Um den zur Versteigerung stehenden Koffer auch tatsächlich zu bekommen, hatte die Agency einige strenge Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Neben verschiedenen anderen Möglichkeiten verfügte Night & Sons über ein globales, satellitengestütztes Netz von Störsendern, die bei Transaktionen dieser Art gewöhnlich zum Einsatz kamen. Sollte irgendjemand anders ein Gebot abgeben, die Bloodhound genannte Software der Agency würde es innerhalb von Millionstelsekunden aufspüren und die Internetverbindung des Bieters sofort kappen. Das war ein bisschen unfair, ja klar. Aber man wollte schließlich kein Risiko eingehen. Die Erfahrung hatte sie gelehrt, dass es für jeden Dreck einen Interessenten gab und sich immer noch irgendwo auf der Welt ein Spinner fand, der sich sogar für alte Nachttöpfe und Urinstein erwärmte.
»Und wie steht es mit Ihnen, Laurie?«
»Das mit der Lepra ist nur ein ganz gemeines Gerücht, Sir, das in der Kantine kursiert«, entgegnete Laurie, der als Überwachungstechniker nicht gerade zu den Lieblingen des Chefs gehörte. »Eine starke Akne, nichts weiter. Aber mein Hausarzt glaubt, er kriegt das hin.«
»Hören Sie auf, herumzualbern, Laurie.« Mr Night war nicht zu Scherzen aufgelegt. Sein Blick war ebenso eisig wie seine Stimme. »Ich will wissen, ob die Systeme einwandfrei arbeiten, Herrgott noch mal!«
Agent Laurie war dafür zuständig, dass alles reibungslos lief, die Computer und Server funktionierten und sich niemand in das System einhackte. Laurie war seit neun Jahren dabei, eine absolute Koryphäe auf seinem Gebiet. Dass Mr Night ihn als einzigen Mitarbeiter nur mit seinem Nachnamen ansprach, empfand er als pure Respektlosigkeit. Eine Respektlosigkeit, die ihn zutiefst schmerzte. Da war auch die überdurchschnittlich gute Bezahlung von 80 000 Pfund im Jahr kein Trost, denn sein schickes Loft in Shad Thames und der Lotus Esprit waren äußerst kostspielige Hobbys. Er mochte der unsportlichste und beleibteste Mann der ganzen Agency sein – doch was das Computersystem anging, machte ihm niemand etwas vor. Nach ihm wurde immer nur geschrien, wenn es Probleme gab.
»Tut mir leid, Sir«, sagte Laurie kleinlaut. Hastig zerkaute er das Sahnebonbon, auf dem er herumlutschte, und schluckte es runter. »So wie es aussieht, ist alles okay.« Er wischte sich mit einem Handtuch den Schweiß von Stirn und Nacken und schraubte seine Wasserflasche auf. Die Arbeit und die wochenlangen Vorbereitungen hatten ihn völlig geschafft. In letzter Zeit hatte er immer öfter das Gefühl gehabt, dringend einen Tapetenwechsel zu benötigen. Schon zu Beginn der laufenden Operation hatte Laurie bei Night erfolgreich um Urlaub nachgesucht. Wenn das hier erledigt war, würde er erst mal ausgiebig Ferien machen. Auf seine Art.
Denn er hatte etwas ganz Besonderes vor. Er würde eine Party geben. Zu Ehren seines Bruders, der vor einigen Jahren auf so schreckliche Weise ums Leben gekommen war. Und was das für eine Party werden würde! Eine, die man so schnell nicht wieder vergaß. Ein ehemaliger Mitarbeiter der Agency stand ganz oben auf der Gästeliste. Ihn endlich persönlich kennenzulernen, darauf freute Laurie sich am meisten. Er hing noch immer diesen Gedanken nach und machte Pläne, als es plötzlich passierte!
Zwei Sekunden vor Schluss der Auktion wurde die Schrift auf dem Bildschirm plötzlich rot und es tauchte eine neue Nachricht auf: Sie wurden überboten!
Keine Sekunde später fing die rote Lampe neben dem Hauptschirm drohend an zu blinken. Beinahe im selben Augenblick begann der Alarm zu schrillen. Ein entsetzliches, ohrenbetäubendes Geräusch, das jeder im Raum nur aus der Theorie kannte.
»Machen Sie was, Laurie!« Mr Night war außer sich. Eine solche Situation hatte es noch nie zuvor gegeben. »Verdammt noch mal«, schrie er, »machen Sie was! Und um Himmels willen, machen Sie es schnell!«
Talstraße 13, Ingolstadt, Deutschland
In genau dieser Sekunde lag ein 14-jähriger Junge namens Adrian Bertram angezogen auf seinem Bett, starrte schmollend die an die Zimmerdecke geklebten Sternbilder an, die in der Dunkelheit über ihm leuchteten, und malte sich aus, wie es wäre, einfach in ein Raumschiff steigen und mit Lichtgeschwindigkeit in eine andere Galaxie abhauen zu können.
Im Augenblick herrschte nämlich dicke Luft bei den Bertrams. Nachdem Adrian mal wieder eine Fünf in Mathe mit nach Hause gebracht hatte, war seiner ansonsten friedliebenden Tante Margret der Kragen geplatzt und sie hatte ihm Computerverbot erteilt. Denn der Kasten, wie sie den PC abfällig nannte, war ihrer Meinung nach an Adrians schlechten Noten schuld. Was für ein Quatsch! Sie tat ja fast so, als würde einem der Rechner das Gehirn raussaugen, wenn man ein bisschen zu lange vor dem Bildschirm saß. Offenbar war sie der Ansicht, Computer seien einzig dazu da, die Schüler von heute zu verderben. Dabei sollte sie es doch eigentlich besser wissen, schließlich arbeiteten sie sogar in der Schule damit, und Tante Margret war bis zu ihrer Pensionierung vor einem Jahr selbst Lehrerin an seiner Schule gewesen.
Natürlich hatte sie gleich Nägel mit Köpfen gemacht. Anstatt ihm nur zu verbieten, den Rechner zu benutzen, hatte sie ihn komplett abgebaut und in einen Schrank in ihrem Schlafzimmer eingeschlossen.
Adrian war stinksauer.
Auf seinem Schreibtisch lag die verhauene Mathearbeit. Seine Tante hatte ihm den ganzen Nachmittag lang Vorhaltungen deswegen gemacht. Selbst beim Abendessen war keine Ruhe eingekehrt. Ihre Stimme klang ihm noch immer in den Ohren. Und am Ende hatte sie sich sogar geweigert, die blöde Arbeit zu unterschreiben – und das nur, weil er keine Lust gehabt hatte, sich wie ein Baby mit ihr hinzusetzen und Aufgabe für Aufgabe durchzugehen, ehe er die Berichtigung machte. Dabei musste Tante Margret ja wohl am besten wissen, dass er wegen der fehlenden Unterschrift morgen reichlich Stress bekommen würde. Als wäre das Computerverbot nicht schon Strafe genug gewesen. Und jetzt saß sie unten gemütlich vor dem Fernseher und sah sich den neuesten Tatort an, während er hier oben herumlag und gar nichts tun konnte. Was für eine fürchterliche Ungerechtigkeit!
Adrian drehte sich auf die Seite, stützte sich auf den Ellenbogen und klappte das Fotoalbum auf, das neben ihm auf dem Bett lag. Tante Margret war die älteste Schwester seines Vaters. Kein Mann, keine Kinder. Zum Heiraten hatte sie, wie sie niemals müde wurde zu erklären, nie die Zeit gefunden. Adrian lebte seit drei Jahren bei ihr und ihren zwei Hunden, nachdem seine Eltern in Kanada bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen waren. Ihr Flugzeug, eine kleine Propellermaschine, mit der sie ganz allein unterwegs gewesen waren, hatte einen Berg gestreift und war zerschellt. Genaueres hatte er nie erfahren; was entsetzlich für ihn war, denn er besaß eine ausgeprägte Fantasie und stellte sich oft vor, wie das Flugzeug in einem gleißenden Feuerball explodierte und seine Eltern beim Aufprall in Stücke gerissen wurden.
Manchmal, wenn seine Sehnsucht nach ihnen zu groß wurde und er es gar nicht mehr aushielt, nahm er sich das alte Fotoalbum seiner Mutter vor. Die Bilder gaben ihm ein gutes Gefühl. Denn alles, was er von seinen Eltern noch besaß, waren diese Fotos – und seine Erinnerungen. Mama lachend mit Strohhut auf einer Kaimauer am Hafen, die Sonne sprenkelt das Wasser mit goldenen Tupfen. Papa beim Besteigen eines am Boden knienden Kamels. Der kleine Adrian irgendwo in Marokko in ein Tuch vor Mamas Bauch gewickelt. Du meine Güte, sie hatten so unglaublich viel zusammen unternommen! Auch wenn er damals noch zu jung gewesen war, um sich an jedes Detail zu erinnern, so war er mit ihnen doch ganz schön herumgekommen. Seine Eltern waren, so schien es ihm, immerzu auf Achse gewesen, immerzu in Bewegung. Das hatte ihr Beruf so mit sich gebracht, denn die beiden waren Flugkapitäne bei einer großen deutschen Fluggesellschaft gewesen.
Seine Tante war das genaue Gegenteil. Sie war weiß Gott keine Einsiedlerin, aber irgendwie überhaupt nicht in der Lage, länger als ein paar Tage von zu Hause fort zu sein. Ihr Haus und der Garten waren alles für sie.
Es klopfte an der Tür. Adrian klappte das Album zu und warf es neben das Bett. Dann rief er: »Ja?«
Es war Tante Margret. Wer denn auch sonst? Ein achtäugiger Außerirdischer vielleicht, der gekommen war, um mit ihm einen Rundflug durchs All zu machen? Sie schloss die Zimmertür und setzte sich zu ihm auf die Bettkante.
»Na, junger Mann, immer noch nicht ausgezogen? Es ist schon halb elf durch.« Junger Mann – so nannte sie ihn meistens; nur wenn er etwas ausgefressen hatte, sprach sie ihn als Adrian an. »Wie ich sehe, hast du dir dein Album angeguckt.« Und als er nach einer Weile nickte, fügte sie hinzu: »Du bist also noch immer sauer auf mich, stimmt’s?«
Klar! Was für eine Frage! Natürlich war er noch sauer auf sie. Wie konnte er es nicht sein. Sie hatte ihm seinen PC weggenommen!
»Ein bisschen«, grummelte er.
Tante Margret lächelte. Dann streckte sie die Hand aus und strich ihm sanft übers Haar. »Du weißt genau, weshalb ich den ollen Kasten weggesperrt habe.«
Ja, weil er mir das Gehirn raussaugt. »Ja, weil ich die Arbeit vergeigt habe.«
»Nein, weil du jede freie Minute davor verbringst. Du machst kaum noch etwas anderes.«
»Ich benutze ihn ja auch für die Schule«, sagte Adrian lahm.
»Wenn es mal so wäre.« Sie schmunzelte. »Du verlernst noch das Schreiben, wenn du so weitermachst, Adrian. Überleg mal – zu meiner Zeit gab es sogar Noten für die Handschrift.«
Adrian stieß einen zentnerschweren Seufzer aus. Zu meiner Zeit, du meine Güte! Sie war gerade mal 65 und tat fast so, als sei sie in der Steinzeit zur Schule gegangen. Wenn man sie so reden hörte, konnte man fast glauben, sie habe noch mit Hammer und Meißel geschrieben.
»Und wann kann ich den PC wiederhaben?«
»In ein paar Tagen.«
»Das ist echt gemein.«
»Ich tue das nicht, um dich zu ärgern, junger Mann«, sagte Tante Margret. »Ich wollte nur, dass du das weißt.«
»Ach, und warum unterschreibst du dann die Mathearbeit nicht?«
»Ich habe dir heute Nachmittag meine Hilfe angeboten, oder etwa nicht? Und was hast du getan? Du hast mich angeschrien, Adrian. Deshalb unterschreibe ich die Mathearbeit nicht. Du musst einfach lernen, für das, was du tust, Verantwortung zu übernehmen.«
»Das ist ja ganz toll.« Adrian warf sich wieder aufs Bett und verschränkte schnaufend die Arme vor der Brust.
»Du wirst mir noch mal dankbar sein.«
»Ja, sicher.« Adrians Stimme klang wie Gewittergrollen.
Seine Tante sah ihn an. Er war groß geworden in den letzten drei Jahren, und es wurde nicht einfacher mit ihm. Manchmal wünschte sie, sie hätte jemanden an ihrer Seite, jemanden, der sie ein bisschen unterstützte.
»Ich bin müde. Ich gehe ins Bett.« Sie stand auf und ging zur Tür. »Tu mir den Gefallen und zieh dich auch aus, ja? Und vergiss nicht, das Licht auszumachen. Gute Nacht.«
»Gute Nacht.«
Dann war die Tür zu. Adrian hörte, wie seine Tante hinunterging, im Wohnzimmer und in der Küche die Jalousien herunterließ und die Haustür absperrte, während er auf dem Bett lag und über ihr Gespräch nachdachte. Im Grunde hatte sie ja recht. In letzter Zeit saß er oft sehr lange vor dem PC. Und meistens surfte er im Internet. Aber dass er jede freie Minute vor dem Bildschirm verbrachte, stimmte einfach nicht. Dazu hatte er viel zu viele andere Interessen.
Was ihn an dem Computerverbot eigentlich am meisten ärgerte, war, dass er seine Auktionen nicht beobachten konnte. Denn er hatte eine ausgeprägte Schwäche für Rätsel und Geheimnisse. Er liebte Sherlock Holmes und James Bond. Und wenn er nicht gerade einen Agententhriller las oder ein spannendes Krimihörspiel hörte, experimentierte er mit seinem Detektivkoffer herum, baute Alarmanlagen, nahm Fingerabdrücke oder rührte irgendwelche Geheimtinten zusammen. Sogar ein richtiges Geheimversteck hatte Adrian sich eingerichtet – es lag hinter einer als Bücherregal getarnten Tür in Tante Margrets Arbeitszimmer verborgen. Eben diese Schwäche für alles Rätselhafte und Geheimnisvolle war es auch, die ihn hin und wieder auf Dinge bieten ließ, von denen er sich ein wenig Nervenkitzel versprach. Dinge, die sonst niemanden zu interessieren schienen. So wie diesen verdreckten, alten und verbeulten Koffer, den er neulich entdeckt hatte und der angeblich nichts weiter enthielt als zwei vergilbte Bögen Blankopapier und ein leeres Notizbuch. Das war ihm so ungewöhnlich vorgekommen, dass er gleich ein Gebot abgegeben hatte. Mit etwas Glück war er der einzige Bieter geblieben.
Adrian nahm sich vor, gleich morgen nach dem Unterricht bei Herrn Waldmann, dem Hausmeister seiner Schule, vorbeizugehen und nach dem Koffer zu sehen. Herr Waldmann war nämlich ziemlich gut ausgerüstet. Er hatte nicht nur die obligatorische Kaffeemaschine in seinem Hausmeisterkabuff stehen, sondern auch einen superschnellen Rechner mit Internetzugang. Waldmann war bei Lehrern und Schülern gleichermaßen beliebt, doch Adrian kam besonders gut mit ihm zurecht, was womöglich daran lag, dass Herr Waldmann Tante Margret noch aus dem aktiven Schuldienst kannte und sich seit Jahr und Tag um ihren Garten kümmerte. Häufig kam er bei ihnen zu Hause vorbei, um Reparaturen am Haus auszuführen oder einfach nur nach dem Rechten zu sehen. Für Adrian, der Herbert Waldmann schon beinahe ebenso lange kannte, wie er bei seiner Tante wohnte, war der Hausmeister im Laufe der Jahre so etwas wie ein väterlicher Freund geworden, mit dem er über Gott und die Welt reden konnte. Wenngleich Adrian es natürlich niemals gewagt hätte, ihn beim Vornamen zu nennen, kamen sie doch ziemlich gut miteinander klar. Nicht selten verbrachte er ganze Nachmittage in Herrn Waldmanns Kabuff und machte oft noch vor der Schule seine Hausaufgaben dort.
Der Koffer lief ihm nicht weg. Jetzt musste Adrian erst mal das Problem mit der fehlenden Unterschrift in den Griff kriegen.
Sie einfach zu fälschen, kam nicht infrage. Denn so wie er Tante Margret kannte, würde sie sich in ein oder zwei Tagen doch noch dazu herablassen, das Heft abzuzeichnen. Sie würde nur sichergehen wollen, dass er die Schmach einer Rüge hatte ertragen müssen. Also musste die Unterschrift zwar morgen früh um acht da sein, wenn Frau Krailsmeyer sie sehen wollte, indessen wieder verschwinden, ehe seine Tante das Heft am Nachmittag in die Finger bekam.
Adrian rollte sich vom Bett herunter und stand schwungvoll auf. Er öffnete die oberste Schublade des Schreibtisches, nahm sie ganz heraus und stellte sie vorsichtig auf den Boden. Dann griff er abermals in das Fach und tastete nach der flachen Pappschachtel, die er mit doppelseitigem Klebeband von unten an die Tischplatte geklebt hatte. Er riss sie ab, setzte die Schublade wieder ein und öffnete die Schachtel. Ein Stift mit farbloser Miene, wie bei einem Tintenkiller, zwei kleine Plastikfläschchen und ein Wattebausch lagen darin.
Tante Margrets Unterschrift war nicht sehr schwierig und sie ging ihm mittlerweile recht leicht von der Hand. Trotzdem gönnte er sich zwei Testläufe auf Schmierpapier, ehe er sich das Matheheft vornahm und mit dem farblosen Stift den Namen seiner Tante in schwungvollen, wenn auch unsichtbaren Schlaufen unter die Bemerkungen seiner Klassenlehrerin schrieb.
Jetzt konnte er die Schrift ganz nach Belieben sichtbar oder unsichtbar machen – es kam nur darauf an, mit welcher Chemikalie er den Wattebausch tränkte, ehe er darüberstrich.