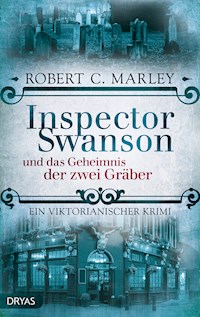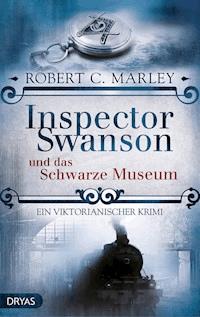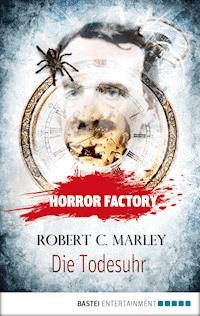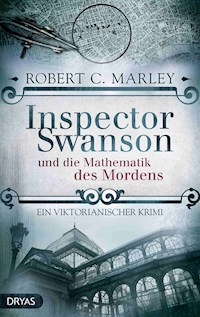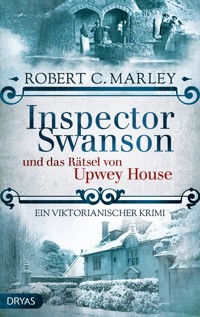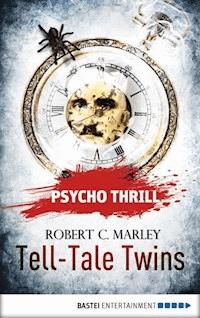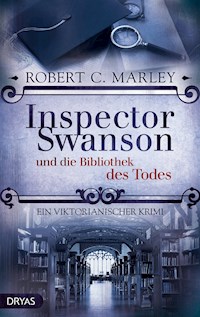
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Dryas Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Inspector Swanson: Baker Street Bibliothek
- Sprache: Deutsch
England 1895 – Oscar Wilde kämpft in London um seinen Ruf und seine Karriere, als sich in Oxford ein brutales Verbrechen ereignet: Ein angesehener Professor für englische Literatur wird in der Bodleian Library erschlagen aufgefunden. War es der Racheakt eines Studenten? Neid unter Kollegen? Oder liegt das Motiv vielmehr in einem alten, geheimnisvollen Buch, das seit dem Mord verschwunden ist? Chief Inspector Swanson und sein Team sind mit einem undurchdringlichen Netz aus Lügen, Verstrickungen und Intrigen konfrontiert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 261
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
InspectorSwanson
und dieBibliothek des Todes
Ein Kriminalromanaus dem Jahre 1895von Robert C. Marley
Für Wolf-Dieter Haase –lebendiges Vorbild
Und in liebevollem Gedenkenan Hans Lefeber23.07.1950 – 27.11.2019undNevill Swansongest. 11.07.2020
»Gesunder Menschenverstandist der Feind aller Romantik.Lassen Sie uns etwas Unwirklichkeit.Machen Sie uns nicht allzu vulgär vernünftig.«
Oscar Wilde
Inhalt
Vorbemerkung
PROLOG
ERSTER TEIL OSCAR
KAPITEL 1 49 Gordon Square, Bloomsbury, London, 28. Februar 1895
KAPITEL 2 16 Tite Street, London, 1. März 1895
KAPITEL 3 Carters Hotel, London
ZWEITER TEIL OXFORD
KAPITEL 4 New Scotland Yard, 27. März 1895, Whitehall, London
KAPITEL 5 Oxford, 30. März 1895
KAPITEL 6
KAPITEL 7 Bodleian Library, Oxford
KAPITEL 8
KAPITEL 9
DRITTER TEIL DONALD
KAPITEL 10 Oxford
KAPITEL 11 Oxford, 1. April 1895
KAPITEL 12
KAPITEL 13 Oxford, 2. April 1895
KAPITEL 14
VIERTER TEIL BOYLE, EDWARDS & BOWDEN
KAPITEL 15 Oxford, 3. April 1895
KAPITEL 16 Bodleian Library, Oxford
KAPITEL 17 London, 4. April 1895
KAPITEL 18 Fentimen’s Hotel, Oxford
KAPITEL 19 Broad Street, Oxford, 5. April 1895
FÜNFTER TEIL MISS HILL
KAPITEL 20
KAPITEL 21 6. April 1895, Oxford
SECHSTER TEIL GANESHA
KAPITEL 22 Bodleian Library, Oxford, 7. April 1895
EPILOG
Personen & Begriffe
Danksagung
Vorbemerkung
Bücher, die Trost spenden. Bücher, die traurig machen. Bücher, die Kraft geben. In meinen Schreibkursen sage ich meinen Schülerinnen und Schülern: Bücher sollten so sein wie ein erfülltes Leben – alles andere als langweilig. Am Ende sollten wir auf unser Leben zurückblicken können und sagen: »Mensch, es war zwar nicht immer einfach, aber es war spannend. Das Buch würde ich noch einmal lesen wollen.« In diesem hier geht es unter anderem um Oscar Wilde. Sein späteres Leben und sein tragisches Schicksal werden für ihn selbst sicherlich oft schwer genug zu ertragen gewesen sein. Und dennoch: Rückblickend muss man sagen, es war ein spannendes Leben, ein Leben wie ein Roman.
Es sei noch hinzugefügt, dass die Handlung dieses Romans teilweise parallel zum Vorgängerband angesiedelt ist.
R. C. M.
PROLOG
»Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.«
Ps. 91, 11-12
Bodleian Library, Oxford, 28. Februar 1895
Mr Bernard Wilkes, seines Zeichens Verwalter und Archivar der berühmten altehrwürdigen Bibliothek der Universitäten von Oxford, zog die Schublade seines Schreibtisches auf, in der seine Taschenuhr lag.
Gleich fünf.
Die rechte Zeit, um nachzuschauen, ob sich noch jemand in den gut behüteten Räumen aufhielt, über die er wachte, ehe er die Türen schloss.
Das Aufziehen der Schublade war mehr eine Marotte als eine notwendige Handlung für ihn, denn Mr Wilkes hatte in den beinahe zwanzig Jahren, die er nun bereits im Dienste der Bibliothek stand, ein nahezu untrügliches Gespür für Zeit entwickelt. Es wäre nicht notwendig, auf die Uhr zu schauen. Ganz und gar nicht. Er hatte es im Gefühl, wenn die rechte Zeit gekommen war.
Mr Wilkes kannte keine Eile.
Eile war etwas, das nicht in diese Umgebung passte. Die ersten Steine des alten gotischen Gebäudes waren im Mittelalter gesetzt worden. Könige und berühmte Gelehrte hatten in diesen Räumen studiert und taten es noch. Nein, nichts und niemand gemahnte einen hier zur Eile. Zu Pünktlichkeit vielleicht, zu Ordnung und Anstand. Nicht jedoch zu Hast und Eile. Der Fluss der Zeit war ewig und konstant.
Wenn Mr Wilkes am späten Nachmittag seinen Rundgang antrat, die Lichter löschte, vergessene Bücher in die deckenhohen Regale zurückstellte und nachschaute, ob sämtliche Durchgänge und Türen sorgfältig verschlossen waren, spürte er jedes Mal sehr deutlich: Die Bibliothek mit all ihrem Wissen würde auch in fünfhundert Jahren noch genau hier an dieser Stelle stehen. Eine unsterbliche Göttin, unter deren Blick ein Menschenleben nicht länger währte als ein Wimpernschlag. Er und all die studierten Leute, die Studenten mit ihren Kladden und die Professoren mit ihren Macken und Schrullen, all die geduldeten Besucher wären dann längst nichts weiter mehr als bloß noch eine vage Erinnerung.
Er griff gelassen in die Schublade und nahm die Whiskyflasche und einen kleinen Silberbecher heraus, die darin lagen, dann schenkte er sich ein und stellte den kleinen Becher, ohne davon zu trinken, auf den Schreibtisch, ehe er sich erhob, um seine letzte Runde anzutreten. Wie alles um ihn herum wäre auch der Whisky noch hier, wenn er zurückkam.
Wenn er zurückkam.
Soweit er sagen konnte, hielten sich zu diesem Zeitpunkt noch drei Personen im Lesesaal auf.
Carstairs, ein Student der Rechtswissenschaften, den die Bibliothek für Hilfsarbeiten bezahlte und der sicherlich nach Schließung der Räume noch bis halb sieben blieb, um Papiere zu sortieren und abzuheften. Professor William Glaister, der Altgrieche, wie Mr Wilkes ihn insgeheim nannte – ein Mann, der Sonderrechte genoss, weil seine Familie jährlich eine stattliche Summe Geldes an die Bibliothek spendete – und Professor Alistair Hargraves.
Der hatte vor etwa einer halben Stunde nach einem Buch gefragt. Wilkes hatte ihm die Regalnummer herausgesucht und ihn daran erinnert, dass ihm nicht mehr als dreißig Minuten blieben.
Hargraves, der dafür bekannt war, kaum noch auf seine Uhr zu achten und Raum und Zeit zu vergessen, sobald er erst mal in der Bibliothek an etwas arbeitete, hatte ihm versichert, er würde nicht mehr als fünfzehn, allerhöchstens zwanzig Minuten benötigen. Und nun war er noch immer nicht wieder zurück.
Mr Wilkes seufzte, dachte, dass er mal wieder ein ernstes Wort mit dem Professor würde sprechen müssen, und wollte eben nach seinem Schlüsselbund greifen und sich auf den Weg machen, als die Tür zur Eingangshalle geöffnet wurde und Miss Hill den Empfangsraum betrat.
Bernard Wilkes, unverheiratet und mit seinen zweiundfünfzig Jahren weit über das Alter hinaus, wo er noch damit rechnete, eines Tages zu heiraten, geschweige denn eine Familie zu gründen, spürte, wie sein Herz beim Anblick der jungen Frau einen freudigen Sprung machte.
»Guten Abend, Miss Hill«, sagte er in einem Ton, der, wie er hoffte, nicht verriet, was in ihm vorging, und tippte sich mit zwei Fingern zum Gruß an die Stirn. »Herrlicher Tag, nicht wahr?«
Miss Hills strahlend blaue Augen leuchteten wie kostbare Aquamarine. »Oh ja, Mr Wilkes«, entgegnete sie lächelnd und deutete einen Knicks an, wobei sie den Saum ihres schlichten Kleides ein wenig anhob.
Mr Wilkes wusste kaum etwas über sie. Dem Akzent nach musste sie gebürtig aus Irland stammen. »Ein besonders schöner Tag. Vielleicht eine Spur zu heiß um die Mittagsstunde.«
»Gewiss.«
Jedes Mal, wenn er Miss Hill sah, ging ihm das Herz auf. Er war indes stets sorgsam darauf bedacht, unverfänglich zu bleiben und sich nicht anmerken zu lassen, welche Gefühle sie in ihm auslöste.
Sie war wunderschön, hatte makellose weiße Haut, lustige Sommersprossen auf der Stirn und feuerrotes Haar, das ihre blauen Augen noch mehr zur Geltung brachte, und das sie für gewöhnlich offen trug. Eine Ungezogenheit, die sich keines der Hausmädchen erlaubt hätte, die in den Familien der Professoren ihren Dienst taten. Und dann ihr Lächeln. Sie hatte das bezauberndste Lächeln, das Mr Wilkes jemals gesehen hatte. Ohne indiskret zu werden, hatte er nicht in Erfahrung bringen können, wie alt sie war. Er schätzte sie auf Anfang dreißig.
Obwohl Mr Wilkes nicht einmal ihren Vornamen kannte, malte er sich gelegentlich aus, wie es sein würde, Miss Hill einmal bei Kerzenschein gegenüberzusitzen.
Wie gerne würde er sie eines Tages fragen, ob sie ihn ins Pub begleiten oder mit ihm ein Restaurant aufsuchen würde. Sie war eine von seinesgleichen. Standesschranken gab es zwischen ihnen nicht zu beachten. Wäre er nur mutiger gewesen. Doch er war sich nicht sicher, wie sie darauf reagierte. Sie nach einer Verabredung zu fragen, hatte er noch nicht gewagt. Und würde es vermutlich niemals tun. Er neigte nicht zu Leidenschaft, Mut und Abenteuer, war kein feuriger Liebhaber, war es nie gewesen.
Er liebte die Romantik.
Und so hatte er sich nie ein Herz gefasst und ihr gestanden, wie gern er sie mochte. Seit er ihr vor etwa einem Jahr das allererste Mal begegnet war, begnügte er sich damit, sie in aller Stille und aus der Ferne zu verehren.
Bis auf einige kurze Konversationen, in denen es lediglich um die Arbeit für die Bibliothek, das Wetter oder eine kleine Besorgung gegangen war, hatte er noch kein privates Gespräch mit ihr geführt.
Er legte den Federhalter vor sich auf die Schreibtischunterlage. »Äh, Miss Hill?«
Sie blieb stehen und wandte sich zu ihm um. »Ja, Mr Wilkes?«
Er versuchte, sich seine Nervosität nicht anmerken zu lassen. »Ich frage mich, ob es Ihnen etwas ausmachen würde, mir einen Tee zu bringen?«
»O, gewiss nicht. Liebend gerne. Ich wollte ohnehin eben in die Küche hinübergehen.« Sie schenkte ihm ein Lächeln, das ihre Nase kräuselte, und strich sich eine widerspenstige rote Locke aus dem Gesicht. Mr Wilkes wurde ganz warm ums Herz. Sie kam näher, trat ganz dicht an seinen Schreibtisch heran. Den Kopf schief gelegt wie eine junge Katze sagte sie dann: »Wenn Sie mögen, bringe ich Ihnen auch noch ein paar Kekse mit.«
»Das …« Er schluckte und während er spürte, wie er errötete, blinzelte er nervös. »Das ist sehr freundlich von Ihnen. Aber nur, wenn es Ihnen nicht zu viele Umstände macht, Miss Hill. Dann wäre das wirklich wunderbar, ja.«
Wieder lächelte sie ihn an, eine Spur verlegen diesmal. »Es macht mir überhaupt keine Umstände, Mr Wilkes. Das tue ich doch gerne für Sie.«
»Das weiß ich sehr zu schätzen, Miss Hill.« Er hätte sich auf die Zunge beißen mögen, weil er es nicht wagte, ihr zu sagen, was er für sie empfand. Was wäre so schlimm daran, es einfach zu tun, fragte er sich in einem Anflug seltener Kühnheit. Doch sein Verstand kam ihm auch diesmal dazwischen. Der und sein Anstand.
»Sie sind so ein freundlicher Mann, Mr Wilkes, da mache ich das doch gern.« Sie nahm eine Strähne ihres Haars und wickelte sie sich gedankenverloren um den rechten Zeigefinger. »Immer höflich und immer so zuvorkommend. Das kann man beileibe nicht von jedem Mann hier sagen.«
Das Herz wurde ihm schwer. Plötzlich hatte er das Gefühl, einen Teerklumpen verschluckt zu haben. »Was meinen Sie damit, Miss Hill?«
Sie errötete und senkte den Blick. »Ach nichts, Mr Wilkes. Ich stelle mich bloß an.« Dann lächelte sie wieder »Es ist wirklich nichts weiter.«
Mr Wilkes war mit der Antwort nicht zufrieden. »Hat sich jemand Ihnen gegenüber ungebührlich verhalten?«
»Nicht gerade ungebührlich«, antwortete sie. »Aber ach.« Sie ließ die Haarsträhne fallen und deutete ein Kopfschütteln an, auf das ein kurzes hastiges Lächeln folgte. »Ich will mich nicht beklagen.«
»Miss Hill, wenn ich irgendetwas für Sie tun kann, dann sagen Sie es bitte.”
»Nein. Ich fürchte, das können Sie nicht, Mr Wilkes. Aber haben Sie vielen Dank.« Sie klopfte mit den Knöcheln ihrer rechten Hand auf den Schreibtisch und sagte: »Ich gehe jetzt besser und hole Ihnen den Tee.« Sie knickste wieder.
»Falls Sie Sorgen haben, Miss Hill, egal, welcher Art …«, begann Mr Wilkes.
»Ich weiß, Mr Wilkes. Die habe ich nicht – wirklich«, sagte sie schnell und senkte den Blick. Einen Hauch zu schnell, wie er fand.
»Ich möchte nur, dass Sie wissen, ich bin für Sie da, wenn Sie mich brauchen.«
»Danke.« Sie knickste ein drittes Mal. »Danke, Mr Wilkes. Und jetzt mache ich Ihnen erst mal eine schöne heiße Tasse Tee.«
Immer höflich und immer so zuvorkommend. Das kann man beileibe nicht von jedem Mann hier sagen.
Er sah ihr nach, wie sie den schmalen Flur hinunterging, der vom Empfangsraum zur Küche hinunterführte, und fragte sich, wen genau sie wohl mit ihrer Bemerkung gemeint haben mochte.
ERSTER TEIL
OSCAR
»Seit Oscar Dorian Gray geschrieben hat, spricht niemand mehr mit uns.«
Constance Wilde
KAPITEL 1
49 Gordon Square, Bloomsbury,London, 28. Februar 1895
Sie befanden sich in Frederick Greenlands Haus – Oscar Wilde, der gefeierte Literat und Bühnenautor, Miss Louisa Balshaw, Fredericks Verlobte, und Mr Frederick Greenland, Lebemann und reicher Erbe, selbst.
Während der letzten Monate hatte Wilde, dessen Stück The Importance of Being Earnest am 14. Februar im St James’s Theatre Premiere gefeiert hatte, ihnen öfters einen Besuch abgestattet, war indessen nie lange genug geblieben, um Gelegenheit zu haben, im vertrauten Kreise Privatangelegenheiten anzusprechen.
Morton, Frederick Greenlands Butler, hatte Wilde vor etwa einer halben Stunde in den Salon geführt, und obgleich er Louisa und ihm gegenüber versuchte, sich nichts anmerken zu lassen, bemerkte Frederick an dessen Verhalten gleich, dass Wilde etwas bedrückte.
Dass Oscar nicht von allen Londonern gleichermaßen geliebt und bewundert wurde, war Frederick bewusst, seit er das erste Mal vor vielen Jahren von Oscar Wilde, dem Poeten und Schöngeist gehört hatte. Wilde selbst legte nicht den geringsten Wert darauf, jedermann zu gefallen, im Gegenteil. Er liebte es zu schockieren. Und unter schockierenden Umständen hatten sich auch Oscar und er während der Ermittlungen im Fall des berüchtigten Hope Diamanten kennengelernt. Wilde hatte ihm damals das Leben gerettet.
Frederick schenkte ihnen Cognac ein, reichte Wilde einen der Schwenker, nahm auf dem Sofa neben Louisa Platz und sagte: »Oscar, ich habe Sie noch nie so besorgt gesehen. Etwas scheint Sie zu bedrücken.«
»Es ist Lord Queensberry. Seit wir uns das letzte Mal ausgiebig gesprochen haben, ist etwas geschehen«, sagte Wilde ernst. Er sah blass aus, fand Frederick, den mittlerweile so etwas wie enge Freundschaft mit Wilde verband. Und so war ihm bekannt, welch schlechtes Verhältnis zwischen den beiden Männern herrschte, weil der Marquess das Verhältnis seines Sohnes mit Wilde missbilligte. »Als er mich damals mit seinem Preisboxer besuchte, um mich einzuschüchtern und Bosie und mich auseinanderzubringen, da habe ich ihm noch ins Gesicht gelacht. Und auch als er vor zwei Wochen versuchte, mein neues Stück am Eröffnungsabend mit einem grotesk großen Bouquet aus Früchten zu stören, sah ich darüber hinweg. Doch diesmal ist er zu weit gegangen. Ich muss etwas unternehmen.«
»Was ist passiert?«
»Soll ich lieber gehen?«, fragte Louisa. »Ihr habt Vertrauliches zu besprechen und ich habe oben noch meine Handarbeit liegen.«
»Nein«, sagte Wilde. »Bitte, Louisa, bleiben Sie. Es gibt nichts, was ich nicht auch vor Ihnen erzählen würde. Bald wird es ohnehin ganz London wissen.«
Wenn es etwas war, von dem in Kürze ganz London wissen würde, musste es schon etwas Gravierendes sein, etwas, das über Wildes sonstige Eskapaden weit hinausging. Beinahe gegen seinen Willen fragte Frederick: »Was zum Teufel haben Sie jetzt schon wieder ausgefressen, Oscar? Ich meine, haben Sie Queensberry irgendeinen Anlass gegeben, wieder gegen Sie vorzugehen?«
»Ich bin völlig unschuldig, Freddy. Dummerweise liebe ich Kissenschlachten, wie Sie wissen.« Er seufzte. »Ich erhielt heute seine Visitenkarte, die Queensberry offenbar schon vor zehn Tagen in meinem Club, dem Albemarle, abgegeben hatte.«
»Seine Karte?« Frederick war fast ein bisschen enttäuscht. »Ich verstehe nicht, was Sie daran so aufbringt?«
»Es ist nicht die Karte selbst«, erklärte Wilde, während er den Salon durchquerte und schließlich am Kamin stehen blieb. »Es ist das, was er darauf gekritzelt hat.«
»Eine Beleidigung demnach?«
»Die schlimmste. Für den Portier und jeden anderen lesbar. Er bezichtigt mich, ein posierender Sodomit zu sein.« Ein rasches Lächeln erhellte sein Gesicht, als er sah, wie Louisa entsetzt die Hand vor den Mund schlug. »Ein Mann wie Queensberry wird niemals verstehen, was Männer wie Bosie und ich abseits von Frauen miteinander zu teilen vermögen. Und das werfe ich ihm nicht einmal vor. Doch er ist drauf und dran, mein Leben zu zerstören, wenn er mich öffentlich und unverhohlen der Sodomie bezichtigt.«
»Sie müssen wirklich vorsichtiger sein, Oscar«, sagte Frederick.
»Gewiss nicht, Freddy. Ich muss dem Marquess einen Denkzettel verpassen. Diese Anfeindungen müssen aufhören. Auf der Stelle.«
»Was wollen Sie dagegen tun?«
»Ihn anzeigen«, sagte Wilde knapp.
Frederick glaubte, seinen Ohren nicht zu trauen. »Wenn Sie ihn anzeigen …« Er verstummte und schüttelte den Kopf. »Das dürfen Sie keinesfalls tun.«
»Wer sollte es mir verbieten?«
»Ihr gesunder Menschenverstand, Oscar.« Frederick rutschte auf die Sofakante vor, hielt den Cognacschwenker mit beiden Händen fest wie einen Rettungsring. »Sie kämen in Teufels Küche.«
»Oh, und ich hatte den Eindruck, dort sei ich bereits«, sagte Wilde.
»Frederick hat recht«, sagte Louisa. »Niemand darf Ihnen vorschreiben, was Sie zu tun haben. Und doch hat Frederick recht. Sehen Sie von einer Anzeige ab.«
»Haben Sie eine bessere Idee?«
»Zeigen Sie stattdessen Haltung«, sagte Frederick. »Lassen Sie sich nicht zu Schritten provozieren, die Sie später bereuen würden. Es sind bloß Beleidigungen.«
Wilde rieb sich mit Daumen und Zeigefinger über die Stirn.
»Das kann ich mir nicht gefallen lassen, Freddy«, sagte er. Er stieß sich mit beiden Händen vom Kaminsims ab und wandte sich zu Frederick Greenland und Miss Louisa Balshaw um. »Es ist nicht so sehr wegen mir. Aber es verletzt mich, dass Lord Queensberry Bosie und meine Familie mit in diese unschöne Angelegenheit hineinzieht.«
»Die Leute beginnen zu reden, Oscar.« Frederick setzte sich auf und verschränkte die Arme vor der Brust.
»Ach was – geredet haben sie schon immer. Davon lebt unsereins doch. Jetzt beginnen sie zu schweigen, Freddy. Und das macht mir Angst.« Er nahm das Glas Cognac, an dem er zwischendurch immer wieder genippt hatte, und das er vor beinahe zehn Minuten auf dem kleinen runden Tisch neben dem Ohrensessel abgestellt hatte, auf und ging damit zur Tür des Balkons hinüber, der auf den Gordon Square hinunterblickte. Leiser, und offensichtlich mehr zu sich selbst sagte er: »Das ist das Schlimmste. Sie werden vergessen, wer ich gewesen bin.«
Louisa warf Frederick einen raschen Seitenblick zu und erhob sich. »Niemand wird Sie vergessen, Oscar.« Sie ging zu ihm hinüber und hakte sich bei ihm ein. »Wenn Sie kämpfen wollen, müssen Sie kämpfen.«
»Denken Sie nicht, es lohnt sich, für die Sache vor Gericht zu gehen?« Er sah sie nicht an, sondern blickte weiterhin in das Dunkel der nächtlichen Parkanlage hinaus. Sein Gesicht war völlig unbewegt, ohne jeden Ausdruck. »Denken Sie nicht, dass ich das Richtige tue?«
»Das weiß ich nicht.« Louisa streichelte seinen linken Oberarm. »Das weiß niemand. Das ist etwas, das Sie ganz allein entscheiden müssen, Oscar.«
Er nickte. Ganz leicht nur. Und schwieg.
Frederick, in dessen Magen sich ein Klumpen aus Blei gebildet zu haben schien, legte das Chinzkissen, an dem er sich schon eine ganze Weile festgehalten hatte, auf das Sofa und stand ebenfalls auf. »Sie müssen das nicht tun«, sagte er. »Niemand kann Sie dazu zwingen, den Fehdehandschuh, den Queensberry Ihnen hingeworfen hat, auch aufzunehmen.«
Wilde hob beinahe belustigt die Augenbrauen. »Und was bin ich für ein Mann, wenn ich es nicht tue?«
»Das erinnert mich an eine Geschichte, die Conan Doyle mir einmal erzählt hat«, meinte Frederick, doch er spürte selbst, wie wenig enthusiastisch er klang.
»Conan Doyle erzählt immer Geschichten, Freddy. Und die meisten davon sind so flach wie eine Flunder.« Wilde schüttelte missbilligend den Kopf. »Ich verstehe bis heute nicht, was die Leute an seinen Sherlock-Holmes-Geschichten finden. Was ist so brillant daran, die Lösung für ein Problem zu finden, wenn man es sich selbst ausgedacht hat?«
»Warten Sie es doch ab. Diese Geschichte ist wirklich gut. Ich glaube, sie wird Ihnen gefallen.«
Wilde hielt Louisas Arm fest in seinem, als er sich gespielt gönnerhaft umwandte. Abwartend sah er Frederick an.
Der breitete die Arme aus wie ein Schauspieler und sagte: »Nun – ein alter Kung-Fu-Meister ging eines Tages mit seinem Schüler spazieren …«
Wilde zog die Augenbrauen hoch. »Bin ich etwa der Kung-Fu- Meister?«
»Oscar! Lassen Sie mich doch um Himmels willen einmal ausreden.«
»Bitte.«
»Sie gingen also spazieren.«
»Wo?«
»An einem Fluss.«
»An welchem?«
»Am Shinano«, sagte Frederick wie aus der Pistole geschossen. Irgendwo hatte er einmal gelesen, dass das der längste Fluss Japans sei.
»Wahrscheinlich war es doch eher der Jangtsekiang«, sagte Wilde und ein Lächeln huschte über sein Gesicht. »Der Shinano liegt nämlich in Japan. Und Kung-Fu ist eine chinesische Kampfkunst.«
Frederick begann sich unbehaglich zu fühlen. »Das ist ohne Bedeutung für die Geschichte.«
Wilde legte den Kopf schief und lächelte übertrieben breit. »Für mich nicht. Die Fakten sollten stimmen. Wenn die Fakten stimmen, hat man zumindest die Illusion von Wirklichkeit. Selbst wenn sie noch so ernüchternd sein sollte.«
Frederick ließ sich nicht beirren. Er fuchtelte mit der Hand herum, als könne er Wildes Worte wie lästige Fliegen verscheuchen. »Sie gingen eben einfach so herum und trafen am Ufer … dieses chinesischen Flusses auf einen Mann, der sich ihnen in den Weg stellte.« Er hob Einhalt gebietend die Hand, ehe Wilde wieder etwas einwerfen konnte. »Und als sie so dahinspazierten, trafen sie auf einen ehemaligen Schüler des Meisters, der ihn verlassen hatte, um bei jemand anders zu lernen, den er für einen noch besseren Kung-Fu-Meister hielt.«
»Ich beginne allmählich Interesse für Ihre ungelenke kleine Geschichte zu entwickeln, Freddy.« Wilde fuchtelte generös mit der Hand. »Weiter. Weiter.«
»Dieser ehemalige Schüler fing an, seinen alten Meister zu beschimpfen«, fuhr Frederick fort. »Er warf ihm die abscheulichsten Dinge an den Kopf.«
»Was genau sagte er denn?«
»Das ist unerheblich.«
»Wenn Sie Ihre Zuhörer fesseln wollen, Freddy, dann dürfen Sie eine Geschichte niemals bloß einfach so erzählen. Sie müssen sie sie erleben lassen.«
Frederick schnaufte. »Ich bin kein Schriftsteller, Oscar. Alles, was ich will, ist Ihnen die Moral der Geschichte klar machen.«
»Moral wird überbewertet«, entgegnete Wilde. »Moral setzt dem Verstand und dem Gefühl absichtlich Grenzen. Niemand sollte sich in diesen Bereichen Grenzen setzen lassen.«
»Oscar, jetzt seien Sie nicht immer so schrecklich ungezogen«, sagte Louisa. »Hören Sie sich Fredericks Geschichte an. Es kann Ihr Schaden nicht sein.«
»Also schön, weil Sie es sind, Miss Louisa.« Wilde breitete beide Hände aus. »Ich werde Sie nicht mehr unterbrechen, Freddy. Mein Ehrenwort.« Er verschränkte die Arme vor der Brust und lehnte sich, den Zeigefinger am Kinn, mit der rechten Schulter an den Kaminsims. Als Frederick ihn nur anblickte, sagte er: »Worauf warten Sie denn noch? Ich bin ganz Ohr.«
Frederick, der tatsächlich kurz überlegt hatte, ob er die Art und Weise, wie er seine Geschichte erzählt hatte, nun würde ändern müssen, um dem hohen Niveau seines Zuhörers gerecht zu werden, entschied sich dagegen. Immerhin war er weder Wildes Dichterkollege noch seine Amme.
»Wo war ich stehen geblieben? Ah, ja: Dieser ehemalige Schüler beschimpfte also seinen alten Meister. Er habe ihn nichts Ordentliches gelehrt, er sei ein schlechter Kung-Fu-Kämpfer, sein neuer Meister sei viel jünger, viel stärker … was weiß denn ich.« Er blickte zu Wilde hin, der nach wie vor schweigend am Kamin stand und offensichtlich keinerlei Anstalten machte, ihn zu unterbrechen. »All diese Schmähreden ließ der alte Kung-Fu-Meister schweigend und unbewegt über sich ergehen, bis dem frechen Schüler die Worte ausgingen, der sich umdrehte und wütend davonrannte.« Frederick hob den Zeigefinger, als Wilde von einem Bein auf das andere wechselte und sich nun mit der linken Schulter anlehnte. »Ich bin noch nicht fertig, Oscar.«
»Ich ging auch nicht davon aus.«
»Nachdem der andere davongelaufen war, fragte der treue Schüler seinen Meister, weshalb er sich das alles habe gefallen lassen? Warum er ihn seiner Respektlosigkeit wegen nicht geschlagen oder wenigstens gescholten habe. Der Meister schwieg eine ganze Weile, ehe er antwortete.« Frederick verstummte ebenfalls und überlegte kurz, wie er seine Geschichte halbwegs pointiert zu Ende bringen konnte.
»Der Meister schwieg eine ganze Weile, ehe er antwortete, und …«, wiederholte Wilde, der sich eine Bemerkung offenbar doch nicht verkneifen konnte. »Erzählen Sie weiter. Sie fesseln mich geradezu. Wie lautete seine Antwort?«
Frederick zog die Augenbrauen hoch. »Er stellte seinem Schüler eine Frage«, sagte er. »›Nehmen wir an, jemand bringt dir ein Geschenk mit, und du nimmst dieses Geschenk nicht an – was denkst du, bei wem bleibt dann das Geschenk?‹ ›Bei dem anderen, Meister‹, antwortete der Schüler. Der Kung-Fu-Meister nickte und sagte: ›Und mit Beleidigungen verhält es sich ebenso.‹«
»Bravo!« Wilde klatschte ein paar Mal in die Hände.
»Das war eine sehr schöne Geschichte, Frederick«, meinte Louisa.
»Ganz ausgezeichnet«, sagte Wilde. »Wirklich ganz ausgezeichnet.«
»Machen Sie sich nicht lustig über mich.« Frederick ließ sich ins Sofa zurückfallen. »Ich bin weiß Gott kein Geschichtenerzähler, aber ich denke zumindest, die Moral haben Sie verstanden, Oscar.«
»Keine falsche Bescheidenheit. Sie haben Ihre Sache ziemlich gut gemacht, Freddy«, sagte Wilde. »Zumindest für einen, der seinen Lebensunterhalt mit Nichtstun verdient.«
Louisa stieß ein glockenhelles Lachen hervor. »Ich werde mal nach Badger sehen. Wer weiß, wo der Junge wieder steckt. Wahrscheinlich bei Morton und Miss Magda in der Küche. Erst neulich hat er ihnen einen Mordsschrecken eingejagt, als er hinten im Garten eine Rauchbombe zündete. Gott sei Dank ist nichts weiter geschehen und niemand kam zu Schaden.« Sie nahm Wildes Hände. Ihr Gesicht war ernst und unbewegt, als sie ihm tief in die Augen blickte. »Ich hoffe, Sie tun das Richtige, Oscar. Wir alle mögen Sie – sehr sogar. Ignorieren Sie Fredericks Geschichte nicht einfach, bitte. Wenn Sie Lord Queensberry vor Gericht bringen, wird Sie das erheblich mehr kosten, als es Ihnen einbringt.«
»Ich danke Ihnen für Ihre Warnung, Miss Louisa.« Um Wildes Lippen spielte ein trauriges kleines Lächeln. Er tat einen tiefen Atemzug, als wolle er weitersprechen, hielt dann aber einen Moment lang inne, ehe er fragte: »Können Sie es sehen? Ich meine …« Wieder hielt er inne. »Sehen Sie, was geschehen wird, wenn ich … wenn ich meiner Wut nachgebe und Lord Queensberry für sein Verhalten mir gegenüber bei der Polizei anzeige?«
Sie schüttelte den Kopf. »Nein. Nein, ich kann es nicht sehen, Oscar. Selbst wenn ich bestimmte Dinge zu spüren vermag. Ich weiß einfach, dass es nicht gut für Sie ausgeht. Sie sind ein sensibler Mensch, Oscar. Sie würden einen solchen Prozess nicht überstehen, ginge er schlecht für Sie aus.«
Wilde nickte.
Louisa ließ seine Hände los, streckte die rechte Hand aus und berührte ihn sanft, beinahe mütterlich an der Wange. Dann verließ sie den Salon.
Frederick sah Wilde an und erkannte, dass sich etwas tief in dessen Innern verändert hatte. Für den Bruchteil einer Sekunde, in dem Moment nämlich, als Louisa sich von ihm abgewandt hatte, um zur Tür zu gehen, hatte er in Wildes Gesicht einen solch deutlichen Ausdruck von Trauer gesehen, wie man ihn sonst nur bei Abschieden bemerkte; jenen Abschieden, bei denen unzweifelhaft feststand, dass es ein Lebewohl für immer sein würde.
Bodleian Library, Oxford
In der kleinen, fensterlosen Küche war es stickig und Miss Hill wischte sich mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn.
Die Küche befand sich in einem Nebenraum der Bibliothek, zu dem es nur eine Tür gab. Sie lag am Ende eines langen Ganges, der vom Empfang zu den Lagerräumen führte. Hier kam außer ihr und Mr Wilkes selbst kaum mal jemand her.
Miss Hill wickelte sich ein Geschirrtuch um die Hand, nahm den Kessel mit kochendem Wasser vom Herd neben dem Spülstein, trug ihn zu dem Tisch in der Mitte der Küche, wo sie die Porzellankanne vorbereitet hatte, und brühte den Tee auf.
Mr Wilkes war ein so netter Mann. Sie mochte es, sich mit ihm zu unterhalten, auch wenn er stets so wirkte, als seien die Bücher und die Listen, in die er tagaus tagein die Besucher der Bibliothek eintrug, wenn sie ankamen, und wieder austrug, wenn sie das Gebäude verließen, die wichtigsten Dinge auf der Welt.
Dass er sich überhaupt mit ihr unterhielt, war ein mittleres Wunder. Er schien ein wenig schüchtern zu sein, oder einfach kein großes Interesse an Menschen zu haben – an Frauen schon gar nicht.
Nie hatte sie gesehen, dass er sich mit einer der wenigen Studentinnen unterhalten hätte, die die Bibliothek gelegentlich aufsuchten; abgesehen von seiner üblichen Aufforderung, sich in das Anwesenheitsbuch einzutragen. Wenn überhaupt plauderte er auf seine etwas distanzierte Weise höchstens mit den studentischen Hilfskräften oder den Professoren, die er bereits seit vielen Jahren kannte. Über private Dinge sprach er so gut wie gar nicht. Nur gelegentlich mit ihr.
Miss Hill stützte die Hände auf den Tisch in der Mitte der Küche, hob das Metallsieb ein Stück weit aus der Kanne und tauchte es wieder hinein. In der Küche gab es keine Uhr. Sie selbst trug ebenfalls keine, und so musste sie abschätzen, wann der Tee lange genug gezogen hatte.
Ehe sie die Arbeit in der Bibliothek angenommen hatte, war sie in verschiedenen Stellungen als Hausmädchen tätig gewesen. Sie hatte es gemocht, den Herrschaften die Betten zu machen und sich um den Haushalt zu kümmern. Doch es waren Dinge geschehen. Und mit der Zeit hatte sie angefangen, sich zunehmend unbehaglicher zu fühlen. Sie wusste, dass einige der anderen Hausmädchen ihr die Schuld dafür gaben. Sie sei zu kokett mit den Herrschaften gewesen, behaupteten sie. Doch das stimmte nicht. Nicht einmal war sie mit ihrer Weiblichkeit hausieren gegangen oder hatte um die Gunst eines Professors geworben. Es war eben einfach so geschehen. Was konnte sie dafür, dass die Männer sie mochten und diese Dinge taten, die sie nicht wollte?
Mr Wilkes war anders. Bei ihm fühlte sie sich sicher. Womöglich war das der Grund, weshalb sie ihm und sich jeden Abend einen Tee zubereitete.
Die Tür ging plötzlich auf und Dekan Thompson steckte seinen grauhaarigen Kopf in die Küche. »Ach, da stecken Sie ja, Miss Hill«, sagte er mit einem flüchtigen Höflichkeitslächeln. »Ich habe Sie schon überall gesucht. Meine Gattin würde sich freuen, wenn Sie sie heute Abend mit den Kindern unterstützen könnten. Denken Sie, das ließe sich einrichten?«
»Ich weiß nicht, ob ich das heute tun kann, Mr Thompson, Sir. Ich bin mit meiner Tätigkeit für Mr Wilkes bereits in Verzug und …«
»Ich gehe davon aus, dass Sie die Zeit finden, Miss Hill«, sagte der Dekan in einem Ton, der keinen Widerspruch duldete.
Sie senkte den Blick. »Selbstverständlich, Mr Thompson, Sir.«
»Sehr gut. Ach, und Miss Hill?« Er trat näher, streckte seine Hand aus und legte sie auf ihre.
Sie zog ihre Hand zurück ohne aufzublicken. »Ja, Sir?«
Er kam um den Tisch herum, blieb vor ihr stehen. Mit der linken Hand hob er ihr Kinn an, sodass sie ihm in die Augen blicken musste. Dann streichelte er mit dem Handrücken ihre Wange. »Kommen Sie doch in meine Räume, sobald Sie hier fertig sind, ja?«
KAPITEL 2
16 Tite Street,London, 1. März 1895
Oscar Wilde erhob sich aus dem Sessel, in dem er die letzte halbe Stunde gedöst hatte, streckte seine gut Einmeterneunzig zu voller Größe und fuhr sich mit einem leisen Seufzer durch das gewellte braune Haar, von dem so viele seiner Bewunderinnen allzu gern eine Locke besessen hätten.
Er achtete darauf, die Hand vor den Mund zu legen, als er gähnte. Das tat er, wie selbst einige Zeitungsjournalisten mittlerweile bemerkt hatten, auch, wenn er öffentlich sprach. Gerüchte waren ins Kraut geschossen, nachdem er das tat, seit er in den Vereinigten Staaten gewesen war, um seine Stimme voller klingen zu lassen, um sie milder klingen zu lassen, um sich vor Ansteckung mit Keimen zu schützen, um andere vor der Ansteckung mit Keimen zu schützen … um anders als alle anderen Menschen zu sein …
Tatsächlich waren seine ehemals makellos weißen und ebenmäßigen Zähne in letzter Zeit durch den regelmäßigen und verheerenden Genuss von Opium in Mitleidenschaft gezogen worden. Sie hatten einen leichten Grünton angenommen, der sich selbst mit Schlämmkreide nicht mehr richtig entfernen ließ. Daher hatte er es sich zur Angewohnheit gemacht, seinen Mund zu bedecken, wenn er in Gesellschaft lächelte, gähnte oder sprach.
Die Gesellschaft, in der er sich augenblicklich befand, war Lord Alfred Bosie Douglas, jener knabenhafte Mann, der seine Leidenschaft für körperliche Genüsse seit einigen Jahren mit ihm teilte.
Nach außen hin gab sich Wilde weiterhin den Anschein überheblicher Gleichgültigkeit, was die Gesellschaft und ihre lächerlichen Konventionen betraf, doch er selbst fühlte sich bereits seit einiger Zeit alles andere als selbstsicher.