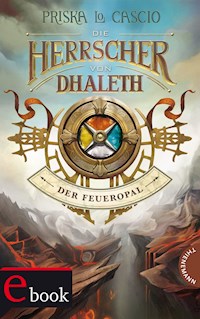9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
1449. Als Dirne im Nürnberger Frauenhaus führt die junge Anna ein Schattendasein zwischen Moralpolitik des Stadtrats und öffentlicher Ächtung. Zu ihren Kunden gehören sowohl angesehene Bürger als auch Priester. Die Arbeitsbedingungen sind gesetzlich geregelt. Eigentlich ... denn die Betreiber des Bordells scheren sich nicht darum, und das Leben der Dirnen ist hart.
Doch in der Stadt herrscht Aufregung: Nürnberg bereitet sich auf einen Krieg vor, in den der jahrelange Streit zwischen dem Ansbacher Markgrafen und dem städtischen Patriziat zu gipfeln droht. Als eines Tages ein Fremder namens Endres im Bordell auftaucht, stellt dessen eigentümliche Art Anna zunächst vor Rätsel. Dennoch behandelt er sie mit mehr Respekt, als sie je erfahren hat. Aber Endres ist ein Spion des Markgrafen und somit ein Feind.
Dann geschieht etwas, das für Anna alles ändert, und sie beschließt, das Ungeheuerliche zu wagen: Für ihr Recht zu kämpfen. Mit Endres an ihrer Seite ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 526
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Über das Buch
Nürnberg 1449. Das städtische Frauenhaus ist eine feste Institution in Nürnberg. Hier verkehren auch die Honoratioren der Stadt, sogar einige Priester. Die Arbeitsbedingungen sind gesetzlich geregelt. Eigentlich … denn die Betreiber des Bordells scheren sich nicht darum, und das Leben der Dirnen ist hart. Doch niemand unternimmt etwas. Als die Lage sich zuspitzt, versucht die junge Anna die Frauen zum Widerstand zu bewegen, scheitert aber kläglich. Dann geht eine heimliche Abtreibung schief und Annas Freundin stirbt. Sie beschließt, in die Öffentlichkeit zu treten und offiziell Klage zu erheben. Es kommt zu einem Prozess, der die ganze Stadt in Aufruhr versetzt …
Über die Autorin
Priska Lo Cascio, Jahrgang 1972, hat lange im Tourismus gearbeitet und ist schon seit Kindertagen von Geschichte, Sprachen und Kultu-ren fasziniert. Wenn sie nicht gerade schreibt, stöbert sie oft und gerne durch herrlich verstaubte Archive, erkundet geschichtsträchtige Orte und taucht so in frühere Zeiten ab. Sie lebt mit Mann und Sohn in Zürich.
PriskaLo Casico
Dasgelbe Tuch
HISTORISCHER ROMAN
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Dieser Titel ist auch als Hörbuch erschienen
Originalausgabe
Dieses Werk wurde vermittelt durch die
Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover
Copyright © 2022 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Dr. Ulrike Brandt-Schwarze, Bonn
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign, München unter Verwendung von Motiven von © KathySG/shutterstock.com; Holiday.Photo.Top/shutterstock.com; prapann/adobestock.com; milanares/adobestock.com; 100ker/shutterstock.com; Michel Wolgemut/commons.wikimedia.org; Mickis-Fotowelt/shutterstock.com; Zerbor/shutterstock.com
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7517-2071-7
www.luebbe.de
www.lesejury.de
Die Figuren der Handlung
Die mit einem * versehenen Namen verweisen auf historische Personen.
Anna, Tochter eines verarmten Landgrafen aus dem Coburger Land
Endres Groß: jüngster Sohn eines angesehenen Nürnberger Kupferhändlers und Ratsmitglieds, Gefolgsmann Albrechts von Ansbach
Reichsstift Niedermünster, Regensburg
Magdalena von Colmberg, Kanonissin
Agatha Pfister, Stiftsschülerin
Johanna Paumgartner, Stiftsschülerin
Haus der Witwe Geuschmied in Nürnberg
Hedwig Geuschmied(Säckelfingerin), Kupplerin
Lisbet, Hübschlerin
Agnes, Hübschlerin
Käthe, Hübschlerin
Ursel, Magd
Oswald und Wendel, ehemalige Söldner und Türwächter
Das städtische Frauenhaus im Muckenthal
Veit Zingel (Zingeler): Wirt des städtischen Frauenhauses
Bärbel (Kurzbein-): Dirne
Herta (die lange): Dirne
Klara: junge Dirne
Der Markgraf und seine Umgebung
* Albrecht Achilles, Markgraf von Ansbach aus dem Hause Zollern
* Friedrich (Friedel) zu Castell, Sohn des Grafen Wilhelm II. zu Castell und Albrechts Knappe
Georg Täuschler, Wundarzt und Feldscherer
Martin, der Taubstumme: sein Gehilfe
Hans Brotschelm, Fechtmeister auf der Cadolzburg
Kunz, markgräflicher Leibdiener
* Peter Knorr, einer der juristischen Berater und Kanzler Albrechts
* Ludwig von Eyb d. Ä., enger Vertrauter und Berater Albrechts von Ansbach. Während des Markgrafenkriegs Feldhauptmann auf der Cadolzburg.
* Ulrich Rummel, Mitglied des Nürnberger Stadtadels und Lehnsmann Albrechts
Die Nürnberger Familie Groß
Bartholomäus Groß, der Ältere: stadtbekannter Kupferkaufmann, Mitglied im Großen Rat und Endres’ Vater
Ulman Groß: Endres’ älterer Bruder
* Erhard Schürstab: Mitglied des Großen Rats von Nürnberg und Nürnberger Kriegsherr
* Karl Holzschuher, Steuereinnehmer im Nürnberger Rat und Kriegsherr
* Konrad (Kunz) von Kaufungen, sächsischer Adeliger
Kapitel 1
Regensburg, Reichsstift Niedermünster, Sommer, Anno Domini 1499
Wie friedvoll der Tag doch ist, dachte Magdalena von Colmberg und lächelte. Ihre Hände tasteten vorsichtig über das große Drahtsieb vor ihr, das bereits zur Hälfte mit zum Trocknen vorbereiteten Rosenblütenblättern belegt war. Sie spürte die Wärme auf den Wangen, hob das Gesicht der Sonne entgegen und atmete die nach Rosen, Liebstöckel und von Tau benetztem Salbei duftende Morgenluft ein.
Es war der erste Sonnenstrahl, der über die hohe Außenmauer in den Kräutergarten des Kanonissenstifts von Niedermünster fiel. In ein paar Stunden würde es hier sengend heiß werden, aber noch genoss Magdalena die morgendliche Frische, die sich so belebend auf der Haut anfühlte. So prickelnd und wohltuend. Einen Moment lang vergaß sie sogar die Schmerzen, die in ihren alten Gliedern steckten und sie jeden Tag ein Stück mehr daran erinnerten, dass ihre Zeit auf Erden sich allmählich dem Ende zuneigte.
Sogleich schalt sich Magdalena in Gedanken eine einfältige Gans. Ständig darüber nachzugrübeln änderte schließlich nichts an der Tatsache: Sie war alt geworden – alt und gebrechlich. Dicke Gichtknorpel hatten ihre Finger verkrümmt, und wenn das Wetter umschlug, spürte sie es schon Tage zuvor in der linken Schulter und den Knien.
Dabei hatte sie mit ihren siebzig Jahren ein längeres Leben gehabt, als es so manch anderem Menschen vergönnt war. Das stimmte wohl. Zudem war sie vermögend genug, damit sie sich in dieses, dem heiligen Erhard geweihte Stift hatte einkaufen können. Sie besaß ihr eigenes kleines Zimmer, in das sie sich zurückziehen konnte, hatte die Gesellschaft der anderen Kanonissinnen, wenn sie sie suchte. Ja, sie hatte alles, was sie brauchte, um ihren Lebensabend hier in Frieden, Ruhe und Zurückgezogenheit zu verbringen. So, wie sie es sich immer gewünscht hatte.
Wenn nur die leidigen Gebrechen nicht wären, die das Alter mit sich brachte. Magdalena hasste es, sich so unzulänglich zu fühlen. Nun ja, womöglich war sie mit den Jahren auch etwas wunderlich geworden.
Mit einem leisen Seufzen griff sie in den links neben ihr stehenden Korb voller Rosenblüten, nahm eine Handvoll davon und legte sie sich in den Schoß. Vorsichtig, denn man konnte nie wissen, ob sich nicht vielleicht eine Biene zwischen den Blüten versteckte. Ihr Summen war rundum zu hören, um diese Tageszeit waren sie besonders arbeitsam.
Sachte fuhr Magdalena mit den Fingerspitzen über die zarten Blütenblätter. Sofort drang ihr der frische, süßliche Rosenduft in die Nase, der durch die zunehmende Wärme noch verstärkt wurde. Die Farbe der Wildrosen reichte von hellem Zartrosa bis hin zu einem kräftigen Hellrot. Magdalena erinnerte sich ganz genau daran, obwohl ihre eigene Welt längst nur noch aus helleren und dunkleren Schatten bestand. Der graue Star hatte ihre Augen nach und nach mit einem Schleier überzogen und ihnen das Licht geraubt. Auch daran war das verflixte Altwerden schuld.
Zwar hätte ein Bader ihr womöglich mit einem Starstich das Augenlicht wieder zurückgeben können. Aber sie hatte in ihrem Leben genug solcher Quacksalber bei der Arbeit gesehen, und sie würde den Teufel tun und sich mit einer schmutzigen Nadel ins Auge stechen lassen.
Sofort presste Magdalena die Lippen zusammen. Herrje, sie hatte wieder geflucht, wenn auch nur in Gedanken. Zum Glück konnte diese niemand hören.
Das war schon immer ihre Stärke und zugleich ihre größte Bürde gewesen. Nicht das Fluchen natürlich, sondern ihre Unverblümtheit und ihre Wissbegierde. Ungewöhnliche Charakterzüge für eine Frau, weswegen man sie früher oft sogar als dreist und respektlos beschimpft hatte. Es war ein Kampf, sich diese lebenslangen Eigenheiten abzugewöhnen und sich stattdessen in den Tugenden der Selbstbeherrschung und Zurückhaltung zu üben. Selbst die Äbtissin von Niedermünster hatte es inzwischen aufgegeben, sie zurechtzuweisen, wenn Magdalena, wie so oft, nicht ums Wort verlegen war. »Einen verwurzelten alten Baum vermag selbst der Wind nicht mehr zu biegen«, sagte sie immer. Damit hatte sie wohl recht.
So war Magdalena zwar in das Stift gekommen, um Ruhe zu finden, dennoch überkam sie ab und zu Wehmut. Sie vermisste es, die Welt mit all ihren Farben und Formen sehen und bewundern zu können, zu lesen und zu schreiben. Sie vermisste ihr Leben, wie es früher gewesen war. Ja, wahrscheinlich wurde sie tatsächlich immer wunderlicher.
Sie zupfte ein Blütenblatt nach dem anderen ab und legte sie auf das Sieb. Einmal getrocknet, dienten sie sowohl als Aufguss gegen allerlei Frauenleiden als auch als Füllung für wohlriechende Duftsäckchen.
Ihr gegenüber saßen zwei junge Frauen. Stiftsschülerinnen, die erst vor ein paar Tagen in Niedermünster angekommen waren. Gewiss stammten sie aus reichen Patrizierfamilien, aus Städten wie Nürnberg oder Bamberg. Wie Magdalena hatten auch sie die Aufgabe, die Rosenblätter zu pflücken. Jedoch nicht, um sie zum Trocknen auszulegen, sondern um sie für die Herstellung von Rosenwasser und Likör zu sammeln.
Sie vernahm das leise Murmeln der Mädchen. Ihre Stimmen klangen sehr jung, fast noch kindlich. Während sie den beiden zuhörte, musste sie schmunzeln. Wohlhabende und Adlige schickten ihre Töchter heutzutage eher als Schülerinnen in ein Frauenstift, als sie in ein Kloster und damit in ein Leben als Bräute Christi zu zwingen. Denn beim Eintritt in ein Stift legten die jungen Frauen kein Ordensgelübde ab, sondern versprachen lediglich Gehorsam und Keuschheit. So auch bei den Kanonissen. Natürlich umfasste die Ausbildung dennoch den Chordienst. In Niedermünster nahmen sie neben den täglichen Arbeiten ebenso an den Stundengebeten und der heiligen Messe teil, versorgten Kranke und Bedürftige oder verpflegten Pilgerinnen und Pilger auf der Durchreise. Wer sich nach der mehrjährigen Ausbildung jedoch nicht zu diesem Weg berufen fühlte, durfte wieder aus dem Stift austreten – zum Beispiel, um zu heiraten. Und genau das war oft auch das Ziel: Die Heiratschancen einer Tochter aus gutem Hause erhöhten sich um ein Vielfaches, wenn sie in Moral und Sitte erzogen, im Weben, Spinnen und Nähen und noch dazu im Lesen, Schreiben, Latein und Mathematik unterrichtet worden war.
Plötzlich horchte Magdalena auf. Hörte sie da nicht ein unterdrücktes Schluchzen?
»Solange ich denken kann, habe ich in Vaters Buchdruckoffizin mitgearbeitet«, brachte eine der beiden jungen Frauen gepresst hervor. »Ich kenne jeden Handgriff, jeden einzelnen Bolzen an der Presse, weiß alles über das Gießen der Schriftlettern oder in welchem Verhältnis Ruß und Leinöl für die Druckerschwärze zu mischen sind.«
Das Mädchen kam ins Stocken. Sie schwankte zwischen erneutem Schluchzen und bemühter Selbstbeherrschung, als sie fortfuhr: »Ein ganzes Jahr lang hat keiner von Vaters Kunden bemerkt, dass ich mich an seiner Stelle um alles gekümmert habe. Sämtliche Korrespondenz, die Aufträge, die Abrechnungen und die Verkäufe – das habe alles ich erledigt. Tag und Nacht habe ich zusammen mit den Gesellen geschuftet, weil mein Vater so krank war, dass er sich nicht einmal mehr auf den Beinen halten konnte.«
Sie holte tief Atem und stieß mit vor Wut zitternder Stimme hervor: »Gleich am Tag nach Vaters Begräbnis hat mein Onkel an unsere Haustür geklopft und mir alles genommen.«
Magdalena hielt in ihrem Tun inne. Sie hatte nicht lauschen wollen, aber nun konnte sie nicht anders.
»Das kann er doch nicht machen! Du bist mündig, hast keine weiteren nahen Verwandten. Von Gesetzes wegen bist du also alleinige Erbin«, wandte das andere Mädchen ein.
»Das wäre ich, wenn Vater sich nicht Geld von seinem Bruder geliehen und dafür das Haus mit der Offizin als Pfand hinterlassen hätte.« Erneut brach sie in Tränen aus. »Mir ist nichts mehr geblieben. Keine Familie, kein Elternhaus und kein Erbe. Mein einziges Glück im Unglück war, dass die Äbtissin mich hier aufgenommen hat. Ich hätte sonst nicht einmal mehr ein Dach über dem Kopf gehabt.« Ihr bitteres Schluchzen war gewiss im ganzen Garten zu vernehmen.
Magdalena wusste, sie sollte sich besser um ihre eigenen Angelegenheiten scheren, das hier ging sie nicht das Geringste an. Dennoch fragte sie in sanftem Ton: »Wie ist dein Name, Kindchen?«
Mit einem Mal wurde es still dort, wo die beiden jungen Frauen saßen. So als ob sie Magdalena erst jetzt bemerkten.
Sie konnte ihre verwunderten Gesichter förmlich vor sich sehen.
»Ich … ich bin Agatha. Agatha Pfister … aus Bamberg«, stammelte das Mädchen und schniefte wenig damenhaft.
Mit einem Nicken nahm Magdalena die Antwort zur Kenntnis. »Und wie alt bist du, Agatha?«
»Ich werde im kommenden Januar sechzehn. Warum wollt Ihr das wissen, Schwester?«
»Oh, ich bin keine Schwester … trotz des Schleiers.« Lächelnd schüttelte Magdalena den Kopf und strich flüchtig mit der Hand über das Tuch, das Haar und Stirn bedeckte und über die Schultern bis zu den Oberarmen reichte. »Mein Name ist Magdalena.«
»Ich heiße Johanna Paumgartner«, meldete sich die zweite Stiftsschülerin eilig zu Wort. »Ich komme aus Coburg und werde im Sommer fünfzehn.«
»Gut. Agatha und Johanna.« Magdalena schmunzelte. Die beiden waren noch so jung und unwissend, fast noch Kinder. Und dennoch alt genug, um verheiratet zu werden, wenn es ihren Familien beliebte oder die Pläne ihrer Vormunde es verlangte.
»Ich habe gehört, was dir widerfahren ist, Agatha, und es tut mir leid.« Augenblicklich begann die Angesprochene erneut zu schluchzen. »Immerfort zu heulen und dich in deiner Verzweiflung zu suhlen wird dich jedoch keinen Schritt weiterbringen, glaub mir.« Sogleich biss sich Magdalena auf die Zunge und verwünschte in Gedanken ihre Direktheit, die einmal mehr erbarmungsloser geklungen hatte als eigentlich gewollt. Herrje, an ihr war wirklich Hopfen und Malz verloren.
Prompt wurde Agathas Weinkrampf noch heftiger.
»Warum sagt Ihr so etwas Gemeines? Seht nur, was Ihr damit angerichtet habt«, empörte sich Johanna und versuchte, ihre Freundin zu trösten. »Ganz ruhig. Sie hat es bestimmt nicht so gemeint.«
»Doch, ich habe es genau so gemeint, wie ich es gesagt habe«, entgegnete Magdalena ungerührt und verteilte weitere Blütenblätter auf dem Trockensieb.
»Was denkt Ihr denn, was ich tun soll?« Agathas Stimme war ein herzzerreißendes Wimmern geworden. »Selbst wenn ich mein Anliegen dem Bamberger Schöffen vortragen wollte, würde der mir gewiss nie Gehör und Glauben schenken.«
Seelenruhig schüttelte sich Magdalena die Schürze sauber, legte die Hände in den Schoß, straffte die Schultern und drehte den Kopf in die Richtung, aus der die Stimmen der Schülerinnen kamen. »Jedenfalls tut er das ganz sicher nicht«, sagte sie, »wenn du ihm in diesem Zustand und ohne Überzeugung und Beweise vor die Augen trittst, Kindchen.«
Das Schluchzen verstummte erneut. »Was wollt Ihr damit sagen?«, fragte Agatha leise.
»Dass man den Glauben an die eigenen Möglichkeiten niemals aufgeben darf«, antwortete Magdalena bestimmt.
»Aber ich bin allein und gegenüber meinem Onkel völlig machtlos.«
»Ja«, meldete sich auch Johanna zu Wort. »Was kann sie denn allein schon ausrichten?«
Magdalena seufzte innerlich. Sie hätte sich wirklich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern sollen, das hatte sie nun davon. Andererseits war es noch ein Weilchen hin bis zum nächsten Stundengebet, und außer dem Zupfen der Rosenblüten hatte sie keine andere Beschäftigung.
Sie hob den Kopf, fühlte die immer kräftiger werdende Sonne im Gesicht und rutschte auf der Steinbank auf die schattige Seite unmittelbar vor dem Rosenbusch. Der Duft war hier noch stärker, das Summen der Bienen noch lauter.
»Du hast recht: Es war dein Glück im Unglück, dass die Äbtissin dich im Stift aufgenommen hat«, sagte sie dann. »Hier stehen dir Möglichkeiten offen, die du sonst niemals gehabt hättest. Eine ganze Welt voller Wissen. Und Wissen ist Macht, vergiss das nie.«
Sie brauchte es nicht zu sehen, um sicher zu sein, dass die Mädchen verständnislos die Köpfe schüttelten. Hätte sie es selbst nicht besser gewusst, hätte sie vermutlich auch ihre Zweifel gehabt. Sie hob lächelnd den Kopf, stemmte die Hände auf den Knien ab und lehnte sich vor. »Ich werde euch eine Geschichte erzählen. Eine wahre Geschichte, die sich seinerzeit genau so in Nürnberg zugetragen hat. Danach werdet ihr begreifen, was ich meine, also hört gut zu.«
Magdalena straffte die Schultern und räusperte sich. »Nun, also, es war im April vor fast genau fünfzig Jahren. Nur wenige Monate, bevor der Krieg zwischen den alten fürstlichen Adelsgeschlechtern und der Stadt Nürnberg begann …«
Kapitel 2
Vor den Mauern der Reichsstadt Nürnberg, 26. Tag des Monats Aprilis, Anno Domini 1449
Endres hielt instinktiv den Atem an. Sein Blick wanderte erst an der Mauer entlang und dann zum Wehrturm hinauf, der rechts der Mauerbrücke, einem massiven, allen Unwettern und Angriffen trotzenden Steinriesen gleich, in die Höhe ragte. Zu seiner Verwunderung hatte Endres ganz vergessen, wie mächtig der Turm war.
Es war schon später Nachmittag, doch noch immer drängte die Menschenmenge über die Mauerbrücke und durch den hohen Torbogen des Vorwerks in die Stadt hinein.
Die Mauer selbst war hier, an dieser Stelle, rund vier Mann hoch und zusätzlich geschützt durch einen tiefen Graben. Oben an den Schießscharten des Wehrturms standen fünf Bewaffnete. Sie waren unschwer an den Eisenhüten und Harnischen zu erkennen. Endres’ geschultes Auge sah die Bogen der Armbrüste, die sie an ihre Rücken geschnallt hatten. Beim Tor standen weitere sechs Wachmänner. Sie trugen außer dem Harnisch sogar stählernes Armzeug über den wattierten Jacken. An ihren Gürteln hingen Dolche, und in der Hand hielt jeder von ihnen eine Hellebarde. Rüstungen und Waffen waren in scheinbar tadellosem Zustand. Gewiss wussten die Männer auch damit umzugehen. Weitere Soldaten, daran zweifelte Endres nicht, befanden sich dahinter beim Zwinger.
So unauffällig wie möglich ließ er den Blick nach rechts wandern – über die westliche Mauer, die Haller Wiese und weiter bis zum Fluss Pegnitz, der die Stadt in die nördliche Sebaldus- und die südliche Sankt-Lorenzer-Hälfte teilte. Entlang der gesamten Mauerlinie erhoben sich in fast regelmäßigen Abständen weitere, kleinere Türme, auf denen ebenfalls Wachsoldaten die Stellung hielten. Weiter südlich, von Endres’ Standort aus nicht mehr zu sehen, lag der südwestliche Stadtzugang beim Spittlertor. Dann, an der südöstlichen Seite, folgte das Frauentor, im Nordosten das Laufer Tor und schließlich ganz im Norden das Tiergärtnertor, in dessen unmittelbarer Nähe sich die Kaiserfestung befand.
Einen winzigen Moment lang fühlte Endres, wie sich sein Kiefer entspannte und der Anflug eines Lächelns in seinem Mundwinkel zuckte. Seine beiden älteren Brüder und er hatten immer einen Reim gesungen, um sich die Reihenfolge der Türme zu merken. Damals, als er noch ein vorwitziger Lümmel gewesen war. Der jüngste der drei Söhne des in ganz Nürnberg angesehenen Kupferhändlers und Stadtratsmitglieds Bartholomäus Groß. Die Stadt war sein Revier, Tummelplatz und seinerzeit, in der Vorstellung eines fünfjährigen Bengels, die nie versiegende Quelle unendlich vieler Abenteuer gewesen.
»Nun geh schon weiter, statt hier Maulaffen feilzuhalten«, schimpfte eine Frau hinter Endres und riss ihn damit aus seinen Erinnerungen.
Er wandte den Kopf und machte gerade noch rechtzeitig einen Schritt zur Seite, ehe das Rad eines Ochsenkarrens seinen Fuß zerquetschte.
Endres zerbiss einen wüsten Fluch und packte den Holzstab in seiner Hand noch fester. Er hatte viel Mühe für seine Verkleidung aufgewandt, trug einen langen Kapuzenmantel, den typischen Hut mit der breiten Krempe und den Holzstab mit den zwei runden Knubbeln am oberen Ende. Er hatte sogar an Kleinigkeiten wie die Wallfahrtspfennige an der Hutkrempe gedacht, und an seinem Gürtel hing ein Rosenkranz.
Er hätte nie erwartet, dass er eines Tages heimlich und in der Kluft eines Pilgers in seine Heimatstadt zurückkehren würde, um unerkannt zu bleiben. Solange nur niemand die beiden Dolche entdeckte, die er auf dem Rücken in dafür eigens in sein Wams genähten Taschen bei sich trug. Denn er kam nicht zu Besuch oder um die Familie und den Vater nach sechs Jahren wiederzusehen, oh nein. Er hatte einen Auftrag. Und der Tumult während der Festlichkeiten anlässlich der alljährlichen Heiltumsweisung war wie geschaffen, um unter den Tausenden von Schaulustigen, Pilgern, Händlern, Bettlern und dem Gesindel unbemerkt in die Stadt zu gelangen. Sein Pferd hatte er bei einem Hof ein paar Meilen westlich der Stadt untergestellt und dem Bauern ein fürstliches Entgelt bezahlt, damit er gut auf den Hengst achtgab, und ihm andernfalls gedroht, ihn ohne mit der Wimper zu zucken zu entmannen. Endres hatte den Dunkelfuchs mit der markanten Blesse und dem Kupfermaul vor drei Jahren bei einem Turnier in Konstanz gewonnen und ihm den Namen »Donner« gegeben. Seither waren sie beide unzertrennlich gewesen, und Donner hatte sich schon mehr als einmal als treu und unerschrocken in der Schlacht bewiesen.
Mit festem Schritt trat Endres auf die Brücke und ging auf die Torwächter zu. Diese beäugten jeden einzelnen Ankömmling mit strengen, forschenden Blicken, untersuchten hier und da sogar die Säcke und Körbe der Passanten oder stießen ihre Waffen in eine Wagenladung voller Stroh, um sicherzugehen, dass sich darunter nichts oder niemand verbarg.
Die Pilgerkluft war hingegen die Idee seines Befehlshabers gewesen. Markgraf Albrecht von Ansbach aus dem Hause der Zollern war ein Vertreter des alten Landadels, dessen Pflichten und Privilegien er mit allen Mitteln und voller Inbrunst verteidigte. Vor allem gegen die immer dreister und mächtiger werdenden Reichsstädte wie Nürnberg. Genau deshalb hatte er Endres hierhergeschickt.
Er spürte, wie ihm der Schweiß über den Nacken rann. Verdammt, wenn er wenigstens sein Schwert bei sich hätte. Nur mit den zwei lächerlichen Dolchen bewaffnet, fühlte er sich nackt und verwundbar.
Jetzt einfach weitergehen. Sich nichts anmerken lassen. Überlegenheit zeigen. Was hatte er außer seinem Leben schon zu verlieren?
»Gott zum Gruße«, sagte er zu dem ersten Wachmann und bemühte sich um ein Lächeln.
»Geh weiter«, schnauzte ihn dieser an und winkte ihn gelangweilt durch.
Die Rüstungen der Wachen … Auf den zweiten Blick entdeckte Endres Dellen auf Harnischen und Armschienen, hier und da sogar ein paar Rostflecken. Sieh einer an. Waren die Nürnberger Stadtwachen doch nachlässiger, als sie gern den Anschein gaben?
Hinter dem Vorwerk lag der Zwinger – fünfzehn Schritte breit –, dann folgte das sogenannte Neutor, eines der fünf Haupttore der Reichsstadt Nürnberg. Wie erwartet, standen auch hier Wachen. Endres zählte drei Mann auf jeder Seite.
Er ging weiter, ließ sich in der Menge treiben. Und im nächsten Moment befand er sich in der Stadt. Er erkannte die Straße sofort, es war die Hintere Füll. Folgte man ihr, so kam man zum Milchmarkt und zur Sebalduskirche. Diese wiederum lag gleich gegenüber dem Rathaus.
Geschwind drückte sich Endres in ein Seitengässchen, bog mal rechts und mal links ab, um ganz sicherzugehen, dass ihm niemand folgte. Durch die Weißgerbergasse, die allein schon am beißenden Geruch nach Alaun und Kochsalz zu erkennen war und wo die Gerber in den eng aneinandergebauten, mehrstöckigen Häusern sowohl ihre feinen hellen Leder herstellten als auch ihre Verkaufsläden betrieben. Vorbei am Findelhaus, bis ans Ufer der Pegnitz. Dort, an der Steinbrücke über den Fluss, blieb er zum ersten Mal stehen und atmete tief ein.
Die Erkenntnis sickerte endgültig in seinen Verstand. Er war wieder in Nürnberg, zum ersten Mal nach sechs Jahren, und alles hier wirkte vertraut und zugleich fremd.
Die Abendsonne drückte durch die Wolkendecke. Ihre Strahlen tauchten die Stadt in ein weiches Licht und malten glitzernde Flecken auf die Wasseroberfläche der Pegnitz.
Linkerhand sah Endres das Siechhaus mit dem spitz zulaufenden Dach und dahinter den wuchtigen Bau des Wasserturms. Zu seiner Rechten erkannte er eine der Mühlen der Stadt. Gegenüber, auf der anderen Flussseite, standen die Häuser der Lorenzer Stadthälfte, dicht an dicht, bis ans Ufer gebaut. Eine Entenfamilie schwamm in einer Reihe flussaufwärts und zog eine kleine, keilförmige Welle hinter sich her. Ein Bild des Friedens.
Doch zugleich war da das Gewimmel der Menschen, die zur Heiltumsweisung gekommen waren. Das betäubende Stimmengewirr und das Gebrüll der Marktschreier. Der Geruch nach Weihrauch, Bratfett, Tierkadavern, Dreck und zu vielen Leuten, der vor allem hier am Fluss über der Stadt hing wie eine dicke Dunstwolke. Dagegen halfen auch die Töpfe mit Nelken und Hyazinthen kaum, die sich die Wohlhabenden in die Fenster stellten, um des von draußen hereindringenden Gestanks Herr zu werden. Dennoch hatte dieser Geruch für Endres etwas Vertrautes, beinahe Beruhigendes. Keine andere Stadt roch wie Nürnberg. Er konnte es sehr wohl beurteilen, er hatte seit Beginn seiner Dienstzeit in Albrecht von Ansbachs Gefolge schließlich schon einige Städte gesehen.
Als er den Stundenschlag von der Frauenkirche her hörte, wandte er sich um. Schon so spät?
Mit einem Ruck straffte er sich und drängte durch die mit Marktständen und Menschen überfüllten Gassen. Durch ein Seitensträßchen vor dem Augustinerkloster ging er über den Platz vor dem Waagamt und weiter in Richtung Salzmarkt. Zum Glück kannte er die Stadt wie seine eigene Handfläche. Unterwegs zählte er an die dreißig bewaffnete Wachmänner.
Immer wieder musste er sich dabei in Gedanken an seine Verkleidung und damit an Mäßigung erinnern. Denn ein echter Pilger quetschte sich nicht mit den Ellenbogen rempelnd durch die Menge, sondern folgte andächtig betend dem Strom Gleichgesinnter, die von einer Kirche zur nächsten zogen. Und das aus gutem Grund, denn wer während den Tagen der Heiltumsweisung mindestens fünf Kirchen Nürnbergs besuchte, sicherte sich vierzig Tage Ablass von seinen Sündenstrafen.
Endres sog zischend die Luft ein, als er in der Eile vor der Frauenkirche gegen die Holzlade eines Händlers stieß. Ein paar der darauf liegenden Pilgerabzeichen – kleine, aus Zinn gegossene Medaillons mit dem Bildnis des heiligen Sebaldus – fielen klimpernd zu Boden.
»Pass doch auf, du Tölpel«, zeterte der Händler, erbleichte jedoch schlagartig und trat einen Schritt zurück, als Endres’ stechender Blick ihn traf.
Drei Teufel, das war unbedacht gewesen, schalt dieser sich im nächsten Atemzug. Unnötiges Aufsehen diente seiner Sache nicht im Geringsten. Als Sohn eines stadtbekannten Geschäftsmannes und Mitglieds des Inneren Rats war es ohnehin schon schwer genug, unerkannt zu bleiben, vor allem in diesem Stadtteil. Früher oder später hätte sein Vater davon erfahren, und das wollte er um jeden Preis vermeiden.
Heimlich ließ er den Blick unter dem tiefen Hutrand hervor über die Gesichter und über die Fassaden der Häuser auf der anderen Seite des Hauptmarkts wandern, die ihm als Kind immer wie eine Reihe mit Harz zusammengeklebter Holzstücke erschienen waren. In dem dreistöckigen Gebäude dort – dem vierten von rechts, mit dem ockerfarbenen Anstrich, dem Verkaufsladen im Erdgeschoss und der Gaube oben auf dem Spitzdach – war Endres geboren und aufgewachsen. Es war das Haus der Kupferhändlerfamilie Groß. Augenblicklich begann das Geflecht aus Brandnarben an seiner linken Handkante zu jucken, und er ballte die Faust.
Die all die Jahre lang verdrängten Erinnerungen kehrten mit einem Schlag zurück, und er biss die Zähne zusammen, bis sie knirschten. Er sah Vater noch immer dort vor dem Kamin in der Stube stehen. Hoch aufragend, keuchend, mit zornumwölkter Miene und der Gerte aus Haselweide in der rechten Hand. Von deren Spitze fiel ein dunkler Tropfen zu Boden, währenddessen Endres’ Rücken wie Feuer brannte. Ob es sein eigenes Blut oder Vaters Schweiß gewesen war, der dort auf den Fußboden tropfte, hatte er nie herausgefunden, und im Grunde war es auch einerlei. Es war der Tag von Mutters Beerdigung gewesen, und zugleich der Tag, an dem Endres sich geschworen hatte, seinen Vater den Rest seines Lebens lang zu hassen.
Entschieden wandte er dem Gewimmel auf dem Marktplatz den Rücken zu. Sein Weg führte ihn über den etwas kleineren Obstmarkt und weiter zu den Häusern betuchter Bürger am Zotenberg.
Er fand den vereinbarten Hinterhof auf Anhieb. Im Vergleich zum Tumult draußen auf den Straßen herrschte hier eine willkommene Ruhe. Der Lärm und die Stimmen waren nur noch als gedämpftes Brummen zu hören.
Der Hof diente wohl als eine Art Lager. An den Wänden stapelten sich Körbe, Holzkisten und Fässer. Ein süßlich-erdiger Geruch nach verfaultem Obst und Lehm lag in der Luft.
Es war keine Menschenseele zu sehen. Dennoch griff Endres instinktiv nach einem der Messer, trat mit lautlosen Schritten näher an die Kisten und spähte in die Lücken dazwischen. Vorsichtig, wachsam, auf jede noch so winzige Bewegung, jedes kaum hörbare Geräusch achtend. Sämtliche Muskeln seines Körpers angespannt. Er war bereit, sich, falls nötig, zu verteidigen. So, wie es ihn die Jahre als Reisiger und später als Hauptmann des dritten Reiterhaufens von Albrechts Leibgarde gelehrt hatten.
Da. Ein leises Rascheln hinter ihm.
Endres fuhr herum. Das eben hatte zwar geklungen, als wehe eine kleine Brise durch trockenes Laub, aber nirgends im Hof sah er auch nur ein einzelnes Blättchen, und zudem war es absolut windstill. Er war also doch nicht allein hier.
»Komm heraus, wenn du Schneid hast, und ich werd dir nichts tun«, knurrte er.
Nichts rührte sich.
Endres blickte kurz über beide Schultern, um sich zu vergewissern, dass hinter ihm keine Gefahr lauerte. Seine Finger schlossen sich noch fester um den Dolchgriff. Er hatte weiß Gott keine Zeit für solche Spielchen.
Mit einem Ruck riss er den Stapel aus geflochtenen Weidekörben zu Boden. Im selben Atemzug bewegte sich ein schwarzer Schatten rechts vor ihm und sprang schnell wie ein Pfeil auf ihn zu.
Sofort drehte Endres den Oberkörper ab, wich aus – gerade noch rechtzeitig, bevor die Krallen der wütend fauchenden Katze ihn erwischten.
Flink landete sie einen Schritt weit von ihm entfernt am Boden. Er konnte noch das schwarze Fell erkennen, ehe das Tier um die Mauerecke verschwand. Dann herrschte erneut Stille.
Er ließ das Messer sinken und atmete aus. Seine Muskeln waren noch immer zum Zerreißen angespannt, und es prickelte unangenehm unter seiner Haut. Die freie Hand ballte er zur Faust und klemmte dabei den Daumen zwischen Mittel- und Zeigefinger. Das alte Zeichen gegen das Böse. Endres hielt sich nicht für übermäßig abergläubisch, aber man konnte nie wissen.
Zugleich verfluchte er sich in Gedanken selbst zum wohl dreihundertsten Mal, weil er den Auftrag überhaupt angenommen und nicht irgendwelche Ausflüchte gefunden hatte. Es war ein Fehler gewesen, nach Nürnberg zurückzukommen. Vor allem jetzt, wo der Ausbruch eines Krieges mit jedem Tag wahrscheinlicher wurde. Die vielen Wachen an den Toren, auf den Mauertürmen und in den Straßen der Stadt waren nicht allein wegen des Festtags aufgeboten worden. Die Bewohner rüsteten sich für den Ernstfall. Für einen Konflikt, der sich bereits seit Jahren zwischen Nürnberg und den anderen dreißig Mitgliedern des Städtebundes auf der einen und dem Bündnis aus alteingesessenen Adelsfamilien auf der gegnerischen Seite zusammenbraute.
Umso nachvollziehbarer war Endres’ Auftrag: Er sollte die Wehrkraft und Kampfstärke der Städter ausspionieren.
Er hätte eine ganze Liste von Gründen aufzählen können, weshalb er Nürnberg und damit seiner Familie den Rücken gekehrt und stattdessen niemand Geringerem als Albrecht von Ansbach die Treue geschworen hatte. Dem Mann, der im Begriff war, Endres’ Heimatstadt die Fehde zu erklären und damit das Kriegsfeuer zu entzünden: weil ihm als Jüngstem ohnehin nur die Krümel des Familienvermögens blieben. Weil er im Vergleich zu seinen Brüdern immer der Außenseiter gewesen war. Der Wildfang. Der Rebell. Derjenige, der die Prügel kassierte, wenn Vater entsprechender Laune war.
Übrig blieb allein die Frage des Gewissens oder der Pflicht. Zu welcher Seite auch immer Endres sich bekannte, irgendwann würde er sich dafür vor dem Allmächtigen verantworten müssen.
Aber noch nicht heute.
Er verbannte den Gedanken mit finsterer Entschlossenheit aus seinem Kopf. Nein, nicht heute. Erst einmal musste er seinen Auftrag ausführen und den Informanten treffen, einen der in Nürnberg lebenden Lehnsmänner Albrechts namens Ulrich Rummel.
Als Treffpunkt war dieser Hinterhof kurz vor Sonnenuntergang vereinbart worden. Mit einem raschen Blick zum Himmel sah Endres, dass es bereits dämmerte. Er setzte sich hinter einen Kistenstapel, von dem aus er den ganzen Hof sowie den Zugang beobachten konnte. Es würde nicht mehr lange dauern, bis Rummel kam.
Doch Endres wartete die ganze Nacht vergeblich.
Kapitel 3
Nürnberg, 27. Tag des Monats Aprilis, Anno Domini 1449
Die Leute drängten in solchen Scharen durch die Gassen, dass sich Anna nur mithilfe ihrer Ellenbogen einen Weg durch die Menge zu bahnen vermochte. An den Verkaufsständen links und rechts der Straße brüllten die Marktschreier um die Wette.
So viele Menschen. Anna bekam kaum noch Luft, die Ränder ihres Blickfelds verschwammen, es rauschte in ihren Ohren. Sie blinzelte und schluckte. Zugleich fühlte sie, wie die Hitze aus ihrer Magengegend langsam, ganz langsam die Kehle hochstieg.
Atme, befahl sich Anna in Gedanken und zwang mit aller Kraft das aufkommende Gefühl der Beklemmung hinunter. Sie hatte solche Menschenansammlungen noch nie gemocht. All dieser Lärm und diese vielen Leute, die sie schubsten und anrempelten. All diese fremden Gesichter, Stimmen und Gerüche. All diese Eindrücke, die sie vergebens zu erfassen versuchte und die sie dennoch jedes Mal völlig überwältigten.
Warum ließ sie sich nur immer wieder zu solchen Ausflügen überreden?
Hektisch wandte Anna den Blick über die Schulter zurück, um zu sehen, ob ihre Begleiterin ihr noch immer folgte. Sie erkannte Lisbets Kopf in der Menge, die blonden Locken, die sich unter dem Haubenrand hervorkringelten.
»Komm schnell. Hier entlang«, rief Lisbet und wedelte mit der Hand in Richtung des Karmeliterklosters rechts von ihnen.
Mit einem beherzten Knuff stieß Anna einen nach Fisch stinkenden Kerl beiseite und schlüpfte, der Freundin folgend, durch die Menge.
Am zweiten Freitag nach dem heiligen Osterfest gab es in Nürnberg immer ein solches Getümmel. Es war der Tag der Heiltumsweisung. Ein Anlass, zu dem die Menschen zu Hunderten aus dem ganzen Umland in die Stadt strömten, um einen Blick auf Insignien und Reliquien wie die Heilige Lanze, die Reichskrone oder das Krönungszepter zu werfen.
Sobald sie das Seitengässchen des Roßmarkts erreicht hatten, lehnte sich Anna erschöpft aufatmend gegen eine Hauswand. Nur ganz allmählich ebbte das Rauschen in ihren Ohren endlich ab, und ihr Herzschlag beruhigte sich.
Hier war das Gedränge nicht ganz so dicht. Es gab sogar genügend Platz, um in Ruhe die Auslagen der Marktstände betrachten zu können.
»Unglaublich! So viele Menschen habe ich noch nie in der Stadt gesehen«, sagte Lisbet, richtete sich sorgsam die Falten ihres Rocks und sah kopfschüttelnd auf den Strom aus Pilgern und Schaulustigen, der sich über die Fleischbrücke von Sankt Lorenz über die Pegnitz in Richtung Hauptmarkt wälzte. »Man möchte fast meinen, das Ende der Welt sei gekommen, und alle müssten sich noch kurzerhand ihr Seelenheil sichern.«
Die Bemerkung brachte Anna trotz allem zum Schmunzeln. Ja, das Seelenheil war für jedermann ein kostbares Gut – vor allem in solch unruhigen Zeiten wie diesen.
»Gerade jetzt kann es nicht schaden, wenn sich der eine oder andere seiner Sünden besinnt«, gab sie mit Blick auf die drängelnden Leute zurück. Es erstaunte sie nicht, dass die Menschen in noch größeren Scharen als üblich zur Heiltumsweisung gekommen waren. Das war auch der Grund, weshalb der Rat die Festlichkeiten dieses Jahr überhaupt erlaubt hatte, obwohl sich doch schon seit Monaten dunkle Sturmwolken des Krieges über dem Süden des Reichs zusammenbrauten.
Zwar bedeutete das für Torwächter, Türmer und Stadtknechte eine noch viel größere Verantwortung, weil sie bei dieser Menge von Menschen noch wachsamer sein, noch mehr Körbe und Karrenladungen durchsuchen und die Augen auf noch mehr Bettler und Gesindel halten mussten.
»Ich fürchte, du bist wie immer viel zu gutgläubig«, seufzte Lisbet und runzelte zweifelnd die Stirn. »Wer lässt sich schon freiwillig die vierzig Tage Ablass entgehen, die allen bei der Heiltumsweisung Anwesenden gewährt werden. Aber die ganze Geschichte mit dem Rattenschiss trägt bestimmt auch dazu bei, da hast du recht.« Sie rümpfte verächtlich die Nase.
»Rattenschiss«, den Namen hatten ihm die Nürnberger während der vergangenen Monate gegeben. Ihm, dem Markgrafen Albrecht von Ansbach. Jenem Adligen aus dem Hause der Zollern, dem sie unter Fürstenkreisen wegen seiner Kühnheit und Tapferkeit ehrfürchtig den Beinamen »Achilles« gegeben hatten. Dem Mann, der – so predigte zumindest der Diakon von St. Sebaldus jeden Sonntag in der Messe – den Sturm heraufbeschwor, als wäre er der leibhaftig gewordene Teufel.
Anna lebte erst seit drei Jahren in Nürnberg, und wenn sie ehrlich sein wollte, wusste sie über Albrecht nur, was sich die Leute in der Stadt über ihn erzählten: Er war der Sohn des Kurfürsten Friedrich I. von Brandenburg. Ein Schützling des einstigen Kaisers Sigismund. Siegreich im Kampf gegen die Hussiten, Böhmen und Sachsen und wie die meisten Reichsfürsten ein Meister im Spiel der Mächtigen um die besten Happen und vorteilhaftesten Standesrechte. Und Albrechts begehrtester Happen war Nürnberg. Oder besser gesagt, die Privilegien, die die Stadt ihm verweigerte. Um seinen Willen zu bekommen, scheute er nicht einmal vor einer Fehdeandrohung zurück. Wie ein feiger Rattenschiss eben.
Er hatte jedoch nicht mit der sturen Hartnäckigkeit der Nürnberger gerechnet. Während sich Albrecht nämlich die Zähne ausbiss und seine Ansprüche mit immer neuen, an den Haaren herbeigezogenen Forderungen geltend zu machen suchte, verzeichnete die Stadt während der beiden Tage der Heiltumsweisung erkleckliche Einnahmen. Die Schenken waren bis zum Bersten voll, in den Herbergen wurden die Zimmer doppelt und dreifach belegt. Wer keine Unterkunft mehr fand, musste mit einer Hausnische vorliebnehmen.
Entlang der Straßen und Gassen der ganzen Stadt hatten Händler ihre Stände aufgestellt und boten die unterschiedlichsten Waren feil. Das Angebot war vielfältig. Es reichte von einfachen, aus Reisig geflochtenen Körben bis hin zu kostbarem Weihrauchharz. Oft war das Warenangebot schon von Weitem am Geruch nach Rauchwürsten, Kerzenwachs oder seltenen Gewürzen zu erkennen.
Inzwischen fühlte sich Anna zwar wieder etwas besser, trotzdem sah sie sich vorsichtig und möglichst unauffällig um. Sie erfasste jede noch so winzige Kleinigkeit: die Bäckersfrau mit dem Korb voller Brezen. Die Kohlmeise, die dort beim Bordstein ein paar Weizenkörner aufpickte, ehe sie geschwind wieder davonflog. Den Marktschreier auf der gegenüberliegenden Straßenseite, der lauthals die Kämme und Bürsten auf seiner Lade anbot. Die Edelfrau, die mit gerafftem Rock, vorsichtig und mit spitz zulaufenden hölzernen Trippen unter den Schuhen durch die Straße schritt. Die Bedienstete hinter ihr trug eine ebenso überhebliche Miene zur Schau wie ihre Herrin.
Erst allmählich atmete Anna auf. Menschenansammlungen waren und blieben ihr ein Gräuel. Was sprach dagegen, dass sie sich lieber in der Sicherheit des vertrauten Heims aufhielt?
Einen winzigen Augenblick lang wünschte sie sich zurück in ihre Kammer, sie war schließlich nur Lisbets wegen mitgekommen. Doch sogleich schob sie den Gedanken beiseite. Sie hatte es der Freundin schon vor Wochen versprochen.
»Warte, ich will mir noch einen Zettel kaufen«, rief Lisbet und drängte zu einem Stand am Straßenrand, wo außer einer Vielzahl von Amuletten und Rosenkränzen eine ganze Reihe von Papierzetteln an einer aufgespannten Leine hingen. Sie waren entweder nur mit schwarzer Tinte bedruckt oder farbig ausgemalt und zeigten das Bildnis eines Engels, der in seinen ausgestreckten Armen das heilige Herz Christi offenbarte. In dessen Mitte klaffte ein Schnitt im Zettel.
»Der Schnitt stammt von der Klinge der Heiligen Lanze«, erklärte der Händler eifrig.
»Warum sollte ich dir glauben, dass es auch wirklich die Heilige Lanze war und nicht bloß irgendein Dolch?«, fragte Lisbet den Händler mit misstrauischer Miene.
Die Hängebacken des Mannes blähten sich auf, während er empört nach Luft schnappte. »Ich bin einer der von St. Sebaldus lizenzierten Verkäufer von Heiltumszetteln.« Er warf sich in die Brust. »Bis jetzt hat mir noch nie jemand eine solche Gaunerei unterstellt!«
Anscheinend gehörte er zu jenen Männern, die sich gern mit Titeln brüsteten, die nicht das Geringste bedeuteten. Und zweifellos war er auch einer von denen, die das verdiente Geld lieber in einer Schenke versoffen. Anna konnte seinen Bieratem sogar über den Tisch hinweg riechen. Seine Kleidung hatte ebenfalls schon bessere Zeiten gesehen. Ein dunkler Schmutzrand zierte die ausgefransten Ärmelsäume seines Hemdes, das er unter dem Wams trug, und eines der Nestelbänder an seinen Schultern war gerissen.
Dennoch erhellte sich Lisbets Gesicht, als sie ihn anlächelte. Nicht auf eine aufgesetzte Weise, wie man es vielleicht bei solch beiläufigen Begegnungen erwarten könnte. Ihre himmelblauen Augen erstrahlten, wirkten auf einmal noch größer, und auf ihren Wangen bildeten sich kleine Grübchen, die ihrem Gesicht eine jugendliche Unschuld verliehen. Es war eines jener Lächeln, mit denen Lisbet ihr Geld verdiente, und sie wusste ganz genau, wie es auf andere Leute wirkte. Vor allem auf Männer.
»Natürlich«, sagte sie dann. »Bitte verzeih meine Unwissenheit. Ich nehme zwei davon. Einen für mich und einen für meine Freundin.« Sie klimperte mit den Augen.
Anna unterdrückte ein Kichern. Sie staunte jedes Mal von Neuem über Lisbets Fähigkeit, ihre Reize so gezielt und mit einer fast schon selbstverständlichen Natürlichkeit einzusetzen.
Und die Wirkung war verblüffend. Das aufgeplusterte Gehabe des Händlers verpuffte so schnell, wie es gewachsen war, und er erinnerte Anna unwillkürlich an eine Schweinsblase, der die Luft ausging. Stattdessen räusperte er sich, zupfte sein abgewetztes Wams zurecht und setzte ein kundenfreundliches Lächeln auf. »Welche sollen es denn sein? Die farbig gedruckten kosten je zehn Schilling. Die schwarzen fünf.«
Aufseufzend legte Lisbet die Hand an die Wange. »Ach herrje, die Qual der Wahl. Welche sind denn wirkungsvoller?«
»Da empfehle ich die farbigen. Die sind zwar etwas teurer, aber auch viel schöner«, sagte der Händler und streckte die Hand nach einem der Zettel aus. Das Herz war in einem zarten Rot ausgemalt. Der nach außen hin immer dunkler werdende Farbton sorgte dafür, dass die Darstellung noch lebendiger wirkte.
»Ich weiß nicht recht.« Lisbet legte den Kopf schief und runzelte die Stirn. »Schön sind sie ja, aber zehn Schilling für jeden Zettel ist ein ziemlicher Batzen Geld. Ich nehme zwei zum Preis von einem.«
»Ha, wofür hältst du mich? Da bräuchte ich meinen Stand ja gar nicht erst aufzustellen. Ich hab schließlich eine Familie zu ernähren«, rief der Händler kopfschüttelnd.
Das war Annas Stichwort. Sie hatte sich bisher bewusst im Hintergrund gehalten, trat jetzt aber vor und legte die Hand auf den Arm der Freundin. »Lass es gut sein. Anscheinend geht es ihm weder um neue Kunden noch um die eigene Konkurrenz, geschweige denn um die Qualität seiner Ware. Sonst wüsste er nämlich, dass es drüben in Sebaldus, direkt vor der Stiftskirche zum Heiligen Geist einen Verkaufsstand gibt, wo die farbigen Zettel zwar gleich viel kosten, aber noch viel schöner bemalt sind. In echtem Purpurrot aus dem Sekret der Murex-Schnecke.« Sie nickte, um ihren Worten noch mehr Nachdruck zu verleihen. »Und es heißt, die Farbe sei von solch vorzüglicher Qualität, dass sie nicht verschmiert, wenn man mit dem Daumen darüberwischt. Außerdem sollen die Zettel sogar mit Weihwasser besprenkelt sein.«
Sie ließ die Worte verklingen, wohl wissend, dass ihre Rede sowohl den Händler als auch die Mehrzahl der Leute rundum in völlige Verwirrung gestürzt hatte. Genau das war ihre Absicht gewesen. Gewiss konnte hier niemand etwas mit der Bezeichnung »Murex« anfangen. Geschweige denn, dass irgendwer wusste, was ein Sekret war.
Wer hätte gedacht, dass sie eines Tages auf diese Weise einsetzen würde, was sie all die Jahre im Kloster gelernt hatte. Wie immer überkamen sie einen winzigen Moment lang Gewissensbisse. Ihre Bildung war ihr höchstes Gut, und sie nutzte ihr Wissen schamlos aus.
Aber wie hieß es noch gleich in der Heiligen Schrift? Alles hatte seine Stunde. Für jedes Geschehen unter dem Himmel gab es also eine bestimmte Zeit. Und seit ihre Brüder sie vor fast genau drei Jahren aus der lieb gewonnenen, sicheren Geborgenheit des Klosters gerissen und hierher nach Nürnberg gebracht hatten, war in Annas Leben kein Platz mehr für Schuldgefühle. An deren Stelle war der Wille zu überleben getreten, um nicht am Schicksal zu zerbrechen.
Außerdem machten sie es immer so, Lisbet und sie, wenn es darum ging, den Preis herunterzuhandeln: Die eine von ihnen war die Käuferin, während die andere die Helferin spielte. Es war Lisbets Idee gewesen. Sie hatte Anna auch beigebracht, worauf es beim Feilschen ankam. Nämlich unter anderem auf das Beobachten des Angebots. Je größer dieses und somit die Konkurrenz war, desto leichter ließen sich die Händler auf einen Preisnachlass ein. Und am Tag der Heiltumsweisung war das Angebot an Heil versprechenden Amuletten, Rosenkränzen, allerlei Duplikaten von Reliquien, an Heiltumszetteln und Spiegeln, um das Antlitz der Heiltümer und deren Wirkungskraft während der Weisung darin aufzufangen, wahrlich im Überfluss vorhanden.
Andererseits galt es auch, die Kundschaft und deren Kaufwillen zu beachten. Letzterer war vor und am Feiertag mindestens ebenso groß wie das Angebot selbst, was das Schachern wiederum heikler machte. Dann war Vortäuschung die einzige verbleibende Möglichkeit. Jedoch nicht bei den Ständen, vor denen die Leute bereits Schlange standen, die hatten einen Preisnachlass nicht nötig. Nein, es waren Krämer wie dieser hier, der offensichtlich bereits durch seinen benachteiligten Standort abseits der breiten Hauptstraße um jeden Käufer kämpfen musste, bei dem sich ein Versuch überhaupt lohnte.
Schulterzuckend wandte sich Lisbet zum Gehen. »Es ist wirklich schade, wenn ein Händler nicht auf seine Kunden eingeht«, sagte sie laut genug, damit die umstehenden Leute es hörten.
Die Miene des Krämers wandelte sich von einem Ausdruck purer Entrüstung über Entsetzen bis hin zu untertäniger Freundlichkeit, ehe er rief: »Nicht doch, wer hat denn so etwas behauptet? Natürlich sind mir meine Kunden wichtig.« Er hob beschwichtigend die Hände. »Ich bin sicher, wir kommen ins Geschäft.« Er zeigte auf die vor ihm hängenden Zettel. »Sucht euch zwei aus. Ich gebe sie euch für fünfzehn Schilling. Tiefer kann ich beim besten Willen nicht gehen.«
»Zehn für zwei, keinen einzigen Heller mehr.« Entschieden legte Lisbet die Geldstücke vor ihm auf den Tisch und deutete auf zwei der farbigen Zettel ganz rechts an der Leine. »Ich hab mich für die beiden da entschieden. Und an deiner Stelle würde ich das Angebot annehmen. Oder hast du mit all den unverkauften Zetteln im Korb unter deiner Lade etwa nicht bereits genug zu schleppen? Das Geschäft ist wohl nicht so gut gelaufen wie erwartet?« Den letzten Satz sagte sie mit solchem Mitgefühl, als ob sie mit einem halb verhungerten Bettlerjungen sprechen würde. Fehlte nur noch, dass sie dem Mann die Hand tätschelte.
Anna biss sich auf die Zunge, um nicht laut aufzulachen, als der Händler erst verdutzt dreinschaute. Wer Lisbet zum ersten Mal begegnete, sah ein feines, zartes Persönchen voller Liebreiz und mit Engelslocken. Keiner erwartete einen solchen Scharfsinn, geschweige denn ein mit absoluter Treffsicherheit zuschlagendes Mundwerk.
Seine Reaktion folgte unverzüglich. Um wenigstens ein Quäntchen an Haltung zu wahren, schüttelte er heftig den Kopf. Sein Hals rötete sich zusehends vor Ärger, und seine Nasenflügel bebten, als er nach Luft schnappte und brüllte: »Das ist eine Unverschämtheit!«
Von dem Lärm neugierig gemacht, blieben die vorübergehenden Leute stehen und wandten die Köpfe.
Kein Zweifel, Lisbet hatte einen wunden Punkt getroffen. Das Gesicht des Händlers verzerrte sich zu einer wütenden Grimasse, und er ballte die Fäuste. Er sah aus, als wolle er sich über den Tisch hinweg auf Lisbet stürzen.
Sofort trat Anna neben die Freundin und fasste nach deren Arm.
Doch im selben Moment fiel der Blick des Händlers auf sie, und er hielt mitten in der Bewegung inne. »Deine Augen«, keuchte er mit fassungsloser Miene.
Sofort wandte Anna den Kopf ab. Sie wusste sehr wohl, was an ihren Augen so seltsam war, dass die Leute oft mitten auf der Straße stehen blieben und sie anstarrten, der Händler war damit beileibe nicht der Einzige. Sie hatte sich im Laufe der Jahre wohl oder übel an die gaffenden Blicke gewöhnt und auch an die heimlichen Zeichen gegen das Böse, die die meisten Leute machten, sobald sie ihr begegneten. So, wie der Händler es jetzt auch tat, indem er den kleinen und den Zeigefinger der linken Hand verstohlen zum Hörnerzeichen ausstreckte.
Ihre Augen waren, neben dem fehlenden Geld für ihre Mitgift, einer der Gründe gewesen, warum Vater sie bereits als Kind ins Kloster gegeben hatte.
»Du hast Teufelsaugen«, hatte er gesagt, und am Anfang hatte Anna ihm sogar geglaubt. Die beiden unterschiedlichen Farben ihrer Augen – das eine war von dunklem Kohlebraun, das andere so hell wie das Kraut der Silberminze – konnte schließlich nur der Teufel persönlich zu verantworten haben. Wer sollte sie so schon jemals heiraten wollen? Eine Braut mit einem solchen Makel?
Elf Jahre hatte Anna daraufhin in der Ruhe des Klosters von Sonnefeld verbracht.
Wie immer bei der Erinnerung an ihre Zeit in Sonnefeld fühlte sie, wie ihr vor Wehmut die Brust eng wurde. Es war die schönste Zeit ihres Lebens gewesen. Dort, in der großen Schreibstube des Klosters, wo die Sonnenstrahlen durch die Fenster fielen und den Raum in helles Licht tauchten. So als käme all das Wissen in den unzähligen Schriften und Büchern in den Sälen hinter der Stube direkt von Gott.
Mit aller Kraft schob Anna den Gedanken beiseite. Ob Teufelswerk oder nicht, ihre Augen waren ihr Fluch und zugleich ihre teuerste Habe – zumindest seit sie hier in Nürnberg lebte.
»Da. Nehmt euch eure Zettel und verschwindet.« Damit warf der Krämer ihnen die beiden Papierstücke über den Tisch entgegen und scheuchte sie händewedelnd fort. Natürlich nicht, ohne zuvor das Geld einzustecken.
»Das war ein gutes Geschäft«, meinte Lisbet zufrieden, als sie wenig später über die Fleischerbrücke in Richtung Hauptmarkt schlenderten, und reichte Anna einen der beiden Heiltumszettel.
»Einen Moment lang hab ich befürchtet, dass der Händler sich auf dich stürzt. Du solltest dich wirklich etwas mäßigen«, erwiderte Anna vorwurfsvoll und sah die Freundin von der Seite her an.
»Ach«, tat diese den Einwand mit einer wegwerfenden Handbewegung ab. »Das war nur einer dieser Männer, die sich aufplustern müssen, um sich besser zu fühlen. Du weißt doch: mehr Schein als Sein.«
»Das hat aber nicht danach ausgesehen«, wandte Anna ein.
Aber Lisbet lachte nur und hakte sich bei ihr unter. »Du machst dir wie immer viel zu viele Sorgen. Das Leben ist schon trist genug. Ein Grund mehr, um nicht alles ständig nur schwarzzusehen, hab ich dir das etwa nicht beigebracht?« Damit war die Sache für sie erledigt.
Kapitel 4
Nürnberg, 27. Tag des Monats Aprilis, Anno Domini 1449
Anna seufzte in Gedanken auf. Lisbet war die Herzensgüte in Person. So hatte sie sich seinerzeit auch ihrer angenommen und ihr, der verschüchterten, weltfremden Klosternovizin, alles beigebracht, was sie wissen musste. Sie lachte gern und oft, liebte schöne Kleider und die farbigen Stoffbänder, die sie sich ins Haar flocht, und trat stets leidenschaftlich für ihre Überzeugungen ein. Dem gegenüber stand jedoch die völlige Unvorhersehbarkeit ihrer Handlungen, die Anna manchmal schier zur Verzweiflung brachte.
Sie wunderte sich ohnehin, wie es überhaupt zu dieser schnörkellosen Freundschaft zwischen ihnen beiden gekommen war. Ihre Wesenszüge und Auffassungen hätten kaum unterschiedlicher sein können. Das mochte unter anderem an ihrer Herkunft liegen. Lisbet war die Tochter eines einfachen Müllers aus Forchheim. Anna hingegen …
Sie hatten inzwischen den Hauptmarkt erreicht, jenen großen, viereckigen Platz auf der Sebalder Stadtseite, der, umgeben von prächtigen Herrenhäusern, direkt vor der Frauenkirche lag.
Dort, auf der gegenüberliegenden Seite der Kirche und unweit des großen Brunnens stand der Heiltumsstuhl schon seit Tagen bereit – ein massives, zweistöckiges, mit Zeltdach, Fahnen und Teppichen verziertes Holzgerüst –, auf dem die heiligen Reliquien und Insignien dem Volk gezeigt werden würden.
»Schnell. Es fängt gleich an.« Lisbet zog Anna an der Hand durch die Menge weiter nach vorn, um besser sehen zu können.
Sie hatte recht. Auch Anna konnte die erwartungsvolle Spannung spüren, die die versammelten Menschen umfing. Ein Großaufgebot von Bewaffneten stand rund um den Platz verteilt. Weitere Soldaten in glänzend polierten Rüstungen hatten bereits, mit Armbrüsten und Hellebarden bewaffnet, auf dem unteren Geschoss des Holzgerüstes Stellung bezogen. Ein Trommelwirbel ertönte.
»Schau, da kommen die Herren Würdenträger«, flüsterte eine neben Anna stehende Frau ihrer kleinen Tochter zu. Zugleich ging ein ehrfürchtiges Raunen durch die Menge, während insgesamt fünf Kirchenmänner in feierlichem Ornat, gefolgt von ebenfalls fünf Vertretern des Großen Rats der Stadt Nürnberg, den Balkon zuoberst auf dem Gerüst betraten. Die Geistlichen trugen allesamt Mitren, was sie als Äbte oder sogar Bischöfe auswies. Jeder der Ratsherren hielt eine lange Stabkerze in Händen.
Zuletzt trat ein einzelner Mann im Gewand eines Priesters auf den Balkon, der langsam eine Schriftrolle aufgleiten ließ. Eine kleine Glocke oben auf dem Zeltdach klingelte dreimal. Ein heller, tragender Ton erklang. Sofort wandten alle Anwesenden den Blick nach oben. Die Männer zogen ehrfurchtsvoll die Mützen und Kappen von ihren Köpfen.
»So höret, ihr Leute«, rief der Priester mit der Schriftrolle, und das letzte Gewisper verstummte. Die Weisung begann.
»Im ersten Umgang«, hallte die Stimme des Ausrufers über den Platz, während er anfing, die zu zeigenden Reliquien von seiner Liste abzulesen, »erseht ihr die Stücke, die der Kindheit unseres Herrn Jesus Christus und etlicher seiner geborenen Menschheitsfreunde sowie seinen heiligen zwölf Aposteln angehören. Die da sind: ein Span der Krippe Christi.«
Der erste Geistliche trat vor, öffnete den Deckel einer mit Samt ausgepolsterten Holzschatulle und neigte diese vorsichtig nach vorn, sodass das winzige, dort unter einer Glasscheibe liegende Holzstück zu sehen war.
Sogleich hoben die Leute die Heiltumszettel oder, wer es sich leisten konnte, einen der bauchigen Spiegel in die Höhe, um die von den Reliquien ausgehenden Wirkkräfte einzufangen. Dazu bewegten sich ihre Lippen im stummen Gebet.
Bei dem Anblick kam Anna ein zynischer kleiner Gedanke. Lisbet hatte recht. Die gewährten Tage Ablass brachten eine wahrhaft inbrünstige Gläubigkeit in den Leuten hervor. Selbst wenn sie es sonst womöglich mit der Gottesfurcht nicht ganz so ernst nahmen.
»Ein Armknochen der heiligen Anna.« – »Ein Stoffstück vom Gewand Johannes’ des Evangelisten.« Die Vorführung ging weiter. Einer nach dem anderen traten die Geistlichen an die Brüstung und präsentierten der Menge die Reliquien. Danach folgte ein zweiter Durchgang, in dem die Reichskleinodien gezeigt wurden.
»Die Reichskrone. Bestückt mit einer Vielzahl von Perlen und Edelsteinen«, verkündete der Priester mit der Schriftrolle und legte dabei so viel Pathos in seine Stimme, als würde er den Kaiser in Person ankündigen. Die staunenden Ausrufe der Menge waren ein ehrfürchtiger Widerhall seiner Worte.
»Der Reichsapfel!«
Anna lächelte, als sie in Gedanken wieder die rezitierende Stimme Schwester Albertinas hörte: Globus cruciger. Die kreuztragende Weltkugel. Die goldene Kugel als Zeichen des römischen Gottes Jupiter versinnbildlicht den Erdball in der Hand des Kaisers und somit dessen Weltherrschaft. Albertina war eine der Nonnen im Kloster Sonnefeld gewesen. Annas Lehrerin, Vertraute und großes Vorbild.
Wieder spürte Anna den dumpfen Druck auf der Brust, den die Wehmut der Erinnerungen an ihr altes Leben mit sich brachte. Sofort kniff sie sich verstohlen in die Innenseite ihres Unterarms und hielt die Luft an. Das hatte sie sich mit der Zeit so angewöhnt. Der Schmerz brachte sie auf andere Gedanken. Es nützte schließlich nichts, ständig über die Vergangenheit nachzugrübeln, sondern es machte alles nur noch schlimmer. Denn sie konnte nie mehr nach Sonnefeld zurück.
Sie nahm nur am Rande wahr, dass nacheinander Teile des Krönungsornats, wie die Dalmatika – der Mantel aus dunkelblauem Seidenstoff – und die Schuhe aus leuchtend rotem Samt präsentiert wurden. Das Zepter und das Reichsschwert in seinem prunkvollen, goldenen Schaft schlossen den zweiten Durchgang ab.
»Und nun der dritte Durchgang, in dem euch die heiligsten aller Stücke gezeigt werden. Sie alle sind unmittelbar in Berührung mit unserem Herrn Jesus Christus gekommen.« Der Ausrufer ließ die Worte verhallen, und es war, als hielten sämtliche Anwesenden den Atem an. Denn jetzt folgte, worauf sie alle warteten.
»Ein Stück des Tischtuchs, auf dem unser Herr sein letztes Abendmahl gehalten hat.«
Sogleich hoben die Leute ihre Zettel und Spiegel noch höher. Keiner wollte sich die Möglichkeit entgehen lassen, die Heil- und Segenswirkung eines solchen Heiltums einzufangen.
Die nächste Reliquie war ein Stück des Tuchs, mit dem Jesus die Füße seiner Jünger nach der Waschung getrocknet hatte. Dann eine Monstranz mit drei Dornen aus der Dornenkrone des Heilands.
Ein Raunen der Ehrfurcht ging durch die Menge, als der Geistliche an die Brüstung trat und das nächste Heiligtum emporhielt. Ein kleines, in Gold eingefasstes Holzstück des Kreuzes Christi. In dessen Mitte war noch immer eines der Nagellöcher zu sehen.
»Da ist sie«, wisperte Lisbet und stellte sich auf die Zehenspitzen, die rechte Hand mit dem Zettel so weit wie nur möglich emporgereckt.
Anna tat es ihr gleich, während sie den Blick nicht von dem Speer mit der von den Jahrhunderten schwarz gefärbten Eisenspitze abzuwenden vermochte. Die Heilige Lanze. Die Waffe, an deren Klinge, so die Geschichte, noch immer das Blut Christi klebte. In der Mitte der Klinge war einer der drei Kreuzigungsnägel eingearbeitet. Das bedeutendste Stück der königlich-kaiserlichen Insignien. Das Zeichen der direkten, von Gott ausgehenden Macht des Herrschers. Die heiligste aller Reliquien, die Anna höchstwahrscheinlich in ihrem Leben jemals zu Gesicht bekommen würde.
Sie schloss die Augen und begann zu beten. Das tat sie inzwischen nur noch selten. Dennoch formten sich die vor Jahren auswendig gelernten und unzählige Male rezitierten Worte wie von selbst in ihrem Geist: Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem … Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum … – Ich glaube an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen … Und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn … Wenngleich es sonst kaum mehr etwas gab, woran sie wirklich noch glaubte.
Anna war so in ihr Gebet vertieft, dass sie die zischenden Frauenstimmen hinter sich zuerst gar nicht richtig wahrnahm.
»Seht sie euch nur an. Stolzieren herum und tun, als wären sie fromm.«
»Haltet euch wohl für etwas Besseres, ihr zwei, he?«
Sofort schlug Anna die Augen wieder auf. Sie brauchte sich nicht einmal umzusehen, um zu wissen, wer sie da angeiferte, die Stimmen waren unverkennbar.
Im selben Moment hörte sie Lisbet neben sich sagen: »Sieh einer an, die Kurzbein-Bärbel vom Muckenthal und ihr Gefolge. Habt ihr euch verirrt? So hässliche Kröten wie ihr kommen doch sonst nicht weiter als bis zur Pegnitz.«
»Schsch, seid gefälligst still«, brummte ihnen ein Mann in vorwurfsvollem Ton über die Schulter hinweg zu.
Anna biss die Zähne zusammen. Er hatte recht. Denselben Missmut verrieten auch die Blicke, die ihnen die umstehenden Leute zuwarfen. Kein Wunder. Oben auf der Tribüne trat soeben ein Geistlicher mit dem Reichskreuz in den Händen vor, und während die Heiltumsweisung noch im Gange war, zeugte eine solche Unruhe von Respektlosigkeit. Schon sah sie, wie einer der nächststehenden Wachmänner den Blick in ihre Richtung wandte.
Hoffentlich würde sich Lisbet jetzt ausnahmsweise zurückhalten, dann konnten sie immer noch glimpflich davonkommen.
»Hörst du, Lisbet? Halt dein dreckiges Maul und verschwinde endlich aus der Stadt. Zusammen mit all den anderen Weibern in Hedwigs Haus. Ihr habt hier in Nürnberg nichts verloren«, zischte Bärbel und trat noch näher. So nah, dass Anna sogar ihren Geruch nach Ascheseife wahrnahm.
Sofort fasste sie nach Lisbets Hand, schüttelte stumm warnend den Kopf.
Denn, wie gesagt, Lisbet war eine gute Seele, aber sie hatte einen großen Makel: Sie war stur wie ein Ziegenbock und hörte auf so gut wie niemanden. Nicht einmal auf Anna. Und erst recht nicht, wenn sie ausgerechnet von den Konkurrentinnen aus dem städtischen Frauenhaus herausgefordert wurde. Von sogenannten freien Frauen. Von Hübschlerinnen. Von Huren.
Wie es auch sie selbst und Anna waren.
Anna sah, dass Lisbet den Kopf hob, und spürte, dass sie ihren Arm anspannte. Auf den ersten Blick wirkte es, als würde sie lächeln. Die gepressten Atemzüge verrieten jedoch, wie sehr sie um Beherrschung rang.
Oben auf dem Heiltumsstuhl rezitierte der Ausrufer mit wohlklingender Stimme das abschließende Fürbittgebet. »O Heiliger Gott, wir bitten dich an diesem Tage der Offenbarung deiner Größe und der deines Sohnes, Jesus Christus, schütze das Reich und unseren geliebten König Friedrich …«
»Hör nicht auf sie. Sie will doch nur, dass die Wachen auf uns aufmerksam werden«, wisperte Anna der Freundin eindringlich zu und verstärkte den Druck ihrer Finger. Nach Kräften darum bemüht, das gackernde Lachen der Weibsbilder hinter ihr zu ignorieren.
»Ihr seid euch wohl zu fein, um mit uns Frauenhaushuren zu reden«, krächzte Bärbel mit ihrer Krähenstimme. »Dabei macht ihr die Beine ebenso für die Freier breit wie wir.«
»… und segne unsere Stadt Nürnberg sowie die ganze Christenheit. Amen.«
»Amen.« Mit einem Ruck fuhr Lisbet herum. Dabei bauschte sich der Stoff ihres Rocks wie ein dunkelgrünes Segel auf. Von der plötzlichen Bewegung aufgeschreckt, wichen die umstehenden Leute zurück.
Ein erneuter Trommelwirbel gab das Ende der Weisung bekannt.
Hinter ihnen standen zwei Frauen: Bärbel, eine Frau mit spitzer Nase und schiefen Hüften, die ihr den Namen Kurzbein-Bärbel eingebracht hatten, und einem vom Schicksal und Alter gezeichneten Gesicht. Neben ihr stand ein flachbrüstiges junges Ding mit Sommersprossen, an dessen Namen sich Anna nicht mehr erinnern konnte.
Beide hatten sie die Fäuste herausfordernd in die Hüften gestemmt. Ihre Kleidung war zwar sauber, aber die Ärmel waren an den Ellenbogen fast durchgescheuert. An ihren Röcken hing, wie vom Stadtrat befohlen und für jedermann sichtbar, das gelbe Tuch, das sie als Huren auswies.
Das Lächeln auf Lisbets Gesicht wirkte freundlich. Nur wer sie so gut kannte wie Anna entdeckte das winzige Flattern ihrer Nasenflügel. Ihre Stimme war leise, honigsüß und gefährlich. »Genau das ist der Unterschied zwischen euch Stadthuren und uns: Wir haben es nicht nötig, die Beine für jeden Knecht und jeden Säufer breitzumachen, nur weil sie drei Pfennige bezahlen.«
Nun, das war womöglich etwas zu verallgemeinernd, fand Anna, denn der Unterschied zwischen den Huren in einem städtischen Frauenhaus und den heimlichen Dirnen, wie Hedwigs Frauen es waren, war viel feiner und zugleich so groß wie das Himmelszelt.
Aber sie kam nicht dazu, weiter darüber nachzudenken, als Bärbel mit einer erstaunlich raschen Bewegung vorschnellte, die Hand zum Schlag erhoben.
»Vorsicht!« Anna sprang nach vorn, stieß Lisbet beiseite und versuchte zugleich, ihrerseits dem Schlag auszuweichen.
Doch zu spät. Der Faustschlag traf sie mit aller Wucht unter der linken Schläfe. Sogleich zerplatzten Sterne vor ihren Augen, sie fühlte den betäubenden Schmerz.
Irgendwoher hörte sie Lisbet rufen: »Anna!« Ein Durcheinander von Stimmen und Gebrüll und dem metallenen Scheppern von Rüstungen. Oh, sie hasste Tumult aus ganzem Herzen.
Ein Stoß gegen ihre Schulter brachte sie aus dem Gleichgewicht. Blind und orientierungslos geriet sie ins Taumeln, stolperte ein paar Schritte zurück und prallte mit dem Rücken gegen einen Körper. So hart, dass ihr kurz die Luft wegblieb.
Anna riss die Augen auf. Woher kam der Arm, der sich auf einmal wie ein Eisenband von hinten um ihre Mitte schlang und sie festhielt, während sie fiel?