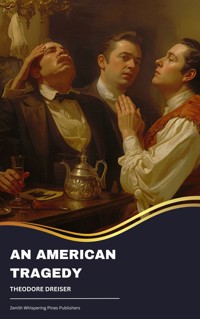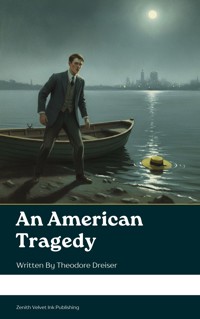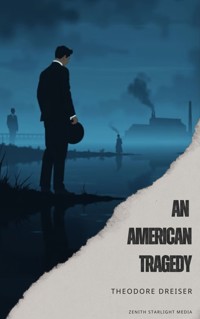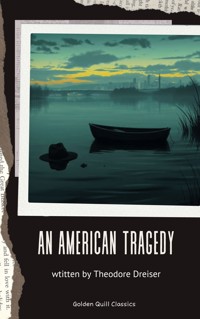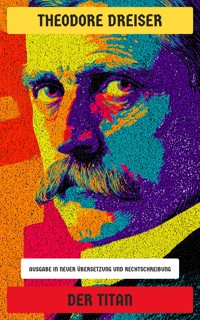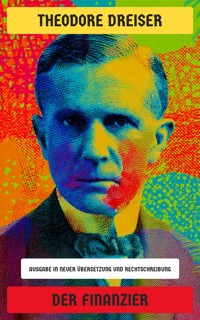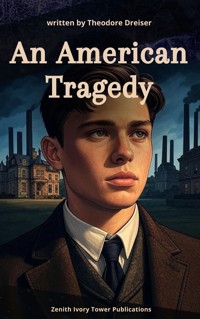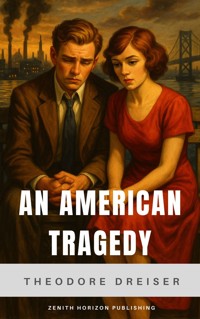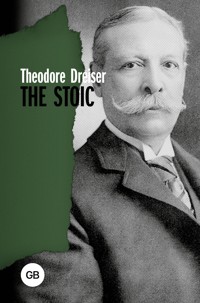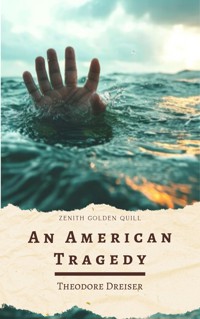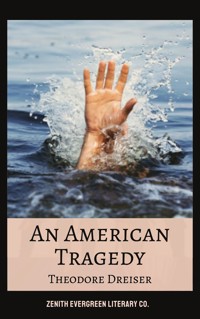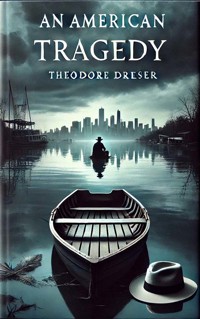1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Neu übersetzt Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Das 'Genie'" von Theodore Dreiser ist ein monumentaler Gesellschaftsroman, der das Porträt eines außergewöhnlich talentierten, aber zutiefst widersprüchlichen Mannes entwirft. Im Zentrum steht Eugene Witla, ein junger Künstler aus bescheidenen Verhältnissen, dessen außergewöhnliche Begabung ihn von der ländlichen Provinz in die pulsierenden Metropolen Amerikas führt. Angetrieben von kreativer Leidenschaft und einem unstillbaren Hunger nach Anerkennung, kämpft er sich durch die Welt der Kunst, des Journalismus und der Gesellschaft – stets hin- und hergerissen zwischen künstlerischer Integrität, materiellen Versuchungen und den Verlockungen des Ruhms. An seiner Seite stehen prägende Figuren, die sein Schicksal entscheidend beeinflussen: Frauen, die ihn inspirieren, lieben und zugleich vor moralische Prüfungen stellen, Mentoren und Weggefährten, die seinen Weg fördern oder behindern, sowie die unbarmherzige Öffentlichkeit, die sein Genie feiert und gleichzeitig kritisch beäugt. Dreiser verwebt in dieser Erzählung kunstvoll persönliche Dramen mit einem scharfsinnigen Panorama der amerikanischen Gesellschaft zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Das Werk, das bei seiner Veröffentlichung wegen seiner offenen Behandlung von Sexualität und seinen ungeschönten Darstellungen des menschlichen Ehrgeizes für Kontroversen sorgte, gilt heute als einer der großen Klassiker der amerikanischen Literatur. Seine Relevanz liegt nicht nur in der Handlung, sondern auch in der kompromisslosen Darstellung zeitloser Themen: die Spannung zwischen schöpferischer Freiheit und gesellschaftlicher Konvention, der Preis des Erfolgs und die Frage, wie viel ein Mensch bereit ist, für seine Visionen zu opfern. "Das 'Genie'" ist mehr als nur die Biografie eines fiktiven Künstlers – es ist ein Spiegel einer Epoche, ein kritischer Kommentar zum amerikanischen Traum und eine eindringliche Untersuchung der Kräfte, die ein außergewöhnliches Talent sowohl beflügeln als auch zerstören können. Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Das „Genie“
Inhaltsverzeichnis
„Eugene Witla, willst du diese Frau zu deiner rechtmäßigen Ehefrau nehmen, um mit ihr nach Gottes Gebot in der heiligen Ehe zusammenzuleben? Willst du sie lieben, trösten, ehren und in Krankheit und Gesundheit bei ihr bleiben und alle anderen verlassen, um nur ihr treu zu sein, solange ihr beide lebt?“
„Ja, das will ich.“
BUCH I
JUGEND
Kapitel I
Diese Geschichte beginnt in der Stadt Alexandria im US-Bundesstaat Illinois zwischen 1884 und 1889, als dort etwa zehntausend Menschen lebten. Der Ort hatte gerade genug Großstadtflair, um sich vom ländlichen Leben abzuheben. Es gab eine Straßenbahnlinie, ein Theater – oder besser gesagt, ein sogenanntes Opernhaus (warum, konnte niemand sagen, denn dort wurde nie eine Oper aufgeführt) –, zwei Eisenbahnlinien mit Bahnhöfen und ein Geschäftsviertel, das aus vier belebten Straßen rund um einen öffentlichen Platz bestand. Auf dem Platz standen das Bezirksgericht und vier Zeitungsredaktionen. Diese zwei Morgen- und zwei Abendzeitungen machten die Bevölkerung ziemlich bewusst, dass das Leben voller lokaler und nationaler Themen war und dass es viele interessante und abwechslungsreiche Dinge zu tun gab. Am Rande der Stadt gaben mehrere Seen und ein hübscher Bach – vielleicht das Schönste an Alexandria – ihr eine Atmosphäre, die der eines preisgünstigen Sommerurlaubsortes nicht unähnlich war. Die Stadt war architektonisch nicht neu. Sie war größtenteils aus Holz gebaut, wie alle amerikanischen Städte zu dieser Zeit, aber in einigen Teilen hübsch angelegt, mit Häusern, die weit zurückgesetzt in großen Gärten lagen, weit weg von den Straßen, mit Blumenbeeten, gepflasterten Wegen und grünen Bäumen, die ein angenehmes Leben versprachen. Alexandria war eine Stadt junger Amerikaner. Ihr Geist war jung. Das Leben lag fast allen noch offen. Es war wirklich schön, am Leben zu sein.
In einem Teil dieser Stadt lebte eine Familie, die in ihrem Charakter und ihrer Zusammensetzung durchaus als typisch amerikanisch und mittelwestlich angesehen werden konnte. Sie war keineswegs arm – oder zumindest sah sie sich selbst nicht so; reich war sie aber auch nicht. Thomas Jefferson Witla, der Vater, war Vertreter für Nähmaschinen bei der Generalagentur in diesem Bezirk für eine der bekanntesten und meistverkauften Maschinen. Von jeder Maschine, die er für zwanzig, fünfunddreißig oder sechzig Dollar verkaufte, machte er fünfunddreißig Prozent Gewinn. Der Verkauf der Maschinen war nicht groß, aber es reichte ihm, um fast zweitausend Dollar im Jahr zu verdienen; davon hatte er es geschafft, ein Haus mit Grundstück zu kaufen, es gemütlich einzurichten, seine Kinder zur Schule zu schicken und einen Laden auf dem öffentlichen Platz zu betreiben, wo die neuesten Modelle der Maschinen ausgestellt waren. Er nahm auch alte Maschinen anderer Hersteller in n Tausch und gewährte dabei einen Preisnachlass von zehn bis fünfzehn Dollar auf den Kaufpreis einer neuen Maschine. Außerdem reparierte er Maschinen – und mit der für Amerikaner typischen Energie versuchte er zusätzlich, ein kleines Versicherungsgeschäft aufzubauen. Seine erste Idee war, dass sein Sohn Eugene Tennyson Witla diese Arbeit übernehmen könnte, sobald er alt genug wäre und das Versicherungsgeschäft sich ausreichend entwickelt hätte. Er wusste nicht, was aus seinem Sohn werden würde, aber es war immer gut, einen Anker in der Hand zu haben.
Er war ein schneller, drahtiger, aktiver Mann von nicht großer Statur, mit sandfarbenem Haar, blauen Augen mit markanten Augenbrauen, einer Adlernase und einem ziemlich strahlenden und gewinnenden Lächeln. Die Arbeit als Vertreter, bei der er hartnäckige Ehefrauen und gleichgültige oder konservative Ehemänner davon überzeugen musste, dass sie wirklich eine neue Maschine in ihrem Haushalt brauchten, hatte ihn vorsichtig, taktvoll und geschickt gemacht. Er wusste, wie man auf Menschen zugeht. Seine Frau fand, dass er das zu gut konnte.
Sicherlich war er ehrlich, fleißig und sparsam. Sie hatten lange auf den Tag gewartet, an dem sie sagen konnten, dass sie ein eigenes Haus besaßen und ein kleines Polster für Notfälle hatten. Dieser Tag war gekommen, und das Leben war gar nicht so schlecht. Ihr Haus war gepflegt – weiß mit grünen Fensterläden, umgeben von einem Garten mit gepflegten Blumenbeeten, einem gepflegten Rasen und einigen wenigen formschönen, weit ausladenden Bäumen. Es gab eine Veranda mit Schaukelstühlen, eine Schaukel unter einem Baum, eine Hängematte unter einem anderen, einen Buggy und mehrere Handkarren in einem nahe gelegenen Stall. Witla mochte Hunde, deshalb gab es zwei Collies. Frau Witla mochte lebende Tiere, deshalb gab es einen Kanarienvogel, eine Katze, ein paar Hühner und ein Vogelhaus auf einem Pfahl, in dem ein paar Blaukehlchen ihr Zuhause gefunden hatten. Es war ein hübsches kleines Haus, und Herr und Frau Witla waren ziemlich stolz darauf.
Miriam Witla war ihrem Mann eine gute Ehefrau. Als Tochter eines Heu- und Getreidehändlers in Wooster, einer kleinen Stadt in der Nähe von Alexandria im McLean County, war sie nie weiter als bis nach Springfield und Chicago gekommen. Als kleines Mädchen war sie nach Springfield gefahren, um Lincoln beerdigt zu sehen, und einmal war sie mit ihrem Mann auf der Staatsmesse oder Ausstellung gewesen, die damals jedes Jahr am Seeufer in Chicago stattfand. Sie war gut erhalten, sah gut aus und war trotz ihrer ausgeprägten Zurückhaltung poetisch. Sie war es, die darauf bestanden hatte, ihren einzigen Sohn Eugene Tennyson zu nennen, als Hommage an ihren Bruder Eugene und an den berühmten romantischen Dichter, dessen „Idyllen des Königs“ sie so beeindruckt hatten.
Eugene Tennyson kam Witla père als Name für einen Jungen aus dem Mittleren Westen der USA ziemlich stark vor, aber er liebte seine Frau , und ließ ihr in den meisten Dingen freien Lauf. Die Namen Sylvia und Myrtle, die sie ihren beiden Mädchen gegeben hatte, gefielen ihm recht gut. Alle drei Kinder waren hübsch – Sylvia, ein einundzwanzigjähriges Mädchen mit schwarzen Haaren, dunklen Augen, blühend wie eine Rose, gesund, lebhaft und lächelnd. Myrtle war von weniger kräftiger Statur, klein, blass, schüchtern, aber unglaublich lieb – wie die Blume, nach der sie benannt war, sagte ihre Mutter. Sie neigte dazu, fleißig und nachdenklich zu sein, Gedichte zu lesen und zu träumen. Die jungen Männer der Highschool waren alle verrückt danach, mit Myrtle zu sprechen und mit ihr spazieren zu gehen, aber sie fanden keine Worte. Und sie selbst wusste nicht, was sie ihnen sagen sollte.
Eugene Witla war der Liebling seiner Familie, zwei Jahre jünger als seine beiden Schwestern. Er hatte glattes, schwarzes Haar, dunkle mandelförmige Augen, eine gerade Nase, ein wohlgeformtes, aber nicht aggressives Kinn; seine Zähne waren gleichmäßig und weiß und zeigten sich mit einer merkwürdigen Zartheit, wenn er lächelte, als sei er stolz auf sie. Er war von Natur aus nicht besonders stark, launisch und ausgesprochen künstlerisch. Wegen seines schwachen Magens und einer leichten Anämie wirkte er nicht so stark, wie er war. Er hatte Gefühle, Feuer und Sehnsüchte, die er hinter einer Mauer der Zurückhaltung verbarg. Er war schüchtern, stolz, sensibel und sehr unsicher.
Zu Hause lungerte er herum und las Dickens, Thackeray, Scott und Poe. Er blätterte müßig in einem Buch nach dem anderen und grübelte über das Leben nach. Die großen Städte zogen ihn an. Er hielt Reisen für etwas Wunderbares. In der Schule las er zwischen den Unterrichtsstunden Taine und Gibbon und staunte über den Luxus und die Schönheit der großen Höfe der Welt. Grammatik, Mathe, Botanik oder Physik interessierten ihn nicht, außer gelegentlichen Kleinigkeiten hier und da. Seltsame Fakten faszinierten ihn – die Beschaffenheit von Wolken, die Zusammensetzung von Wasser, die chemischen Elemente der Erde. Er lag gerne zu Hause in der Hängematte, im Frühling, Sommer oder Herbst, und schaute in den blauen Himmel, der durch die Bäume schien. Ein hoch in der Luft schwebender Bussard, der in spekulativem Flug verharrte, fesselte seine Aufmerksamkeit. Das Wunder einer schneeweißen Wolke, die sich hoch wie Wolle auftürmte und wie eine Insel dahintrieb, war für ihn wie ein Lied. Er hatte Witz, einen ausgeprägten Sinn für Humor und ein Gespür für Pathos. Manchmal dachte er daran, zu zeichnen, manchmal zu schreiben. Er glaubte, für beides ein wenig Talent zu haben, tat aber praktisch nichts davon. Er skizzierte ab und zu, aber nur Fragmente – ein kleines Dach, aus dem Rauch aus einem Schornstein aufstieg und Vögel flogen; ein Stück Wasser mit einer sich darüber neigenden Weide und vielleicht einem vor Anker liegenden Boot; ein Mühlenteich mit Enten und einem Jungen oder einer Frau am Ufer . Er hatte zu dieser Zeit wirklich kein großes Talent für Interpretation, nur einen ausgeprägten Sinn für Schönheit. Die Schönheit eines Vogels im Flug, einer blühenden Rose, eines im Wind schwankenden Baumes – das faszinierte ihn. Er spazierte nachts durch die Straßen seiner Heimatstadt und bewunderte die hell erleuchteten Schaufenster, die Jugend und Begeisterung, die von den Menschenmengen ausging, das Gefühl von Liebe, Geborgenheit und Zuhause, das durch die leuchtenden Fenster der Häuser zwischen den Bäumen strahlte.
Er bewunderte Mädchen – war verrückt nach ihnen –, aber nur nach denen, die wirklich schön waren. In seiner Schule gab es zwei oder drei, die ihn an poetische Ausdrücke erinnerten, die er gelesen hatte – „Schönheit wie ein gespannter Bogen“, „dein hyazinthenblühendes Haar, dein klassisches Gesicht“, „eine tanzende Gestalt, ein fröhliches Bild“ –, aber er konnte nicht ungezwungen mit ihnen reden. Sie waren schön, aber so unnahbar. Er verlieh ihnen mehr Schönheit, als sie hatten; die Schönheit lag in seiner eigenen Seele. Aber das wusste er nicht. Ein Mädchen, dessen gelbes Haar in großen gelben Zöpfen wie reifer Weizen auf ihrem Nacken lag, war ständig in seinen Gedanken. Er verehrte sie aus der Ferne, aber sie wusste nichts davon. Sie wusste nie, welche ernsten schwarzen Augen sie anblickten, wenn sie nicht hinsah. Sie verließ Alexandria, ihre Familie zog in eine andere Stadt, und mit der Zeit erholte er sich, denn es gibt viel Schönheit. Aber die Farbe ihres Haares und die Schönheit ihres Halses blieben ihm immer in Erinnerung.
Witla hatte vor, seine Kinder aufs College zu schicken, aber keiner von ihnen zeigte großes Interesse an einer Ausbildung. Sie waren vielleicht klüger als Bücher, denn sie lebten in einer Welt der Fantasie und Gefühle. Sylvia sehnte sich danach, Mutter zu werden, und heiratete mit einundzwanzig Henry Burgess, den Sohn von Benjamin C. Burgess, dem Herausgeber der Zeitung Morning Appeal. Im ersten Jahr kam ein Baby zur Welt. Myrtle träumte sich durch Algebra und Trigonometrie und fragte sich, ob sie Lehrerin werden oder heiraten sollte, denn der bescheidene Wohlstand der Familie verlangte, dass sie etwas tat. Eugene träumte sich durch seine Schulzeit und lernte nichts Praktisches. Er schrieb ein wenig, aber seine Versuche mit sechzehn waren kindisch. Er zeichnete, aber es gab niemanden, der ihm sagte, ob das, was er tat, etwas wert war oder nicht. Praktische Dinge waren für ihn im Allgemeinen ohne Bedeutung. Aber er war eingeschüchtert von der Tatsache, dass die Welt praktische Dienste verlangte – kaufen und verkaufen wie sein Vater, als Verkäufer in Geschäften arbeiten, ein großes Unternehmen leiten. Es war ein verwirrendes Labyrinth, und er fragte sich schon in diesem Alter, was aus ihm werden sollte. Er hatte nichts gegen die Arbeit seines Vaters, aber sie interessierte ihn nicht. Für sich selbst wusste er, dass es ein sinnloses, trostloses Leben wäre, und was Versicherungen anging, war es genauso schlimm. Er konnte sich kaum dazu bringen, die langen, komplizierten Bedingungen durchzulesen, die in jedem Versicherungsvertrag aufgeführt waren. Es gab Zeiten – abends und samstags –, in denen er im Laden seines Vaters aushalf, aber es war eine mühsame Arbeit. Er war mit den Gedanken woanders.
Schon als er zwölf war, hatte sein Vater gemerkt, dass Eugene nicht fürs Geschäft geeignet war, und als er sechzehn war, war er davon überzeugt. Aufgrund seiner Lesevorlieben und seiner Noten in der Schule war er ebenso überzeugt, dass der Junge kein Interesse am Lernen hatte. Myrtle, die zwei Klassen über ihm war, aber manchmal im selben Raum unterrichtet wurde, berichtete, dass er zu viel träumte. Er schaute immer aus dem Fenster.
Eugene hatte nicht viel Erfahrung mit Mädchen. Es gab diese ganz kleinen Dinge, die in der frühen Jugend passieren – Mädchen, die man heimlich küsst oder die einen heimlich küssen – Letzteres war bei Eugene der Fall gewesen. Er hatte kein besonderes Interesse an einem bestimmten Mädchen. Mit vierzehn wurde er auf einer Party von einem kleinen Mädchen als Seelenverwandter ausgewählt, zumindest für den Abend, und bei einem Spiel „Stelle” genoss er das Wunder, dass ein Mädchen ihn in einem dunklen Raum umarmte und ihre Lippen seine berührten; aber seitdem hatte es keine weitere Begegnung dieser Art gegeben. Er hatte von der Liebe geträumt, basierend auf dieser einen Erfahrung, aber immer auf eine schüchterne, distanzierte Weise. Er hatte Angst vor Mädchen, und sie, um ehrlich zu sein, hatten Angst vor ihm. Sie konnten ihn nicht einschätzen.
Aber im Herbst seines siebzehnten Lebensjahres kam Eugene mit einem Mädchen in Kontakt, das einen tiefen Eindruck auf ihn machte. Stella Appleton war eine auffallend schöne Frau. Sie war sehr blond, in Eugenes Alter, hatte sehr blaue Augen und einen schlanken, elfengleichen Körper. Sie war fröhlich und charmant auf eine verführerische Art, ohne wirklich zu merken, wie gefährlich sie für das durchschnittliche, empfängliche männliche Herz war. Sie flirtete gern mit den Jungs, weil es ihr Spaß machte, und nicht, weil sie sich für einen bestimmten interessierte. Das hatte aber nichts mit Gemeinheit zu tun, denn sie fand sie alle ganz nett, wobei ihr die weniger Schlauen fast noch besser gefielen als die Schlauen. Vielleicht mochte sie Eugene anfangs wegen seiner Schüchternheit.
Er sah sie zum ersten Mal zu Beginn seines letzten Schuljahres, als sie in die Stadt kam und in die zweite Klasse der Highschool eintrat. Ihr Vater war aus Moline, Illinois, gekommen, um eine Stelle als Manager in einer neuen, gerade gegründeten Riemenscheibenmanufaktur anzutreten. Sie hatte sich schnell mit seiner Schwester Myrtle angefreundet, vielleicht weil sie von ihrer ruhigen Art angezogen war, so wie Myrtle von Stellas Fröhlichkeit.
Eines Nachmittags, als Myrtle und Stella auf der Hauptstraße unterwegs waren, auf dem Heimweg vom Postamt, begegneten sie Eugene, der gerade auf dem Weg war, einen Freund zu besuchen. Er war in Wahrheit sehr schüchtern; und als er sie auf sich zukommen sah, hätte er am liebsten das Weite gesucht, doch es gab kein Entkommen. Sie hatten ihn bereits gesehen, und Stella trat selbstbewusst genug auf ihn zu. Myrtle war darauf bedacht, ihn abzufangen, da sie ihre hübsche Begleiterin bei sich hatte.
„Warst du nicht zu Hause?“, fragte sie und blieb stehen. Das war ihre Chance, Stella vorzustellen; Eugene konnte nicht entkommen. „Fräulein Appleton, das ist mein Bruder Eugene.“
Stella schenkte ihm ein strahlendes, ermutigendes Lächeln und reichte ihm ihre Hand, die er zögernd ergriff. Er war sichtlich nervös.
„Ich bin nicht sehr sauber“, sagte er entschuldigend. „Ich habe meinem Vater geholfen, die Kutsche zu reparieren.“
„Ach, das macht nichts“, sagte Myrtle. „Wohin gehst du?“
„Zu Harry Morris“, erklärte er.
„Wozu?“
„Wir holen Hickory-Nüsse.“
„Oh, ich hätte auch gerne welche“, sagte Stella.
„Ich bring dir welche mit“, bot er galant an.
Sie lächelte wieder. „Das wäre schön.“
Sie hätte fast vorgeschlagen, dass sie mitkommen sollten, aber ihre Unerfahrenheit hielt sie davon ab.
Eugene war sofort von ihrem Charme überwältigt. Sie wirkte wie eines dieser unerreichbaren Wesen, die kurz zuvor in sein Blickfeld geschwommen waren und dann wieder verschwunden waren. Sie hatte etwas von dem Mädchen mit den maisblonden Haaren, nur dass sie menschlicher war, weniger wie ein Traum. Dieses Mädchen war zart, zart, rosig, wie Porzellan. Sie war zerbrechlich und dennoch kraftvoll. Er hielt den Atem an, aber er hatte mehr oder weniger Angst vor ihr. Er wusste nicht, was sie von ihm denken könnte.
„Also, wir gehen jetzt zum Haus“, sagte Myrtle.
„Ich würde mitkommen, wenn ich Harry nicht versprochen hätte, vorbeizuschauen.“
„Ach, das ist schon in Ordnung“, antwortete Myrtle. „Das macht nichts.“
Er zog sich zurück, weil er das Gefühl hatte, einen sehr schlechten Eindruck hinterlassen zu haben. Stellas Augen hatten ihn sehr fragend angesehen. Sie schaute ihm nach, als er gegangen war.
„Ist er nicht nett?“, fragte sie Myrtle offen.
„Ich finde schon“, antwortete Myrtle, „irgendwie nett. Aber er ist zu launisch.“
„Was ist los mit ihm?“
„Er ist nicht sehr stark.“
„Ich finde, er hat ein nettes Lächeln.“
„Das werde ich ihm sagen!“
„Nein, bitte nicht! Das machst du doch nicht, oder?“
„Nein.“
„Aber er hat ein nettes Lächeln.“
„Ich lade dich mal abends zu uns ein, dann kannst du ihn wieder treffen.“
„Das würde ich gern“, sagte Stella. „Das wäre bestimmt lustig.“
„Komm am Samstagabend vorbei und bleib über Nacht. Er ist dann zu Hause.“
„Mach ich“, sagte Stella. „Das wird herrlich!“
„Ich glaube, du magst ihn!“, lachte Myrtle.
„Ich finde ihn sehr nett“, sagte Stella schlicht.
Das zweite Treffen fand wie vereinbart am Samstagabend statt, als er von seinem gelegentlichen Arbeitstag im Versicherungsamt seines Vaters nach Hause kam. Stella war zum Abendessen gekommen. Eugene sah sie durch die offene Wohnzimmertür, als er nach oben eilte, um sich umzuziehen, denn er hatte ein jugendliches Feuer, das in diesem Alter weder durch Magenbeschwerden noch durch schwache Lungen zu bremsen war. Ein Schauer der Vorfreude lief ihm über den Rücken. Er gab sich besondere Mühe mit seiner Toilette, richtete seine rote Krawatte sorgfältig und teilte sein Haar in der Mitte. Nach einer Weile kam er wieder herunter, wohl wissend, dass er etwas Kluges sagen musste, das ihm würdig war, sonst würde sie nicht sehen, wie attraktiv er war; und doch fürchtete er sich vor dem Ergebnis. Als er das Wohnzimmer betrat, saß sie mit seiner Schwester vor einem offenen Kamin, und das Licht einer Lampe mit einem rotblumigen Schirm tauchte den Raum in eine warme Glut. Es war ein gewöhnlicher Raum mit einem blauen Tischtuch bedeckten Tisch in der Mitte, Stühlen in stereotypem Fabrikdesign und einem Bücherregal mit Romanen und Geschichtsbüchern, aber er war gemütlich und strahlte eine starke Heimeligkeit aus.
Frau Witla ging ab und zu rein und raus, um Sachen zu suchen, die sie als Hausfrau brauchte. Der Vater war noch nicht da; er würde zum Abendessen kommen, nachdem er in einer abgelegenen Stadt des Landkreises versucht hatte, eine Maschine zu verkaufen. Eugene war es egal, ob er da war oder nicht. Herr Witla hatte einen Sinn für Humor, der sich, wenn er gut gelaunt war, in Scherzen mit seinem Sohn und seinen Töchtern äußerte, indem er ihr aufkeimendes Interesse am anderen Geschlecht bemerkte und ihnen banale Höhepunkte ihrer großen Liebe prophezeite, wenn diese einmal kommen sollte. Er erzählte Myrtle gern, dass sie eines Tages einen Pferdearzt heiraten würde. Für Eugene sagte er eine gewisse Elsa Brown voraus, die laut seiner Frau fettige Locken hatte. Das irritierte weder Myrtle noch Eugene. Es zauberte sogar ein schiefes Lächeln auf Eugenes Gesicht, denn er mochte Scherze; aber er sah seinen Vater schon in diesem Alter ziemlich klar. Er sah die Kleinheit seines Geschäfts, die lächerliche e eines solchen Berufs, der Anspruch auf ihn erheben konnte. Er wollte nie etwas sagen, aber in ihm brodelte eine brennende Ablehnung gegen das Alltägliche, eine glühende Grube in einem Krater der Zurückhaltung, die hin und wieder bedrohlich aufloderte, für jeden, der sie lesen konnte. Weder sein Vater noch seine Mutter verstanden ihn. Für sie war er ein seltsamer Junge, verträumt, kränklich, noch ohne Ahnung davon, was er wirklich wollte.
„Oh, da bist du ja!“, sagte Myrtle, als er hereinkam. „Komm, setz dich.“
Stella schenkte ihm ein verführerisches Lächeln.
Er ging zum Kaminsims und blieb dort stehen, um sich in Pose zu werfen. Er wollte dieses Mädchen beeindrucken, wusste aber nicht so recht, wie. Ihm fiel fast nichts ein, was er sagen könnte.
„Du kannst dir nicht vorstellen, was wir gemacht haben!“, zwitscherte seine Schwester hilfsbereit.
„Na, was denn?“, fragte er ratlos.
„Du solltest raten. Kannst du nicht nett sein und raten?“
„Einmal raten“, warf Stella ein.
„Popcorn machen“, wagte er mit einem halben Lächeln.
„Du bist nah dran“, sagte Myrtle.
Stella sah ihn mit großen blauen Augen an. „Noch ein Versuch“, schlug sie vor.
„Kastanien!“, riet er.
Sie nickte fröhlich. „Was für Haare!“, dachte er. Dann: „Wo sind sie?“
„Hier ist eine“, lachte seine neue Bekannte und streckte eine kleine Hand aus.
Unter ihrem lachenden Zuspruch fand er seine Stimme wieder. „Geizhals!“, sagte er.
„Das ist aber gemein“, rief sie. „Ich habe ihm meine einzige gegeben. Gib ihm keine von deinen, Myrtle.“
„Ich nehme es zurück“, bat er. „Das wusste ich nicht.“
„Das werde ich nicht!“, rief Myrtle. „Hier, Stella“, und sie hielt ihr die wenigen Nüsse hin, die sie noch hatte, „nimm die, und gib ihm keine!“ Sie legte sie in Stellas eifrige Hände.
Er verstand, was sie wollte. Es war eine Einladung zu einem Wettstreit. Sie wollte, dass er versuchte, sie dazu zu bringen, ihm welche zu geben. Er spielte ihr Spiel mit.
„Hier!“ Er streckte seine Handfläche aus. „Das ist nicht fair!“
Sie schüttelte den Kopf.
„Na, wenigstens eine“, beharrte er.
Sie schüttelte langsam den Kopf.
„Einen“, bat er und kam näher.
Wieder die goldene Ablehnung. Aber ihre Hand war an der Seite , die ihm am nächsten war, wo er sie greifen konnte. Sie begann, den Inhalt hinter ihrem Rücken in die andere Hand zu stecken, aber er sprang hoch und schnappte ihn sich.
„Myrtle! Schnell!“, rief sie.
Myrtle kam. Es war ein Kampf zu dritt. Mitten im Gerangel drehte sich Stella und stand auf. Ihr Haar streifte sein Gesicht. Er hielt ihre kleine Hand fest. Einen Moment lang sah er ihr in die Augen. Was war das? Er konnte es nicht sagen. Nur ließ er sie halb los und überließ ihr den Sieg.
„Da“, lächelte sie. „Jetzt gebe ich dir eins.“
Er nahm ihn lachend. Am liebsten hätte er sie in seine Arme genommen.
Kurz vor dem Abendessen kam sein Vater herein, setzte sich, nahm aber gleich eine Zeitung aus Chicago und ging ins Esszimmer, um zu lesen. Dann rief seine Mutter sie zum Tisch, und er setzte sich neben Stella. Er war sehr interessiert an dem, was sie tat und sagte. Wenn sich ihre Lippen bewegten, achtete er genau darauf. Wenn sie ihre Zähne zeigte, fand er sie wunderschön. Eine kleine Locke auf ihrer Stirn lockte ihn wie ein goldener Finger. Er spürte das Wunder der poetischen Formulierung „die glänzenden Strähnen ihres Haares“.
Nach dem Abendessen gingen er, Myrtle und Stella zurück ins Wohnzimmer. Sein Vater blieb zurück, um zu lesen, seine Mutter, um abzuwaschen. Myrtle verließ nach einer Weile den Raum, um ihrer Mutter zu helfen, und dann waren die beiden allein. Er hatte nicht viel zu sagen, jetzt, wo sie zusammen waren – er konnte nicht reden. Etwas an ihrer Schönheit ließ ihn schweigen.
„Magst du die Schule?“, fragte sie nach einer Weile. Sie hatte das Gefühl, dass sie reden mussten.
„Nur ganz in Ordnung“, antwortete er. „Ich finde es nicht so interessant. Ich glaube, ich werde bald aufhören und arbeiten gehen.“
„Was willst du machen?“
„Ich weiß es noch nicht – ich würde gerne Künstler werden.“ Zum ersten Mal in seinem Leben gestand er seine Ambitionen – warum, hätte er nicht sagen können.
Stella nahm das nicht zur Kenntnis.
„Ich hatte Angst, dass sie mich nicht in die zweite Klasse der Highschool aufnehmen würden, aber sie haben es getan“, bemerkte sie. „Der Schulleiter in Moline musste dem Schulleiter hier schreiben.“
„Die sind streng mit solchen Sachen“, überlegte er.
Sie stand auf und ging zum Bücherregal, um sich die Bücher anzusehen. Er folgte ihr nach einem Moment.
„Magst du Dickens?“, fragte sie.
Er nickte ernst und sagte: „Ziemlich.“
„Ich kann ihn nicht mögen. Er ist zu langatmig. Ich mag Scott lieber.“
„Ich mag Scott“, sagte er.
„Ich erzähle dir mal von einem schönen Buch, das ich mag.“ Sie hielt inne, öffnete die Lippen, um sich an den Titel zu erinnern. Sie hob die Hand, als wolle sie den Titel aus der Luft pflücken. „The Fair God“, rief sie schließlich.
„Ja, das ist gut“, stimmte er zu. „Ich fand die Szene im alten Azteken-Tempel, wo sie Ahwahee opfern wollten, so toll!“
„Oh ja, das hat mir auch gefallen“, fügte sie hinzu. Sie holte „Ben Hur“ hervor und blätterte gedankenverloren darin. „Und das war auch so gut.“
„Wunderbar!“
Sie hielten inne, und sie ging zum Fenster und stellte sich unter die billigen Spitzenvorhänge. Es war eine mondhelle Nacht. Die Baumreihen, die die Straße zu beiden Seiten säumten, waren kahl, das Gras braun und abgestorben. Durch die dünnen, ineinander verschlungenen Zweige, die wie silberne Filigranarbeiten aussahen, konnten sie die Lampen anderer Häuser durch die halb heruntergelassenen Jalousien leuchten sehen. Ein Mann ging vorbei, ein schwarzer Schatten im Halbdunkel.
„Ist das nicht schön?“, sagte sie.
Eugene kam näher. „Es ist schön“, antwortete er.
„Ich wünschte, es wäre kalt genug zum Schlittschuhlaufen. Kannst du Schlittschuh laufen?“ Sie drehte sich zu ihm um.
„Ja, klar“, antwortete er.
„Ist das schön in einer Mondnacht. Ich bin früher oft in Moline Schlittschuh gelaufen.“
„Wir laufen hier viel Schlittschuh. Es gibt zwei Seen, weißt du.“
Er dachte an die klaren, kristallenen Nächte, wenn das Eis des Grünen Sees hin und wieder mit einem gewaltigen, dröhnenden Krachen aufbrach. Er dachte an die Scharen von Jungen und Mädchen, die riefen und lachten, an die fernen Schatten, an die Sterne. Bisher hatte er nie ein Mädchen gefunden, mit dem er gut hatte Schlittschuh laufen können. Er hatte sich mit niemandem je ganz ungezwungen gefühlt. Er hatte es versucht, doch einmal war er mit einem Mädchen gestürzt, und das hatte ihn beinahe für immer vom Schlittschuhlaufen geheilt. Er hatte das Gefühl, mit Stella laufen zu können. Er hatte das Gefühl, dass sie vielleicht gern mit ihm laufen würde.
„Wenn es kälter wird, könnten wir gehen“, wagte er. „Myrtle läuft Schlittschuh.“
„Oh, das wäre toll!“, applaudierte sie.
Dennoch schaute sie weiter auf die Straße.
Nach einer Weile kam sie zurück zum Kamin und stellte sich vor ihn, den Blick nachdenklich nach unten gerichtet.
„Glaubst du, dein Vater bleibt hier?“, fragte er.
„Er sagt schon. Ihm gefällt es hier sehr gut.“
„Und du?“
„Ja – jetzt.“
„Warum jetzt?“
„Oh, zuerst hat es mir nicht gefallen.“
„Warum?“
„Ach, wahrscheinlich, weil ich niemanden kannte. Aber jetzt gefällt es mir.“ Sie hob den Blick.
Er rückte ein wenig näher.
„Es ist ein schöner Ort“, sagte er, „aber für mich gibt es hier nicht viel. Ich glaube, ich werde nächstes Jahr weggehen.“
„Wohin willst du denn gehen?“
„Nach Chicago. Ich will nicht hierbleiben.“
Sie drehte sich zum Feuer und er setzte sich auf einen Stuhl hinter ihr und lehnte sich an die Rückenlehne. Sie spürte, dass er ziemlich nah war, bewegte sich aber nicht. Er überraschte sich selbst.
„Kommst du nie wieder zurück?“, fragte sie.
„Vielleicht. Kommt drauf an. Ich denke schon.“
„Ich hätte nicht gedacht, dass du schon weggehen willst.“
„Warum?“
„Du sagst doch, es ist so schön hier.“
Er antwortete nicht, und sie schaute über ihre Schulter. Er beugte sich ganz zu ihr hinüber.
„Willst du diesen Winter mit mir Schlittschuh laufen gehen?“, fragte er bedeutungsvoll.
Sie nickte.
Myrtle kam herein.
„Worüber redet ihr beiden?“ fragte sie.
„Über das tolle Eislaufen hier“, sagte er.
„Ich liebe Schlittschuhlaufen“, rief sie.
„Ich auch“, fügte Stella hinzu. „Es ist himmlisch.“
Kapitel II
Einige der Ereignisse dieser kurzen Romanze haben Eugene echt beeindruckt. Kurz danach haben sie sich zum Schlittschuhlaufen getroffen, weil es geschneit hatte und das Eis auf dem Green Lake super zum Schlittschuhlaufen war. Der Frost hielt so lange an, dass Männer mit Pferden und Eissägen am Miller's Point, wo die Eishäuser standen, einen Fuß dicke Eisblöcke herausgesägt haben. Nach Thanksgiving waren fast jeden Tag viele Jungs und Mädels aus den Schulen da und flitzten wie Wasserskipper über das Eis. Eugene konnte unter der Woche abends und samstags nicht immer mitkommen, weil er seinem Vater im Laden helfen musste. Aber regelmäßig konnte er Myrtle bitten, Stella zu holen, damit sie alle zusammen abends losziehen konnten. Und manchmal bat er sie, mit ihm allein zu gehen. Das tat sie auch nicht selten.
Einmal waren sie unterhalb einer Gruppe von Häusern, die sich auf einer Anhöhe in der Nähe des Sees befanden. Der Mond war aufgegangen und seine lieblichen Strahlen hielten sich in der glatten Oberfläche des Eises vor Augen. Durch die schwarzen Baumreihen, die das Ufer säumten, konnte man das gelbe, heimelige Leuchten der Fenster sehen. Eugene und Stella waren langsamer geworden, um umzukehren, nachdem sie die Menge der Schlittschuhläufer ein Stück hinter sich gelassen hatten. Stellas goldene Locken waren bis auf ein paar Strähnen von einer französischen Haube bedeckt; ihr Körper war bis unter die Hüften in einen weißen, eng anliegenden und figurbetonten Jersey aus Wolle gehüllt. Der Rock darunter war aus einer grauen Mischung aus dicker Wolle, und die Strümpfe waren von weißen Wollgamaschen bedeckt. Sie sah verführerisch aus und wusste das auch.
Plötzlich, als sie sich umdrehten, löste sich einer ihrer Schlittschuhe und sie stolperte und schrie auf. „Warte“, sagte Eugene, „ich mache das.“
Sie stellte sich vor ihn hin, und er kniete sich hin und löste den verdrehten Riemen. Als er den Schlittschuh abgenommen und für ihren Fuß bereit hatte, sah er auf, und sie sah lächelnd auf ihn herab. Er ließ den Schlittschuh fallen, schlang seine Arme um ihre Hüften und legte seinen Kopf an ihre Taille.
„Du bist ein böser Junge“, sagte sie.
Ein paar Minuten lang schwieg sie, denn als Mittelpunkt dieser schönen Szene war sie einfach göttlich. Während er sie festhielt, zog sie ihm die Wollmütze vom Kopf und legte ihre Hand auf sein Haar. Er war so glücklich, dass ihm fast die Tränen kamen. Gleichzeitig erwachte eine ungeheure Leidenschaft in ihm. Er umklammerte sie bedeutungsvoll.
„Mach meinen Schlittschuh wieder fest“, sagte sie weise.
Er stand auf, um sie zu umarmen, aber sie ließ ihn nicht.
„Nein, nein“, protestierte sie. „Das darfst du nicht tun. Wenn du das tust, komme ich nicht mit dir mit.“
„Oh, Stella!“, flehte er.
„Ich meine es ernst“, beharrte sie. „Das darfst du nicht tun.“
Er gab nach, verletzt und halb wütend. Aber er fürchtete ihren Willen. Sie war wirklich nicht so bereit für Zärtlichkeiten, wie er gedacht hatte.
Ein anderes Mal veranstalteten einige Schulmädchen eine Schlittenfahrt, zu der Stella, Eugene und Myrtle eingeladen waren. Es war eine Nacht mit Schnee und Sternen, nicht zu kalt, aber belebend. Ein großer Kastenwagen war zerlegt worden, der Aufbau auf Kufen gesetzt und mit Stroh und warmen Decken gefüllt. Eugene und Myrtle waren wie die anderen an ihrer Haustür abgeholt worden, nachdem der Schlitten etwa zehn friedliche kleine Häuser angefahren hatte. Stella war noch nicht da, aber nach einer Weile erreichten sie ihr Haus.
„Komm rein“, rief Myrtle, obwohl sie halb so weit von Eugene entfernt saß. Ihre Aufforderung machte ihn wütend. „Setz dich zu mir“, rief er, aus Angst, sie würde es nicht tun. Sie kletterte neben Myrtle hinein, fand aber den Platz nicht bequem und rückte weiter nach hinten. Eugene bemühte sich besonders, Platz neben sich zu schaffen, und sie kam wie zufällig dorthin. Er zog eine Büffeldecke um sie und war ganz aufgeregt bei dem Gedanken, dass sie wirklich da war. Der Schlitten fuhr klingelnd durch die Stadt, um weitere Passagiere aufzunehmen, und fuhr schließlich aufs Land hinaus. Er kam an großen, stillen, verschneiten Waldstücken vorbei, an kleinen weißen Bauernhäusern, die sich dicht an den Boden schmiegten und deren Fenster in einem vagen, romantischen Licht schimmerten. Die Sterne waren unzählbar und hell. Die ganze Szene machte einen gewaltigen Eindruck auf ihn, denn er war verliebt, und hier neben ihm, im Schatten eines Gegenstandes oder Lebewesens, war dieses Mädchen, dessen Gesicht sich blass abzeichnete. Er konnte die Süße ihrer Wangen, ihre Augen, die Weichheit ihres Haares erkennen.
Es wurde viel geplaudert und gesungen, und inmitten dieser Ablenkungen gelang es ihm, einen Arm um ihre Taille zu legen, ihre Hand in seine zu nehmen, ihr tief in die Augen zu schauen und zu versuchen, ihren Ausdruck zu deuten. Sie war ihm gegenüber immer schüchtern, nicht ganz nachgiebig. Drei- oder viermal küsste er sie heimlich auf die Wange und einmal auf den Mund. An einer dunklen Stelle zog er sie kräftig zu sich heran und gab ihr einen langen, sinnlichen Kuss auf die Lippen, der sie erschreckte.
„Nein“, protestierte sie nervös. „Das darfst du nicht.“
Er hörte für einen Moment auf, weil er das Gefühl hatte, zu weit gegangen zu sein. Aber die Nacht in ihrer ganzen Schönheit und sie in ihrer Schönheit hinterließen einen bleibenden Eindruck.
„Ich denke, wir sollten Eugene in die Zeitungsbranche oder so etwas bringen“, schlug Witla senior seiner Frau vor.
„Es sieht so aus, als wäre das das Einzige, wozu er taugt, zumindest im Moment“, antwortete Frau Witla, die zufrieden war, dass ihr Junge noch nicht seinen Platz im Leben gefunden hatte. „Ich glaube, später wird er etwas Besseres finden. Seine Gesundheit ist nicht besonders gut, weißt du.“
Witla vermutete halb, dass sein Junge von Natur aus faul war, aber er war sich nicht sicher. Er schlug vor, dass Benjamin C. Burgess, der zukünftige Schwiegervater von Sylvia und Herausgeber und Eigentümer des Morning Appeal, ihm vielleicht eine Stelle als Reporter oder Schriftsetzer geben könnte, damit er das Handwerk von der Pike auf lernen könnte. Der Appeal hatte nur wenige Angestellte, aber Herr Burgess hätte vielleicht nichts dagegen, Eugene als Reporter einzustellen, wenn er schreiben konnte, oder als Schriftsetzerlehrling, oder beides. Eines Tages sprach er Burgess auf der Straße an.
„Sagen Sie mal, Burgess“, sagte er, „Sie hätten nicht zufällig einen Platz in Ihrer Firma für meinen Jungen, oder? Ich habe bemerkt, dass er gerne ein wenig schreibt. Ich glaube, er gibt auch vor, ein wenig zu zeichnen, obwohl ich vermute, dass das nicht viel ist. Er sollte etwas anfangen. In der Schule macht er nichts. Vielleicht könnte er Schriftsetzer lernen. Es würde ihm nicht schaden, ganz unten anzufangen, wenn er diesen Weg einschlagen will. Was Sie ihm anfangs bezahlen, wäre egal.“
Burgess dachte nach. Er hatte Eugene in der Stadt gesehen und wusste nichts Schlimmes über ihn, außer dass er lustlos und ziemlich launisch war.
„Schick ihn doch mal zu mir“, sagte er unverbindlich. „Ich könnte vielleicht was für ihn tun.“
„Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du das tun würdest“, sagte Witla. „So wie es jetzt ist, bringt er nicht viel“, und die beiden Männer gingen ihrer Wege.
Er ging nach Hause und erzählte Eugene davon. „Burgess sagt, er könnte dir vielleicht eine Stelle als Schriftsetzer oder Reporter bei der Appeal geben, wenn du mal vorbeikommst und ihn triffst“, erklärte er und sah zu seinem Sohn hinüber, der bei der Lampe saß und las.
„Wirklich?“, antwortete Eugene ruhig. „Nun, ich kann nicht schreiben. Ich könnte vielleicht setzen. Hast du ihn gefragt?“
„Ja“, sagte Witla. „Du solltest mal bei ihm vorbeischauen.“
Eugene biss sich auf die Lippe. Er wusste, dass dies ein Hinweis auf seine Neigung zum Faulenzen war. Er war nicht besonders gut in der Schule, das war klar. Aber Schriftsetzer war kein Beruf für jemanden mit seinem Temperament. „Ich werde es tun“, sagte er schließlich, „wenn die Schule vorbei ist.“
„Sprich lieber vor Schulende mit ihm. Einige der anderen Jungs könnten ihn um diese Zeit danach fragen. Es kann nicht schaden, es einmal auszuprobieren.“
„Ich werde es tun“, sagte Eugene gehorsam.
An einem sonnigen Nachmittag im April blieb er vor dem Amt von Herrn Burgess stehen. Es befand sich im Erdgeschoss des dreistöckigen Appeal-Gebäudes am öffentlichen Platz. Herr Burgess, ein dicker Mann mit leichtem Haarausfall, sah ihn hinter seiner stahlgerahmten Brille fragend an. Das wenige Haar, das er noch hatte, war grau.
„Du denkst also, du würdest gerne in die Zeitungsbranche einsteigen, ja?“, fragte Burgess.
„Ich würde es gerne versuchen“, antwortete der Junge. „Ich möchte sehen, ob es mir gefällt.“
„Ich kann dir gleich sagen, dass es da nicht viel zu holen gibt. Dein Vater sagt, du schreibst gern.“
„Ich würde es gerne, aber ich glaube nicht, dass ich es kann. Ich hätte nichts dagegen, Schriftsetzen zu lernen. Wenn ich jemals schreiben könnte, würde ich es gerne tun.“
„Wann möchtest du anfangen?“
„Wenn es Ihnen recht ist, nach Schulende.“
„Das macht keinen großen Unterschied. Ich brauche eigentlich niemanden, aber ich könnte dich gebrauchen. Wären fünf Pfund pro Woche in Ordnung für dich?“
„Ja, Herr.“
„Na gut, komm vorbei, wenn du bereit bist. Ich werde sehen, was ich machen kann.“
Er winkte dem angehenden Schriftsetzer mit einer Bewegung seiner dicken Hand weg und wandte sich seinem schwarzen Walnussschreibtisch zu, der schmuddelig und mit Zeitungen bedeckt war und von einer grünen Lampenschirmlampe beleuchtet wurde. Eugene ging hinaus, den Geruch frischer Druckerschwärze in der Nase und den ebenso aggressiven Geruch feuchter Zeitungen. Es würde eine interessante Erfahrung werden, dachte er, aber vielleicht auch Zeitverschwendung. Er hielt nicht viel von Alexandria. Irgendwann würde er da rauskommen.
Das Büro der Zeitung Appeal unterschied sich nicht von dem jeder anderen Landzeitung innerhalb unserer beiden Hemisphären. Im Erdgeschoss befand sich vorne das Geschäftsbüro und im hinteren Teil die große Flachbettpresse und die Druckpressen. Im zweiten Stock war der Satzraum mit seinen Reihen von Letkasten auf hohen Regalen – denn diese Zeitung wurde, wie die meisten anderen Landzeitungen, noch von Hand gesetzt; und davor lag das einzige schäbige Büro des sogenannten Redakteurs, oder Chefredakteurs, oder Stadtredakteurs – denn alle drei waren ein und dieselbe Person, ein Herr Caleb Williams, den Burgess in vergangenen Zeiten aus dem Nichts aufgegabelt hatte. Williams war ein kleiner, schlanker, drahtiger Mann mit einem schwarzen Spitzbart und einem Glasauge, das einen gelegentlich mit seiner schwarzen Pupille ganz unheimlich anstarrte ( ). Er war gesprächig, huschte von Aufgabe zu Aufgabe, trug die meiste Zeit eine grüne Sonnenblende tief in die Stirn gezogen und rauchte eine braune Bruyèrepfeife. Er verfügte über einen reichen Wissensschatz, den er in seiner journalistischen Tätigkeit in der Großstadt angesammelt hatte, aber er war hier mit seiner Frau und seinen drei Kindern verwurzelt, nachdem er zweifellos ein stürmisches Leben hinter sich hatte, und freute sich, nach dem Büro, mit fast jedem über das Leben und seine Erfahrungen zu sprechen. Er brauchte von acht Uhr morgens bis zwei Uhr nachmittags, um die lokalen Nachrichten zu sammeln und sie entweder zu schreiben oder zu redigieren. Er schien eine Reihe von Korrespondenten zu haben, die ihm wöchentlich Nachrichten aus der Umgebung schickten. Die Associated Press versorgte ihn per Telegramm mit ein paar kleineren Meldungen, und es gab einen „Patent-Insider”, zwei Seiten mit Geschichten, Haushaltstipps, Medikamentenanzeigen und was nicht alles, was ihm viel Zeit und Stress ersparte. Die meisten Nachrichten, die ihn erreichten, wurden bei der Bearbeitung kurz abgefertigt. „In Chicago haben wir solchen Dingen viel Aufmerksamkeit geschenkt“, pflegte Williams jedem zu erklären, der ihm zuhörte, „aber hier unten geht das nicht. Die Leser erwarten das nicht. Sie wollen lokale Nachrichten. Ich achte immer sehr genau auf die lokalen Nachrichten.“
Herr Burgess kümmerte sich um die Anzeigen. Er warb sogar persönlich um Anzeigen, sorgte dafür, dass sie so gesetzt wurden, wie es der Inserent wollte, und dass sie entsprechend der Tagesordnung und den Rechten und Anforderungen anderer richtig platziert wurden. Er war der Politiker des Unternehmens, der Mann für den Handschlag, der Lenker seiner Politik. Er schrieb hin und wieder Leitartikel oder entschied zusammen mit Williams, wie diese zu formulieren waren, empfing Besucher, die zum Amt kamen, um den Herausgeber zu sprechen, und schlichtete alle bekannten Schwierigkeiten. Er stand bestimmten mächtigen Republikanern des Bezirks auf Abruf zur Verfügung, was jedoch ganz natürlich schien, da er selbst von seiner Gesinnung und seinem Charakter her Republikaner war. Einmal wurde er zum Postmeister ernannt, um ihn für einige nützliche Dienste zu belohnen, aber er lehnte ab, weil er mit seiner Zeitung wirklich mehr verdiente, als ihm das Amt des Postmeisters eingebracht hätte. Er erhielt alle Stadt- und Kreiswerbung, die die republikanischen Führer ihm geben konnten, und so ging es ihm sehr gut. Williams wusste teilweise um die Komplikationen seiner politischen Beziehungen, aber sie störten diesen fleißigen Mann nicht. Er verzichtete auf Moralpredigten. „Ich muss für mich, meine Frau und meine drei Kinder sorgen. Das reicht mir, um mich nicht um andere Leute zu kümmern.“ So wurde dieses Amt wirklich sehr ruhig, effizient und in den meisten Fällen angenehm geführt. Es war ein sonniger Arbeitsplatz.
Witla, der am Ende seines elften Schuljahres hierher kam, als er gerade siebzehn geworden war, war beeindruckt von der Persönlichkeit von Herrn Williams. Er mochte ihn. Er schloss einen gewissen Jonas Lyle ins Herz, der an dem arbeitete, was man als Chefschreibtisch des Satzraums bezeichnen könnte, und einen gewissen John Summers, der gelegentlich arbeitete – immer dann, wenn es einen zusätzlichen Ansturm an Druckaufträgen gab. Er merkte schnell, dass John Summers, der fünfundfünfzig Jahre alt, grau und ziemlich still war, Probleme mit der Lunge hatte und trank. Summers schlich sich mehrmals am Tag aus dem Büro, und war fünf bis fünfzehn Minuten weg. Niemand sagte jemals etwas, denn es gab hier keinen Druck. Die Arbeit, die zu erledigen war, wurde erledigt. Jonas Lyle war von interessanterer Natur. Er war zehn Jahre jünger, kräftiger, besser gebaut, aber dennoch eine Persönlichkeit. Er war halb phlegmatisch, philosophisch und ein wenig literarisch. Wie Eugene im Laufe der Zeit herausfand, hatte er in fast allen Teilen der Vereinigten Staaten gearbeitet – in Denver, Portland, St. Paul, St. Louis und wo nicht alles – und verfügte über einen reichen Schatz an Erinnerungen an diesen oder jenen Geschäftsinhaber. Immer wenn er in der Zeitung einen besonders bekannten Namen sah, brachte er die Zeitung zu Williams – und später, als sie sich besser kannten, zu Eugene – und sagte: „Ich kannte den Kerl aus ... Er war Postmeister (oder so was) in X ... Er ist ganz schön aufgestiegen, seit ich ihn kenne.“ In den meisten Fällen kannte er diese Prominenten überhaupt nicht persönlich, aber er hatte von ihnen gehört, und das Echo ihres Ruhmes, das in diesem abgelegenen Winkel der Welt widerhallte, beeindruckte ihn. Er war ein sorgfältiger Korrektor für Williams, ein schneller Schriftsetzer, ein Mann, der seine Aufgaben treu erfüllte. Aber er hatte es zu nichts gebracht, denn schließlich war er kaum mehr als eine Maschine. Eugene erkannte das auf einen Blick.
Lyle brachte ihm die Kunst des Schriftsetzens bei. Am ersten Tag zeigte er ihm die Theorie der Quadrate oder Fächer in einem Schrifttisch, wie manche Buchstaben handlicher waren als andere, warum manche Buchstaben in größerer Menge vertreten waren, warum Großbuchstaben in bestimmten Ämtern für bestimmte Zwecke verwendet wurden, in anderen nicht. „Bei der Chicago Tribune haben wir die Namen von Kirchen, Booten, Büchern, Hotels und ähnlichen Dingen kursiv geschrieben. Das ist die einzige Zeitung, die ich kenne, die das so macht“, bemerkte er. Was Slugs, Sticks, Galleys und Turnovers bedeuteten, wurde ihm schnell klar. Dass die Finger das Gewicht der Bleie durch Berührung erkennen würden, dass ein Buchstabe fast instinktiv seinen Weg zurück in die richtige Tasche finden würde, auch wenn man nicht darüber nachdachte, sobald man einmal Experte war, waren Tatsachen, die er fröhlich mitteilte. Er wollte, dass sein Wissen ernst genommen wurde, , und diese ernsthafte Aufmerksamkeit war Eugene aufgrund seines angeborenen Respekts vor jeglicher Art von Bildung nur zu gerne bereit, ihm zu schenken. Er wusste nicht, was er machen wollte, aber er wusste ganz genau, dass er alles sehen wollte. Aus diesem Grund fand er diesen Laden eine Zeit lang interessant, denn obwohl er schnell merkte, dass er weder Schriftsetzer noch Reporter werden wollte, noch irgendetwas anderes, das mit einer Landzeitung zu tun hatte, lernte er hier etwas über das Leben. Er arbeitete fröhlich an seinem Schreibtisch, lächelte die Welt an, die sich ihm durch das offene Fenster zeigte, las die kuriosen Nachrichten, Meinungen oder lokalen Anzeigen, während er sie aufstellte, und träumte davon, was die Welt für ihn bereithalten könnte. Er war noch nicht besonders ehrgeizig, aber hoffnungsvoll und dabei ein wenig melancholisch. Er sah Jungen und Mädchen, die er kannte, wie sie auf den Straßen oder an den Straßenecken herumlungerten; er sah, wo Ted Martinwood in der Kutsche seines Vaters vorbeifuhr oder George Anderson die Straße entlangging mit der Miene von jemandem, der niemals arbeiten musste. Georges Vater besaß das einzige Hotel. Er dachte daran, angeln zu gehen, Boot zu fahren, irgendwo mit einem hübschen Mädchen herumzulungern, aber leider schienen die Mädchen ihn nicht so recht zu mögen. Er war zu schüchtern. Er dachte, es müsse schön sein, reich zu sein. So träumte er.
Eugene war in dem Alter, in dem er sich mit leidenschaftlichen Worten ausdrücken wollte. Er war auch in dem Alter, in dem ihn seine Schüchternheit zurückhielt, obwohl er verliebt und sehr emotional war. Er konnte Stella nur belanglose Dinge sagen und ihr seine Leidenschaft zeigen, während es gerade die belanglosen Dinge waren, die ihr gefielen, nicht seine Leidenschaft. Sie begann sogar schon zu denken, dass er ein wenig seltsam war, ein wenig zu angespannt für ihr Naturell. Trotzdem mochte sie ihn. In der Stadt war allgemein bekannt, dass Stella seine Freundin war. In einer kleinen Stadt oder einem Dorf läuft das in der Schule normalerweise so. Man sah ihn mit ihr ausgehen. Sein Vater neckte ihn. Ihre Eltern hielten das für eine Jugendliebe, nicht so sehr von ihrer Seite, da sie wussten, dass sie jegliche Zuneigungsbekundungen von Jungen eher leicht nahm, sondern eher von seiner Seite. Sie dachten, seine Sentimentalität würde Stella bald langweilen. Und sie lagen nicht ganz falsch mit ihrer Einschätzung. Einmal wurde auf einer Party von mehreren Highschool-Mädchen ein „Landpostamt” organisiert. Das war eines dieser Spiele, bei denen es nur ums Küssen ging. Ein System von Raten führte zu einer Reihe von Strafen. Wer daneben lag, musste Postmeister werden und jemanden zum „Postamt“ rufen. „Post“ bedeutete, in einem dunklen Raum (wo der Postmeister auf der Tribüne stand) von jemandem geküsst zu werden, den man mochte oder der einen mochte. Als Postmeister hatte man die Autorität oder den Zwang – wie auch immer man dazu stand –, jemanden seiner Wahl aufzurufen.
In diesem speziellen Fall war Stella, die vor Eugene erwischt wurde, gezwungen, jemanden zum Küssen aufzurufen. Ihr erster Gedanke galt ihm, aber wegen der Offenheit der Tat und weil sie insgeheim Angst vor seiner Begierde hatte, war der Name, den sie aussprechen musste, Harvey Rutter. Harvey war ein gutaussehender Junge, den Stella nach ihrer ersten Begegnung mit Eugene kennengelernt hatte. Er faszinierte sie noch nicht, aber er gefiel ihr. Sie hatte den koketten Wunsch, zu sehen, wie er so war. Dies war ihre erste direkte Gelegenheit dazu.
Er trat fröhlich ein, und Eugene war sofort wahnsinnig vor Eifersucht. Er konnte nicht verstehen, warum sie ihn so behandelte. Als er an der Reihe war, rief er Bertha Shoemaker, die er bewunderte und die auf ihre Art süß war, aber in seinen Augen nichts für Stella war. Der Schmerz, sie zu küssen, obwohl er eigentlich das andere Mädchen wollte, war groß. Als er herauskam, sah Stella die schlechte Laune in seinen Augen, entschied sich aber, sie zu ignorieren. Er war offensichtlich halbherzig und niedergeschlagen in seiner vorgetäuschten Freude.
Eine zweite Chance kam für sie, und diesmal rief sie ihn auf. Er ging hin, war aber halb trotzig. Er wollte sie bestrafen. Als sie sich im Dunkeln trafen, erwartete sie, dass er seine Arme um sie legen würde. Ihre eigenen Hände waren etwa auf der Höhe seiner Schultern. Stattdessen fasste er nur einen ihrer Arme mit seiner Hand und drückte ihr einen kühlen Kuss auf die Lippen. Hätte er nur gefragt: „Warum hast du das getan?“, oder sie festgehalten und sie gebeten, ihn nicht so schlecht zu behandeln, hätte die Beziehung vielleicht länger gehalten. Stattdessen sagte er nichts, und sie wurde trotzig und ging fröhlich davon. Es herrschte eine gewisse Zurückhaltung zwischen ihnen, bis die Party zu Ende war und er sie nach Hause brachte.
„Du bist heute Abend wohl melancholisch“, sagte sie, nachdem sie zwei Blocks schweigend gegangen waren. Die Straßen waren dunkel, und ihre Schritte hallten hohl auf dem Kopfsteinpflaster wider.
„Oh, mir geht es gut“, antwortete er mürrisch.
„Ich finde es bei den Weimers immer so schön, wir haben dort immer so viel Spaß.“
„Ja, viel Spaß“, wiederholte er verächtlich.
„Ach, sei nicht so mürrisch!“, entgegnete sie. „Du hast keinen Grund, dich so aufzuregen.“
„Habe ich nicht?“
„Nein, hast du nicht.“
„Na ja, wenn du das so siehst, dann habe ich wohl keinen Grund. Ich sehe das nicht so.“
„Nun, es ist mir egal, wie du das siehst.“
„Ach nein?“
„Nein, tut es nicht.“ Sie hob den Kopf und war wütend.
„Na dann ist es mir egal.“
Es folgte eine weitere Stille, die bis kurz vor ihrer Ankunft anhielt.
„Kommst du nächsten Donnerstag zum geselligen Beisammensein?“, fragte er. Er meinte damit einen methodistischen Abend, der ihm zwar nicht besonders wichtig war, aber praktisch war, weil er sie so sehen und nach Hause bringen konnte. Er fragte sie, weil er befürchtete, dass es bald zum Bruch kommen könnte.
„Nein“, sagte sie. „Ich glaube nicht, dass ich komme.“
„Warum nicht?“
„Ich habe keine Lust.“
„Ich finde, du bist gemein“, sagte er vorwurfsvoll.
„Das ist mir egal“, antwortete sie. „Ich finde dich zu herrisch. Ich glaube, ich mag dich sowieso nicht besonders.“
Sein Herz zog sich bedrohlich zusammen.
„Mach, was du willst“, beharrte er.
Sie erreichten ihr Tor. Es war seine Gewohnheit, sie im Schatten eines Gegenstandes oder Lebewesens zu küssen – sie trotz ihrer Proteste ein paar Minuten lang festzuhalten. Als sie sich heute näherten, dachte er daran, es zu tun, aber sie gab ihm keine Gelegenheit dazu. Als sie das Tor erreichten, öffnete sie es schnell und schlüpfte hinein. „Gute Nacht“, rief sie.
„Gute Nacht“, sagte er, und als sie ihre Tür erreichte, „Stella!“
Sie war offen, und sie schlüpfte hinein. Er stand im Dunkeln, verletzt, verletzt, bedrückt. Was sollte er tun? Er schlenderte nach Hause und zerbrach sich den Kopf, ob er nie wieder mit ihr sprechen oder sie ansehen sollte, bis sie zu ihm kam, oder ob er sie suchen und alles mit ihr ausfechten sollte. Sie hatte Unrecht, das wusste er. Als er zu Bett ging, grämte er sich darüber, und als er aufwachte, beschäftigte es ihn den ganzen Tag.
Er machte ziemlich schnelle Fortschritte als Schriftsetzer und bis zu einem gewissen Grad auch in der Theorie des Journalismus, und er arbeitete fleißig und ernsthaft in seinem angestrebten Beruf. Er liebte es, aus dem Fenster zu schauen und zu zeichnen, obwohl er in letzter Zeit, nachdem er Stella so gut kennengelernt hatte und wegen ihrer Gleichgültigkeit mit ihr in Streit geraten war, wenig Herzblut darin legte. Es hatte einen konstruktiven Wert, ins Amt zu kommen, eine Schürze anzuziehen und mit der lokalen Korrespondenz vom Vortag oder mit Telegrammen zu beginnen, die frisch an seinem Haken eingehängt worden waren. Williams versuchte, ihn als Reporter für einige lokale Nachrichten einzusetzen, aber er arbeitete langsam und war fast ein Versager darin, alle Fakten zu recherchieren. Er schien nicht zu wissen, wie man jemanden interviewt, und kam mit einer Geschichte zurück, die aus anderen Quellen ergänzt werden musste. Er verstand die Theorie der Nachrichten wirklich nicht, und Williams konnte sie ihm nur teilweise erklären. Meistens arbeitete er an seinem Fall, aber er lernte doch einiges.
Zum einen begann er, die Theorie der Werbung zu begreifen. Diese lokalen Händler schalteten Tag für Tag die gleichen Anzeigen, und viele von ihnen änderten sie nicht merklich. Er sah, wie Lyle und Summers die gleichen Anzeigen nahmen, die, was ihre Hauptmerkmale betraf, Monat für Monat unverändert erschienen waren, und nur ein paar Worte änderten, bevor sie sie an die Druckerei zurückschickten. Er wunderte sich über die Gleichheit der Anzeigen, und als er sie schließlich zur Überarbeitung bekam, wünschte er sich oft, er könnte sie ein wenig ändern. Die Sprache kam ihm so langweilig vor.
„Warum machen die nie kleine Zeichnungen in diese Anzeigen?“, fragte er Lyle eines Tages. „Findest du nicht, dass die dann etwas besser aussehen würden?“
„Oh, ich weiß nicht“, antwortete Jonas. „Sie sehen doch ganz gut aus. Die Leute hier würden so etwas nicht wollen. Sie würden es für zu ausgefallen halten.“ Eugene hatte die Anzeigen in den Zeitschriften gesehen und in gewisser Weise studiert. Sie erschienen ihm so viel faszinierender. Warum konnten Zeitungsanzeigen nicht anders sein?
Aber er musste sich nie mit diesem Problem herumschlagen. Herr Burgess kümmerte sich um die Werbekunden. Er legte fest, wie die Anzeigen aussehen sollten. Er sprach nie mit Eugene oder Summers darüber, nicht einmal mit Lyle. Manchmal ließ er Williams erklären, wie sie gestaltet sein sollten. Eugene war so jung, dass Williams ihm zunächst nicht viel Aufmerksamkeit schenkte, aber nach einer Weile begann er zu erkennen, dass hier eine Persönlichkeit steckte, und dann erklärte er ihm Dinge – warum der Platz für manche Artikel knapp bemessen sein musste und für andere großzügig, warum Nachrichten aus dem Landkreis, aus den kleinen Städten rund um Alexandria und über die Menschen finanziell viel wichtiger für die Zeitung waren als die korrekte Berichterstattung über den Tod des Sultans von der Türkei. Das Wichtigste war, die lokalen Namen richtig zu schreiben. „Schreib sie niemals falsch“, ermahnte er ihn einmal. „Lass niemals einen Teil eines Namens weg, wenn du es vermeiden kannst. Die Leute reagieren darauf sehr empfindlich. Sie kündigen ihr Abonnement, wenn du nicht aufpasst, und du weißt nicht, woran es liegt.“
Eugene nahm sich all diese Dinge zu Herzen. Er wollte sehen, wie das Ganze ablief, auch wenn es ihm im Grunde genommen ein wenig klein vorkam. Tatsächlich kamen ihm die meisten Leute ein wenig klein vor.
Eine der Sachen, die ihn interessierte, war zu sehen, wie die Zeitung „ “ auf die Druckpresse gelegt und gedruckt wurde. Er half gern dabei, die Druckformen einzuspannen, und sah zu, wie sie ausgerichtet und registriert wurden. Er hörte gern das Rattern der Druckpresse und half dabei, die nassen Zeitungen zu den Versandtischen und zum Ausgabetisch vorne im Laden zu tragen. Die Zeitung hatte keine sehr hohe Auflage, aber zu dieser Zeit herrschte ein leichtes Summen, das ihm gefiel. Er mochte das Gefühl, wenn seine Hände und sein Gesicht schmutzig waren und es ihm nichts ausmachte, und wenn er seine zerzausten Haare im Spiegel sah. Er versuchte, sich nützlich zu machen, und die verschiedenen Leute bei der Zeitung mochten ihn, obwohl er oft etwas ungeschickt und langsam war. Er war zu dieser Zeit nicht sehr kräftig und hatte Magenprobleme. Er dachte auch, dass der Geruch der Druckfarbe seine Lungen beeinträchtigen könnte, obwohl er sich darüber keine ernsthaften Sorgen machte. Im Großen und Ganzen war es interessant, aber klein; er wusste, dass es draußen eine viel größere Welt gab. Er hoffte, eines Tages dorthin zu gehen; er hoffte, nach Chicago zu gehen.
Kapitel III
Eugene wurde immer launischer und unruhiger, weil Stella immer unabhängiger wurde. Sie wurde wegen seiner Launen immer gleichgültiger. Dass andere Jungs total auf sie standen, spielte eine große Rolle; dass ein bestimmter Junge, Harvey Rutter, immer freundlich, aber nicht aufdringlich war, besser aussah als Eugene und viel besser gelaunt war, half dabei sehr. Eugene sah sie ab und zu mit ihm zusammen, sah sie mit ihm Schlittschuh laufen oder zumindest mit einer Gruppe, zu der er gehörte. Eugene hasste ihn aus tiefstem Herzen; er hasste sie manchmal dafür, dass sie ihm nicht ganz nachgab; aber er war trotzdem total verrückt nach ihrer Schönheit. Das prägte sich in seinem Kopf als ein Ideal ein. Von da an wusste er ganz genau, wie eine Frau sein musste, um wirklich schön zu sein.
Außerdem wurde ihm dadurch seine Stellung in der Welt bewusst. Bisher war er immer von seinen Eltern abhängig gewesen, was Essen, Kleidung und Taschengeld anging, und seine Eltern waren nicht besonders großzügig. Er kannte andere Jungs, die Geld hatten, um nach Chicago oder nach Springfield – letzteres war näher – zu fahren, um dort Samstag und Sonntag Spaß zu haben. Solche Vergnügungen waren für ihn nicht drin. Sein Vater würde es nicht erlauben, oder besser gesagt, er würde es nicht bezahlen. Es gab andere Jungs, die dank reichlich Taschengeld die Dandys der Stadt waren. Er sah sie mittwochs und samstags und manchmal auch sonntagabends vor dem Buchladen an der Ecke herumlungern, dem Haupttreffpunkt der Elite, bevor sie irgendwohin gingen, gekleidet in luxuriöse Gewänder, von denen er nicht einmal zu träumen wagte. Ted Martinwood, der Sohn des wichtigsten Kurzwarenhändlers, hatte einen Gehrock, den er manchmal trug, wenn er zum Friseur ging, um sich rasieren zu lassen, bevor er seine Freundin besuchen ging. George Anderson besaß einen Anzug und trug zu allen Tanzveranstaltungen Tanzschuhe. Da war Ed Waterbury, der dafür bekannt war, ein eigenes Pferd und einen eigenen Runabout zu besitzen. Diese Jugendlichen waren etwas älter und interessierten sich für Mädchen aus einer etwas älteren Gruppe, aber im Grunde genommen war es dasselbe. Diese Dinge verletzten ihn.
Er selbst hatte keine Aussicht auf eine Zukunft, die ihm, soweit er sehen konnte, finanziellen Wohlstand versprach. Sein Vater würde niemals reich werden, das war jedem klar. Er selbst hatte in der Schule keine nennenswerten Fortschritte gemacht – das wusste er selbst. Er hasste Versicherungen – sowohl das Akquirieren als auch das Schreiben –, verachtete das Nähmaschinengeschäft und wusste nicht, wie er mit dem, was er gerne in Literatur oder Kunst machen würde, jemals etwas anfangen könnte. Sein Zeichnen schien ein Witz zu sein, sein Schreiben oder sein Wunsch zu schreiben sinnlos. Er war grüblerisch unglücklich.
Eines Tages blieb Williams, der ihn schon lange beobachtet hatte, an seinem Schreibtisch stehen.
„Sag mal, Witla, warum gehst du nicht nach Chicago?“, fragte er. „Dort gibt es für einen Jungen wie dich viel mehr zu tun als hier. Bei einer Landzeitung wirst du es nie zu etwas bringen.“
„Ich weiß“, sagte Eugene.
„Bei mir ist das anders“, fuhr Williams fort. „Ich habe meine Erfahrungen gemacht. Ich habe eine Frau und drei Kinder, und wenn man eine Familie hat, kann man kein Risiko eingehen. Aber du bist noch jung. Warum gehst du nicht nach Chicago und suchst dir eine Stelle bei einer Zeitung? Du könntest etwas erreichen.“
„Was könnte ich denn bekommen?“, fragte Eugene.
„Na ja, du könntest vielleicht einen Job als Schriftsetzer bekommen, wenn du der Gewerkschaft beitrittst. Ich weiß nicht, wie gut du als Reporter wärst – ich glaube kaum, dass das dein Ding ist. Aber du könntest Kunst studieren und zeichnen lernen. Zeitungszeichner verdienen gut.“
Eugene dachte an seine Kunst. Sie war nicht besonders gut. Er machte nicht viel daraus. Trotzdem dachte er an Chicago; die Welt reizte ihn. Wenn er nur hier wegkommen könnte – wenn er nur mehr als sieben oder acht Dollar pro Woche verdienen könnte. Er grübelte darüber nach.
An einem Sonntagnachmittag gingen er und Stella mit Myrtle zu Sylvia nach Hause, und nach einem kurzen Aufenthalt sagte Stella, dass sie gehen müsse; ihre Mutter erwarte sie. Myrtle wollte mit ihr gehen, änderte aber ihre Meinung, als Sylvia sie bat, zum Tee zu bleiben. „Eugene soll sie nach Hause bringen“, sagte Sylvia. Eugene war auf seine hartnäckige, hoffnungslose Art begeistert. Er war noch nicht davon überzeugt, dass er sie nicht für sich gewinnen konnte. Als sie in die frische, süße Luft traten – es war fast Frühling –, hatte er das Gefühl, dass er jetzt eine Chance hatte, etwas zu sagen, das sie für ihn gewinnen würde – das sie zu ihm locken würde.