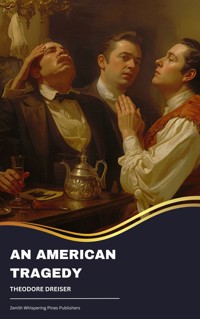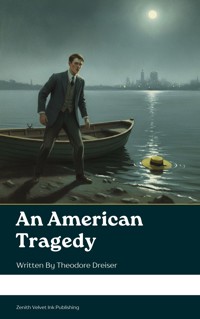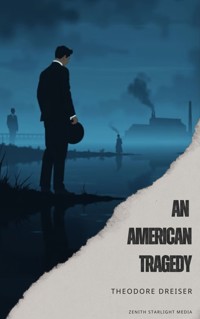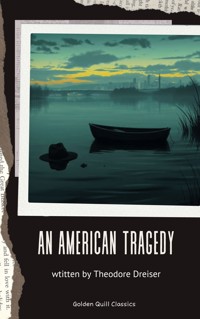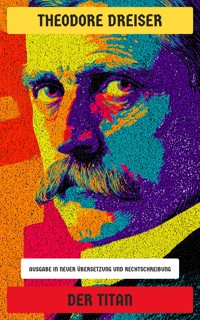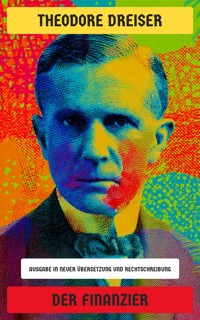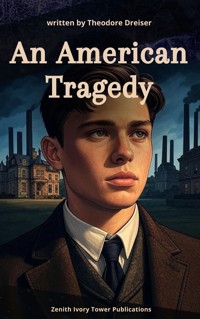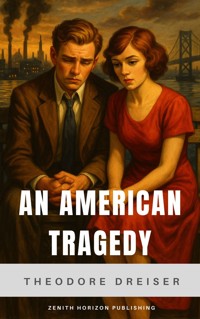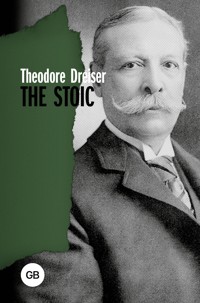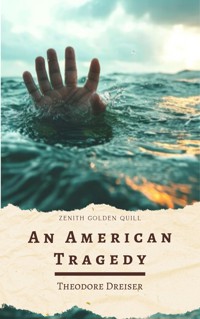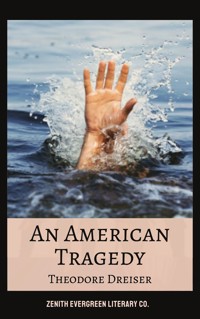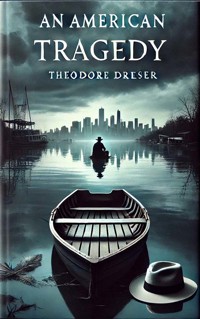1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Neu übersetzt Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Jennie Gerhardt" von Theodore Dreiser ist ein bedeutender Roman der amerikanischen Literatur, der eindringlich und bewegend die sozialen Konflikte und moralischen Spannungen des frühen 20. Jahrhunderts behandelt. Im Mittelpunkt der Handlung steht Jennie Gerhardt, eine junge, gutherzige Frau aus bescheidenen Verhältnissen, deren Leben von Armut, gesellschaftlichen Vorurteilen und persönlichen Tragödien geprägt ist. Die Geschichte beginnt, als Jennie auf den wohlhabenden Senator Brander trifft, der ihr Schicksal entscheidend beeinflusst. Diese Begegnung setzt eine Reihe von Ereignissen in Gang, die Jennie immer wieder vor schwerwiegende Entscheidungen und moralische Konflikte stellen. Nach einer Reihe persönlicher Rückschläge lernt sie Lester Kane kennen, einen wohlhabenden Industriellensohn, mit dem sie eine intensive Beziehung eingeht. Doch die Unterschiede ihrer gesellschaftlichen Herkunft und die strikten Moralvorstellungen der damaligen Zeit bedrohen fortwährend ihre Liebe und ihr persönliches Glück. Dreiser beschreibt meisterhaft, wie Jennies Aufrichtigkeit, Güte und innerliche Stärke im Kontrast zu einer Gesellschaft stehen, die von Doppelmoral und sozialer Ungerechtigkeit geprägt ist. Die tragische Schönheit des Romans liegt in seiner ehrlichen Darstellung menschlicher Schwächen, gesellschaftlicher Zwänge und des beständigen Kampfes um Würde und Glück. "Jennie Gerhardt" ist von großer literarischer Bedeutung, da Dreiser darin die Widersprüche des amerikanischen Traums aufzeigt: den scheinbar grenzenlosen Möglichkeiten einerseits, und der harten Realität sozialer Ungleichheit andererseits. Durch seine detaillierte Charakterzeichnung, realistische Erzählweise und eindringliche Gesellschaftskritik bleibt dieser Roman ein zeitloses und wichtiges Werk, das den Leser auch heute noch emotional berührt und zum Nachdenken anregt. Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Jennie Gerhardt
Inhaltsverzeichnis
Kapitel I
Eines Morgens im Herbst 1880 kam eine Frau mittleren Alters mit einem 18-jährigen Mädchen an die Rezeption des besten Hotels in Columbus, Ohio, und fragte, ob es dort irgendetwas zu tun gäbe. Sie war hilflos und dick, hatte ein offenes Gesicht und wirkte unschuldig und schüchtern. Ihre Augen waren groß und geduldig, und in ihnen lag ein Schatten der Verzweiflung, wie ihn nur diejenigen kennen, die schon einmal mitfühlend in die Gesichter verzweifelter und hilfloser armer Menschen geblickt haben. Jeder konnte sehen, woher ihre Tochter die Schüchternheit und Schamhaftigkeit hatte, die sie nun zurücktreten und gleichgültig wegschauen ließen. Sie war das Produkt der Fantasie, der Gefühle und der angeborenen Zuneigung der ungebildeten, aber poetischen Seele ihrer Mutter, kombiniert mit der Ernsthaftigkeit und Gelassenheit, die für ihren Vater charakteristisch waren. Die Armut trieb sie in die Not. Zusammen boten sie ein so anrührendes Bild ehrlicher Not, dass sogar der Angestellte davon berührt war.
„Was würdest du gerne machen?“, fragte er.
„Vielleicht haben Sie etwas zu putzen oder zu schrubben“, antwortete sie schüchtern. „Ich könnte den Boden wischen.“
Die Tochter, die das hörte, drehte sich unruhig um, nicht weil sie die Arbeit störte, sondern weil sie es hasste, wenn Leute ihre Armut erahnen konnten. Der Angestellte, ein Mann von Welt, war von der Schönheit in Not beeindruckt. Die unschuldige Hilflosigkeit der Tochter ließ ihr Schicksal wirklich hart erscheinen.
„Wartet einen Moment“, sagte er, ging in ein hinteres Büro und rief die Haushälterin.
Es gab Arbeit zu erledigen. Die Haupttreppe und der Salon waren nicht gefegt, weil die reguläre Putzfrau nicht da war.
„Ist das ihre Tochter, die da bei ihr steht?“, fragte die Haushälterin, die sie von ihrem Standpunkt aus sehen konnte.
„Ja, ich glaube schon.“
„Sie könnte heute Nachmittag kommen, wenn sie möchte. Das Mädchen hilft ihr doch, nehme ich an?“
„Geh mal zur Haushälterin“, sagte der Angestellte freundlich, als er zum Schreibtisch zurückkam. „Geh einfach da durch“ – er zeigte auf eine Tür in der Nähe. „Sie wird das mit dir regeln.“
Eine Reihe von Unglücksfällen, deren tragischer Höhepunkt diese kleine Szene nennen könnte, hatte sich im Leben und in der Familie von William Gerhardt, einem Glasbläser von Beruf, ereignet. Nachdem er die in den unteren Schichten so häufigen Rückschläge erlitten hatte, war dieser Mann gezwungen, seine Frau, seine sechs Kinder und sich selbst für den Lebensunterhalt auf das zu verlassen, was der Zufall ihm an jedem neuen Tag bringen würde. Er selbst lag krank im Bett. Sein ältester Sohn Sebastian, von seinen Freunden „Bass“ genannt, arbeitete als Lehrling bei einem örtlichen Güterwagenbauer, verdiente aber nur vier Dollar pro Woche. Genevieve, die älteste der Mädchen, war bereits über achtzehn, hatte aber noch keine Ausbildung für eine bestimmte Arbeit. Die anderen Kinder, George, vierzehn, Martha, zwölf, William, zehn, und Veronica, acht, waren noch zu jung, um etwas zu tun, und machten das Problem des Überlebens nur noch komplizierter. Ihre einzige Stütze war das Haus, das, abgesehen von einer Hypothek von sechshundert Dollar, dem Vater gehörte. Er hatte sich das Geld geliehen, als er genug gespart hatte, um das Haus zu kaufen, und drei Zimmer und eine Veranda anbauen wollte, damit es groß genug für die Familie wurde. Die Hypothek war noch nicht ganz abbezahlt, aber die Zeiten waren so schlecht, dass er nicht nur seine Ersparnisse für die Tilgung, sondern auch die jährlichen Zinsen aufbrauchen musste. Gerhardt war hilflos, und das Bewusstsein seiner prekären Lage – die Arztrechnung, die fälligen Hypothekenzinsen, die Schulden beim Metzger und Bäcker, die ihn, weil sie ihn als absolut ehrlich kannten, vertraut hatten, bis sie es nicht mehr konnten – all diese Sorgen lasteten auf ihm und quälten ihn so sehr, dass sich seine Genesung verzögerte.
Frau Gerhardt war keine Schwächling. Eine Zeit lang nahm sie Wäsche an, so wenig sie bekommen konnte, und widmete die Zeit dazwischen dem Anziehen der Kinder, dem Kochen, dem Aufbruch der Kinder zur Schule, dem Flicken ihrer Kleidung, der Pflege ihres Mannes und gelegentlich dem Weinen. Nicht selten ging sie persönlich zu einem neuen Lebensmittelhändler, jedes Mal weiter und weiter weg, und eröffnete mit ein wenig Bargeld ein Konto, bis andere Lebensmittelhändler den Philanthropen vor seiner Torheit warnten. Mais war billig. Manchmal kochte sie einen Topf Laugenmais, der zusammen mit ein paar anderen Sachen fast eine ganze Woche lang reichte. Auch Maismehl, zu Brei gekocht, war besser als nichts, und mit ein bisschen Milch war das fast schon ein Festmahl. Bratkartoffeln waren das Luxuriöseste, was sie jemals zu essen bekamen, und Kaffee war eine seltene Delikatesse. Kohle holten sie in Eimern und Körben aus dem Labyrinth der Gleise des nahe gelegenen Bahnhofs. Holz holten sie auf ähnlichen Ausflügen zu den umliegenden Holzlagern. So lebten sie von Tag zu Tag und hofften jede Stunde, dass der Vater wieder gesund würde und die Glasfabrik bald wieder in Betrieb genommen würde. Aber als der Winter näher rückte, begann Gerhardt zu verzweifeln.
„Ich muss hier schnell weg“, war der ständige Kommentar des robusten Deutschen, und seine Angst kam nur schwach in seiner bescheidenen Stimme zum Ausdruck.
Zu all diesen Schwierigkeiten kam noch hinzu, dass die kleine Veronica die Masern bekam und man einige Tage lang um ihr Leben bangte. Die Mutter vernachlässigte alles andere, um sich um sie zu kümmern und auf das Beste zu hoffen. Dr. Ellwanger kam jeden Tag aus rein menschlicher Anteilnahme und untersuchte das Kind ernst. Der lutherische Pfarrer Wundt kam, um Trost zu spenden. Beide Männer brachten eine Atmosphäre von düsterem Kirchentum ins Haus. Sie waren die schwarz gekleideten, scheinheiligen Abgesandten höherer Mächte. Frau Gerhardt hatte das Gefühl, ihr Kind zu verlieren, und wachte traurig am Bettchen. Nach drei Tagen war das Schlimmste überstanden, aber es gab kein Brot im Haus. Sebastians Lohn war für Medikamente ausgegeben worden. Nur Kohle konnte man sich kostenlos holen, und mehrmals waren die Kinder vom Bahngelände verscheucht worden. Frau Gerhardt überlegte, wo sie noch um Hilfe bitten könnte, und kam verzweifelt auf das Hotel. Nun bot sich ihr wie durch ein Wunder eine Chance.
„Wie viel verlangen Sie?“, fragte die Haushälterin sie.
Frau Gerhardt hatte nicht damit gerechnet, dass sie noch eine Chance bekommen würde, aber die Not machte sie mutig.
„Wäre ein Dollar pro Tag zu viel?“
„Nein“, sagte die Haushälterin, „es gibt nur etwa drei Tage Arbeit pro Woche. Wenn du jeden Nachmittag kommst, kannst du das schaffen.“
„Sehr gut“, sagte die Bewerberin. „Sollen wir heute anfangen?“
„Ja, wenn du jetzt mitkommst, zeige ich dir, wo die Putzsachen sind.“
Das Hotel, in das sie so kurzerhand eingeführt wurden, war für die damalige Zeit und den Ort ein ziemlich bemerkenswertes Exemplar. Columbus, die Hauptstadt des Bundesstaates mit fünfzigtausend Einwohnern und einem regen Passagierverkehr, war ein gutes Feld für das Hotelgewerbe, und die Gelegenheit war genutzt worden; zumindest dachten das die Einwohner von Columbus stolz. Das fünfstöckige, imposante Gebäude stand an einer Ecke des zentralen öffentlichen Platzes, wo sich auch das Kapitol und die wichtigsten Geschäfte befanden. Die Lobby war groß und war kürzlich renoviert worden. Sowohl der Boden als auch die Wandverkleidung waren aus weißem Marmor, der durch häufiges Polieren glänzend gehalten wurde. Es gab eine imposante Treppe mit Handläufen aus Walnussholz und golden glänzenden Fußleisten. Eine einladende Ecke war einem Zeitungs- und Zigarrenstand gewidmet. Dort, wo die Treppe nach oben führte, befanden sich der Schreibtisch des Angestellten und die Büros, die alle aus Hartholz gefertigt und mit neuartigen Gaslampen verziert waren. Durch eine Tür an einem Ende der Lobby konnte man den Friseursalon mit seinen Stühlen und einer Reihe von Rasierbechern sehen. Draußen standen normalerweise zwei oder drei Busse, die je nach Zugverkehr ankamen oder abfuhren.
In diese Karawanserei kamen die besten politischen und gesellschaftlichen Gönner des Staates. Mehrere Gouverneure hatten es während ihrer Amtszeit zu ihrem ständigen Aufenthaltsort gemacht. Die beiden Senatoren der Vereinigten Staaten, wann immer sie geschäftlich nach Columbus kamen, hatten ausnahmslos Salons im Hotel. Einer von ihnen, Senator Brander, wurde vom Besitzer mehr oder weniger als ständiger Gast angesehen, da er nicht nur in der Stadt wohnte, sondern auch ein sonst heimatloser Junggeselle war. Zu den anderen, eher vorübergehenden Gästen gehörten Kongressabgeordnete, Staatsgesetzgeber und Lobbyisten, Kaufleute, Freiberufler und, in deren Gefolge, die ganze Schar der Unbeschreiblichen, die mit ihrem Kommen und Gehen den Glanz und die Lebendigkeit dieser kaleidoskopischen Welt ausmachen.
Mutter und Tochter, die plötzlich in diese Welt voller Glanz und Glamour geworfen wurden, waren total überwältigt. Sie waren so schüchtern, dass sie nichts anfassen wollten, um niemanden zu beleidigen. Der große, mit rotem Teppich ausgelegte Flur, den sie kehren sollten, wirkte auf sie wie ein Palast; sie hielten den Blick gesenkt und sprachen mit leiser Stimme. Als es darum ging, die Stufen zu schrubben und die golden glänzenden Beschläge der prächtigen Treppe zu polieren, mussten sich beide zusammenreißen, die Mutter gegen ihre Schüchternheit, die Tochter gegen die Scham, sich so öffentlich zu zeigen. Weit unter ihnen lag die imposante Lobby, und Männer, die herumlungerten, rauchten und ständig ein- und ausgingen, konnten die beiden sehen.
„Ist das nicht schön?“, flüsterte Genevieve und zuckte nervös zusammen, als sie ihre eigene Stimme hörte.
„Ja“, antwortete ihre Mutter, die auf den Knien saß und mit ernstem, aber ungeschicktem Griff den Lappen auswrang.
„Es muss viel kosten, hier zu wohnen, meinst du nicht?“
„Ja“, sagte ihre Mutter. „Vergiss nicht, diese kleinen Ecken zu schrubben. Schau mal, was du da vergessen hast.“
Jennie, gekränkt durch diese Zurechtweisung, machte sich eifrig an die Arbeit und polierte kräftig, ohne wieder den Mut aufzubringen, den Blick zu heben.
Mit akribischer Sorgfalt arbeiteten sie sich bis etwa fünf Uhr nach unten; draußen war es dunkel, und der ganze Vorraum war hell erleuchtet. Nun waren sie fast am Ende der Treppe angelangt.
Durch die großen Schwingtüren kam aus der kalten Welt ein großer, vornehmer Herr mittleren Alters herein, dessen Zylinderhut und lockerer Militärmantel ihn in der Menge der Müßiggänger sofort als jemanden von Bedeutung auszeichneten. Sein Gesicht war dunkel und ernst, aber breit und sympathisch, und seine hellen Augen waren von dichten, buschigen, schwarzen Augenbrauen stark beschattet. Er ging zum Schreibtisch, nahm den Schlüssel, der schon für ihn bereitlag, und stieg die Treppe hinauf.
Die Frau mittleren Alters, die zu seinen Füßen schrubbte, beachtete er nicht nur, indem er um sie herumging, sondern auch, indem er ihr freundlich mit der Hand winkte, als wolle er sagen: „Bleiben Sie stehen.“
Die Tochter jedoch fiel ihm auf, als sie aufstand, und ihr beunruhigter Blick zeigte, dass sie befürchtete, ihm im Weg zu stehen.
Er verbeugte sich und lächelte freundlich.
„Du hättest dir keine Mühe machen sollen“, sagte er.
Jennie lächelte nur.
Als er den oberen Treppenabsatz erreicht hatte, versicherte ihm ein impulsiver Seitenblick noch deutlicher als zuvor, dass sie ungewöhnlich anziehend aussah. Er bemerkte die hohe, weiße Stirn mit dem glatt gescheitelten und geflochtenen Haar. Die Augen, die er sah, waren blau und die Haut hell. Er hatte sogar Zeit, den Mund und die vollen Wangen zu bewundern – vor allem die wohlgeformte, anmutige Gestalt, voller Jugend, Gesundheit und jener hoffnungsvollen Erwartung, die für Menschen mittleren Alters so sehr auf alles hindeutet, was es sich von der Vorsehung zu wünschen gilt. Ohne einen weiteren Blick ging er würdevoll seines Weges, aber der Eindruck ihrer bezaubernden Persönlichkeit begleitete ihn. Das war der ehrenwerte George Sylvester Brander, Junior-Senator.
„War das nicht ein gut aussehender Mann, der gerade vorbeigegangen ist?“, fragte Jennie wenig später.
„Ja, das war er“, sagte ihre Mutter.
„Er hatte einen Stock mit goldenem Knauf.“
„Du darfst Leute nicht anstarren, wenn sie vorbeigehen“, ermahnte ihre Mutter sie weise. „Das ist nicht nett.“
„Ich habe ihn nicht angestarrt“, erwiderte Jennie unschuldig. „Er hat sich vor mir verbeugt.“
„Nun, achte auf niemanden“, sagte ihre Mutter. „Das könnte ihnen unangenehm sein.“
Jennie machte sich schweigend an ihre Arbeit, aber der Glanz der großen Welt wirkte auf ihre Sinne. Sie konnte nicht umhin, den Geräuschen, dem Trubel, dem Stimmengewirr und dem Lachen um sie herum zu lauschen. In einem Teil des Wohnzimmers befand sich das Esszimmer, und dem Klirren des Geschirrs konnte man entnehmen, dass das Abendessen vorbereitet wurde. In einem anderen Teil befand sich das eigentliche Wohnzimmer, und dort kam jemand, um Klavier zu spielen. Das Gefühl der Ruhe und Entspannung, das vor dem Abendessen einsetzt, durchdrang den Raum. Es erfüllte das Herz der unschuldigen Arbeiterin mit Hoffnung, denn sie war noch jung, und die Armut konnte ihren jungen Geist noch nicht mit Sorgen erfüllen. Sie wischte fleißig weiter und vergaß manchmal die besorgte Mutter an ihrer Seite, deren freundliche Augen von Krähenfüßen umrandet waren und deren Lippen die hundert Sorgen des Tages halb wiederholten. Sie konnte nur daran denken, wie faszinierend all das war, und wünschte sich, dass ein Teil davon ihr zuteilwerden könnte.
Um halb sechs kam die Haushälterin, die sich an sie erinnert hatte, und sagte ihnen, dass sie gehen könnten. Mit einem Seufzer der Erleichterung gaben beide die fertig polierte Treppe auf, räumten ihre Arbeitsgeräte weg und eilten nach Hause, zumindest die Mutter froh, dass sie endlich etwas zu tun hatte.
Als sie an mehreren schönen Häusern vorbeikamen, wurde Jennie wieder von diesem undeutlichen Gefühl erfasst, das das ungewohnte, neue Leben im Hotel in ihr hervorgerufen hatte.
„Ist es nicht toll, reich zu sein?“, fragte sie.
„Ja“, antwortete ihre Mutter, die an die leidende Veronica dachte.
„Hast du gesehen, was für einen großen Speisesaal sie dort hatten?“
„Ja.“
Sie gingen weiter, vorbei an den niedrigen Häuschen und zwischen den abgefallenen Blättern.
„Ich wünschte, wir wären reich“, murmelte Jennie halb zu sich selbst.
„Ich weiß nicht, was ich tun soll“, vertraute ihre Mutter ihr mit einem langen Seufzer an. „Ich glaube, wir haben nichts zu essen im Haus.“
„Lass uns noch mal bei Herrn Bauman vorbeischauen“, sagte Jennie, deren natürliche Mitgefühl durch die hoffnungslose Stimme ihrer Mutter wieder geweckt worden war.
„Glaubst du, er würde uns noch vertrauen?“
„Sagen wir ihm, wo wir arbeiten. Ich werde es tun.“
„Na gut“, sagte ihre Mutter müde.
Nervös betraten sie den kleinen, schwach beleuchteten Lebensmittelladen, der zwei Blocks von ihrem Haus entfernt war. Frau Gerhardt wollte gerade anfangen, aber Jennie kam ihr zuvor.
„Würden Sie uns heute Abend etwas Brot geben und ein wenig Speck? Wir arbeiten jetzt im Columbus-Haus und zahlen Ihnen ganz bestimmt am Samstag.“
„Ja“, sagte Frau Gerhardt, „ich hab noch was zu tun.“
Bauman, der sie schon lange vor ihrer Krankheit und ihren Problemen versorgt hatte, wusste, dass sie die Wahrheit sagten.
„Wie lange arbeitet ihr schon dort?“, fragte er.
„Erst seit heute Nachmittag.“
„Sie wissen doch, Frau Gerhardt“, sagte er, „wie es mir geht. Ich möchte Ihnen nichts abschlagen. Herr Gerhardt ist ein guter Mann, aber ich bin auch arm. Die Zeiten sind hart“, erklärte er weiter, „ich muss meine Familie ernähren.“
„Ja, ich weiß“, sagte Frau Gerhardt schwach.
Ihr alter, abgetragener Schal verbarg ihre rauen Hände, die von der Arbeit des Tages rot waren, aber sie arbeiteten nervös. Jennie stand angespannt und schweigend daneben.
„Na gut“, sagte Herr Bauman schließlich, „diesmal ist es in Ordnung. Tu am Samstag, was du kannst.“
Er wickelte das Brot und den Speck ein, reichte Jennie das Päckchen und fügte mit einem Hauch von Zynismus hinzu:
„Wenn du wieder Geld hast, gehst du wohl woanders einkaufen.“
„Nein“, erwiderte Frau Gerhardt, „das wissen Sie doch besser.“ Aber sie war zu nervös, um lange zu diskutieren.
Sie gingen hinaus auf die schattige Straße, vorbei an den niedrigen Häuschen zu ihrem eigenen Zuhause.
„Ich frage mich“, sagte die Mutter müde, als sie sich der Tür näherten, „ob sie Kohle haben?“
„Mach dir keine Sorgen“, sagte Jennie. „Wenn sie keine haben, gehe ich hin.“
„Ein Mann hat uns verjagt“, war fast das Erste, was der verstörte George sagte, als seine Mutter ihn nach der Kohle fragte. „Ich habe aber ein bisschen“, fügte er hinzu. „Ich habe sie aus einem Wagen geworfen.“
Frau Gerhardt lächelte nur, aber Jennie lachte.
„Wie geht es Veronica?“, fragte sie.
„Sie scheint zu schlafen“, sagte der Vater. „Ich habe ihr um fünf wieder Medizin gegeben.“
Während das karge Mahl zubereitet wurde, ging die Mutter zum Bett des kranken Kindes und nahm ganz selbstverständlich eine weitere lange Nachtwache auf sich.
Während das Abendessen gegessen wurde, machte Sebastian einen Vorschlag, und seine größere Erfahrung in sozialen und geschäftlichen Angelegenheiten machte seinen Vorschlag überlegenswert. Obwohl er nur ein Kutschenbauerlehrling war und außer der lutherischen Lehre, die er sehr ablehnte, keine Ausbildung hatte, war er von amerikanischer Lebensart und Energie durchdrungen. Sein neuer Name Bass passte genau zu ihm. Er war groß, athletisch und für sein Alter gut aussehend, ein typischer junger Mann aus der Stadt. Er hatte bereits eine Lebensphilosophie entwickelt. Um erfolgreich zu sein, musste man etwas tun – man musste mit denen zusammen sein oder zumindest so tun, als ob man mit denen zusammen war, die in der Welt der Erscheinungen an der Spitze standen.
Aus diesem Grund hielt sich der junge Bursche so gern beim Columbus-Haus auf. Es erschien ihm, als sei dieses Hotel der Mittelpunkt und zugleich der Inbegriff all dessen, was im gesellschaftlichen Sinne von Bedeutung war. Abends ging er in die Stadt hinunter, sobald er sich zum ersten Mal genug Geld für einen anständigen Anzug zusammengespart hatte, und stand mit seinen Freunden am Hoteleingang herum, schlug die Hacken aneinander, rauchte eine Zwei-für-fünf-Cent-Zigarre, sonnte sich in seinem modischen Auftreten und warf den Mädchen Blicke hinterher. Andere waren ebenfalls dort – städtische Gecken und unbedeutende Gestalten, junge Männer, die kamen, um sich rasieren zu lassen oder ein Glas Whisky zu trinken. Und all diese bewunderte er und strebte danach, ihnen nachzueifern. Kleidung war das entscheidende Kriterium. Wenn Männer schöne Anzüge trugen und Ringe und Anstecknadeln besaßen, schien alles, was sie taten, angemessen. Er wollte so sein wie sie und sich so verhalten wie sie, und so weitete sich sein Erfahrungshorizont in den belangloseren Formen des Lebens rasch aus.
„Warum fragst du nicht einen der Hotelangestellten, ob er dir seine Wäsche gibt?“, fragte er Jennie, nachdem sie ihm von ihren Erlebnissen am Nachmittag erzählt hatte. „Das wäre besser, als die Treppen zu schrubben.“
„Wie soll ich das machen?“, fragte sie.
„Na, frag doch den Angestellten“, sagte er.
Dieser Plan erschien Jennie sehr lohnenswert.
„Sprich mich niemals an, wenn du mich dort siehst“, ermahnte er sie wenig später unter vier Augen. „Lass nicht erkennen, dass du mich kennst.“
„Warum?“, fragte sie unschuldig.
„Du weißt doch warum“, antwortete er, nachdem er zuvor angedeutet hatte, dass er sich nicht blamieren wollte, weil sie so arm waren. „Geh einfach weiter. Hast du verstanden?“
„In Ordnung“, antwortete sie kleinlaut, denn obwohl dieser junge Mann nur ein Jahr älter war als sie, dominierte sein überlegener Wille.
Am nächsten Tag, auf dem Weg zum Hotel, erzählte sie ihrer Mutter davon.
„Bass sagte, wir könnten vielleicht etwas Wäsche von den Männern im Hotel bekommen.“
Frau Gerhardt, die sich die ganze Nacht den Kopf darüber zerbrochen hatte, wie sie die drei Dollar, die sie mit sechs Nachmittagen verdienen würde, aufbessern könnte, fand die Idee gut.
„Das könnten wir“, sagte sie. „Ich werde den Angestellten fragen.“
Als sie jedoch im Hotel ankamen, bot sich keine Gelegenheit dazu. Sie arbeiteten bis zum späten Nachmittag weiter. Dann, wie es der Zufall wollte, schickte die Haushälterin sie hinein, um den Boden hinter dem Schreibtisch des Angestellten zu schrubben. Dieser wichtige Herr empfand große Sympathie für Mutter und Tochter. Er mochte das süß besorgte Gesicht der Mutter und das hübsche Gesicht der Tochter. So hörte er freundlich zu, als Frau Gerhardt sich schüchtern traute, die Frage zu stellen, die sie den ganzen Nachmittag über in ihrem Kopf hin und her gewälzt hatte.
„Gibt es hier einen Herrn“, sagte sie, „der mir seine Wäsche zum Waschen geben würde? Ich wäre Ihnen sehr dankbar dafür.“
Der Angestellte sah sie an und erkannte wieder, dass absolute Not in ihrem besorgten Gesicht geschrieben stand.
„Mal sehen“, antwortete er und dachte an Senator Brander und Marschall Hopkins. Beide waren wohltätige Männer, die einer armen Frau gerne helfen würden. „Geh hinauf und frag nach Senator Brander“, fuhr er fort. „Er wohnt in Zimmer 22. Hier“, fügte er hinzu und schrieb die Nummer auf, „geh hinauf und sag ihm, ich habe dich geschickt.“
Frau Gerhardt nahm die Karte mit zitternder Dankbarkeit entgegen. Ihre Augen sprachen die Worte, die sie nicht sagen konnte.
„Schon gut“, sagte der Angestellte, als er ihre Erregung bemerkte. „Geh ruhig hin. Du findest ihn jetzt in seinem Zimmer.“
Mit größter Scheu klopfte Frau Gerhardt an die Tür mit der Nummer 22. Jennie stand schweigend neben ihr.
Nach einem Moment öffnete sich die Tür, und im strahlenden Licht des hellen Zimmers stand der Senator. Er trug einen eleganten Smoking und sah jünger aus als bei ihrer ersten Begegnung.
„Nun, Madame“, sagte er, als er das Paar und insbesondere die Tochter erkannte, „was kann ich für Sie tun?“
Die Mutter war sehr verlegen und zögerte mit ihrer Antwort.
„Wir würden gerne wissen, ob du vielleicht Wäsche hast, die wir für dich waschen könnten?“
„Wäsche?“, wiederholte er mit einer Stimme, die einen seltsam hallenden Klang hatte. „Wäsche? Kommt rein. Lasst mich mal sehen.“
Er trat mit viel Anmut beiseitesprechen, winkte sie herein und schloss die Tür. „Mal sehen“, wiederholte er und öffnete und schloss eine Schublade nach der anderen des massiven Schreibtischs aus schwarzem Walnussholz. Jennie sah sich interessiert im Zimmer um. So viele Nippes und hübsche Dinge auf dem Kaminsims und dem Frisiertisch hatte sie noch nie gesehen. Der Sessel des Senators mit der grün schirmenden Lampe daneben, der dicke, schwere Teppich und die edlen Läufer auf dem Boden – was für ein Komfort, was für ein Luxus!
„Setzt euch, nehmt die beiden Stühle dort“, sagte der Senator freundlich und verschwand in einem Schrank.
Noch immer eingeschüchtert hielten es Mutter und Tochter für höflicher, abzulehnen, aber nun hatte der Senator seine Suche beendet und wiederholte seine Einladung. Sehr unbehaglich gaben sie nach und nahmen Platz.
„Ist das Ihre Tochter?“, fragte er mit einem Lächeln an Jennie.
„Ja, Herr“, sagte die Mutter, „sie ist meine älteste Tochter.“
„Lebt Ihr Mann noch?“
„Wie heißt er?“
„Wo wohnt er?“
Frau Gerhardt beantwortete alle Fragen ganz demütig.
„Wie viele Kinder haben Sie?“, fragte er weiter.
„Sechs“, sagte Frau Gerhardt.
„Na ja“, sagte er, „das ist ja eine ganz schöne Familie. Du hast deine Pflicht gegenüber der Nation auf jeden Fall erfüllt.“
„Ja, Herr“, antwortete Frau Gerhardt, die von seiner freundlichen und interessanten Art berührt war.
„Und das ist Ihre älteste Tochter?“
„Ja, Herr.“
„Was macht dein Mann?“
„Er ist Glasbläser. Aber er ist gerade krank.“
Während des Gesprächs waren Jennies große blaue Augen vor Interesse weit aufgerissen. Immer wenn er sie ansah, erwiderte sie seinen Blick so offen und unverfälscht und lächelte so vage und süß, dass er seinen Blick nicht länger als eine Minute von ihr abwenden konnte.
„Das ist aber schade! Ich habe hier ein paar Sachen zum Waschen – nicht viel –, aber du kannst sie gerne mitnehmen. Nächste Woche gibt es vielleicht mehr.“
Er ging herum und stopfte Kleidungsstücke in eine blaue Baumwolltasche mit einem hübschen Muster an der Seite.
„Möchten Sie diese an einem bestimmten Tag zurückhaben?“, fragte Frau Gerhardt.
„Nein“, sagte er nachdenklich, „nächste Woche geht es mir recht.“
Sie bedankte sich mit einem einfachen Satz und wollte gehen.
„Mal sehen“, sagte er, trat vor sie und öffnete die Tür, „du kannst sie am Montag zurückbringen!“
„Ja, Herr“, sagte Frau Gerhardt. „Danke.“
Sie gingen hinaus, und der Senator widmete sich wieder seiner Lektüre, aber er war seltsam beunruhigt.
„Schade“, sagte er und schloss sein Buch. „Diese Leute haben etwas sehr Mitleiderregendes an sich.“ Jennies Staunen und Bewunderung waren im ganzen Raum zu spüren.
Frau Gerhardt und Jennie machten sich erneut auf den Weg durch die schattigen Straßen. Sie fühlten sich durch dieses glückliche Abenteuer unermesslich ermutigt.
„Hatte er nicht ein schönes Zimmer?“, flüsterte Jennie.
„Ja“, antwortete die Mutter, „er ist ein großer Mann.“
„Er ist Senator, oder?“, fragte die Tochter weiter.
„Ja.“
„Es muss schön sein, berühmt zu sein“, sagte das Mädchen leise.
Kapitel II
Der Geist von Jennie – wer kann ihn beschreiben? Diese Tochter der Armut, die nun die Wäsche dieses angesehenen Bürgers von Columbus holen und tragen musste, war ein Wesen von einer Sanftheit, die Worte nur vage andeuten können. Es gibt Menschen, die ohne Verständnis auf die Welt kommen und wieder gehen, ohne sich zu fragen, warum. Das Leben, solange sie es ertragen, ist ein wahres Wunderland, etwas von unendlicher Schönheit, das, könnten sie nur staunend darin umherwandern, ihnen als Himmel genügen würde. Wenn sie die Augen öffnen, sehen sie eine behagliche und vollkommene Welt. Bäume, Blumen, die Welt der Klänge und die Welt der Farben. Das ist das wertvolle Erbe ihres Zustands. Würde niemand zu ihnen „Mein“ sagen, würden sie strahlend umherwandern und das Lied singen, das die ganze Erde eines Tages zu hören hoffen mag. Es ist das Lied der Güte.
Gefangen in der Welt des Materiellen ist eine solche Natur jedoch fast immer eine Anomalie. Die andere Welt des Fleisches, in die Stolz und Gier eingewoben sind, schaut schief auf den Idealisten, den Träumer. Wenn jemand sagt, es sei schön, die Wolken zu betrachten, ist die Antwort eine Warnung vor Müßiggang. Wenn jemand versucht, auf den Wind zu hören, wird es seiner Seele gut gehen, aber sie werden sich seiner Besitztümer bemächtigen. Wenn die ganze Welt der sogenannten leblosen Dinge einen aufhält und mit Zärtlichkeit in Klängen ruft, die zu perfekt sind, um nicht verstanden zu werden, wird es dem Körper schlecht gehen. Die Hände der Realen strecken sich immer nach solchen Dingen aus – immer gierig nach ihnen greifend. Aus solchen Menschen werden Knechte gemacht.
In der Welt der Tatsachen war Jennie so ein Geist. Von ihrer frühesten Jugend an hatten Güte und Barmherzigkeit jeden ihrer Impulse geformt. Wenn Sebastian fiel und sich verletzte, war sie es, die mit angespannter Sorge rang und ihn sicher zu seiner Mutter trug. Wenn George sich beklagte, dass er Hunger habe, gab sie ihm ihr ganzes Brot. Viele Stunden hatte sie ihre jüngeren Geschwister in den Schlaf gewiegt, aus vollem Herzen gesungen und von fernen Träumen geträumt. Seit sie laufen konnte, war sie die rechte Hand ihrer Mutter gewesen. Was es zu schrubben, zu backen, zu besorgen und zu pflegen gab, tat sie. Niemand hatte sie jemals laut klagen hören, obwohl sie oft an ihr hartes Los dachte. Sie wusste, dass es andere Mädchen gab, deren Leben unendlich freier und erfüllter war, aber es kam ihr nie in den Sinn, neidisch zu sein; ihr Herz mochte einsam sein, aber ihre Lippen sangen weiter. Wenn die Tage schön waren, schaute sie aus dem Küchenfenster und sehnte sich danach, auf die Wiesen zu gehen. Die schönen Kurven und Schatten der Natur berührten sie wie ein Lied. Manchmal ging sie mit George und den anderen zu einer Stelle, wo Hickorybäume standen, weil es dort offene Felder gab, die Schatten spendeten, und einen Bach mit klarem Wasser. Obwohl sie keine Künstlerin war, reagierte ihre Seele dennoch auf diese Dinge, und jeder Ton und jeder Seufzer war ihr wegen seiner Schönheit willkommen.
Wenn der leise, sanfte Ruf der Waldtauben, dieser Geister des Sommers, aus der Ferne erklang, neigte sie den Kopf und lauschte, und die ganze spirituelle Qualität dieses Klangs fiel wie silberne Blasen in ihr großes Herz.
Wo das Sonnenlicht warm war und die Schatten mit seinem herrlichen Glanz gesprenkelt waren, erfreute sie sich daran, das Muster zu bewundern, dort zu gehen, wo es am goldensten war, und mit instinktiver Wertschätzung den heiligen Gängen der Bäume zu folgen.
Farben gingen nicht an ihr vorbei. Dieser wunderbare Glanz, der am Abend den westlichen Himmel erfüllte, berührte ihr Herz und befreite es.
„Ich frage mich“, sagte sie einmal mit mädchenhafter Einfachheit, „wie es wohl wäre, dort oben zwischen den Wolken zu schweben.“
Sie hatte eine natürliche Schaukel aus einer wilden Weinrebe entdeckt und saß mit Martha und George darin.
„Oh, wäre es nicht schön, wenn du dort oben ein Boot hättest“, sagte George.
Sie schaute mit erhobenem Gesicht zu einer fernen Wolke, einer roten Insel in einem silbernen Meer.
„Stell dir vor“, sagte sie, „man könnte auf einer solchen Insel leben.“
Ihre Seele war schon dort oben, und ihre elysischen Pfade kannten die Leichtigkeit ihrer Füße.
„Da fliegt eine Biene“, sagte George und bemerkte eine Hummel, die vorbeiflog.
„Ja“, sagte sie verträumt, „sie fliegt nach Hause.“
„Hat alles ein Zuhause?“, fragte Martha.
„Fast alles“, antwortete sie.
„Gehen die Vögel nach Hause?“, fragte George.
„Ja“, sagte sie und spürte selbst die Poesie dieser Worte, „die Vögel fliegen nach Hause.“
„Gehen die Bienen nach Hause?“, drängte Martha.
„Ja, die Bienen gehen nach Hause.“
„Gehen die Hunde nach Hause?“, fragte George, der einen einsamen Hund auf der Straße in der Nähe sah.
„Aber natürlich“, sagte sie, „du weißt doch, dass Hunde nach Hause gehen.“
„Und die Mücken auch?“, fragte er weiter, als er eine dieser seltsamen Spiralen winziger Insekten sah, die sich energisch im schwindenden Licht drehten.
„Ja“, sagte sie, halb überzeugt von ihrer eigenen Aussage. „Hör mal!“
„Aha“, rief George ungläubig, „ich frage mich, in was für Häusern sie wohl wohnen.“
„Hör mal!“, beharrte sie und legte ihre Hand auf seine, um ihn zu beruhigen.
Es war diese idyllische Stunde, in der der Angelus wie ein Segen auf den zu Ende gehenden Tag fällt. In der Ferne erklangen sanfte Töne, und die Natur schien, nun da sie lauschte, ebenfalls innezuhalten. Ein Rotkehlchen hüpfte in kleinen Sprüngen auf dem Gras vor ihr. Eine summende Biene summte, eine Kuhglocke klingelte, während ein verdächtiges Knacken von einem heimlich herumschnüffelnden Eichhörnchen verriet. Sie hielt ihre hübsche Hand in die Luft und lauschte, bis die langen, sanften Töne sich ausbreiteten und verklangen und ihr Herz nicht mehr fassen konnte. Dann stand sie auf.
„Oh“, sagte sie und ballte vor poetischer Ergriffenheit die Finger zu Fäusten. Kristallklare Tränen strömten aus ihren Augen. Das wundersame Meer der Gefühle in ihr war über die Ufer getreten. So war Jennies Geist.
Kapitel III
Der junge Senator George Sylvester Brander war ein ganz besonderer Typ. In ihm waren die Klugheit eines Opportunisten und die Sympathie eines echten Volksvertreters auf bemerkenswerte Weise vereint. Er stammte aus dem Süden Ohios, wo er aufgewachsen war und seine Ausbildung gemacht hatte, wenn man von den zwei Jahren absehen konnte, in denen er an der Columbia University Jura studiert hatte. Er kannte sich mit dem allgemeinen Recht und dem Strafrecht vielleicht so gut aus wie jeder andere Bürger seines Bundesstaates, aber er hatte nie mit der Beharrlichkeit praktiziert, die für herausragende Erfolge als Anwalt erforderlich ist. Er hatte Geld verdient und hatte großartige Möglichkeiten gehabt, noch viel mehr zu verdienen, wenn er bereit gewesen wäre, sein Gewissen zu verraten, aber dazu war er nie in der Lage gewesen. Und doch war seine Integrität nicht immer immun gegen die Ansprüche der Freundschaft gewesen. Erst bei den letzten Präsidentschaftswahlen hatte er einen Mann zum Gouverneur unterstützt, von dem er genau wusste, dass er keine Ansprüche hatte, die ein streng ehrliches Gewissen hätte anerkennen können.
Ebenso hatte er sich einiger sehr fragwürdiger und ein oder zwei tatsächlich unappetitlicher Ernennungen schuldig gemacht. Wann immer sein Gewissen ihn zu sehr plagte, versuchte er sich mit seinem Lieblingsspruch zu trösten: „Alles im Leben.“ Wenn er ganz allein in seinem Sessel saß und über alles nachdachte, stand er manchmal mit diesen Worten auf den Lippen auf und lächelte dabei verlegen. Sein Gewissen war keineswegs tot in ihm. Seine Sympathien waren, wenn überhaupt, stärker denn je.
Dieser Mann, dreimal Kongressabgeordneter des Bezirks, zu dem Columbus gehörte, und zweimal Senator der Vereinigten Staaten, hatte nie geheiratet. In seiner Jugend hatte er eine ernsthafte Liebesbeziehung gehabt, aber die Tatsache, dass daraus nichts geworden war, war für ihn nicht beschämend. Die Dame fand es unbequem, auf ihn zu warten. Er brauchte zu lange, um sich eine Existenz aufzubauen, von der sie hätten leben können.
Groß, mit geraden Schultern, weder dünn noch dick, war er heute eine beeindruckende Erscheinung. Da er harte Schläge hinnehmen und Verluste erdulden musste, hatte er etwas an sich, das die Fantasie anregte und Mitgefühl weckte. Die Leute fanden ihn von Natur aus sympathisch, und seine Senatskollegen hielten ihn für nicht allzu schwer von Begriff, aber für einen feinen Kerl.
Dass er gerade jetzt in Columbus war, lag daran, dass er seine politischen Beziehungen wieder aufbauen musste. Die allgemeinen Wahlen hatten seine Partei in der Staatslegislative geschwächt. Es gab zwar genügend Stimmen, um ihn wiederzuwählen, aber es würde äußerst sorgfältiger politischer Manipulation bedürfen, um sie zusammenzuhalten. Andere Männer waren ehrgeizig. Es gab ein halbes Dutzend verfügbare Kandidaten, von denen jeder gerne in seine Fußstapfen getreten wäre. Er war sich der Dringlichkeit der Lage bewusst. Sie könnten ihn wohl nicht schlagen, dachte er, aber selbst wenn dies geschehen sollte, könnte man den Präsidenten sicherlich dazu bewegen, ihm ein Ministeramt im Ausland zu verschaffen.
Ja, man könnte ihn als erfolgreichen Mann bezeichnen, aber Senator Brander hatte das Gefühl, dass ihm etwas fehlte. Er hatte so viele Dinge tun wollen. Da war er nun, zweiundfünfzig Jahre alt, sauber, ehrenhaft, hoch angesehen, wie die Welt es sieht, aber alleinstehend. Er konnte nicht umhin, sich ab und zu umzusehen und darüber nachzudenken, dass er niemanden hatte, der ihn gern hatte. Manchmal kam ihm sein Zimmer seltsam leer vor – seine eigene Persönlichkeit äußerst unangenehm.
„Fünfzig!“, dachte er oft bei sich. „Allein – ganz allein.“
Als er an diesem Samstagnachmittag in seinem Zimmer saß, weckte ihn ein Klopfen an der Tür. Er hatte gerade darüber nachgedacht, wie sinnlos seine politische Energie angesichts der Vergänglichkeit des Lebens und des Ruhmes war.
„Was für einen großen Kampf führen wir, um uns zu erhalten?“, dachte er. „Wie wenig wird es für mich in ein paar Jahren noch bedeuten?“
Er stand auf, öffnete die Tür weit und sah Jennie. Sie war, wie sie ihrer Mutter vorgeschlagen hatte, zu dieser Zeit gekommen, statt am Montag, um einen besseren Eindruck von ihrer Pünktlichkeit zu machen.
„Komm rein“, sagte der Senator und machte ihr wie beim ersten Mal freundlich Platz.
Jennie ging hinein und erwartete einen Kompliment für die Schnelligkeit, mit der sie die Wäsche erledigt hatte. Der Senator bemerkte das aber gar nicht.
„Nun, meine junge Dame“, sagte er, als sie das Bündel abgestellt hatte, „wie geht es dir heute Abend?“
„Sehr gut“, antwortete Jennie. „Wir dachten, wir bringen Ihre Kleidung lieber heute statt am Montag.“
„Ach, das hätte keinen Unterschied gemacht“, antwortete Brander leichtfertig. „Leg sie einfach auf den Stuhl.“
Jennie wollte sich, ohne daran zu denken, dass ihr für ihre Dienste kein Geld angeboten worden war, gerade zurückziehen, als der Senator sie zurückhielt.
„Wie geht es deiner Mutter?“, fragte er freundlich.
„Ihr geht es sehr gut“, sagte Jennie schlicht.
„Und deine kleine Schwester? Geht es ihr besser?“
„Der Arzt meint schon“, antwortete sie.
„Setz dich“, fuhr er freundlich fort. „Ich möchte mit dir reden.“
Das junge Mädchen ging zu einem Stuhl in der Nähe und setzte sich.
„Ähm“, sagte er und räusperte sich leicht. „Was ist denn mit ihr los?“
„Sie hat die Masern“, antwortete Jennie. „Wir dachten schon, sie würde sterben.“
Brander musterte ihr Gesicht, während sie das sagte, und glaubte, etwas äußerst Mitleiderregendes darin zu sehen. Die armselige Kleidung des Mädchens und ihre staunende Bewunderung für seine hohe Stellung beeindruckten ihn. Er schämte sich fast für den Komfort und Luxus, der ihn umgab. Wie hoch stand er doch in der Welt!
„Ich bin froh, dass es ihr jetzt besser geht“, sagte er freundlich. „Wie alt ist dein Vater?“
„Siebenundfünfzig.“
„Und geht es ihm besser?“
„Oh ja, Herr, er ist wieder da, obwohl er noch nicht rausgehen kann.“
„Ich glaube, deine Mutter hat gesagt, er sei von Beruf Glasbläser?“
„Ja, Herr.“
Brander wusste genau, wie schlecht es um diese Branche in der Gegend stand. Das war sogar ein Thema in der letzten Wahlkampagne gewesen. Die müssen echt in einer schwierigen Lage sein.
„Gehen alle Kinder zur Schule?“, fragte er.
„Ja, Sir“, antwortete Jennie stammelnd. Sie schämte sich zu sehr, um zuzugeben, dass eines der Kinder wegen fehlender Schuhe die Schule verlassen musste. Die Lüge bereitete ihr Unbehagen.
Er hielt einen Moment inne, dann wurde ihm klar, dass er keinen guten Grund hatte, sie länger aufzuhalten, stand auf und ging zu ihr hinüber. Aus seiner Tasche holte er ein dünnes Bündel Geldscheine, nahm einen heraus und reichte ihn ihr.
„Nimm das“, sagte er, „und sag deiner Mutter, ich habe gesagt, sie soll es für alles verwenden, was sie braucht.“
Jennie nahm das Geld mit gemischten Gefühlen an; es kam ihr nicht in den Sinn, nachzusehen, wie viel es war. Der große Mann stand so nah bei ihr, der beeindruckende Raum, in dem er wohnte, war so beeindruckend, dass sie kaum realisierte, was sie tat.
„Danke“, sagte sie. „Möchten Sie, dass ich Ihre Wäsche abhole?“, fügte sie hinzu.
„Oh ja“, antwortete er, „montags – montagabends.“
Sie ging weg, und halb in Träumerei versunken, schloss er die Tür hinter ihr. Das Interesse, das er für diese Leute empfand, war ungewöhnlich. Armut und Schönheit bildeten zweifellos eine bewegende Kombination. Er setzte sich in seinen Sessel und gab sich den angenehmen Spekulationen hin, die ihr Kommen in ihm geweckt hatte. Warum sollte er ihnen nicht helfen?
„Ich werde herausfinden, wo sie wohnen“, beschloss er schließlich.
In den folgenden Tagen kam Jennie regelmäßig, um die Kleider abzuholen. Senator Brander interessierte sich immer mehr für sie, und mit der Zeit gelang es ihm, ihr die Schüchternheit und Angst zu nehmen, die sie in seiner Gegenwart so unbehaglich gemacht hatten. Dazu trug auch bei, dass er sie bei ihrem Vornamen nannte. Das begann bei ihrem dritten Besuch, und danach benutzte er ihn fast unbewusst immer häufiger.
Man konnte kaum sagen, dass er dies aus väterlicher Liebe tat, denn er hatte gegenüber niemandem eine solche Haltung. Er fühlte sich unglaublich jung, wenn er mit diesem Mädchen sprach, und fragte sich oft, ob sie vielleicht seine jugendliche Seite wahrnehmen und schätzen konnte.
Jennie war total beeindruckt von dem Komfort und Luxus, der diesen Mann umgab, und unbewusst auch von ihm selbst, dem attraktivsten Mann, den sie je kennengelernt hatte. Alles, was er hatte, war toll, alles, was er tat, war sanft, vornehm und rücksichtsvoll. Aus einer fernen Quelle, vielleicht von alten deutschen Vorfahren, hatte sie ein Verständnis und eine Wertschätzung für all das geerbt. Das Leben sollte so gelebt werden, wie er es lebte; das Privileg, großzügig zu sein, gefiel ihr besonders.
Ein Teil ihrer Einstellung kam von ihrer Mutter, für die Mitgefühl immer wichtiger war als Vernunft. Als sie ihr zum Beispiel die zehn Dollar brachte, war Frau Gerhardt total begeistert.
„Oh“, sagte Jennie, „ich wusste erst draußen, dass es so viel war. Er sagte, ich solle es dir geben.“
Frau Gerhardt nahm das Geld, hielt es locker in ihren gefalteten Händen und sah vor sich deutlich den großen Senator mit seinen guten Manieren.
„Was für ein toller Mann!“, sagte sie. „Er hat ein gutes Herz.“
Den ganzen Abend und den nächsten Tag über sprach Frau Gerhardt immer wieder von diesem wunderbaren Schatz und wiederholte immer wieder, wie gut er sein müsse und wie groß sein Herz sein müsse. Als sie seine Kleidung wusch, rieb sie sie fast kaputt, weil sie das Gefühl hatte, dass sie gar nicht genug tun konnte. Gerhardt wusste davon nichts. Er hatte so strenge Ansichten darüber, Geld anzunehmen, ohne es zu verdienen, dass es ihr selbst in ihrer Not schwer gefallen wäre, ihn dazu zu bringen, es anzunehmen. Deshalb sagte sie nichts, sondern kaufte davon Brot und Fleisch, und da es nur so wenig war, fiel der plötzliche Geldsegen niemandem auf.
Jennie hielt sich von nun an an diese Haltung gegenüber dem Senator und begann, weil sie ihm so dankbar war, freier zu sprechen. Sie verstanden sich so gut, dass er ihr ein kleines Lederbildetui aus seiner Kommode schenkte, das sie bewundert hatte. Jedes Mal, wenn sie kam, fand er eine Ausrede, um sie aufzuhalten, und entdeckte bald, dass trotz ihrer sanften Mädchenhaftigkeit tief in ihr eine bewusste Verachtung der Armut und eine Scham darüber, dass sie etwas brauchte, steckten. Er bewunderte sie aufrichtig dafür, und als er sah, dass ihre Kleidung armselig und ihre Schuhe abgetragen waren, begann er sich zu fragen, wie er ihr helfen könnte, ohne sie zu beleidigen.
Nicht selten überlegte er, ihr eines Abends zu folgen, um selbst zu sehen, wie die Familie wohl leben könnte. Aber er war ein Senator der Vereinigten Staaten. Die Nachbarschaft, in der sie lebten, musste sehr arm sein. Er hielt inne, um nachzudenken, und vorerst siegte die Vorsicht. Folglich wurde der geplante Besuch verschoben.
Anfang Dezember kehrte Senator Brander für drei Wochen nach Washington zurück, und sowohl Frau Gerhardt als auch Jennie waren überrascht, als sie eines Tages erfuhren, dass er weg war. Er hatte ihnen nie weniger als zwei Dollar pro Woche für seine Wäsche gegeben, und mehrmals waren es sogar fünf gewesen. Vielleicht war ihm nicht bewusst, welche finanzielle Lücke seine Abwesenheit hinterlassen würde. Aber es gab nichts, was sie tun konnten; sie schafften es, sich durchzuwursteln. Gerhardt, dem es nun besser ging, suchte in verschiedenen Fabriken nach Arbeit, fand aber nichts. Also besorgte er sich einen Sägebock und eine Säge und ging von Tür zu Tür, um sich das Sägen von Holz anbieten zu lassen. Es gab nicht viel zu tun, aber durch fleißige Arbeit verdiente er zwei, manchmal sogar drei Dollar pro Woche. Zusammen mit dem, was seine Frau verdiente und was Sebastian gab, reichte das gerade so, um sich zu ernähren, aber kaum mehr.
Zu Beginn der fröhlichen Weihnachtszeit traf sie die Bitterkeit ihrer Armut am härtesten. Die Deutschen lieben es, zu Weihnachten groß aufzutrumpfen. Es ist die einzige Zeit im Jahr, in der sich die ganze Liebe ihrer großen Familien zeigt. Sie genießen die Freuden der Kindheit und lieben es, die Kleinen beim Spielen und mit ihren Spielsachen zu beobachten. Vater Gerhardt dachte in den Wochen vor Weihnachten oft daran, während er an seinem Sägebock saß. Was hätte die kleine Veronica nach ihrer langen Krankheit nicht verdient! Wie gerne hätte er jedem der Kinder ein Paar feste Schuhe geschenkt, den Jungen eine warme Mütze, den Mädchen eine hübsche Haube. Spielzeug und Süßigkeiten hatten sie immer gehabt. Er hasste den Gedanken an den verschneien Weihnachtsmorgen und einen Tisch, der nicht reich gedeckt war mit dem, was sich ihre jungen Herzen am meisten wünschten.
Frau Gerhardt konnte man ihre Gefühle besser vorstellen als beschreiben. Sie nahm es so schwer, dass sie sich kaum dazu bringen konnte, mit ihrem Mann über die gefürchtete Stunde zu sprechen. Sie hatte es geschafft, drei Dollar beiseitesprechen, in der Hoffnung, genug für eine Tonne Kohle zu haben, um so die tägliche Pilgerfahrt des armen Georg zum Kohlenhändler zu beenden, aber jetzt, da die Weihnachtswoche näher rückte, beschloss sie, das Geld für Geschenke zu verwenden. Auch Vater Gerhardt hatte heimlich zwei Dollar beiseite gelegt, in der Hoffnung, sie am Heiligabend im entscheidenden Moment hervorzuzaubern und so die mütterliche Sorge zu lindern.
Als es dann soweit war, gab es jedoch wenig Grund zur Freude über das, was sie aus dieser Gelegenheit machen konnten. Die ganze Stadt war voller Weihnachtsstimmung. Lebensmittelgeschäfte und Fleischmärkte waren mit Stechpalmen geschmückt. Die Spielzeugläden und Süßwarengeschäfte strahlten mit schönen Auslagen von allem, was ein sich selbst respektierender Weihnachtsmann bei sich haben sollte. Sowohl Eltern als auch Kinder beobachteten alles – die einen mit ernsten Gedanken an Not und Sorgen, die anderen mit wilder Fantasie und nur teilweise unterdrückten Sehnsüchten.
Gerhardt hatte in ihrer Gegenwart oft gesagt:
„Knecht Ruprecht ist dieses Jahr sehr arm. Er hat nicht allzu viel zu verschenken.“
Aber kein Kind, egal wie arm es war, konnte das glauben. Jedes Mal, wenn er das gesagt hatte, schaute er ihnen in die Augen, aber trotz seiner Warnung loderte die Vorfreude in ihnen unvermindert weiter.
Da Weihnachten auf einen Dienstag fiel, war am Montag davor keine Schule. Bevor Frau Gerhardt ins Hotel ging, hatte sie George ermahnt, er solle genug Kohle aus dem Hof holen, damit sie über Weihnachten reiche. Dieser machte sich sofort mit seinen beiden jüngeren Schwestern auf den Weg, aber da es kaum etwas Gutes zu holen gab, brauchten sie lange, um ihre Körbe zu füllen, und bis zum Abend hatten sie nur eine magere Ausbeute zusammen.
„Hast du die Kohle geholt?”, fragte Frau Gerhardt als Erstes, als sie am Abend aus dem Hotel zurückkam.
„Ja“, sagte George.
„Hast du genug für morgen?“
„Ja“, antwortete er, „ich glaube schon.“
„Na gut, dann werde ich mal nachsehen“, antwortete sie. Sie nahm die Lampe und ging mit ihm in den Holzschuppen, wo die Kohle gelagert war.
„Oh je!“, rief sie, als sie die Kohle sah. „Das reicht doch nicht annähernd. Du musst sofort los und noch mehr holen.“
„Ach“, sagte George und schmollte, „ich will nicht gehen. Lass Bass gehen.“
Bass, der pünktlich um Viertel nach sechs zurückgekommen war, war bereits im hinteren Schlafzimmer damit beschäftigt, sich zu waschen und anzuziehen, um in die Stadt zu gehen.
„Nein“, sagte Frau Gerhardt. „Bass hat den ganzen Tag hart gearbeitet. Du musst gehen.“
„Ich will nicht“, schmollte George.
„Na gut“, sagte Frau Gerhardt, „vielleicht hast du morgen kein Feuer, und was dann?“
Sie gingen zurück ins Haus, aber Georges Gewissen war zu sehr aufgewühlt, als dass er die Sache als erledigt betrachten konnte.
„Bass, komm auch mit“, rief er seinem älteren Bruder zu, als er drinnen war.
„Wohin?“, fragte Bass.
„Kohle holen.“
„Nein“, sagte der ältere, „ich glaube nicht. Für wen hältst du mich?“
„Na gut, dann nicht“, sagte George mit einem hartnäckigen Kopfschütteln.
„Warum hast du es heute Nachmittag nicht geholt?“, fragte sein Bruder scharf. „Du hattest den ganzen Tag Zeit dafür.“
„Ach, ich hab's doch versucht“, sagte George. „Wir haben nicht genug gefunden. Ich kann doch keine holen, wenn keine da ist, oder?“
„Ich glaube, du hast dich nicht besonders angestrengt“, sagte der Dandy.
„Was ist denn los?“, fragte Jennie, die gerade hereinkam, nachdem sie bei der Lebensmittelhandlung für ihre Mutter eingekauft hatte, und George mit einem ernsten Schmollmund sah.
„Oh, Bass will nicht mit mir Kohle holen gehen?“
„Hast du heute Nachmittag keine geholt?“
„Doch“, sagte George, „aber Mama sagt, ich habe nicht genug bekommen.“
„Ich geh mit dir“, sagte seine Schwester. „Bass, kommst du mit?“
„Nein“, sagte der junge Mann gleichgültig, „ich will nicht.“ Er richtete seine Krawatte und war genervt.
„Es gibt keine“, sagte George, „es sei denn, wir holen sie von den Wagen. Dort, wo ich war, gab es keine Wagen.“
„Doch, gibt es“, rief Bass.
„Doch, gibt es“, sagte George.
„Streitet euch nicht“, sagte Jennie. „Holt die Körbe und lasst uns gehen, bevor es zu spät wird.“
Die anderen Kinder, die ihre große Schwester sehr mochten, holten die Vorräte heraus – Veronica einen Korb, Martha und William Eimer und George einen großen Wäschekorb, den er und Jennie füllen und gemeinsam tragen sollten. Bass, bewegt von der Hilfsbereitschaft seiner Schwester und der kleinen Wertschätzung, die er ihr noch entgegenbrachte, machte nun einen Vorschlag.
„Ich sag dir, was du machen sollst, Jen“, sagte er. „Geh mit den Kindern rüber zur Achten Straße und wartet dort bei den Wagen. Ich komme gleich nach. Wenn ich komme, tut so, als würdet ihr mich nicht kennen. Sagt einfach: “Herr, würdest du uns bitte etwas Kohle herunterwerfen?„ Dann klettere ich auf den Wagen und werfe euch genug hinein, um die Körbe zu füllen. Verstanden?“
„In Ordnung“, sagte Jennie sehr erfreut.
Hinaus in die verschneite Nacht gingen sie und schlugen den Weg zu den Eisenbahngleisen ein. An der Kreuzung der Straße mit dem weiten Bahngelände standen viele schwer beladene Waggons mit frisch herangebrachter Steinkohle. Alle Kinder versammelten sich im Schatten eines dieser Wagen. Während sie dort standen und auf das Eintreffen ihres Bruders warteten, fuhr der Washington-Sonderzug ein – ein langer, eleganter Zug mit mehreren Salonwagen neuer Bauart, deren große Fensterscheiben aus Plattglas glänzten, während die Passagiere aus der Tiefe ihrer bequemen Sessel hinaussahen. Instinktiv wichen die Kinder zurück, als der Zug donnernd vorbeiraste.
„Oh, war der lang!“, sagte George.
„Ich wäre so gern Bremser“, seufzte William.
Nur Jennie schwieg, aber gerade sie hatte sich von der Vorstellung von Reisen und Komfort angezogen gefühlt. Wie schön muss das Leben für die Reichen sein!
Sebastian tauchte nun in der Ferne auf, mit männlichem Schwung in seinen Schritten und allem Anschein, dass er sich selbst ernst nahm. Er war von dieser eigentümlichen Hartnäckigkeit und Entschlossenheit, dass er, hätten die Kinder seinen Plan nicht ausgeführt, absichtlich vorbeigegangen wäre und sich geweigert hätte, ihnen zu helfen.
Martha jedoch nahm die Situation so, wie sie war, und sagte kindlich: „Herr, würdest du uns bitte etwas Kohle herunterwerfen?“
Sebastian blieb abrupt stehen, sah sie scharf an, als wäre er wirklich ein Fremder, rief: „Aber natürlich!“, kletterte auf den Wagen und warf mit bemerkenswerter Schnelligkeit mehr als genug Brocken herunter, um ihre Körbe zu füllen. Dann, als wolle er sich nicht länger in der Gesellschaft dieser Plebejer aufhalten, eilte er über das Schienennetz und verschwand aus ihrem Blickfeld.
Auf dem Heimweg trafen sie einen anderen Herrn, diesmal einen echten, mit hohem Hut und vornehmer Kappe, den Jennie sofort erkannte. Es war der ehrenwerte Senator selbst, der gerade aus Washington zurückgekehrt war und ein sehr unrentables Weihnachtsfest erwartete. Er war mit dem Expresszug angekommen, der die Aufmerksamkeit der Kinder auf sich gezogen hatte, und trug seine leichte Reisetasche zum Vergnügen zum Hotel. Als er vorbeikam, glaubte er, Jennie zu erkennen.
„Bist du das, Jennie?“, fragte er und blieb stehen, um sich zu vergewissern.
Diese hatte ihn noch schneller entdeckt als er sie und rief: „Oh, da ist Herr Brander!“ Dann ließ sie ihr Ende des Korbes fallen, ermahnte die Kinder, ihn nach Hause zu bringen, und eilte in die entgegengesetzte Richtung davon.
Der Senator folgte ihr und rief drei- oder viermal vergeblich: „Jennie! Jennie!“ Als er die Hoffnung aufgab, sie einzuholen, und plötzlich ihre schlichte, mädchenhafte Scham erkannte und respektierte, blieb er stehen, drehte sich um und beschloss, den Kindern zu folgen. Wieder verspürte er dasselbe Gefühl, das dieses Mädchen immer in ihm hervorrief – die große Kluft zwischen ihrem Stand und seinem. Es war etwas Besonderes, heute Abend Senator zu sein, hier, wo diese Kinder Kohle schaufelten. Was würde der freudige Feiertag morgen für sie bereithalten? Mitfühlend schlenderte er weiter, und ein ehrliches Leuchten kam in seine Schritte, und bald sah er sie in das Tor der niedrigen Hütte gehen. Er überquerte die Straße und blieb im schwachen Schatten der schneebedeckten Bäume stehen. In einem hinteren Fenster brannte ein gelber Schein. Rundherum lag der weiße Schnee. Im Holzschuppen konnte er die Stimmen der Kinder hören, und einmal glaubte er, die Gestalt von Frau Gerhardt zu erkennen. Nach einer Weile kam eine weitere Gestalt wie ein Schatten durch das Seitentor. Er wusste, wer es war. Es traf ihn bis ins Mark, und er biss sich fest auf die Lippe, um keine weiteren Gefühlsregungen zu zeigen. Dann drehte er sich energisch auf dem Absatz um und ging weg.
Der größte Lebensmittelhändler der Stadt war ein gewisser Manning, ein überzeugter Anhänger von Brander, der sich durch die Bekanntschaft mit dem Senator geehrt fühlte. Zu ihm an seinen belebten Schreibtisch kam der Senator noch am selben Abend.
„Manning“, sagte er, „könntest du heute Abend eine kleine Aufgabe für mich übernehmen?“
„Aber natürlich, Senator, natürlich“, sagte der Lebensmittelhändler. „Wann sind Sie zurückgekommen? Schön, Sie zu sehen. Natürlich.“
„Ich möchte, dass du alles zusammenstellst, was eine Familie mit acht Personen – Vater, Mutter und sechs Kinder – zu Weihnachten braucht: einen Weihnachtsbaum, Lebensmittel, Spielzeug – du weißt schon, was ich meine.“
„Natürlich, Senator.“
„Mach dir keine Gedanken um die Kosten. Schick einfach von allem reichlich. Ich gebe dir die Adresse“, und er nahm ein Notizbuch, um sie aufzuschreiben.
„Aber gerne, Senator“, sagte Herr Manning, selbst etwas gerührt. „Ich freue mich sehr. Du warst schon immer großzügig.“
„Hier bitte, Manning“, sagte der Senator grimmig, nur um seine senatorische Würde zu wahren. „Schick alles sofort und die Rechnung an mich.“
„Mit Vergnügen“, war alles, was der verblüffte und zustimmende Lebensmittelhändler sagen konnte.
Der Senator ging hinaus, aber er dachte an die alten Leute und besuchte einen Bekleidungsgeschäft und einen Schuhmacher. Da er nur raten konnte, welche Größen sie brauchen könnten, bestellte er die verschiedenen Artikel mit dem Recht, sie umzutauschen. Als er fertig war, kehrte er in sein Zimmer zurück.
„Kohle tragen“, dachte er immer wieder. „Das war wirklich sehr gedankenlos von mir. Ich darf sie nicht mehr vergessen.“
Kapitel IV
Der Wunsch zu fliehen, den Jennie verspürte, als sie den Senator wieder sah, war darauf zurückzuführen, dass sie ihre Lage als Schande empfand. Sie schämte sich bei dem Gedanken, dass er, der so viel von ihr hielt, sie bei etwas so Gewöhnlichem entdecken könnte. Mädchenhaft neigte sie dazu, sich vorzustellen, dass sein Interesse an ihr auf etwas anderem als ihrer bloßen Persönlichkeit beruhte.
Als sie nach Hause kam, hatte Frau Gerhardt von den anderen Kindern von ihrer Flucht erfahren.
„Was ist denn mit dir los?“, fragte George, als sie hereinkam.
„Ach, nichts“, antwortete sie, wandte sich aber sofort an ihre Mutter und sagte: „Herr Brander kam vorbei und hat uns gesehen.“
„Ach, wirklich?“, rief ihre Mutter leise. „Dann ist er wieder da. Warum bist du denn weggerannt, du dummes Mädchen?“
„Na ja, ich wollte nicht, dass er mich sieht.“
„Vielleicht hat er dich ja gar nicht erkannt“, sagte sie mit einem gewissen Mitgefühl für die missliche Lage ihrer Tochter.
„Oh doch, er hat mich erkannt“, flüsterte Jennie. „Er hat mir drei- oder viermal hinterhergerufen.“
Frau Gerhardt schüttelte den Kopf.
„Was ist los?“, fragte Gerhardt, der das Gespräch aus dem Nebenzimmer mitgehört hatte und nun herauskam.
„Ach nichts“, sagte die Mutter, die es hasste, die Bedeutung zu erklären, die die Persönlichkeit des Senators in ihrem Leben gewonnen hatte. „Ein Mann hat sie erschreckt, als sie die Kohle gebracht haben.“
Die Ankunft der Weihnachtsgeschenke später am Abend versetzte den Haushalt in helle Aufregung. Weder Gerhardt noch die Mutter trauten ihren Augen, als ein Lebensmittelwagen vor ihrer Hütte hielt und ein kräftiger Angestellter begann, die Geschenke hineinzutragen. Nachdem sie den Angestellten nicht davon überzeugen konnten, dass er sich geirrt hatte, wurde die große Auswahl an Leckereien mit großer Freude begutachtet.
„Mach dir keine Gedanken“, sagte der Verkäufer bestimmt. „Ich weiß, was ich tue. Gerhardt, nicht wahr? Ja, ihr seid die Richtigen.“
Frau Gerhardt lief aufgeregt hin und her, rieb sich die Hände und rief immer wieder: „Ist das nicht schön!“
Gerhardt selbst war gerührt von der Großzügigkeit des unbekannten Wohltäters und neigte dazu, alles der Güte eines großen lokalen Mühlenbesitzers zuzuschreiben, der ihn kannte und ihm Gutes wünschte. Frau Gerhardt ahnte unter Tränen, woher das kam, sagte aber nichts. Jennie wusste instinktiv, wer der Urheber von all dem war.
Am Nachmittag des Tages nach Weihnachten traf Brander die Mutter im Hotel, Jennie war zu Hause geblieben, um auf das Haus aufzupassen.
„Guten Tag, Frau Gerhardt“, sagte er freundlich und streckte ihr die Hand entgegen. „Wie war Ihr Weihnachtsfest?“
Die arme Frau Gerhardt nahm sie nervös und ihre Augen füllten sich schnell mit Tränen.
„Na, na“, sagte er und tätschelte ihr die Schulter. „Weine nicht. Vergiss nicht, heute meine Wäsche zu holen.“
„Oh nein, Herr“, antwortete sie und hätte noch mehr gesagt, wenn er nicht schon weggegangen wäre.
Von diesem Tag an hörte Gerhardt im Hotel ständig von dem feinen Senator, wie nett er sei und wie viel er für seine Wäsche bezahle. Mit der Einfachheit eines deutschen Arbeiters ließ er sich leicht davon überzeugen, dass Herr Brander ein sehr großer und sehr guter Mann sein müsse.
Jennie, deren Gefühle in dieser Richtung keiner Ermutigung bedurften, war mehr denn je für ihn eingenommen.
In ihr entwickelte sich jene vollendete Weiblichkeit, jene vollendete Form, die jeden Mann anziehen musste. Sie war bereits gut gebaut und groß für ein Mädchen. Hätte sie die wallenden Röcke einer modischen Frau getragen, wäre sie eine passende Begleiterin für einen Mann von der Statur des Senators gewesen. Ihre Augen waren wunderbar klar und strahlend, ihre Haut hell und ihre Zähne weiß und gleichmäßig. Sie war auch klug, auf eine vernünftige Art, und keineswegs unaufmerksam. Alles, was ihr fehlte, war Bildung und die Selbstsicherheit, die einem das Bewusstsein völliger Abhängigkeit nimmt. Aber das Wäschewaschen und die Notwendigkeit, fast alles als Gefallen anzunehmen, benachteiligten sie.
Wenn sie jetzt zweimal pro Woche zum Hotel kam, nahm Senator Brander ihre Anwesenheit mit leichter Anmut hin, und sie erwiderte das. Er gab ihr oft kleine Geschenke für sich selbst oder für ihre Brüder und Schwestern, und er redete so ungezwungen mit ihr, dass schließlich das Gefühl der großen Unterschiede zwischen ihnen verschwunden war und sie ihn mehr als einen großzügigen Freund denn als einen angesehenen Senator betrachtete. Einmal fragte er sie, ob sie gerne auf ein Seminar gehen würde, wobei er die ganze Zeit daran dachte, wie attraktiv sie sein würde, wenn sie dort fertig wäre. Schließlich rief er sie eines Abends zu sich.
„Komm her, Jennie“, sagte er, „stell dich neben mich.“
Sie kam, und von einem plötzlichen Impuls getrieben, nahm er ihre Hand.
„Also, Jennie“, sagte er und musterte ihr Gesicht mit einem fragenden Blick, „was hältst du eigentlich von mir?“
„Oh“, antwortete sie und schaute bewusst weg, „ich weiß nicht. Warum fragst du mich das?“
„Doch, das tust du“, erwiderte er. „Du hast eine Meinung von mir. Sag sie mir jetzt.“
„Nein, habe ich nicht“, sagte sie unschuldig.
„Doch, du hast eine“, fuhr er freundlich fort, interessiert von ihrer offensichtlichen Ausweichhaltung. „Du musst doch etwas von mir denken. Nun, was ist es?“
„Meinst du, ob ich dich mag?“, fragte sie offen und schaute auf sein dichtes schwarzes Haar mit den grauen Strähnen, das ihm in die Stirn fiel und seinem schönen Gesicht etwas Löwenhaftes verlieh.
„Nun ja“, sagte er mit einem Anflug von Enttäuschung. Sie beherrschte die Kunst der Koketterie nicht.
„Aber natürlich mag ich dich“, antwortete sie charmant.
„Hast du nie etwas anderes über mich gedacht?“, fragte er weiter.
„Ich finde dich sehr nett“, fuhr sie noch schüchterner fort; ihr wurde jetzt bewusst, dass er immer noch ihre Hand hielt.
„Ist das alles?“, fragte er.
„Na ja“, sagte sie mit flatternden Augenlidern, „reicht das nicht?“
Er sah sie an, und die spielerische, vertraute Direktheit ihres Blickes durchdrang ihn bis ins Innerste. Er studierte schweigend ihr Gesicht, während sie sich drehte und wand und die tiefe Bedeutung seiner Musterung spürte, aber kaum verstand.
„Also“, sagte er schließlich, „ich finde, du bist ein hübsches Mädchen. Findest du mich nicht auch ganz nett?“
„Ja“, sagte Jennie prompt.
Er lehnte sich in seinem Stuhl zurück und lachte über die unbewusste Komik ihrer Antwort. Sie sah ihn neugierig an und lächelte.
„Was hat dich zum Lachen gebracht?“, fragte sie.
„Oh, deine Antwort“, antwortete er. „Ich sollte eigentlich nicht lachen. Du schätzt mich überhaupt nicht. Ich glaube nicht, dass du mich magst.“
„Doch, das tue ich“, antwortete sie ernst. „Ich finde dich so gut.“ Ihre Augen zeigten ganz deutlich, dass sie meinte, was sie sagte.
„Na gut“, sagte er, zog sie sanft zu sich herunter und drückte im selben Moment seine Lippen auf ihre Wange.
„Oh!“, rief sie und richtete sich auf, zugleich erschrocken und verängstigt.
Das war etwas Neues in ihrer Beziehung. Die senatorische Würde verschwand augenblicklich. Sie erkannte in ihm etwas, das sie zuvor nicht gefühlt hatte. Er schien auch jünger zu sein. Für ihn war sie eine Frau, und er spielte die Rolle eines Liebhabers. Sie zögerte, wusste aber nicht, was sie tun sollte, und tat nichts.
„Na“, sagte er, „hab ich dich erschreckt?“
Sie sah ihn an, aber bewegt von ihrem tiefen Respekt für diesen großen Mann, sagte sie mit einem Lächeln: „Ja, das hast du.“