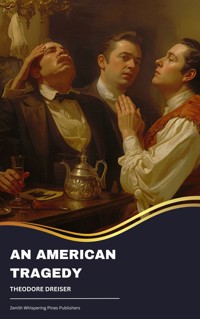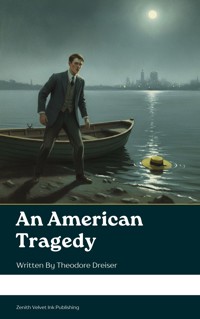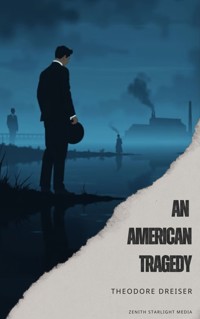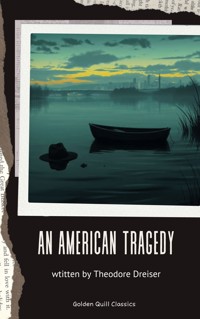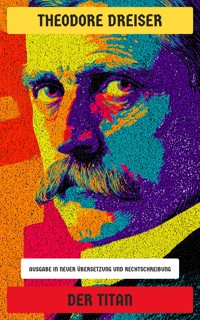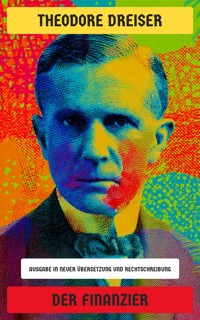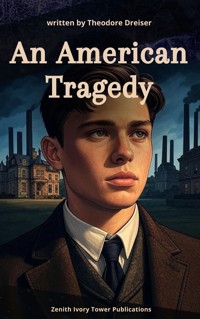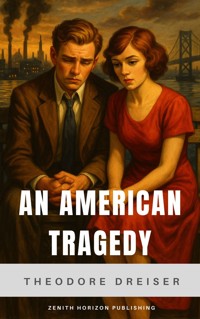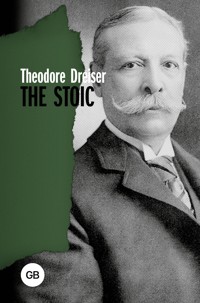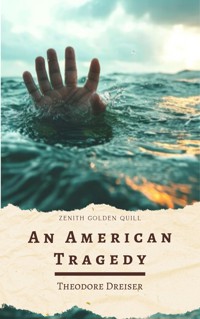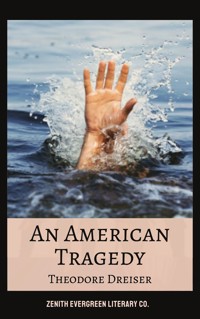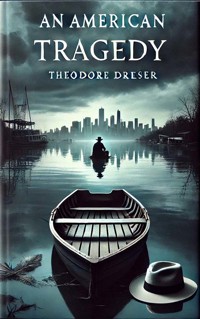1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Neu übersetzt Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Eine amerikanische Tragödie" von Theodore Dreiser gilt als eines der bedeutendsten Werke der amerikanischen Literatur des 20. Jahrhunderts. Der Roman erzählt die Geschichte von Clyde Griffiths, einem jungen Mann aus einfachen Verhältnissen, der in den Wirren des frühen industriellen Amerika nach sozialem Aufstieg, Wohlstand und Anerkennung strebt. Früh geprägt von Armut und familiärer Strenge, findet Clyde eine Anstellung in einem Luxushotel, wo er die glitzernde, aber moralisch ambivalente Welt der Reichen kennenlernt. Diese Begegnung mit einem verführerischen Lebensstil weckt in ihm Ehrgeiz und den Wunsch, seine gesellschaftliche Stellung um jeden Preis zu verbessern. Sein Weg führt ihn schließlich in eine Fabrik, die einem wohlhabenden Verwandten gehört. Dort lernt er Roberta Alden kennen, eine Arbeiterin, die ihm Zuneigung und Stabilität bietet. Gleichzeitig wird er von der schönen und privilegierten Sondra Finchley angezogen, die ein Leben voller gesellschaftlicher Möglichkeiten verkörpert. Zwischen Pflicht und Verlangen, Realität und Traum, gerät Clyde in einen immer gefährlicheren inneren und äußeren Konflikt. Dreiser, inspiriert von einem tatsächlichen Kriminalfall aus dem Jahr 1906, nutzt diese Handlung, um die Schattenseiten des "American Dream" zu beleuchten. Der Roman ist ein schonungsloses Porträt einer Gesellschaft, in der soziale Herkunft, wirtschaftliche Zwänge und moralische Entscheidungen untrennbar miteinander verwoben sind. Mit seiner realistischen, fast dokumentarischen Erzählweise eröffnet Dreiser eine tiefgehende psychologische Studie über Ambition, Verführung und moralischen Verfall. Die zeitlose Relevanz des Werks liegt in seiner präzisen Analyse gesellschaftlicher Mechanismen, die auch heute noch Fragen nach sozialer Gerechtigkeit, persönlicher Verantwortung und den Grenzen individueller Freiheit aufwerfen. "Eine amerikanische Tragödie" bleibt ein Meilenstein der Literatur, weil es zugleich eine packende Erzählung, ein historisches Zeitdokument und eine universelle moralische Parabel ist. Theodore Dreiser, ein bedeutender Schriftsteller der amerikanischen Literatur, war Zeitzeuge von sozialen Umwälzungen und dem Streben nach Erfolg, die ihn dazu inspirierten, die dunkleren Seiten des amerikanischen Traums zu erforschen. Geboren 1871 in eine arme Familie, erlebte er selbst die Kämpfe um gesellschaftlichen Aufstieg und die damit verbundenen moralischen Konflikte. Diese persönlichen Erfahrungen und seine Beobachtungen der Gesellschaft beeinflussten die Entstehung von "Eine amerikanische Tragödie", die als Klassiker der amerikanischen Literatur gilt. Dieses Meisterwerk ist für jeden Leser von Bedeutung, der sich für die menschliche Psyche und die Tragik des Strebens nach Erfolg interessiert. Dreisers Erzählung stellt grundlegende Fragen zu Moral, Entschlossenheit und den Preisen, die man für seine Träume zahlen muss. Die gediegene Sprache und die tiefgreifende Analyse der Charaktere machen das Buch nicht nur zu einem bedeutenden literarischen Werk, sondern auch zu einem zeitlosen Spiegel der Gesellschaft. Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Eine amerikanische Tragödie
Inhaltsverzeichnis
BUCH EINS
Kapitel 1
Abenddämmerung – an einem Sommerabend.
Und die hohen Mauern des Geschäftszentrums einer amerikanischen Stadt mit vielleicht 400.000 Einwohnern – Mauern, die mit der Zeit vielleicht nur noch eine Legende sein werden.
Und die breite Straße, jetzt ziemlich ruhig, wird von einer kleinen Gruppe von sechs Leuten belebt – ein Mann um die fünfzig, klein, stämmig, mit buschigen Haaren, die unter einem runden schwarzen Filzhut hervorstehen, eine höchst unscheinbare Person, die eine kleine tragbare Orgel trägt, wie sie gewöhnlich von Straßenpredigern und Sängern benutzt wird. Mit ihm eine Frau, vielleicht fünf Jahre jünger, größer, nicht so breit, aber kräftig gebaut und lebhaft, sehr schlicht in Gesicht und Kleidung, aber nicht hässlich, die mit einer Hand einen kleinen Jungen von sieben Jahren führte und in der anderen eine Bibel und mehrere Gesangbücher trug. Mit diesen dreien, aber unabhängig hinter ihnen gehend, waren ein fünfzehnjähriges Mädchen, ein zwölfjähriger Junge und ein weiteres neunjähriges Mädchen, die alle gehorsam, aber nicht allzu begeistert den anderen folgten.
Es war heiß, aber es lag eine süße Trägheit in der Luft.
Die große Durchgangsstraße, auf der sie gingen, wurde rechtwinklig von einer zweiten canyonartigen Straße gekreuzt, durch die Menschenmassen und Fahrzeuge strömten und verschiedene Autoschlangen sich ihren Weg bahnten, indem sie ihre Glocken läuteten und so schnell vorankamen, wie es ihnen in dem schnell fließenden Verkehr möglich war. Doch die kleine Gruppe schien nichts zu bemerken außer ihrem Vorsatz, sich ihren Weg zwischen den konkurrierenden Verkehrsströmen und Fußgängern zu bahnen, die an ihnen vorbeizogen.
Als sie eine Kreuzung auf dieser Seite der zweiten Hauptstraße erreichten – eigentlich nur eine Gasse zwischen zwei hohen Gebäuden –, die nun völlig menschenleer war, stellte der Mann die Orgel ab, die die Frau sofort öffnete und einen Notenständer aufstellte, auf den sie ein breites, flaches Gesangbuch legte. Dann reichte sie dem Mann die Bibel, stellte sich wieder neben ihn, während der zwölfjährige Junge einen kleinen Klappstuhl vor die Orgel stellte. Der Mann – zufällig der Vater – sah sich mit scheinbar weit aufgerissenen Augen selbstbewusst um und verkündete, ohne sich darum zu kümmern, ob er Zuhörer hatte oder nicht:
„Wir werden zuerst ein Loblied singen, damit alle, die den Herrn anerkennen möchten, mit uns singen können. Würdest du uns die Ehre erweisen, Hester?“
Daraufhin ließ sich das älteste Mädchen, das bis jetzt versucht hatte, so unbewusst und unbeeindruckt wie möglich zu wirken, auf den Klappstuhl sinken und blätterte im Gesangbuch, während sie die Orgel pumpte und ihre Mutter bemerkte:
„Ich denke, es könnte schön sein, heute Abend die Nummer 27 zu singen – ‚Wie lieblich der Balsam der Liebe Jesu‘.“
Inzwischen hatten verschiedene Personen unterschiedlicher Herkunft und aus verschiedenen Gesellschaftsschichten, die auf dem Heimweg waren, die kleine Gruppe bemerkt, die sich auf diese Weise niedergelassen hatte, und zögerten einen Moment, um sie misstrauisch zu beäugen oder anzuhalten, um herauszufinden, was sie taten. Dieses Zögern, das der Mann offenbar als Aufmerksamkeit interpretierte, wenn auch nur als flüchtige, nutzte er aus und begann, zu ihnen zu sprechen, als wären sie eigens hier, um ihm zuzuhören.
„Lasst uns alle zusammen die 27 singen – “Wie lieblich der Balsam der Liebe Jesu”.
Daraufhin begann das junge Mädchen, die Melodie auf der Orgel zu spielen, wobei sie eine dünne, aber korrekte Melodie hervorbrachte und gleichzeitig ihre eher hohe Sopranstimme mit der ihrer Mutter und der eher zweifelhaften Baritonstimme des Vaters vereinte. Die anderen Kinder sangen schwach mit, wobei der Junge und das Mädchen Gesangbücher aus dem kleinen Stapel auf der Orgel genommen hatten. Während sie sangen, starrte das unscheinbare und gleichgültige Publikum auf der Straße, fasziniert von der Besonderheit einer so unbedeutend aussehenden Familie, die öffentlich ihre Stimme gegen die große Skepsis und Apathie des Lebens erhob. Einige waren interessiert oder bewegt von der eher zahmen und unzulänglichen Gestalt des Mädchens an der Orgel, andere von der unpraktischen und materiell ineffizienten Erscheinung des Vaters, dessen schwache blaue Augen und eher schlaffe, aber schlecht gekleidete Gestalt mehr von Versagen zeugten als von irgendetwas anderem. Von der Gruppe stach nur die Mutter hervor, die jene Kraft und Entschlossenheit besaß, die, wie blind oder falsch sie auch sein möge, zum Selbsterhalt, wenn nicht zum Erfolg im Leben führt. Sie stand mehr als alle anderen mit einer unwissenden, aber irgendwie respektablen Überzeugung da. Wenn man sie beobachtet hätte, wie sie das Gesangbuch an ihre Seite fallen ließ und ihren Blick geradeaus in die Leere richtete, hätte man gesagt: „Nun, hier ist jemand, der, ungeachtet ihrer Fehler, wahrscheinlich so gut wie möglich das tut, woran sie glaubt.“ Eine Art harter, kämpferischer Glaube an die Weisheit und Barmherzigkeit jener bestimmten, alles beherrschenden und wachsamen Macht, die sie verkündete, stand ihr in jeder Gesichtszug und jeder Geste geschrieben.
„Die Liebe Jesu rettet mich ganz, Die Liebe Gottes lenkt meine Schritte“,
sang sie mit klangvoller, wenn auch leicht nasaler Stimme zwischen den hoch aufragenden Mauern der benachbarten Gebäude.
Der Junge trat unruhig von einem Fuß auf den anderen, hielt den Blick gesenkt und sang meist nur halb mit. Er war groß und noch schlank, hatte einen interessanten Kopf und ein interessantes Gesicht – weiße Haut, dunkles Haar – und schien aufmerksamer und deutlich sensibler zu sein als die meisten anderen – er schien tatsächlich seine Lage zu verabscheuen und sogar darunter zu leiden. Eher heidnisch als religiös, interessierte ihn das Leben, obwohl er sich dessen noch nicht ganz bewusst war. Alles, was man jetzt wirklich über ihn sagen konnte, war, dass all dies für ihn keinen besonderen Reiz hatte. Er war zu jung, sein Geist viel zu empfänglich für Phasen der Schönheit und des Vergnügens, die wenig oder gar nichts mit der fernen und nebulösen Romantik zu tun hatten, die die Gedanken seiner Mutter und seines Vaters beherrschte.
Tatsächlich trugen das Familienleben, in dem dieser Junge aufgewachsen war, und die verschiedenen materiellen und psychischen Kontakte, die er bisher gehabt hatte, nicht dazu bei, ihn von der Realität und Kraft all dessen zu überzeugen, woran seine Mutter und sein Vater so fest zu glauben schienen und was sie sagten. Vielmehr schienen sie in ihrem Leben mehr oder weniger unzufrieden zu sein, zumindest in materieller Hinsicht. Sein Vater las ständig in der Bibel und hielt Reden an verschiedenen Orten, vor allem in der „Mission”, die er und seine Mutter nicht weit von hier betrieben. Gleichzeitig sammelten sie, soweit er es verstand, hier und da Geld von verschiedenen interessierten oder wohltätig gesinnten Geschäftsleuten, die an solche philanthropische Arbeit zu glauben schienen. Dennoch war die Familie immer „knapp bei Kasse“, nie besonders gut gekleidet und vieler Annehmlichkeiten und Vergnügungen beraubt, die für andere selbstverständlich schienen. Und sein Vater und seine Mutter verkündeten ständig die Liebe, Barmherzigkeit und Fürsorge Gottes für ihn und für alle Menschen. Offensichtlich stimmte irgendwo etwas nicht. Er konnte sich keinen Reim darauf machen, aber dennoch konnte er nicht umhin, seine Mutter zu respektieren, eine Frau, deren Kraft und Ernsthaftigkeit sowie ihre Liebenswürdigkeit ihn beeindruckten. Trotz der vielen Missionsarbeit und der familiären Sorgen gelang es ihr, recht fröhlich zu bleiben oder zumindest durchzuhalten, und oft erklärte sie mit Nachdruck: „Gott wird für uns sorgen“ oder „Gott wird uns den Weg zeigen“, besonders in Zeiten, in denen die Not um Essen und Kleidung besonders groß war. Doch trotz allem zeigte Gott, wie er und alle anderen Kinder sehen konnten, keinen klaren Weg, obwohl seine Hilfe in ihren Angelegenheiten dringend nötig war.
Als er heute Abend mit seinen Schwestern und seinem Bruder die große Straße entlangging, wünschte er sich, dass sie das nicht mehr tun müssten, oder zumindest, dass er nicht dabei sein müsste. Andere Jungs machten so etwas nicht, und außerdem kam es ihm irgendwie schäbig und sogar erniedrigend vor. Mehr als einmal, bevor er auf diese Weise auf die Straße gebracht wurde, hatten andere Jungen ihn gerufen und sich über seinen Vater lustig gemacht, weil er immer öffentlich seine religiösen Überzeugungen betonte. So hörte er in einer Nachbarschaft, in der sie gelebt hatten, als er noch ein Kind von sieben Jahren war, wie Jungen, weil sein Vater jedes Gespräch mit „Gelobt sei der Herr“ einleitete, riefen: „Da kommt der alte Gelobt-sei-der-Herr-Griffiths.“ Oder sie riefen ihm nach: „Hallo, du bist doch der, dessen Schwester Orgel spielt. Kann sie auch etwas anderes spielen?“
„Warum muss er immer herumgehen und ‚Gelobt sei der Herr‘ sagen? Andere Leute machen das doch nicht.“
Es war diese alte Sehnsucht nach Gleichheit in allen Dingen, die sie und ihn beunruhigte. Weder sein Vater noch seine Mutter waren wie andere Leute, weil sie immer so viel Wert auf Religion legten und nun endlich sogar ein Geschäft daraus machten.
In dieser Nacht, in dieser großen Straße mit ihren Autos, Menschenmassen und hohen Gebäuden, schämte er sich, aus seinem normalen Leben herausgerissen, zur Schau gestellt und verspottet zu werden. Die schicken Autos, die vorbeirauschten, die herumlungernden Fußgänger, die sich zu Dingen begaben, die er nur erahnen konnte, die fröhlichen jungen Paare, die lachten und scherzten, und die „Kinder“, die sie anstarrten, alles beunruhigte ihn mit dem Gefühl, dass es etwas anderes, etwas Besseres, etwas Schöneres gab als sein Leben, oder vielmehr als ihr Leben.
Und nun schienen Teile dieser unruhigen und instabilen Straßenmenge, die sich ständig um sie herum bewegte und veränderte, den psychologischen Fehler all dessen zu spüren, soweit es diese Kinder betraf, denn sie stießen sich gegenseitig an, die Weltgewandteren und Gleichgültigeren hoben eine Augenbraue und lächelten verächtlich, die Sympathischeren oder Erfahreneren kommentierten die nutzlose Anwesenheit dieser Kinder.
„Ich sehe diese Leute jetzt fast jeden Abend hier – jedenfalls zwei- oder dreimal pro Woche“, sagte ein junger Angestellter, der gerade seine Freundin getroffen hatte und sie zu einem Restaurant begleitete. „Die betreiben wohl irgendeinen religiösen Schwindel.“
„Der älteste Junge will gar nicht hier sein. Ich sehe, dass er sich fehl am Platz fühlt. Es ist nicht richtig, ein Kind wie ihn hierher zu bringen, wenn er nicht will. Er versteht das alles sowieso nicht.“ Das sagte ein etwa vierzigjähriger Faulenzer und Tagelügner, einer dieser gelegentlichen Herumhänger im kommerziellen Zentrum einer Stadt, zu einem stehengebliebenen, freundlich wirkenden Fremden.
„Ja, das kann schon sein“, stimmte der andere zu und musterte den seltsamen Ausdruck von Kopf und Gesicht des Jungen. Angesichts des unruhigen und selbstbewussten Ausdrucks auf seinem Gesicht, wann immer er es hob, hätte man klugerweise anmerken können, dass es ein wenig unfreundlich und auch müßig war, einem Temperament, das noch nicht in der Lage war, ihre Bedeutung zu erfassen, öffentlich religiöse und psychische Dienste aufzuzwingen, die eher für reflektierte Temperamente reiferer Jahre geeignet waren.
Aber so war es nun mal.
Was den Rest der Familie betraf, so waren sowohl das jüngste Mädchen als auch der Junge zu klein, um wirklich zu verstehen, worum es ging, oder sich darum zu kümmern. Das älteste Mädchen an der Orgel schien sich nicht sonderlich daran zu stören, sondern eher die Aufmerksamkeit und die Kommentare zu genießen, die ihre Anwesenheit und ihr Gesang hervorriefen, denn mehr als einmal hatten nicht nur Fremde, sondern auch ihre Mutter und ihr Vater ihr versichert, dass sie eine ansprechende und fesselnde Stimme habe, was nur teilweise stimmte. Es war keine gute Stimme. Sie verstanden nicht wirklich etwas von Musik. Körperlich war sie blass, zart und unscheinbar, ohne echte mentale Stärke oder Tiefe, und man konnte ihr leicht einreden, dass dies ein hervorragendes Feld sei, um sich zu profilieren und ein wenig Aufmerksamkeit zu erregen. Ihre Eltern waren fest entschlossen, die Welt so weit wie möglich zu vergeistigen, und sobald die Hymne zu Ende war, begann der Vater mit einer dieser abgedroschenen Beschreibungen der Freuden einer Befreiung durch die Selbstverwirklichung der Barmherzigkeit Gottes, der Liebe Christi und des Willens Gottes gegenüber den Sündern von den drückenden Sorgen eines bösen Gewissens.
„Alle Menschen sind Sünder im Lichte des Herrn“, erklärte er. „Wenn sie nicht Buße tun, wenn sie Christus, seine Liebe und seine Vergebung nicht annehmen, können sie niemals das Glück erfahren, geistig ganz und rein zu sein. Oh, meine Freunde! Wenn ihr nur den Frieden und die Zufriedenheit kennen könntet, die mit dem Wissen und dem inneren Verständnis einhergehen, dass Christus für euch gelebt hat und gestorben ist und dass er jeden Tag und jede Stunde mit euch geht, bei Licht und bei Dunkelheit, in der Morgendämmerung und in der Abenddämmerung, um euch zu bewahren und zu stärken für die Aufgaben und Sorgen der Welt, die immer vor euch liegen. Oh, die Fallstricke und Fallen, die uns alle bedrängen! Und dann die beruhigende Erkenntnis, dass Christus immer bei uns ist, um uns zu beraten, zu helfen, zu ermutigen, unsere Wunden zu verbinden und uns zu heilen! Oh, der Friede, die Zufriedenheit, der Trost, die Herrlichkeit davon!“
„Amen!“, bekräftigte seine Frau, und die Tochter Hester, oder Esta, wie sie von der Familie genannt wurde, bewegt von dem Bedürfnis nach möglichst viel öffentlicher Unterstützung für sie alle, wiederholte es nach ihr.
Clyde, der älteste Junge, und die beiden jüngeren Kinder starrten nur auf den Boden oder gelegentlich auf ihren Vater, mit dem Gefühl, dass das alles vielleicht wahr und wichtig war, aber irgendwie nicht so bedeutend oder verlockend wie einige andere Dinge, die das Leben bereithielt. Sie hatten schon so viel davon gehört, und für ihre jungen, eifrigen Gemüter war das Leben für etwas mehr geschaffen als für solche Proteste auf der Straße und in Missionssälen.
Schließlich, nach einem zweiten Lied und einer Ansprache von Frau Griffiths, in der sie auf die gemeinsame Missionsarbeit in einer nahe gelegenen Straße und ihren Dienst für die Sache Christi im Allgemeinen hinwies, wurde ein drittes Lied gesungen, und dann wurden einige Traktate über die Missionsarbeit verteilt, und freiwillige Spenden wurden von Asa, dem Vater, eingesammelt. Die kleine Orgel wurde geschlossen, der Klappstuhl zusammengeklappt und Clyde gegeben, die Bibel und die Gesangbücher von Frau Griffiths eingesammelt, und mit der Orgel, die mit einem Lederriemen über die Schulter von Griffiths senior gehängt wurde, setzte sich der Marsch zurück zum Missionshaus in Bewegung.
Während dieser ganzen Zeit sagte Clyde sich, dass er das nicht mehr machen wollte, dass er und seine Eltern lächerlich und weniger als normal aussahen – „billig“ wäre das Wort gewesen, das er benutzt hätte, wenn er sich dazu hätte durchringen können, seine ganze Abneigung gegen diese erzwungene Teilnahme zum Ausdruck zu bringen –, und dass er es nicht mehr machen würde, wenn er es irgendwie verhindern könnte. Was brachte es ihnen, ihn dabei zu haben? Sein Leben sollte nicht so sein. Andere Jungs mussten das nicht tun. Er dachte jetzt entschlossener denn je über einen Aufstand nach, durch den er sich von der Notwendigkeit befreien würde, auf diese Weise ausgehen zu müssen. Seine ältere Schwester sollte gehen, wenn sie wollte; ihr gefiel es. Seine jüngere Schwester und sein Bruder waren vielleicht noch zu jung, um sich darum zu kümmern. Aber er –
„Ich fand, sie schienen heute Abend etwas aufmerksamer als sonst“, sagte Griffiths zu seiner Frau, als sie spazieren gingen. Die verführerische Sommerluft milderte ihn und ließ ihn die übliche Gleichgültigkeit der Passanten großzügiger interpretieren.
„Ja, heute Abend haben 27 Traktate mitgenommen, am Donnerstag waren es nur 18.“
„Die Liebe Christi wird sich letztendlich durchsetzen“, tröstete der Vater, ebenso sehr, um sich selbst Mut zu machen wie seine Frau. „Die Freuden und Sorgen der Welt halten sehr viele Menschen fest, aber wenn sie von Trauer übermannt werden, werden einige dieser Samen keimen.“
„Da bin ich mir sicher. Dieser Gedanke hält mich immer aufrecht. Das Leid und die Last der Sünde bringen einige von ihnen schließlich dazu, den Irrtum ihres Weges einzusehen.“
Sie bogen nun in die schmale Straße ein, aus der sie gekommen waren, gingen etwa ein Dutzend Häuser weiter und betraten ein gelbes, einstöckiges Holzhaus, dessen großes Fenster und die beiden Glasscheiben in der mittleren Tür grau-weiß gestrichen waren. Über beiden Fenstern und den kleineren Feldern der Doppeltür stand geschrieben: „Die Tür der Hoffnung. Unabhängige Mission Bethel. Versammlungen jeden Mittwoch- und Samstagabend von 20 bis 22 Uhr. Sonntags um 11, 15 und 20 Uhr. Alle sind willkommen.“ Unter dieser Aufschrift waren auf jedem Fenster die Worte „Gott ist Liebe“ gedruckt, und darunter wieder in kleinerer Schrift: „Wie lange hast du deiner Mutter schon nicht mehr geschrieben?“
Die kleine Gruppe ging durch die unscheinbare gelbe Tür und verschwand.
Kapitel 2
Dass eine Familie, die so kurz vorgestellt wird, eine andere und etwas seltsame Geschichte haben könnte, kann man sich schon denken, und das stimmt auch. Tatsächlich zeigte sie eine dieser psychischen und sozialen Reflexe und Motivationen, die nicht nur Psychologen, sondern auch Chemiker und Physiker vor eine große Herausforderung stellen würden. Zunächst einmal war Asa Griffiths, der Vater, einer dieser schlecht integrierten und unausgeglichenen Menschen, das Produkt seiner Umgebung und einer religiösen Theorie, aber ohne eigene Leitlinien oder Einsichten, dafür aber sensibel und daher sehr emotional und ohne jeglichen Sinn für das Praktische. Es ist wirklich schwer zu sagen, was ihn am Leben hielt oder wie seine Gefühle wirklich waren. Seine Frau hingegen war, wie bereits erwähnt, von festerem Charakter, aber auch nicht wirklich einfühlsam oder praktisch veranlagt.
Die Geschichte dieses Mannes und seiner Frau ist hier nicht besonders interessant, außer insofern, als sie ihren zwölfjährigen Sohn Clyde Griffiths beeinflusste. Dieser Junge, abgesehen von einer gewissen Emotionalität und einem exotischen Sinn für Romantik, die ihn auszeichneten und die er eher von seinem Vater als von seiner Mutter hatte, brachte eine lebhaftere und intelligentere Vorstellungskraft mit und dachte ständig darüber nach, wie er sich verbessern könnte, wenn er eine Chance hätte; Orte, an die er gehen könnte, Dinge, die er sehen könnte, und wie anders er leben könnte, wenn nur dies und das und jenes wahr wäre. Was Clyde bis zu seinem fünfzehnten Lebensjahr und noch lange danach im Nachhinein am meisten beunruhigte, war, dass der Beruf seiner Eltern in den Augen anderer so schäbig war, wie er ihnen erschien. Denn während seiner Jugend in verschiedenen Städten, in denen seine Eltern missionierten oder auf der Straße predigten – Grand Rapids, Detroit, Milwaukee, Chicago und zuletzt Kansas City –, war es offensichtlich, dass die Leute, zumindest die Jungen und Mädchen, denen er begegnete, auf ihn und seine Geschwister herabblickten, weil sie Kinder solcher Eltern waren. Mehrmals, und sehr gegen den Willen seiner Eltern, die solche Wutausbrüche nie gut fanden, hatte er angehalten, um mit dem einen oder anderen dieser Jungen zu kämpfen. Aber immer, ob geschlagen oder siegreich, war er sich der Tatsache bewusst gewesen, dass die Arbeit seiner Eltern für andere nicht zufriedenstellend war – schäbig, trivial. Und immer dachte er daran, was er tun würde, sobald er an den Ort gelangte, an dem er wegkommen konnte.
Denn Clydes Eltern hatten sich in der Frage der Zukunft ihrer Kinder als unpraktisch erwiesen. Sie verstanden nicht, wie wichtig und notwendig eine praktische oder berufliche Ausbildung für jedes einzelne ihrer Kinder war. Stattdessen waren sie so sehr mit der Idee beschäftigt, die Welt zu evangelisieren, dass sie es versäumt hatten, ihre Kinder an einem Ort zur Schule zu schicken. Sie zogen hierhin und dorthin, manchmal mitten in einem Schuljahr, weil sie ein größeres und besseres religiöses Betätigungsfeld suchten. Und es gab Zeiten, in denen die Arbeit sich als äußerst unrentabel erwies und Asa mit den beiden Dingen, die er am besten konnte – Gartenarbeit und das Anpreisen der einen oder anderen Erfindung –, nicht viel Geld verdienen konnte, sodass sie kaum genug zu essen und keine anständigen Kleider hatten und die Kinder nicht zur Schule gehen konnten. Angesichts solcher Situationen blieben Asa und seine Frau, egal was die Kinder denken konnten, so optimistisch wie immer, oder sie redeten sich ein, dass sie es waren, und hatten unerschütterliches Vertrauen in den Herrn und seine Absicht, für sie zu sorgen.
Das Haus und die Mission, die diese Familie bewohnten, waren in den meisten Phasen so trostlos, dass sie jeden durchschnittlichen Jugendlichen oder jedes Mädchen ohne besonderen Lebensmut entmutigt hätten. Es bestand aus einem einzigen langen Ladenraum in einem alten, ausgesprochen farblosen und unansehnlichen Holzgebäude, das in dem Teil von Kansas City lag, der nördlich des Independence Boulevard und westlich der Troost Avenue liegt. Die genaue Straße oder der Ort hieß Bickel, eine sehr kurze Durchgangsstraße, die von der Missouri Avenue abzweigte, einer etwas längeren, aber nicht weniger unscheinbaren Hauptstraße. Und die ganze Gegend, in der sie stand, roch ganz schwach und nicht gerade angenehm nach einem Geschäftsleben, das längst weiter nach Süden, wenn nicht sogar nach Westen gezogen war. Sie lag etwa fünf Blocks von dem Ort entfernt, an dem zweimal pro Woche die Freiluftversammlungen dieser religiösen Enthusiasten und Bekehrer stattfanden.
Und im Erdgeschoss dieses Gebäudes, das nach vorne zur Bickel Straße und nach hinten zu einigen trostlosen Hinterhöfen ebenso trostloser Holzhäuser hinausging, befand sich ein Raum, der vorne in einen 12 mal 7,5 Meter großen Saal unterteilt war, in dem etwa 60 klappbare Holzstühle, ein Rednerpult, eine Karte von Palästina oder dem Heiligen Land und als Wanddekoration etwa 25 gedruckte, aber ungerahmte Sprüche standen, auf denen unter anderem zu lesen war:
„WEIN IST EIN SPÖTTISCHER, STARKER TRUNK, UND WER SICH VON IHM VERFÜHREN LÄSST, IST NICHT WEISE.“
„GREIFT ZUM SCHILD UND ZUM BUCKLER UND STELLT EUCH AUF MEINE HILFE.“ PSALMEN 35:2.
„Und ihr, meine Herde, die Herde meiner Weide, seid Menschen, und ich bin euer Gott, spricht Gott, der Herr.“ Hesekiel 34:31.
„Gott, du kennst meine Dummheit, und meine Sünden sind dir nicht verborgen.“ PSALMEN 69:5.
„WENN IHR GLAUBEN HABT WIE EIN SENFKORN, SO WERDET IHR ZU DIESEM BERG SAGEN: HUB DICH HIN UND SETZ DICH DORTHIN! UND ER WIRD SICH HINBEWEGEN, UND NICHTS WIRD EUCH UNMÖGLICH SEIN.“ MATTHÄUS 17:20.
„DENN DER TAG DES HERRN IST NAHE.“ OBADIA 15.
„DENN DEM BÖSEN WIRD KEIN VERGELTUNG TEILEN.“ SPRÜCHE 24:20.
„SCHAU NICHT AUF DEN ROTEN WEIN, WENN ER ROT IST, DENN ER BIESTET WIE EINE SCHLANGE UND STICHT WIE EINE GRUBE.“ SPRÜCHE 23:31,32.
Diese mächtigen Ermahnungen waren wie Silber- und Goldplatten, die in eine Wand aus Schlacke gesetzt waren.
Die hinteren zwölf Meter dieses ganz gewöhnlichen Raumes waren kompliziert, aber ordentlich in drei kleine Schlafzimmer, ein Wohnzimmer mit Blick auf den Hinterhof und die Holzzäune der Nachbargrundstücke, die nicht besser waren als die hinteren; außerdem eine Kombination aus Küche und Esszimmer, die genau zehn Fuß im Quadrat groß war, und ein Lagerraum für Missionstraktate, Gesangbücher, Kisten, Truhen und alles, was die Familie sonst noch besaß und was nicht von unmittelbarem Nutzen, aber von angenommenem Wert war. Dieser besonders kleine Raum lag direkt hinter dem Versammlungsraum der Mission, und vor oder nach den Vorträgen oder wenn eine wichtige Besprechung anstand, zogen sich Herr und Frau Griffiths dorthin zurück – manchmal auch, um zu meditieren oder zu beten.
Wie oft hatten Clyde und seine Schwestern und sein jüngerer Bruder seine Mutter oder seinen Vater oder beide in Gesprächen mit einem heruntergekommenen oder halb reuigen Menschen gesehen, der um Rat oder Hilfe gebeten hatte, meistens um Hilfe. Und hier fand man sie manchmal, wenn die finanziellen Schwierigkeiten seiner Mutter und seines Vaters am größten waren, nachdenkend oder, wie Asa Griffiths manchmal hilflos zu sagen pflegte, „sich einen Ausweg betend“, was Clyde später als ziemlich wirkungslos empfand.
Und die ganze Nachbarschaft war so trostlos und heruntergekommen, dass er den Gedanken hasste, dort zu leben, geschweige denn Teil einer Arbeit zu sein, die ständige Bitten um Hilfe sowie ständiges Gebet und Dankbarkeit erforderte, um sie aufrechtzuerhalten.
Frau Elvira Griffiths war vor ihrer Heirat mit Asa nichts weiter als ein unwissendes Bauernmädchen gewesen, das ohne viel religiösen Einfluss aufgewachsen war. Aber nachdem sie sich in ihn verliebt hatte, war sie mit dem Virus des Evangelismus und der Missionierung infiziert worden, der ihn beherrschte, und hatte ihn freudig und enthusiastisch bei all seinen Unternehmungen und Launen begleitet. Da sie sich durch die Tatsache, dass sie sprechen und singen konnte, ziemlich geschmeichelt fühlte, und durch ihre Fähigkeit, Menschen mit dem „Wort Gottes“, wie sie es sah, zu beeinflussen, zu überzeugen und zu kontrollieren, war sie mehr oder weniger zufrieden mit sich selbst und ließ sich daher überreden, weiterzumachen.
Gelegentlich folgte eine kleine Gruppe von Menschen den Predigern zu ihrer Mission oder erfuhr durch ihre Straßenarbeit von deren Existenz und tauchte später dort auf – jene gelegentlichen und geistig verwirrten oder verstörten Seelen, die man überall findet. Und es war Clydes Pflicht gewesen, all die Jahre, in denen er nicht selbst handeln konnte, an diesen verschiedenen Versammlungen teilzunehmen. Und immer hatte ihn die Art von Männern und Frauen, die hierherkamen – meist Männer –, mehr irritiert als positiv beeinflusst: heruntergekommene Arbeiter, Faulenzer, Trunkenbolde, Verschwender, Versager und Hilflose, die hierher zu treiben schienen, weil sie keinen anderen Ort hatten, an den sie gehen konnten. Und sie erzählten immer, wie Gott oder Christus oder die göttliche Gnade sie aus dieser oder jener Notlage gerettet hatte – nie, wie sie jemand anderem geholfen hatten. Und immer sagten sein Vater und seine Mutter „Amen“ und „Ehre sei Gott“ und sangen Hymnen und sammelten anschließend eine Kollekte für die legitimen Ausgaben des Saals – Kollekten, die, wie er vermutete, gering genug waren, um die verschiedenen Missionen, die sie durchgeführt hatten, gerade so am Leben zu erhalten.
Das Einzige, was ihn an seinen Eltern wirklich interessierte, war die Existenz eines Onkels irgendwo im Osten – in einer kleinen Stadt namens Lycurgus, in der Nähe von Utica, wie er verstanden hatte –, eines Bruders seines Vaters, der ganz anders war als alle anderen. Dieser Onkel – Samuel Griffiths hieß er – war reich. Auf die eine oder andere Weise hatte Clyde aus beiläufigen Bemerkungen seiner Eltern erfahren, dass dieser Onkel bestimmte Dinge für jemanden tun könnte, wenn er nur wollte; Er hörte, dass er ein gewiefter, harter Geschäftsmann war, dass er ein großes Haus und eine große Fabrik in Lycurgus hatte, in der Kragen und Hemden hergestellt wurden und nicht weniger als dreihundert Leute arbeiteten, dass er einen Sohn hatte, der ungefähr so alt sein musste wie Clyde, und mehrere Töchter, mindestens zwei, die alle, wie Clyde sich vorstellte, in Lycurgus in Luxus lebten. Die Nachrichten darüber waren offenbar auf irgendeinem Weg von Leuten, die Asa und seinen Vater und Bruder kannten, in den Westen gelangt. So wie Clyde sich diesen Onkel vorstellte, musste er eine Art Krösus sein, der dort im Osten in Wohlstand und Luxus lebte, während er hier im Westen – in Kansas City – mit seinen Eltern, seinem Bruder und seinen Schwestern in derselben elenden und eintönigen Existenz führte, die ihr Leben seit jeher geprägt hatte.
Aber dafür – abgesehen von dem, was er selbst tun könnte, wie er schon früh zu erkennen begann – gab es keine Abhilfe. Denn mit fünfzehn, sogar schon etwas früher, begann Clyde zu begreifen, dass seine Ausbildung, ebenso wie die seiner Schwestern und seines Bruders, sträflich vernachlässigt worden war. Und es würde ihm ziemlich schwer fallen, diesen Rückstand aufzuholen, wenn man bedenkt, dass andere Jungen und Mädchen mit mehr Geld und besseren Familienverhältnissen für bestimmte Berufe ausgebildet wurden. Wie sollte man unter solchen Umständen einen Anfang machen? Schon als er im Alter von dreizehn, vierzehn und fünfzehn Jahren begann, in den Zeitungen zu suchen, die, weil sie zu weltlich waren, nie in sein Haus durften, stellte er fest, dass meist Fachkräfte gesucht wurden oder Jungen, die einen Beruf erlernen wollten, für den er sich zu diesem Zeitpunkt nicht besonders interessierte. Denn getreu dem Standard der amerikanischen Jugend oder der allgemeinen amerikanischen Lebenseinstellung fühlte er sich über jede rein manuelle Arbeit erhaben. Was denn! Eine Maschine bedienen, Ziegelsteine legen, Tischler, Stuckateur oder Klempner werden, wenn Jungs, die nicht besser waren als er, Angestellte, Apothekergehilfen, Buchhalter und Assistenten in Banken, Immobilienämtern und so weiter waren? War es nicht niederträchtig, genauso erbärmlich wie das Leben, das er bisher geführt hatte, alte Kleidung zu tragen, morgens so früh aufzustehen und all die alltäglichen Dinge zu tun, die solche Leute tun mussten?
Denn Clyde war ebenso eitel und stolz wie arm. Er gehörte zu den interessanten Menschen, die sich selbst als etwas Besonderes betrachteten – nie ganz und gar mit der Familie, der er angehörte, verschmolzen und nie tief verpflichtet gegenüber denen, die für seine Geburt verantwortlich waren. Im Gegenteil, er neigte dazu, seine Eltern zu studieren, nicht allzu scharf oder bitter, aber mit einem sehr fairen Verständnis für ihre Eigenschaften und Fähigkeiten. Und doch war er trotz seines guten Urteilsvermögens in dieser Hinsicht nie in der Lage – zumindest nicht bis zu seinem sechzehnten Lebensjahr –, eine Strategie für sein Leben zu entwickeln, und selbst dann nur auf eher unbeholfene und zaghafte Weise.
Übrigens hatte zu dieser Zeit auch die sexuelle Anziehungskraft begonnen, sich zu manifestieren, und er war bereits intensiv interessiert und beunruhigt von der Schönheit des anderen Geschlechts, seiner Anziehungskraft auf ihn und seiner Anziehungskraft auf das andere Geschlecht. Und natürlich und zufälligerweise begann ihn die Frage nach seiner Kleidung und seinem Aussehen nicht wenig zu beunruhigen – wie er aussah und wie andere Jungen aussahen. Es war jetzt schmerzhaft für ihn, daran zu denken, dass seine Kleidung nicht richtig war, dass er nicht so gut aussah, wie er könnte, nicht so interessant. Wie elend war es doch, arm geboren zu sein und niemanden zu haben, der etwas für einen tat, und selbst nicht viel für sich tun zu können!
Wenn er sich zufällig im Spiegel betrachtete, kam er eher zu dem Schluss, dass er gar nicht so schlecht aussah – eine gerade, gut geschnittene Nase, eine hohe, weiße Stirn, welliges, glänzendes, schwarzes Haar, schwarze Augen, die manchmal etwas melancholisch wirkten. Und doch führte die Tatsache, dass seine Familie so unglücklich war, dass er nie echte Freunde gehabt hatte und seiner Meinung nach auch keine haben konnte, weil der Beruf und die Verbindungen seiner Eltern dies unmöglich machten, nun immer mehr zu einer Art geistiger Depression oder Melancholie, die für seine Zukunft nicht viel Gutes versprach. Das stand ihm zur Seite und machte ihn rebellisch und daher manchmal lethargisch. Wegen seiner Eltern und trotz seines Aussehens, das wirklich angenehm und ansprechender als das der meisten anderen war, neigte er dazu, die interessierten Blicke, die ihm gelegentlich von jungen Mädchen aus ganz anderen Verhältnissen zugeworfen wurden, falsch zu deuten – die verächtliche und doch eher einladende Art, mit der sie ihn ansahen, um zu sehen, ob er interessiert oder desinteressiert, mutig oder feige war.
Und doch hatte er sich, bevor er überhaupt Geld verdient hatte, immer gesagt, wenn er nur einen besseren Kragen, ein schöneres Hemd, bessere Schuhe, einen guten Anzug und einen schicken Mantel hätte, wie einige andere Jungs! Oh, die schicken Klamotten, die schönen Häuser, die Uhren, Ringe und Anstecknadeln, mit denen manche Jungs prahlten; die Dandys, die viele Jugendliche in seinem Alter bereits waren! Einige Eltern von Jungen in seinem Alter gaben ihnen sogar eigene Autos, in denen sie herumfahren konnten. Man sah sie auf den Hauptstraßen von Kansas City wie Fliegen hin und her flitzen. Und hübsche Mädchen waren dabei. Und er hatte nichts. Und er hatte nie etwas gehabt.
Und doch war die Welt so voller Dinge, die man tun konnte – so viele Menschen waren so glücklich und erfolgreich. Was sollte er tun? Welchen Weg sollte er einschlagen? Was sollte er lernen und meistern – etwas, das ihn weiterbringen würde? Er wusste es nicht. Er wusste es nicht genau. Und seine seltsamen Eltern waren keineswegs in der Lage, ihn zu beraten.
Kapitel 3
Eines der Dinge, die Clydes Stimmung gerade zu dem Zeitpunkt verdunkelten, als er nach einer praktischen Lösung für sich suchte, ganz zu schweigen von der zutiefst entmutigenden Wirkung auf die gesamte Familie Griffiths, war die Tatsache, dass seine Schwester Esta, an der er nicht wenig Interesse hatte (obwohl sie wirklich sehr wenig gemeinsam hatten), von zu Hause weggelaufen war mit einem Schauspieler, der zufällig in Kansas City auftrat und sich in sie verliebt hatte.
Die Wahrheit über Esta war, dass sie trotz ihrer behüteten Erziehung und der scheinbaren religiösen und moralischen Inbrunst, die sie manchmal an den Tag legte, nur ein sinnliches, schwaches Mädchen war, das noch lange nicht wusste, was sie wollte. Trotz der Atmosphäre, in der sie sich bewegte, gehörte sie im Grunde nicht dazu. Wie die große Mehrheit derjenigen, die die Dogmen und Glaubenssätze der Welt bekennen und täglich wiederholen, war sie seit ihrer frühesten Kindheit so unmerklich in ihre Praktiken und ihre vorgegebene Haltung hineingewachsen, dass sie bis zu diesem Zeitpunkt und sogar noch später nicht wusste, was das alles bedeutete. Denn das Nachdenken war durch Ratschläge und Gesetze oder „offenbarte“ Wahrheiten überflüssig gemacht worden, und solange keine anderen Theorien oder Situationen und Impulse von außen oder sogar von innen auftauchten, die damit kollidierten, war sie sicher genug. Sobald dies jedoch geschah, war es eine ausgemachte Sache, dass ihre religiösen Vorstellungen, die nicht auf einer eigenen Überzeugung oder einer temperamentvollen Neigung beruhten, dem Schock wahrscheinlich nicht standhalten würden. So wanderten ihre Gedanken und Gefühle die ganze Zeit, ähnlich wie bei ihrem Bruder Clyde, hierhin und dorthin – zur Liebe, zum Trost – zu Dingen, die im Großen und Ganzen wenig oder gar nichts mit einer selbstverleugnenden und selbstaufopfernden religiösen Theorie zu tun hatten. In ihr gab es eine Mischung aus Träumen, die irgendwie allem entgegenwirkte, was sie zu sagen hatten.
Doch sie hatte weder Clydes Kraft noch seinen Widerstand. Sie war im Wesentlichen eine Drifterin mit einer vagen Sehnsucht nach hübschen Kleidern, Hüten, Schuhen, Bändern und Ähnlichem, überlagert von der religiösen Theorie oder Vorstellung, dass sie das nicht sein sollte. Da waren die langen, hellen Straßen morgens und nachmittags nach der Schule oder abends. Der Charme bestimmter Mädchen, die Arm in Arm dahinschwebten und Geheimnisse flüsterten, oder der Charme der Jungen, die herumalberten und doch durch ihre ausgelassene, lächerliche Animalität die Kraft und Bedeutung jener Chemie und des Drangs zur Paarung offenbarten, die hinter allen jugendlichen Gedanken und Handlungen steckt. Und in ihr selbst, wenn sie von Zeit zu Zeit Liebende oder Flirtsuchende beobachtete, die an Straßenecken oder in Hauseingängen verweilten und sie sehnsüchtig und suchend ansahen, gab es eine Regung, ein nervöses Herzklopfen, das laut für all die scheinbar materiellen Dinge des Lebens sprach, nicht für die dünnen Höflichkeiten des Himmels.
Und die Blicke durchbohrten sie wie unsichtbare Strahlen, denn sie war hübsch anzusehen und wurde von Stunde zu Stunde attraktiver. Und die Stimmungen der anderen weckten in ihr entsprechende Stimmungen, jene umgestaltenden chemischen Vorgänge, auf denen alle Moral und Unmoral der Welt beruhen.
Und dann, als sie eines Tages von der Schule nach Hause kam, sprach ein junger Mann, der zu der glaubwürdigen Sorte der „Schwärmer“ gehörte, sie an, vor allem wegen ihres Aussehens und ihrer Stimmung, die dazu einluden. Und es gab wenig, was sie zurückhalten konnte, denn sie war von Natur aus nachgiebig, wenn auch nicht verliebt. Doch ihre Erziehung zu Bescheidenheit, Umsicht, Reinheit und Ähnlichem war so streng gewesen, dass zumindest in diesem Fall keine Gefahr bestand, dass sie sofort einen Fehltritt beging. Nur dieser eine Angriff folgte auf den anderen, wurde akzeptiert oder nicht so schnell abgewehrt, und nach und nach trugen sie dazu bei, die Mauer der Zurückhaltung einzureißen, die ihre Erziehung errichtet hatte. Sie wurde geheimnisvoll und verbarg ihr Verhalten vor ihren Eltern.
Jungs gingen manchmal mit ihr spazieren und redeten mit ihr, obwohl sie das nicht wollte. Sie nahmen ihr die übertriebene Schüchternheit, die ihr eigen war und die ihr zumindest vorübergehend geholfen hatte, andere auf Distanz zu halten. Sie sehnte sich nach anderen Kontakten – träumte von einer strahlenden, fröhlichen, wunderbaren Liebe mit jemandem.
Schließlich, nach einem langsamen, aber kräftigen inneren Reifeprozess, tauchte dieser Schauspieler auf, einer dieser eitlen, gutaussehenden, animalischen Typen, der nur aus Kleidung und Allüren bestand, aber keine Moral hatte (keinen Geschmack, keine Höflichkeit oder echte Zärtlichkeit), aber eine unwiderstehliche Anziehungskraft besaß, die ihn innerhalb einer kurzen Woche und einiger Treffen in der Lage versetzte, sie völlig zu verwirren und zu verstricken, so dass sie ihm wirklich gehörte und er mit ihr machen konnte, was er wollte. Und die Wahrheit war, dass er sich kaum für sie interessierte. Für ihn, so langweilig er war, war sie nur ein weiteres Mädchen – recht hübsch, offensichtlich sinnlich und unerfahren, eine Dumme, die man mit ein paar sanften Worten einwickeln konnte – mit einer scheinbar aufrichtigen Zuneigung, mit Gesprächen über die Möglichkeit eines breiteren, freieren Lebens auf Reisen, in anderen großen Städten, als seine Frau.
Und doch waren seine Worte die eines Liebhabers, der für immer treu sein würde. Alles, was sie tun musste, wie er ihr erklärte, war, mit ihm wegzugehen und sofort seine Braut zu werden – jetzt. Eine Verzögerung war so sinnlos, wenn sich zwei wie sie begegnet waren. Es gab Schwierigkeiten mit der Heirat hier, die er ihr nicht erklären konnte – sie hatten mit Freunden zu tun –, aber in St. Louis hatte er einen befreundeten Pfarrer, der sie trauen würde. Sie würde neue und schönere Kleider bekommen, als sie je gesehen hatte, aufregende Abenteuer erleben, Liebe erfahren. Sie würde mit ihm reisen und die große Welt sehen. Sie würde sich um nichts mehr kümmern müssen außer um ihn; und während das für sie die Wahrheit war – die verbalen Beteuerungen einer echten Leidenschaft –, war es für ihn die älteste und bewährteste Form der Schmeichelei, die er schon oft angewendet hatte und die oft erfolgreich war.
In einer einzigen Woche, zu gelegentlichen Stunden, morgens, nachmittags und abends, war diese chemische Hexerei vollbracht.
Als Clyde an einem Samstagabend im April ziemlich spät von einem Spaziergang durch das Geschäftsviertel nach Hause kam, um den üblichen Samstagsgottesdiensten zu entgehen, fand er seine Mutter und seinen Vater besorgt über den Verbleib von Esta. Sie hatte wie immer bei diesem Treffen gespielt und gesungen. Und alles schien in Ordnung gewesen zu sein. Nach dem Treffen war sie in ihr Zimmer gegangen und hatte gesagt, dass sie sich nicht sehr gut fühle und früh ins Bett gehen wolle. Aber um elf Uhr, als Clyde zurückkam, hatte seine Mutter zufällig in ihr Zimmer geschaut und festgestellt, dass sie weder dort noch irgendwo in der Nähe war. Eine gewisse Leere im Zimmer – ein paar Kleinigkeiten und Kleider waren weg, ein alter, vertrauter Koffer fehlte – hatte zuerst die Aufmerksamkeit ihrer Mutter geweckt. Als die Suche im Haus ergab, dass sie nicht da war, ging Asa nach draußen, um die Straße abzusuchen. Manchmal ging sie allein hinaus oder saß oder stand vor der Mission, wenn dort nichts los war oder geschlossen hatte.
Als diese Suche nichts ergab, gingen Clyde und er zu einer Ecke und dann die Missouri Avenue entlang. Keine Esta. Um zwölf kehrten sie zurück, und danach wurde die Neugierde auf sie natürlich immer größer.
Zuerst nahmen sie an, dass sie vielleicht irgendwo spazieren gegangen war, aber als es halb eins, dann eins und schließlich halb zwei wurde und Esta immer noch nicht aufgetaucht war, wollten sie gerade die Polizei benachrichtigen, als Clyde in ihr Zimmer ging und einen Zettel an ihrem kleinen Holzbettkissen fand – eine Nachricht, die seiner Mutter entgangen war. Sofort ging er hin, neugierig und ahnend, denn er hatte sich oft gefragt, wie er es seinen Eltern mitteilen würde, wenn er heimlich weggehen wollte, denn er wusste, dass sie seine Abreise niemals gutheißen würden, wenn sie nicht jedes Detail überwachen könnten. Und jetzt war Esta verschwunden, und hier lag zweifellos eine Nachricht, wie er sie hätte hinterlassen können. Er hob sie auf, begierig, sie zu lesen, aber in diesem Moment kam seine Mutter ins Zimmer, sah den Zettel in seiner Hand und rief: „Was ist das? Ein Zettel? Ist der von ihr?“ Er gab es ihr, und sie faltete es auf und las es schnell. Er bemerkte, dass ihr kräftiges, breites Gesicht, das immer rotbraun gebrannt war, blass wurde, als sie sich zum Nebenzimmer umwandte. Ihr ziemlich großer Mund war jetzt zu einer festen, geraden Linie geformt. Ihre große, kräftige Hand zitterte ein wenig, als sie den kleinen Zettel hochhielt.
„Asa!“, rief sie und stapfte dann in den Nebenraum, wo er stand, sein krauses graues Haar wirbelte verwirrt über seinem runden Kopf, und sagte: „Lies das.“
Clyde, der ihr gefolgt war, sah, wie er den Zettel etwas nervös in seine pummeligen Hände nahm, seine Lippen, die schon immer schwach waren und sich mit zunehmendem Alter in der Mitte zu kräuseln begannen, bewegten sich jetzt seltsam. Jeder, der seine Lebensgeschichte kannte, hätte gesagt, dass es der leicht übertriebene Ausdruck war, mit dem er die meisten der unglücklichen Schläge seines Lebens in der Vergangenheit hingenommen hatte.
„Tst! Tst! Tst!“, war das Einzige, was er zuerst von sich gab, ein schluckendes Geräusch von Zunge und Gaumen – sehr schwach und unzureichend, wie es Clyde vorkam. Dann kam ein weiteres „Tst! Tst! Tst!“, und sein Kopf begann, hin und her zu wackeln. Dann: „Was könnte sie wohl dazu veranlasst haben?“ Dann drehte er sich um und sah seine Frau an, die ihn verständnislos anstarrte. Dann ging er mit hinter dem Rücken verschränkten Händen auf und ab, seine kurzen Beine machten unbewusst seltsam lange Schritte, sein Kopf bewegte sich wieder, und er stieß ein weiteres wirkungsloses „Tst! Tst! Tst!“ aus.
Immer beeindruckender zeigte sich nun Frau Griffiths, die sich in dieser schwierigen Situation deutlich anders und vitaler zeigte, eine Art Irritation oder Unzufriedenheit mit dem Leben selbst, zusammen mit einer offensichtlichen körperlichen Belastung, die wie der sichtbare Schatten eines Gegenstandes oder Lebewesens durch sie hindurchzugehen schien. Als ihr Mann aufgestanden war, streckte sie die Hand aus, nahm den Zettel und starrte ihn nur wieder an, ihr Gesicht zu einer harten, aber erschütterten und beunruhigenden Miene verzogen. Ihr Verhalten war das einer Person, die zutiefst beunruhigt und unzufrieden ist, die wild an einem materiellen Knoten herumfummelt und ihn doch nicht lösen kann, die nach Zurückhaltung und Freiheit von Klagen strebt und doch bitterlich und wütend klagen möchte. Denn hinter ihr lagen all die Jahre religiöser Arbeit und des Glaubens, die in ihrem schlecht integrierten Gewissen irgendwie vage darauf hindeuteten, dass ihr dies zu Recht erspart bleiben sollte. Wo war ihr Gott, ihr Christus, in dieser Stunde, in der dieses offensichtliche Übel geschah? Warum hatte er nicht für sie eingegriffen? Wie sollte er das erklären? Seine biblischen Verheißungen! Seine ewige Führung! Seine verkündete Barmherzigkeit!
Angesichts eines so großen Unglücks fiel es ihr, wie Clyde sehen konnte, sehr schwer, dies zumindest sofort zu klären. Obwohl, wie Clyde inzwischen wusste, dies natürlich irgendwann möglich sein würde. Denn auf eine blinde, dualistische Weise bestanden sowohl sie als auch Asa, wie alle religiösen Menschen, darauf, Gott von Schaden, Irrtum und Elend zu trennen, während sie ihm dennoch die höchste Kontrolle zugestehen. Sie suchten nach etwas anderem – nach einer bösartigen, verräterischen, trügerischen Macht, die angesichts der Allwissenheit und Allmacht Gottes immer noch verführt und betrügt – und fanden sie schließlich im Irrtum und in der Verdorbenheit des menschlichen Herzens, das Gott geschaffen hat, aber nicht kontrolliert, weil er es nicht kontrollieren will.
Im Moment jedoch empfand sie nur Schmerz und Wut, und doch zuckten ihre Lippen nicht wie die von Asa, noch zeigten ihre Augen die tiefe Verzweiflung, die seine erfüllte. Stattdessen trat sie einen Schritt zurück und betrachtete den Brief fast wütend, dann sagte sie zu Asa: „Sie ist mit jemandem durchgebrannt und sagt nicht –“ Dann hielt sie plötzlich inne, als sie sich an die Anwesenheit der Kinder erinnerte – Clyde, Julia und Frank, die alle da waren und neugierig, aufmerksam und ungläubig zuschauten. „Komm her“, rief sie ihrem Mann zu, „ich muss kurz mit dir reden. Ihr Kinder geht besser ins Bett. Wir kommen gleich nach.“
Mit Asa zog sie sich dann ziemlich hastig in einen kleinen Raum hinter dem Gemeindesaal zurück. Sie hörten, wie sie das Licht einschaltete. Dann hörten sie ihre leisen Stimmen, während Clyde, Julia und Frank sich ansahen, obwohl Frank, der erst zehn Jahre alt war, kaum alles verstanden haben dürfte. Selbst Julia begriff kaum die volle Bedeutung des Geschehens. Aber Clyde, der mehr Kontakt zum Leben hatte und die Aussage seiner Mutter („Sie ist mit jemandem durchgebrannt“) kannte, verstand es nur zu gut. Esta hatte all das satt, genau wie er. Vielleicht gab es jemanden, wie einen dieser Dandys, die er auf der Straße mit den hübschesten Mädchen gesehen hatte, mit dem sie weggegangen war. Aber wohin? Und wie sah er aus? Der Zettel verriet etwas, doch seine Mutter hatte ihn ihm nicht gezeigt. Sie hatte ihn zu schnell weggenommen. Hätte er doch nur zuerst heimlich einen Blick darauf werfen können!
„Glaubst du, sie ist für immer weg?“, fragte er Julia zweifelnd, während seine Eltern nicht im Zimmer waren und Julia selbst so ausdruckslos und seltsam aussah.
„Woher soll ich das wissen?“, antwortete sie etwas gereizt, beunruhigt durch die Betroffenheit ihrer Eltern und diese Geheimniskrämerei sowie durch Estas Verhalten. „Sie hat mir nichts gesagt. Ich denke, sie würde sich schämen, wenn sie es getan hätte.“
Julia, die emotional kälter war als Esta oder Clyde, nahm auf konventionelle Weise mehr Rücksicht auf ihre Eltern und war daher trauriger. Zwar verstand sie nicht ganz, was das bedeutete, aber sie ahnte etwas, denn sie hatte gelegentlich mit Mädchen gesprochen, allerdings auf sehr zurückhaltende und konservative Weise. Jetzt aber war es eher die Art und Weise, wie Esta sich entschieden hatte zu gehen, ihre Eltern und ihre Brüder und sich selbst im Stich zu lassen, die sie wütend auf sie machte, denn warum sollte sie etwas tun, das ihre Eltern auf diese schreckliche Weise in Bedrängnis bringen würde? Es war schrecklich. Die Luft war voller Elend.
Und während seine Eltern in ihrem kleinen Zimmer redeten, grübelte Clyde auch, denn er war jetzt sehr neugierig auf das Leben. Was hatte Esta wirklich getan? War es, wie er befürchtete und dachte, eine dieser schrecklichen Flucht- oder sexuell unangenehmen Angelegenheiten, über die die Jungs auf der Straße und in der Schule immer heimlich redeten? Wie beschämend, wenn das wahr wäre! Sie könnte nie wieder zurückkommen. Sie war mit einem Mann gegangen. Da war zweifellos etwas nicht in Ordnung, jedenfalls für ein Mädchen, denn alles, was er jemals gehört hatte, war, dass alle anständigen Kontakte zwischen Jungen und Mädchen, Männern und Frauen, nur zu einer Sache führten – zur Ehe. Und jetzt hatte Esta, zusätzlich zu all ihren anderen Problemen, auch noch das getan. Sicherlich war ihr Familienleben jetzt ziemlich düster, und es würde wegen dieser Sache noch düsterer werden statt heller.
Bald kamen die Eltern heraus, und dann sah Frau Griffiths, wenn auch immer noch ernst und zurückhaltend, doch irgendwie ein wenig anders aus, vielleicht weniger wild, eher hoffnungslos resigniert.
„Esta hat es für richtig gehalten, uns für eine Weile zu verlassen“, war alles, was sie zunächst sagte, als sie die neugierig wartenden Kinder sah. „Nun, macht euch keine Sorgen um sie und denkt nicht weiter darüber nach. Sie wird nach einer Weile zurückkommen, da bin ich mir sicher. Sie hat sich aus irgendeinem Grund entschieden, für eine Weile ihren eigenen Weg zu gehen. Der Wille des Herrn soll geschehen.“ („Gepriesen sei der Name des Herrn!“, warf Asa ein.) „Ich dachte, sie wäre hier bei uns glücklich, aber anscheinend war sie es nicht. Sie muss wohl etwas von der Welt sehen wollen.“ (Hier fügte Asa ein weiteres „Tst! Tst! Tst!“ ein.) „Aber wir dürfen keine harten Gedanken hegen. Das bringt jetzt nichts – nur Gedanken der Liebe und Güte.“ Doch sie sagte dies mit einer Strenge, die irgendwie im Widerspruch dazu stand – ein Klicken in der Stimme, sozusagen. „Wir können nur hoffen, dass sie bald erkennt, wie töricht und unüberlegt sie gehandelt hat, und zurückkommt. Auf dem Weg, den sie jetzt eingeschlagen hat, kann sie nicht glücklich werden. Das ist nicht Gottes Weg und Wille. Sie ist zu jung und hat einen Fehler gemacht. Aber wir können ihr vergeben. Das müssen wir. Wir müssen ihr mit offenem Herzen begegnen, sanft und liebevoll.“ Sie redete, als würde sie vor einer Versammlung sprechen, aber mit einem harten, traurigen, erstarrten Gesicht und einer harten, traurigen Stimme. „Jetzt geht alle ins Bett. Wir können jetzt nur beten und hoffen, morgens, mittags und abends, dass ihr nichts Schlimmes passiert. Ich wünschte, sie hätte das nicht getan“, fügte sie hinzu, ganz im Widerspruch zu dem Rest ihrer Aussage und ohne wirklich an die Kinder zu denken, die anwesend waren – sie dachte nur an Esta.
Aber Asa!
Was für ein Vater, dachte Clyde später oft.
Abgesehen von seinem eigenen Elend schien er nur das noch größere Elend seiner Frau zu bemerken und davon beeindruckt zu sein. Währenddessen hatte er dumm daneben gestanden – klein, grau, zerzaust, unzulänglich.
„Nun, gesegnet sei der Name des Herrn“, warf er von Zeit zu Zeit ein. „Wir müssen unser Herz offen halten. Ja, wir dürfen nicht urteilen. Wir müssen nur auf das Beste hoffen. Ja, ja! Lobet den Herrn – wir müssen den Herrn loben! Amen! Oh ja! Tst! Tst! Tst!“
„Wenn jemand fragt, wo sie ist“, fuhr Frau Griffiths nach einer Weile fort, ohne ihren Mann zu beachten und sich an die Kinder wendend, die sich um sie geschart hatten, „sagen wir, sie sei zu Verwandten von mir nach Tonawanda gefahren. Das ist zwar nicht ganz die Wahrheit, aber wir wissen ja nicht, wo sie ist und was wirklich los ist – und vielleicht kommt sie ja zurück. Also dürfen wir nichts sagen oder tun, was ihr schaden könnte, bis wir es wissen.“
„Ja, Gott sei Dank!“, rief Asa leise.
„Also, wenn jemand fragt, sagen wir das, bis wir mehr wissen.“
„Klar“, warf Clyde hilfsbereit ein, und Julia fügte hinzu: „In Ordnung.“
Frau Griffiths hielt inne und sah ihre Kinder entschlossen und doch entschuldigend an. Asa seinerseits gab erneut ein „Tst! Tst! Tst!“ von sich, und dann wurden die Kinder ins Bett gewunken.
Daraufhin ging Clyde, der wirklich wissen wollte, was in Estas Brief stand, aber aus langjähriger Erfahrung überzeugt war, dass seine Mutter es ihm nicht sagen würde, wenn sie es nicht wollte, wieder in sein Zimmer, denn er war müde. Warum suchten sie nicht weiter, wenn es noch Hoffnung gab, sie zu finden? Wo war sie jetzt – in diesem Moment? In irgendeinem Zug irgendwo? Offensichtlich wollte sie nicht gefunden werden. Wahrscheinlich war sie genauso unzufrieden wie er. Da hatte er noch vor kurzem darüber nachgedacht, selbst wegzugehen, und sich gefragt, wie die Familie darauf reagieren würde, und nun war sie ihm vorausgegangen. Wie würde das seine Sichtweise und sein Handeln in Zukunft beeinflussen? Trotz des Kummers seines Vaters und seiner Mutter konnte er nicht erkennen, dass ihr Weggang eine solche Katastrophe war, jedenfalls nicht aus der Sicht des WEGGEHENS. Es war nur ein weiteres Zeichen dafür, dass hier etwas nicht stimmte. Missionsarbeit war nichts. All diese religiösen Gefühle und Gespräche waren auch nicht so wichtig. Sie hatten Esta nicht gerettet. Offensichtlich glaubte sie, genau wie er, auch nicht so sehr daran.
Kapitel 4
Diese Erkenntnis brachte Clyde dazu, mehr denn je über sich selbst nachzudenken. Und das Wichtigste, was er dabei erkannte, war, dass er etwas für sich tun musste, und zwar schnell. Bis dahin hatte er nur Gelegenheitsjobs gemacht, wie sie alle Jungs zwischen zwölf und fünfzehn so machen: einem Zeitungsausträger während der Sommermonate eines Jahres zu helfen, einen ganzen Sommer lang im Keller eines Gemischtwarenladens zu arbeiten und an Samstagen während einer Zeit im Winter Kisten auszupacken und Waren auszupacken, wofür er die großzügige Summe von fünf Dollar pro Woche erhielt, eine Summe, die ihm damals fast wie ein Vermögen vorkam. Er fühlte sich reich und konnte trotz des Widerstands seiner Eltern, die Theater und Kino nicht nur für weltlich, sondern für sündhaft hielten, gelegentlich ins Kino gehen – auf die Empore –, eine Form der Zerstreuung, die er vor seinen Eltern verheimlichen musste. Doch das hielt ihn nicht davon ab. Er fand, dass er mit seinem eigenen Geld hingehen durfte; auch seinen jüngeren Bruder Frank mitnehmen, der gerne mitkam und nichts sagte.
Später im selben Jahr, als er die Schule verlassen wollte, weil er sich schon sehr im Rückstand fühlte, bekam er eine Stelle als Assistent eines Sodawasserverkäufers in einer der billigeren Drogerien der Stadt, die an ein Theater grenzte und nicht wenig Kundschaft dieser Art hatte. Ein Schild mit der Aufschrift „Junge gesucht” weckte sein Interesse, da es direkt auf seinem Weg zur Schule lag. Später, im Gespräch mit dem jungen Mann, dessen Assistent er werden sollte und von dem er das Handwerk lernen sollte, wenn er bereit und geschickt genug war, erfuhr er, dass er, wenn er diese Kunst beherrschte, bis zu fünfzehn oder sogar achtzehn Dollar pro Woche verdienen könnte. Es ging das Gerücht um, dass Stroud an der Ecke 14th Straße und Baltimore Straße zwei seiner Angestellten so viel zahlte. Das Geschäft, in dem er sich bewarb, zahlte nur zwölf Dollar, was dem üblichen Gehalt an den meisten Orten entsprach.
Aber um diese Kunst zu erlernen, brauchte man, wie er nun erfuhr, Zeit und die freundliche Hilfe eines Experten. Wenn er hierherkommen und zunächst für fünf Dollar arbeiten wolle – na gut, für sechs, da er so niedergeschlagen aussah –, könnte er bald damit rechnen, viel über die Kunst des Mixens süßer Getränke und des Verzieren einer großen Auswahl an Eissorten mit flüssigen Süßigkeiten zu lernen, um daraus Eisbecher zuzubereiten. Vorläufig bedeutete die Lehre, alle Maschinen und Geräte dieser speziellen Theke zu waschen und zu polieren, ganz zu schweigen davon, dass er um sieben Uhr morgens den Laden öffnen und ausfegen, Staub wischen und die Bestellungen ausliefern musste, die der Besitzer dieser Drogerie ihm auftrug. In ruhigen Momenten, wenn sein direkter Chef – ein Herr Sieberling, zwanzig Jahre alt, schneidig, selbstbewusst und gesprächig – zu beschäftigt war, um alle Bestellungen zu erledigen, konnte er aufgefordert werden, kleinere Getränke wie Limonaden, Coca-Cola und Ähnliches zu mixen, wie es der Handel verlangte.
Doch nach reiflicher Überlegung mit seiner Mutter entschied er sich, diese interessante Stelle anzunehmen. Zum einen würde sie ihm, wie er vermutete, kostenlos alle Eiscreme-Limonaden verschaffen, die er wollte – ein nicht zu verachtender Vorteil. Zum anderen war sie, wie er es damals sah, eine offene Tür zu einem Beruf, der ihm fehlte. Außerdem, und das sah er überhaupt nicht als Nachteil an, musste er in diesem Laden bis zwölf Uhr nachts arbeiten, dafür hatte er tagsüber bestimmte Stunden frei, um das auszugleichen. Und so war er abends nicht mehr zu Hause – endlich nicht mehr Teil der Zehn-Uhr-Jungen. Sie konnten ihn nicht bitten, an Versammlungen teilzunehmen, außer sonntags, und selbst dann nicht, da er sonntagnachmittags und -abends arbeiten musste.
Außerdem bekam der Verkäufer, der diese spezielle Soda-Bar bediente, regelmäßig Freikarten vom Manager des Kinos nebenan, in dessen Foyer eine Tür zur Drogerie führte – eine für Clyde äußerst faszinierende Verbindung. Es schien ihm so interessant, für eine Drogerie zu arbeiten, die so eng mit einem Kino verbunden war.
Und das Beste daran war, wie Clyde nun zu seiner Freude, aber manchmal auch zu seiner Verzweiflung feststellte, dass der Laden kurz vor und nach den Matinee-Vorstellungen von Scharen von Mädchen besucht wurde, allein oder in Gruppen, die an der Theke saßen, kicherten und plauderten und vor dem Spiegel ihren Frisuren und ihrem Make-up den letzten Schliff gaben. Und Clyde, der noch grün hinter den Ohren und unerfahren im Umgang mit der Welt und dem anderen Geschlecht war, konnte sich gar nicht sattsehen an der Schönheit, der Kühnheit, der Selbstsicherheit und der Liebenswürdigkeit dieser Mädchen, wie er sie sah. Zum ersten Mal in seinem Leben hatte er, während er damit beschäftigt war, Gläser zu spülen, die Eis- und Sirupbehälter zu füllen und die Zitronen und Orangen in den Tabletts zu arrangieren, die Gelegenheit, diese Mädchen aus nächster Nähe zu studieren. Wie wunderbar sie waren! Die meisten von ihnen waren so gut gekleidet und sahen so schick aus – die Ringe, Anstecknadeln, Pelze, entzückenden Hüte und hübschen Schuhe, die sie trugen. Und so oft hörte er, wie sie über so interessante Dinge redeten – Partys, Tanzveranstaltungen, Abendessen, Shows, die sie gesehen hatten, Orte in oder in der Nähe von Kansas City, die sie bald besuchen wollten, die Unterschiede zwischen den Modetrends dieses und des letzten Jahres, die Faszination bestimmter Schauspieler und Schauspielerinnen – vor allem Schauspieler –, die gerade in der Stadt auftraten oder bald kommen würden. Bis zu diesem Tag hatte er zu Hause noch nie etwas davon gehört.
Und oft war eine dieser jungen Schönheiten in Begleitung eines Mannes in Abendanzug, Hemd, Zylinder, Fliege, weißen Handschuhen und Lackschuhen, einer Kleidung, die Clyde damals als Inbegriff von Vornehmheit, Schönheit, Galanterie und Glückseligkeit empfand. So einen Anzug mit solcher Leichtigkeit und Eleganz tragen zu können! Mit einem Mädchen so locker und cool reden zu können wie einige dieser Gecken! Was für eine Leistung! Kein hübsches Mädchen, so schien es ihm damals, würde etwas mit ihm zu tun haben wollen, wenn er nicht über diese Ausstattung verfügte. Es war einfach notwendig – das Ding. Und wenn er es erst einmal erreicht hatte – solche Kleider tragen konnte – nun, dann war er doch auf dem besten Weg zu allem Glück, oder? Alle Freuden des Lebens würden sich dann mit Sicherheit vor ihm ausbreiten. Das freundliche Lächeln! Die heimlichen Händeschütteln, vielleicht – einen Arm um die Taille der einen oder anderen – ein Kuss – ein Heiratsversprechen – und dann, und dann!
Und das alles als ein offenbarender Blitz nach all den Jahren, in denen er mit seinem Vater und seiner Mutter durch die Straßen zu öffentlichen Gebetstreffen gegangen war, in der Kapelle gesessen und seltsamen und unscheinbaren Menschen zugehört hatte – deprimierenden und beunruhigenden Menschen –, die erzählten, wie Christus sie gerettet hatte und was Gott für sie getan hatte. Natürlich würde er jetzt da rauskommen. Er würde arbeiten und sein Geld sparen und jemand werden. Diese einfache und doch idyllische Mischung aus Alltäglichem hatte zweifellos den Glanz und die Faszination einer spirituellen Verwandlung, die wahre Fata Morgana der verlorenen, durstigen und suchenden Opfer der Wüste.
Das Problem mit dieser besonderen Position war jedoch, wie sich schnell herausstellte, dass sie ihm zwar beibringen konnte, wie man Getränke mixt und wie man schließlich zwölf Dollar pro Woche verdient, aber keine sofortige Lösung für die Sehnsüchte und Ambitionen war, die bereits an seinem Innersten nagten. Denn Albert Sieberling, sein direkter Vorgesetzter, war entschlossen, so viel wie möglich von seinem Wissen und die angenehmsten Teile der Aufgaben für sich zu behalten. Außerdem war er ganz der Meinung des Apothekers, für den sie arbeiteten, dass Clyde ihm nicht nur an der Theke helfen, sondern auch alle Besorgungen erledigen sollte, die der Apotheker ihm auftrug, sodass Clyde fast während seiner gesamten Arbeitszeit fleißig beschäftigt war.
Folglich brachte all dies keine unmittelbaren Ergebnisse. Clyde sah keine Möglichkeit, sich besser zu kleiden als bisher. Schlimmer noch, er wurde von der Tatsache verfolgt, dass er sehr wenig Geld und nur sehr wenige Kontakte und Beziehungen hatte – so wenige, dass er außerhalb seines eigenen Zuhauses einsam war und auch dort nicht viel weniger als einsam. Die Flucht von Esta hatte die religiöse Arbeit dort beeinträchtigt, und da sie noch nicht zurückgekommen war, dachte die Familie, wie er jetzt hörte, darüber nach, hier wegzuziehen und mangels einer besseren Idee nach Denver, Colorado, zu ziehen. Aber Clyde war inzwischen überzeugt, dass er sie nicht begleiten wollte. Was hätte das für einen Sinn, fragte er sich? Dort würde es nur eine weitere Mission geben, genau wie diese hier.