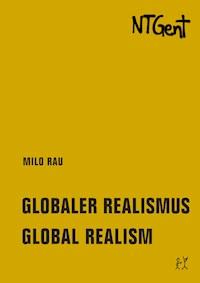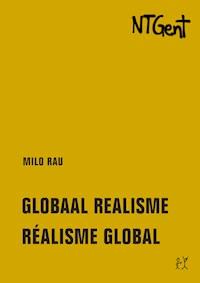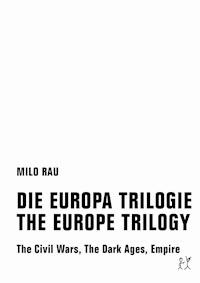19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Alexander Verlag Berlin
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Der Theatererneuerer." Der Spiegel Detailliert legt der "derzeit einflussreichste Regisseur des Kontinents" (Die ZEIT) die komplexen gesellschaftlichen und ästhetischen Herausforderungen offen, die seine politisch-künstlerische Arbeit bestimmen. Milo Rau führt vor, was es künstlerisch bedeutet, mit größter Konsequenz dem "weitumspannenden Innenraum des Kapitals, seinen Alpträumen und Hoffnungen, seinen Unter- und Gegenwelten" nachzuspüren und eine Antwort darauf zu finden – etwa in Gestalt seines ästhetischen Leitmodells eines künstlerischen "globalen Realismus". Das Buch basiert auf Milo Raus Vorlesungen im Rahmen der 6. Saarbrücker Poetikdozentur für Dramatik.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Kritiker bezeichnen ihn als den »einflussreichsten« (DIE ZEIT), »meistausgezeichneten« (Le Soir), »interessantesten« (De Standaard), »umstrittensten« (La Repubblica) oder »ambitioniertesten« (The Guardian) Künstler unserer Zeit: den Schweizer Regisseur und Autor Milo Rau (*1977), seit der Saison 2018/19 künstlerischer Leiter des NTGent.
Rau studierte Soziologie, Germanistik und Romanistik in Paris, Berlin und Zürich u. a. bei Pierre Bourdieu und Tzvetan Todorov. Seit 2002 veröffentlichte er über fünfzig Theaterstücke, Filme, Bücher und Aktionen. Seine Produktionen waren bei allen großen internationalen Festivals zu sehen (u. a. Berliner Theatertreffen, Festival d’Avignon, Biennale Venedig, Wiener Festwochen, Brüsseler Kunstenfestivaldesarts) und tourten bereits durch über dreißig Länder weltweit. Rau hat viele Auszeichnungen erhalten, zuletzt den Peter-Weiss-Preis 2017, den 3sat-Preis 2017, die Saarbrücker Poetikdozentur für Dramatik 2017 und 2016 als jüngster Künstler nach Frank Castorf und Pina Bausch den renommierten ITI-Preis des Welttheatertages. 2017 wurde Milo Rau bei der Kritikerumfrage der Deutschen Bühne zum »Schauspielregisseur des Jahres« gewählt, 2018 erhielt er den Europäischen Theaterpreis. Raus Filme wurden mit vielen Preisen ausgezeichnet (u. a. dem Zürcher Filmpreis und dem Amnesty International Prize) und u. a. für den Deutschen und den Schweizer Filmpreis nominiert. Rau ist auch Fernsehkritiker, Dozent und ein überaus produktiver Schriftsteller.
Johannes Birgfeld, geb. 1971, ist nach Lehrtätigkeiten in Bamberg, Sewanee (TN/USA) und Oxford Studiendirektor i. H. an der Universität des Saarlandes für Neuere deutsche Literaturwissenschaft und Initiator der Saarbrücker Poetikdozentur für Dramatik. Forschungen zur deutschsprachigen Literatur vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart.
Milo Rau
Das geschichtlicheGefühl
Wege zu einem globalen Realismus
Saarbrücker Poetikdozentur für Dramatik
Herausgegeben und mit einem Essayvon Johannes Birgfeld
In dieser Reihe sind bereits erschienen:
Albert Ostermaier: Von der Rolle oder: Über die Dramatik des Verzettelns
She She Pop: Sich fremd werden. Beiträge zu einer Poetik der Performance
Falk Richter: Disconnected. Theater Tanz Politik
Gedruckt mit finanzieller Unterstützung der Fachrichtung Germanistik an der Universität des Saarlandes.
Die Transkription der Vorträge von Milo Rau erfolgte durch Rolf Bossart. Wir danken Stefan Bläske, Daniel Seiffert und Markus Tomsche für die großzügige Einräumung der Abdruckrechte für ihre Fotografien sowie Yven Augustin für die vielfältige freundliche Unterstützung.
Originalausgabe
© by Alexander Verlag Berlin, 2019
Alexander Wewerka, Fredericiastr. 8, 14050 Berlin
www.alexander-verlag.com | [email protected]
Alle Rechte vorbehalten.
Satz und Layout: Antje Wewerka
Umschlaggestaltung: Antje Wewerka
Umschlagfoto: IIPM/Thomas Müller
Schlusslektorat: Christin Heinrichs-Lauer
Korrektorat: Sophie Jaede
ISBN 978-3-89581-508-9 (eBook)
Vorwort
»Das ist der Grund, warum es die Kunst gibt«
Milo Rau im Gespräch mit Rolf Bossart
Erste Vorlesung
Das geschichtliche Gefühl
Zweite Vorlesung
Über das Erscheinen
Dritte Vorlesung
Der symbolische Akt
»Man muss neue, utopische Institutionen vorbereiten«
Milo Rau im Gespräch mit Harald Welzer
Anmerkungen zu den Vorlesungen und Gesprächen
Milo Raus Theater der Revolution
Mimesis, Immersion und Transzendenz, Tragödie und globaler Realismus
Johannes Birgfeld
Danksagung
VORWORT
Ich habe die folgenden Vorlesungen im Mai 2017 an drei Abenden in Saarbrücken gehalten. Sie beinhalten einen Überblick über ziemlich genau zehn Jahre meiner Arbeit: vom Jahr 2007 – als ich im Alter von dreißig Jahren das IIPM (International Institute of Political Murder) gründete1 – bis ins Jahr 2017, als ich zum Intendanten des NTGent (Nederlands Toneel Gent) in Belgien ab der Saison 2018/19 berufen wurde.
Auf Arbeiten vor 2007 – etwa die Pynchon-Verfilmung Paranoia Express (2002) oder die Trilogie Dämonen (UA 2005, Berlin, HAU), Amnesie (UA Juni 2005, Berlin, Theaterdiscounter) und Bei Anruf Avantgarde (UA 2005, Berlin, Sophiensæle) – gehe ich nicht ein. Ebenso wenig auf das, was nach diesen Vorlesungen geschehen ist: die Gründung des ersten Weltparlaments, der General Assembly vom 3.– 5. November 2017 in Berlin,2 (die im Juni 2019 zum zweiten Mal in Brasilien stattfinden wird), das Historien-Stück Lenin an der Schaubühne in Berlin (UA 19. 10. 2017), die Performance Der Sturm auf den Reichstag (07. 11. 2017, Berlin), die Video-Installation Lam Gods/Der Genter Altar am NTGent (UA 28. 09. 2018) und vor allem Die Wiederholung, das erste Stück, das ich gemäß dem »Genter Manifest«3 im Mai 2018 am Théâtre National Brüssel inszeniert habe (UA 04. 05. 2018).
Um diese Lücken ein wenig zu füllen, habe ich das Buch um zwei Gespräche ergänzt: Das erste habe ich im Juni 2013 mit dem Philosophen Rolf Bossart geführt, im Vorfeld zur Ausstellung Die Enthüllung des Realen in den Berliner Sophiensælen.4 Es fasst auf eine spielerische Weise den damaligen Stand meiner Überlegungen zu Theater und Realismus zusammen. Das zweite Gespräch entstand im Herbst 2017, in Vorbereitung der General Assembly, mit dem Soziologen Harald Welzer am Rande der Proben zu Lenin. Es dreht sich um zwei Themen, die mich aktuell sehr interessieren: erstens die Möglichkeiten der Gründung dessen, was ich symbolische Institutionen nenne, die ich zuerst in meinem Projekt Das Kongo Tribunal (2015/17)5 und dann noch einmal in der General Assembly unternommen habe; sowie zweitens, was ich nun am NTGent im Rahmen eines Stadttheaters mit drei Bühnen zu institutionalisieren versuche: ein genauso utopisches wie völlig reales »Theater der Zukunft«.
Denn vielleicht ist das Theater nichts anderes: ein Ort, an dem das Tatsächliche und das Imaginäre aufeinandertreffen, und zwar nicht hypothetisch, sondern in völliger Präsenz. Oder um es mit einem Zitat von George Steiner aus Von realer Gegenwart6 zu sagen: »Ich glaube, dass diese Fähigkeit, alles zu sagen und zu widersagen, Raum und Zeit zu konstruieren und zu dekonstruieren, Nicht-Tatsächliches zu ersinnen und auszusprechen, den Menschen zum Menschen macht.«
Die nachfolgend abgedruckten ›Vorlesungen‹ sind leicht überarbeitete Transkriptionen meiner jeweils rund 60-minütigen Abendvorträge im Rahmen der 6. Saarbrücker Poetikdozentur für Dramatik 2017.7 Die Vorlesungen wurden, auch wenn sie systematisch und bewusst für Menschen angelegt sind, die nichts über meine Arbeit wissen, freisprechend gehalten. Sie sind deshalb auf eine Weise, die mich beim Lesen amüsiert hat, gleichzeitig sehr strukturiert und recht assoziativ, an gewissen Stellen auch vielleicht etwas redundant. Nur manchmal habe ich ein Zitat abgelesen, meistens zitiere oder referiere ich aus der Erinnerung, man mag die Ungenauigkeiten bitte entschuldigen. Meistens aber handelt es sich um Auszüge aus den Stücken oder aus Gesprächen, die ich, wie die Gespräche mit Bossart oder Welzer, während der Arbeit an den besprochenen Stücken und Projekten geführt habe. Ich hoffe, das Folgende macht Sinn und ist nachvollziehbar.
Milo Rau, August 2018, Köln/Gent
Mai 2013
»DAS IST DER GRUND, WARUM ES DIE KUNST GIBT«
Milo Rau im Gespräch mit Rolf Bossart
Rolf Bossart: Du hast im selben Alter Trotzki und Lenin gelesen, in dem andere Kinder Die Schatzinsel verschlingen. Dann bist du mit neunzehn Jahren auf Reportage in den lakandonischen Urwald Mexikos zu den Zapatisten und hast deinen ersten Essay (Langues et Langages de la Révolution)8 veröffentlicht. Kaum warst du wieder zurück in Europa, hast du begonnen, an der Universität Zürich Großdemonstrationen gegen den damals im Bildungssektor verschärft einsetzenden neoliberalen Rückbau zu organisieren. Hilft dieser Bezug auf die Jugend, um die Dinge, die du jetzt tust, zu verstehen? Was davon ist wichtig geworden?
Milo Rau: Das meiste. Aus der Perspektive der existenzialistischen Psychoanalyse würde ich sagen, dass man sich in den Teenagerjahren selber entwirft und dass man diesem Entwurf dann auch nicht mehr entkommt. Das ist, neben allem Zufälligen und Fatalen, das Moment der Freiheit im Menschen. Bestimmte Bücher bewusst zu lesen, auch wenn es anstrengend ist; bestimmte Reisen zu unternehmen, auch wenn sie in irgendeinem deprimierenden Militärlager im Urwald oder im Gefängnis enden; den Kampf aufzunehmen, wo man ihn findet. Wobei das ein dialektischer Prozess ist: Ich habe ja mit sechzehn, siebzehn Jahren nicht nur Lenin gelesen, sondern auch Tarantino geguckt, wie alle, die zu meiner Generation gehören. Ich bin neben meinen offensichtlich politischen Positionen ein geradezu extrem unpolitischer Mensch, ein völlig pedantischer Formalist. Nach meiner Arbeit als Veranstalter von Demonstrationen und Chiapas-Reisender habe ich ein paar Jährchen des L’art pour l’art eingelegt und zum Beispiel eine finanziell verheerende, geradezu lächerlich postmoderne Pynchon-Adaption gedreht (Paranoia Express, 2002) – doch parallel dazu habe ich ernsthafte Kritiken für die Neue Zürcher Zeitung geschrieben und Soziologie studiert. Auch später ist es irgendwie immer durcheinandergegangen: Auf Amnesie (2005), eine völlig realistische, wenn auch aktualisierende Gontscharow-Bearbeitung, folgte Bei Anruf Avantgarde (2005), ironischer Meta-Agitprop. Und so ging es weiter bis heute: Direkt nach einer Aktion wie der City of Change (2010–11) kam ein sehr klassisch geschriebenes und inszeniertes Stück wie Hate Radio (2011). Es ist eine Art Charakterschwäche von mir, mir ständig selbst in den Rücken zu fallen.
Eine Charakterschwäche, mit der du ja sehr offensiv umgehst. Das Motto auf deinem Blog althussers-haende.org9 ist ein Pasolini-Zitat: »Ich weiß sehr wohl, wie widersprüchlich man sein muss, um wirklich konsequent zu sein.« Aber was all deine Unternehmungen doch irgendwie auf einen Nenner bringt, ist deine Art des – im Sinne des Ethnologen Clifford Geertz – »dichten Beschreibens«. Du bleibst nie in ästhetischer Halbdistanz, sondern bist immer sehr nah am Gegenstand.
»Dichtes Beschreiben«, das gefällt mir. Mich interessiert als Künstler in erster Linie eine völlig praktische, völlig reale Involviertheit, ganz egal, ob sich das auf Iwan Alexandrowitsch Gontscharow, ein Videogramm, eine zentralafrikanische Radiostation, eine politische Grundsatzfrage oder auf ein theoretisches Problem bezieht. Seit ich denken kann, war ich geradezu hypnotisiert von dieser Idee, dabei zu sein – in die Dinge, Bücher und Länder, für die ich mich interessiert habe, wirklich einzutauchen, sie tatsächlich zu bearbeiten. Nach der Gontscharow-Adaption habe ich eine Adaption von Euripides’ Bakchen (Montana, 2007) gemacht, die das Original derart vollständig transformiert hat, dass der Zuschauer nicht die geringste Chance hatte, die Vorlage zu erkennen (von der nur ein halber Satz übrig geblieben war). Ich kann diese Leute, die Texte mit dem Leuchtstift anstreichen und sie dann von ihren Schauspielern in dieser oder jener Verrenkung aufsagen lassen, nicht verstehen. Um auf Lenin zurückzukommen: Als ich dreizehn war, da habe ich mich für Russland interessiert, also habe ich Russisch gelernt, nicht allzu ausdauernd, aber ich wollte jemand sein, der in dieser mythisch-politischen Welt tatsächlich Fuß fassen kann – in diesem »frohlockenden und blutschwitzenden Russland«, wie der Dichter Alexander Blok so hübsch sagt. Und als ich dann 2010 begonnen habe, nach Moskau zu fahren, da habe ich fast zwei Jahre gebraucht, bis ich auf die Idee mit den Moskauer Prozessen (2013) gekommen bin. Denn das ist der Nachteil meiner Arbeitsweise: Es ist eine Dialektik von Vorstellen und Begreifen, von Ideen und völlig konkreten Umsetzungen, die sehr langwierig ist. Deshalb gibt es ständig Neukonzeptionen, was das Arbeiten z. B. für meinen Bühnenbildner Anton Lukas sehr anstrengend macht. Und genauso wie bei den Moskauer Prozessen ging es mir mit Hate Radio, mit Die letzten Tage der Ceauçescus (2009), aber auch bei Adaptionen von Autoren wie Euripides oder Pynchon. Am Anfang steht immer dieser obsessive Wunsch, in die soziale und materielle, ja: in die phantasmagorische Bedeutungsdichte von etwas einzudringen.
Du brauchst in älteren Interviews ab und zu den Begriff der »sozialen Phantasie« oder der »sozialen Plastik«, allerdings in einem völlig anderen Sinn als Joseph Beuys. Wie sind diese Begriffe genau gemeint?
Ich gehöre ja zu einer Generation, die von den Ekstasen einer, sagen wir mal, analytischen Phantasie überfüttert wurde. Die einzige Sache, die ich im Gymnasium und dann im Studium immer wieder gelernt habe, ist die, dass man kritisch sein soll: Intelligenz, das hieß, bestehende Erzählungen, bestehende Wirklichkeitsentwürfe zu analysieren und zu zerlegen – und dann, wurde man Künstler, ein wenig daran zu leiden oder eben je nach ästhetischem Ansatz drüber- oder danebenzustehen. Die soziale Phantasie ist nun das Gegenteil davon: Sie ist aktiv, sie hat einen Realisierungsdrang, sie will die ganze Welt auf einmal umarmen, und vor allem will sie sie verändern. Man kann das sehr gut an der zapatistischen Revolution zeigen, einer großformatigen sozialen Plastik. Sie hat ohne eine ernst zu nehmende Streitmacht, ohne Großmächte im Hintergrund und ohne das Anzapfen bereits vorhandener politischer Bewegungen oder Theorien funktioniert. Man kennt ja von Medienbildern diese Soldaten mit den Holzgewehren: Damit sind die Zapatisten sprichwörtlich aus dem Nichts, versteckt unter Skimasken, am 1. Januar 1994 in San Cristóbal aufgetaucht. Sehr geschickt haben sie sich dann als die Namen- und Gesichtslosen inszeniert, die Majas aus dem Urwald, die wahren Mexikaner – und gleichzeitig der Regierung gesagt: Wir sind globalisierter als ihr, urbaner, universeller. Wir sind die Zukunft der Menschheit, nicht ihr! Diese völlig machiavellistische Wendung des postmodernen Eklektizismus, diese kämpferische Form erhöhter sozialer Intelligenz, dieser aggressive Konstruktivismus ist für mich sehr entscheidend geworden. Du kannst tun, was du willst, nur muss es wahr werden, es muss real werden. Analyse allein reicht nicht.
Soziale Phantasie heißt also: Man eignet sich die bestehenden Diskurse an, formatiert sie, radikalisiert sie, führt sie eng und stellt sie in einen Raum, in dem plötzlich wieder völlig offen ist, was sie bedeuten.
Genau. Eine soziale Plastik, wie ich sie verstehe, bedeutet »angewandter Surrealismus«, wie der Leiter des Moskauer Sacharow-Zentrums meine Moskauer Prozesse genannt hat. Theater ist nichts anderes als die völlig konkrete Rückbesinnung auf diese ganz simple aristotelische Tatsache: dass alles, was wir für real erachten, nichts anderes ist als eine soziale Verabredung. Klar, das ist eine Erkenntnis aus dem Soziologie-Proseminar. Aber Spielen oder Inszenieren, wie ich es verstehe, bedeutet, die im Normalfall einfach als natürlich und zwingend hingenommene Wirklichkeit nicht analytisch oder ironisch aufzulösen, sondern sie in all ihren Konsequenzen zur Erscheinung zu bringen, sie in Aktion zu zeigen. Das ist ja der Grund, warum Theater überhaupt als Kunstform entwickelt wurde: als Umgang mit dieser zugleich natürlichsten und phantastischsten Fähigkeit des Menschen, nämlich aus dem sozial Imaginären Realität zu schaffen. Wenn mich einige als Dokumentarist bezeichnen, so basiert das auf einem Missverständnis. Denn was man auf einer Bühne tut, ist grundsätzlich das Gegenteil von Dokumentieren – es sei denn, Seiltanz ist dokumentarisch, weil die Erdanziehungskraft dokumentiert wird. Mein Stück Hate Radio zum Beispiel hat mit dem historischen RTLM etwa so viel zu tun wie die bewaffneten »Majas« der Zapatisten mit den an der Grenze zur totalen Armut lebenden indigenen Kleinbauern Südmexikos, die sich hinter den Skimasken verstecken. Das historische RTLM war, nach heutigem Maßstab, zum Sterben langweilig und langfädig, das waren bis auf einige Momente ziemlich biedere Angestellte des Genozids. Und wenn die Medien berichteten, ich hätte in Moskau den Pussy-Riot-Prozess nachgespielt, so ist genau das Gegenteil wahr: Meine Moskauer Prozesse führten das auf, was in der russischen Wirklichkeit unmöglich gespielt werden kann.
Besteht hier nicht die Gefahr der Beliebigkeit, ja der Geschichtsfälschung?
Absolut. Ich glaube aber, gerade weil es keine dokumentarische Wahrheit gibt, jedenfalls nicht im wirklichen Leben, braucht es die Kunst – die so etwas wie eine künstlerische Wahrheit schaffen kann. Wie ich ja öfters in anderen Interviews erzählt habe, sprechen meine Figuren in Hate Radio unter anderem mit den Worten des heutigen ruandischen Oberbefehlshabers. Ganze Dialoge und Charaktere habe ich erfunden, und dass im RTLM tatsächlich Nirvana gespielt wurde wie in meinem Hate Radio, ist ungefähr genauso unwahrscheinlich und übrigens unnötig, wie dass Madame Bovary tatsächlich in Frankreich gelebt hat. Darum geht es in der Kunst nicht. Worum es geht, ist, dass man bereit ist, dafür den Preis zu zahlen. Ich kann dir sagen, meine Schauspieler und ich, wir haben Blut geschwitzt vor der Uraufführung in Kigali; und wir waren natürlich extrem erleichtert, als die ruandischen Zuschauer sagten: »Genau so war es!« – obwohl wir nicht ganz verstanden haben, was sie damit meinten, denn »genau so« war es ja gerade nicht gewesen. Und das unterscheidet eben das, was ich zu tun versuche, von allen Formen der Beliebigkeit, die sich in diesem grässlich bequemen Theaterbegriff des »Probierens« gehalten hat. Man soll nicht probieren in der Kunst, man soll wetten. Einige der Zapatisten wurden erschossen, als sie Revolution spielten. Die Schauspieler in Hate Radio mussten sehr, wirklich sehr lange »üben«, um über den Tod einer Million Menschen lachen zu können – aus innerstem Herzen. Und als wir nach Ruanda flogen, um im ehemaligen Sendestudio on air zum Massenmord aufzurufen, da hatten wir solche Angst, als gingen wir sprichwörtlich aufs Schlachtfeld.
Das erinnert mich an die Grundvoraussetzung für die psychoanalytische Suche nach dem realen Ding, die Wilfred Bion nennt: »No memory, no desire, no understanding.« Kannst du in Bezug auf deine Arbeit die Differenz zwischen dem bloß Realität vorspielenden und dem Realität bildenden Als-ob noch etwas spezifizieren?
Kürzlich war ich auf der Premiere eines Stücks, das auf Interviews basierte, die die Künstler mit Leuten auf der Straße geführt hatten. Es war eine typische zeitgenössische Regiearbeit, der Text hätte auch von Ibsen oder Sarah Kane sein können: Es gab ein Bühnenkonzept, das schauspielerisch als eine Art Hindernislauf funktionierte, es gab ironische und ernste, stille und laute Momente, irgendwann wurde ein Lied gesungen, das Licht änderte sich ab und zu, und am Ende versuchte einer der Schauspieler, sich mit einem Seil in den Bühnenhimmel zu ziehen. Worauf ich damit hinauswill: Normalerweise ist Theaterkunst eine mehr oder weniger gut funktionierende Gemeinschaft von Handwerkern. Die einen können Texte variabel sprechen, andere können sie zusammenmontieren, und die Dritten wissen, wie man das Ganze beleuchtet – und der Regisseur übernimmt eben irgendwie die Verantwortung und versucht, seine drei, vier Zauberkunststücke, seinen idiosynkratischen Stil unterzubringen. Aber Theater muss ein Akt sein, es muss eine Schwierigkeit darin bestehen, ihn zu vollführen – keine technische, sondern eine reale, eine existenzielle. Theater heißt, wie ich es verstehe: eine Situation der Entscheidung herzustellen. Wenn Anna Stavickaja, die Verteidigerin der Künstler in den historischen Vorbild-Prozessen, in meinen Moskauer Prozessen die Verfahren, die sie allesamt verloren hat, noch einmal verhandelt, dann weiß sie, dass ihre Karriere vorbei ist, wenn sie wieder verliert. Das Ehepaar Ceauşescu in den Letzten Tagen der Ceauşescus eben nicht ironisch zu spielen, sich in Hate Radio vor die Überlebenden eines Genozids zu stellen und ihnen noch einmal willentlich diesen unerträglichen, unverständlichen Schmerz zuzufügen – das ist eine fast untragbare Verantwortung für einen Künstler. Und ich sage nicht, hör zu, ich bin der Regisseur, wir werden jetzt zusammen einen Dreh suchen, dass es für niemanden mehr ein Problem ist; du sprichst das jetzt ein wenig augenzwinkernd. Nein, mein Verständnis von sozialer Plastik ist es, den Künstlern, mit denen ich arbeite, einen öffentlichen Ort zu verschaffen, an dem sie gezwungen sind, die volle Verantwortung für das, was sie da tun, zu übernehmen. Einen tragischen Ort, um es etwas altertümlich zu formulieren.
Ein anderer Begriff, den du gern verwendest, ist die »heroische Öffentlichkeit« – eine Öffentlichkeit, in der der Künstler nicht bloß privat oder als Profi, sondern tatsächlich als Mensch, völlig real und politisch im Jetzt gefordert ist. In Hate Radio wurde das besonders deutlich, weil es bei den ruandischen Schauspielern starke Interferenzen gab zwischen ihrer Biographie, ihrem Selbstverständnis als Schauspieler und der Art, wie die Medien damit umgegangen sind.
Ja, am Anfang haben viele Kritiker von »Laien« oder »Experten« gesprochen. Dabei ist allein schon mein Text, den sie memorieren müssen, derart komplex, dass das für eine nicht ausgebildete Person nie zu schaffen wäre. Aber dass ein Schwarzer, der auch noch einen Massenmord überlebt hat, also quasi das prototypische postkoloniale Opfer – dass so ein Mensch den unfassbar schwierigen dialektischen Drahtseilakt schafft, als Darsteller eines Täters und als Überlebender eines Genozids auf der Bühne zu stehen, und das Ganze völlig entspannt gewissermaßen, also ohne dazwischen gesampelte Übersprunghandlungen: Das war einfach nicht zu verstehen.
Die Schwierigkeit, oder besser: Der Akt war für sie, zugleich als die, die sie fatalerweise sind, und die, die etwas ganz anderes tun, auf der Bühne zu stehen?
Absolut richtig, und zwar ohne sich das anmerken zu lassen. Das klassische Angebot in der mitteleuropäischen Erinnerungskultur wäre die Überhöhung der Tatsache, ein Übriggebliebener zu sein, was jede künstlerische Distanzierung zum selber Erlebten obsolet machen würde. Oder man ist Profi und steht in feiner ironischer Distanz neben dem, was man nun mal ist (oder was man glaubt zu sein), man bringt die eigene Biographie in analytische Schwingung. Das alles ist für mich erledigt, überholt, ja, ich glaube nicht, dass das tatsächlich noch jemanden interessiert. Ich war letzthin mit Hate Radio auf dem Festival d’Avignon, das 2013 einen Afrikaschwerpunkt hatte. Ich habe mir dort mit Nancy Nkusi, der weiblichen Hauptdarstellerin, ein schreckliches Stück angeguckt, in dem kongolesische Künstler auf eine sehr seltsame Weise »Kongolesen« spielten: Sie tanzten, waren poetisch und leidenschaftlich – und gleichzeitig haben sie sich über diesen völlig fatalen Congolese Touch lustig gemacht. Meine Darstellerin, eine geborene Ruanderin, sagte nur leise: »Warum tun die das? Was, verdammt noch mal, ist mit diesen Leuten bloß los?« Und tatsächlich: Warum tun wir das alle, warum spielen wir uns was vor? Übrigens kenne ich das als Schweizer sehr gut, denn ebenso, wie es ein kongolesisches Theater gibt, gibt es auch ein schweizerisches, ein polnisches, ein russisches und so fort. Dieser pseudokritische, völlig folgenlose Authentizitäts- und Ironie-Marathon: Die Schwierigkeit besteht darin, sich dem zu entziehen, ohne zynisch zu werden. Und das kann eben nur mit ganzem Einsatz gelingen: Wenn man mit der Gewissheit auf der Bühne steht, dass die eigenen Spielakte den Diskurs, die symbolische Ordnung oder auch die Geschichte der Menschheit irgendwie verschieben können. Wenn man wirklich die Verantwortung übernimmt. Als ich für Die letzten Tage der Ceauşescus in Rumänien gecastet habe, habe ich mich ganz bewusst für die in Rumänien bekanntesten Fernseh- und Filmschauspieler entschieden. Also für Leute, die gewaltige Übung darin hatten, »den Ceauşescu« zu spielen – und für die es eine Herausforderung, ein berufliches Risiko und rein schauspieltechnisch fast eine Unmöglichkeit war, ihm (und ihren eigenen Erinnerungen an ihn) noch einmal neu zu begegnen.
Man könnte in einem bestimmten Jargon das, was du tust, auch als Erinnerungsarbeit bezeichnen. Es gibt aber diesen Satz von dir, ich glaube, das war in einem der Gespräche, die du mit Friedrich Kittler für Die letzten Tage der Ceauşescus geführt hast10: Erinnerung ist nicht möglich …