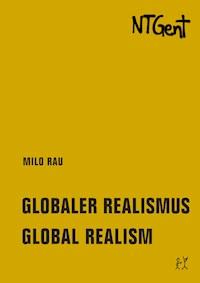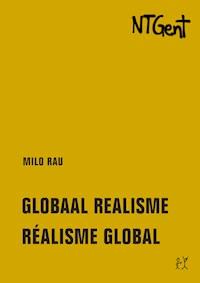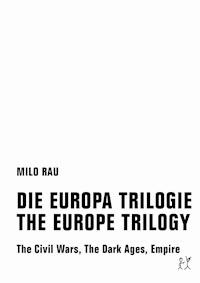19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Zukunft ist düster. Was können, was müssen wir tun? Milo Rau über Stillstand, Protest und Engagement. In unserem Zeitalter der «totalen Gegenwart» wird die Welt nur noch als kritisierbar, nicht aber mehr als veränderbar wahrgenommen. Welche grenzüberschreitenden Protestformen erscheinen noch gerechtfertigt, wenn die Realität eh alternativlos ist? Wie wir gegen die gefühlte Untergangsstimmung angehen können, zeigt Milo Rau in seinem neuen Buch. Entlang seiner Erfahrungen als Regisseur und Aktivist spricht er darüber, wie sich die Zukunft zurückerobern lässt. In seinem radikalen Essay macht er sich auf die Suche nach neuen Formen des Denkens, Fühlens und kollektiven Handelns. Eins ist klar: Die bestehende Ordnung muss gestört werden, nachhaltig, ausdauernd, immer wieder. Überarbeitete Buchausgabe der Zürcher Poetikvorlesung 2022. «Milo Rau ist ein Genie.» Die Welt «Milo Rau ist einer der unerbittlichsten und klügsten Kritiker unserer Zeit: ein Visionär.» Jean Ziegler «Für mich hat Milo Raus Werk in seiner Aktualität, seiner unmittelbaren Wirkung und dem Erfahren von Menschlichkeit eine Bedeutung, die jede Shakespeare-Inszenierung übertrifft.» Sibylle Berg
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 141
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Milo Rau
Die Rückeroberung der Zukunft
Ein Essay
Über dieses Buch
Die Menschheit sieht sich einem grotesken Finanzkapitalismus gegenüber sowie Krieg und Klimakrise. Die Zukunft ist düster. Was können wir tun? Was müssen wir tun? Milo Rau ist Experte, wenn es um Praktiken des Widerstands geht. Sein Credo: Die bestehende Ordnung muss gestört werden, nachhaltig, ausdauernd, immer wieder. Nur so können wir den Sprung von einer zwar kritisierten, aber als unveränderlich empfundenen Gegenwart hin zu einer positiven Zukunftsvision schaffen. In seinem radikalen Essay macht sich Milo Rau ausgehend von seinen Erfahrungen als Theaterregisseur und Aktivist auf die Suche nach neuen Formen des Denkens, Fühlens und kollektiven Handelns.
Vita
Milo Rau, geboren 1977 in Bern, studierte Soziologie, Germanistik und Romanistik in Paris, Zürich und Berlin. Er ist fester Teil des «Literaturclubs» im Schweizer Fernsehen, Intendant der Wiener Festwochen und Hauskünstler des NTGent. Seine Theaterinszenierungen und Filme waren bislang in über 30 Ländern zu sehen, werden zu den wichtigsten nationalen und internationalen Festivals eingeladen und vielfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem Europäischen Theaterpreis und dem Schweizer Filmpreis. Kritiker nennen ihn den «einflussreichsten» (Die Zeit), «kontroversesten» (New York Times) oder «interessantesten» (De Standaard) Künstler unserer Zeit.
Impressum
Dieser Essay basiert auf der Zürcher Poetikvorlesung 2022, die Milo Rau unter dem Titel «Warum Kunst?» am 3. November im Schauspielhaus Zürich, am 10. November im Literaturhaus Zürich und am 16. November im Kunsthaus Zürich auf Einladung des Deutschen Seminars der Universität Zürich hielt.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Oktober 2023
Copyright © 2023 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Covergestaltung zero-media.net, München
ISBN 978-3-644-00563-1
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Triggerwarnung
Moral und Paralyse. Zur totalen Gegenwart
Prolog Was ist totale Gegenwart?
Die fünf Reiter der Posthistoire
Der erste Reiter Der Reiter der Überinformiertheit
Der zweite Reiter Der Reiter der Kritik
Der dritte Reiter Der Reiter der Abgrenzung
Der vierte Reiter Der Reiter des Moralismus
Der fünfte Reiter Der Reiter des Realismus
Lob des Extremismus. Oder eine kurze Geschichte der Revolte
Prolog Das Ende kommt nie
Fünf Seinsweisen für das utopische Denken
Erste Seinsweise Extreme Erfahrung
Zweite Seinsweise Radikale Widersprüchlichkeit
Dritte Seinsweise Ekstatische Praxis
Vierte Seinsweise Konkrete Solidarität
Fünfte Seinsweise Reale Utopie
Epilog Ich schau dich an
Die Rückeroberung der Zukunft. Oder der kommende Aufstand
Prolog Warum Kunst?
Sieben Gesetze für den kommenden Aufstand
Erstes Gesetz Komplexität aushalten
Zweites Gesetz Eine breite Basis schaffen
Drittes Gesetz Das Problem bist du selbst
Viertes Gesetz Schaffe Common Sense
Fünftes Gesetz Schaffe Ereignisse
Sechstes Gesetz Dranbleiben
Siebtes Gesetz Sei demütig und gelassen
Dank
Bildnachweis
Triggerwarnung: Dieses Buch enthält die Darstellung von Zwangsarbeit, Raubkunst und sterblichen Überresten.
Moral und Paralyse. Zur totalen Gegenwart
PrologWas ist totale Gegenwart?
Zum ersten Mal von den Zürcher Poetikvorlesungen gehört habe ich als junger Student der Soziologie und der Germanistik an der Universität Zürich. Das war im Jahr 1997, ich war frisch an der Uni, damals saß man noch einmal in der Woche in der Vorlesung von Peter von Matt, aber nur ab der dritten Reihe, weil in den ersten beiden die Damen und Herren vom Züriberg[1] saßen. Kurt Imhof, der Soziologe mit dem Motorrad, lebte noch und verwirrte uns alle – und nutzte uns junge Student:innen natürlich aus als Recherchemaschinen, er konnte nicht anders, wie alle strahlenden Menschen. Sigrid Weigel führte uns in Freud, das Alte Testament, die Postmoderne ein, gemeinsam mit meinem damaligen und heutigen Professorinnen-Star, Elisabeth Bronfen.
Für mich, der ich von einem St. Galler Gymnasium kam, war das, was an der Universität Zürich gelehrt wurde, alles völlig verrückt. Es war verrückt, dass Tarantino, Moses, Pornofilme, mathematische Gleichungen, die Beastie Boys, Judith Butler, Molière, die Schwestern Brontë, Schweizer Tagespolitik und Max Weber im selben Seminar vorkamen. Dass Moral mit Ironie gemischt wurde, Systemtheorie mit Marxismus, die aufblühende Identitätspolitik mit Bruno Latours Parlament der Dinge. Wenn ich 1997 aus den Vorlesungen kam, wusste ich nicht mehr, sondern weniger als zuvor. Und ich bin noch heute der Meinung: Wissen ist die Vernichtung von Gewissheiten. Wissen ist nicht Information, sondern eine Art von Überblick, der uns aus der Welt der Informationen befreit.
Aber vielleicht ist eine Information trotzdem hilfreich, damit Sie mich besser verstehen: Ich habe meine Ausbildung an der Mittelschule und der Universität genau zwischen den Jahren 1989 und 2001 erhalten. Als hätte der Weltgeist an mir ein besonders kindisches Experiment durchführen wollen, bezog ich das Gymnasium direkt nach dem Fall der Berliner Mauer und schloss mein Studium in dem Moment ab, als die Türme fielen. 1989 bis 2001, das waren die Jahre der großen Revision. Die Siebziger und Achtziger waren das Jahrzehnt der Auflösung dessen gewesen, was man früher etwas hochtrabend die «Großen Erzählungen» genannt hatte: der europazentrierten Universalgeschichte, des biologischen Geschlechts, der sozialen Klassen und der Idee des Klassenkampfs – um nur ein paar Beispiele zu nennen.
Diese Auflösung wurde in den Neunzigern, als ich ein Teenager war, demokratisiert. Mit anderen Worten: Unser Lehrplan war diese Auflösung. «Dekonstruktion» des guten alten binären Abendlands, das war die einzige Aufgabe meiner intellektuellen Generation. Shakespeare zu lesen oder ihn gar zu inszenieren, das hieß in meinen Lehrjahren, ihn zu dekonstruieren. Übrigens ein Wort, das mich melancholisch stimmt, so altmodisch ist es: Dekonstruktion. Aber wie auch immer: In den Siebzigern wagten nur ein paar Avantgardist:innen wie Peter Zadek oder Ariane Mnouchkine, Shakespeare zu dekonstruieren. In den Neunzigern, als ich zur Schule ging, war die Arbeit getan. Man musste Romeo und Julia wirklich gelesen haben, um eine entfernte Ahnung zu haben, was die Schauspieler:innen auf der Bühne da trieben zwischen den Trümmern des Urtexts (den man unter den Techno-Beats, die damals angesagt waren, sowieso kaum verstehen konnte). Sogar am Theater St. Gallen war das so, wo ich meinen ersten Shakespeare sah. Auf der Bühne des Schauspielhauses Zürich war alles natürlich noch viel, viel schlimmer – da wüteten Schlingensief, Marthaler, die Jungs vom Golden Pudel Club und so.
Aber nicht so schnell: 1996 verließ ich St. Gallen, an einem kalten Februartag, und begann in Paris zu studieren, wo alles noch ziemlich oldschool lief, außer bei den Seminaren von Pierre Bourdieu und Bruno Latour natürlich. Ab 1997 studierte ich dann fest in Zürich. Aus Gründen, die ich mir selbst nicht erklären kann, wollte ich unbedingt Germanistik studieren – vielleicht weil es der Traum meines Großvaters Dino Larese gewesen war, ein italienischer Einwanderer. Es war für mich ein Herbst der Wunder, ein Herbst der großen Verwirrung. Es war in jenem Herbst 1997, fast auf den Tag genau vor einem Vierteljahrhundert, als der Schriftsteller W.G. Sebald die Vorlesung hielt, die ich nun im Jahr 2022 selbst halten sollte: die Zürcher Poetikvorlesung. Der Titel lautete damals: Luftkrieg und Literatur. Obwohl äußerst distanziert gehalten, war Sebalds Vorlesung ein Skandal. Es war wie in Adornos Zitat zur Unmöglichkeit der Dichtung nach Auschwitz: Über den Bombenkrieg, also das Leid der Deutschen, der Täter:innen zu sprechen, war an sich eine Art Tabubruch.
Zehn Jahre später, ich hatte mein Studium wie gesagt kurz nach dem Fall der Türme abgeschlossen und arbeitete in Dresden an einem Stück namens Pornografia, hielt Herta Müller die Zürcher Poetikvorlesung. Im Jahr 2009 dann bekam sie den Nobelpreis für ihren Roman Atemschaukel, in dem es um die Verfolgung der Rumäniendeutschen unter Stalin geht. Damals, zwanzig Jahre nach der Wende, arbeitete ich in Bukarest an Die letzten Tage der Ceaușescus. Dass ein Buch den Nobelpreis bekam, das die Leiden eines Deutschen unter dem Kommunismus in einer Region Europas ins Zentrum stellt, in der die (rumänischen und deutschen) Faschisten wie kaum in einem anderen gewütet hatten, das überraschte niemanden. Ebenso wenig überraschte mich, dass ein Stück zum Tod des stalinistischen Ehepaars Ceaușescu, das von einem linksradikalen Künstler wie mir erarbeitet wurde, von der Konrad-Adenauer-Stiftung unterstützt wurde, der Kulturstiftung der CDU.
Um die Jahrtausendwende fanden sich also ich und die Adenauer-Stiftung, der Bombenkrieg und der Holocaust, Hitler und Stalin, die Rumäniendeutschen und die Juden, die Beastie Boys und Judith Butler, Karl Marx und (fast hätte ich ihn vergessen) Carl Schmitt alle irgendwie in der gleichen Geschichte wieder – eine Form der europäischen Einigung aus einer undefinierbaren, aber geschichtsphilosophisch radikalen politischen Mitte heraus. Es war, wie der Philosoph Jean-Claude Michéa in seinem Essay Das Reich des kleineren Übels geschrieben hat, ein «Staat, der nicht denkt» entstanden: «Ein Staat ohne Ideen, oder wie die Liberalen sagen: ohne Ideologien», oder noch kürzer: «Ein Staat ohne Werte.»[2]
Im Oktober 2022 wurde in Frankreich der «Parc Simone Veil» eröffnet. Simone Veil überlebte den Holocaust und war Präsidentin des Europäischen Parlaments, zudem Mitglied der Académie française. Wie auf dem Bild auf der folgenden Seite zu sehen, gleicht der Porticus des «Parc Simone Veil» auf faszinierende Weise dem berühmten Eingang zum KZ Auschwitz. Natürlich führte das nach Bekanntwerden sofort zu einem Shitstorm, und als moralisch entrüstete Journalist:innen den Gemeinderat des kleinen französischen Ortes, dessen Namen hier nichts zur Sache tut, fragten, was er sich dabei gedacht hätte, antwortete dieser: «Nichts.»
Ende 2022 habe ich an meinem Theater in Belgien, dem NTGent, ein Stück produziert. Es heißt A Play for the Living in a Time of Extinction. Das Stück wurde von der US-Amerikanerin Miranda Rose Hall geschrieben, von der flämischen Aktivistin Martha Balthazar inszeniert und von der nigerianisch-belgischen Schauspielerin Lisah Adeaga performt. Es ist der innere Monolog einer Dramaturgin, der damit beginnt, dass sie sagt: «Während ich spreche, wird alle sieben Minuten eine Art von der Erde verschwinden.»
Seit Sie begonnen haben, diesen Text zu lesen, ist also etwa eine Art verschwunden. Ich weiß nicht welche, vielleicht eine Spinnenart, vielleicht eine Salamanderart, irgendwo habe ich gelesen, das seien die gefährdetsten Arten. Großsäuger sind eher unwahrscheinlich, die verschwanden bereits kurz nach Auftauchen des Homo Sapiens auf der Erde, und «kurz» heißt in Erdzeit ja normalerweise: einige 10000 Jahre nachdem der Mensch aus Afrika nach Europa und Asien emigrierte.
Wir befinden uns heute in einem viel schnelleren Prozess. Wozu wir früher 10000 Jahre brauchten, passiert nun in sieben Minuten. Aber versuchen wir zu verstehen: alle sieben Minuten eine Art. Das Erschreckende ist nicht die Tatsache an sich, denn die Tatsache ist nicht vorstellbar. Man kann über das Abstrakte des Artensterbens nicht erschrecken, ich zumindest kann es nicht. Nein, was hier erschreckend ist, ist etwas, was man die Faltung der Zeit nennen könnte. Es vergehen Millionen von Jahren, und dann erscheint eine Gegenwart, die – wie soll ich sagen? – die so kompakt, so kristallin, so absolut ist, dass in ihr in wenigen Minuten nicht nur ein Individuum, sondern eine Art verschwindet, die sich in Millionen, streng genommen in viereinhalb Milliarden Jahren, nämlich seit der Geburt des Planeten, entwickelt hat.
Eine nach menschlichen Maßstäben ewige, undenkbare Vergangenheit des Lebens und mit ihr eine genauso undenkbare, phantastische Fülle an Zukunft: vernichtet in ein paar Minuten. Wie ein Kometeneinschlag, aber ohne Komet. Ein kosmisches Drama, aber ohne Handlung und ohne Zuschauer:innen. Denn Sie werden mir zustimmen, dass der individuelle Tod oder, kulturhistorisch gedacht, das Ende einer Zivilisation zwar auch nicht denkbar, der Gedanke aber akzeptabel ist. Und zwar deshalb, weil es die Geschichte und mit ihr die Erinnerung gibt, weil es «die Menschheit», die Art, die kollektive Kultur, die Geschichte gibt. Sappho ist tot, das antike Griechenland ist vergangen – gleichzeitig kann ich sie hier zitieren: «Buntblumiggewirkte, unsterbliche Aphrodite, … Komm zu mir auch jetzt, erlöse mich von den schweren Sorgen.»[3] Sappho lebt, auf der Scherbe, auf der dieses Gedicht entdeckt wurde, als Mythos, im Stil von Anne Carson oder Kae Tempest, meinen beiden Lieblingsdichter:innen. Ein Teil meiner Familie, eine meiner Großmütter, kam in den dreißiger Jahren in die Schweiz, um den deutschen Nazis zu entkommen – andere starben. Ich aber erzähle hier von ihnen, ich kann hier vortreten und von meinen Großmüttern, Urgroßmüttern, Urgroßtanten sprechen – also sind sie nicht tot. «Alles ändert sich», wie das Motto einer unserer Spielzeiten in Belgien hieß, «aber nichts vergeht.»
Beim Aussterben aber vergeht, ja verschwindet mit dem individuellen Tod, da es der letzte ist, die Sprache, das Wesen, die Kultur, die Kollektivgeschichte einer Art. Das sind, völlig unmetaphorisch, die von Marx besungenen «eiskalten Wasser» des Kapitalismus: die Übersäuerung der Meere, der Bauboom, die Monoplantagen, die Insektizide, die Flächenbrände, in denen täglich Milliarden Wesen sterben. Und sollte eine Scherbe gefunden werden, auf der eines dieser Tiere die Trauer um seine Artgenossen verewigte, einsam herumirrend: Sie würde nicht einmal als Sprache begriffen. Denn dieser Tod, diese Gegenwart, von der ich in diesem Buch sprechen will, und wir stehen in ihrer Mitte, vernichtet alles Vergangene genauso wie alles Kommende: jede Erinnerung, jeden Zusammenhang und damit jedes Verstehen.
Angesichts dieser Tatsache, die wie gesagt emotional unfassbar ist, will ich fragen: Was ist die Zeitlichkeit einer solchen Gegenwart? Wie kann die Zeit gleichzeitig stillstehen und so ungemein beschleunigt sein, ja: rasen? Warum macht uns dieser Stillstand alle so verrückt? Was ist die Moral dieser totalen, in ihrer Totalität so durchaus nihilistischen Gegenwart? Und wie gehen Moral und Nihilismus, Untergang und Tatenlosigkeit zusammen?
Der erste Teil meiner Poetikvorlesung trägt den hochtrabenden Titel: «Moral und Paralyse. Zur totalen Gegenwart». Es ist wie gesagt eine Poetikvorlesung, also werde ich über meine Arbeit sprechen. Wie einige sicher wissen, bin ich Materialist: Ich denke, dass die Umstände, unter denen ich lebe, bedeutsamer sind, als ich es bin. Ich denke, dass es das «Ich» gar nicht gibt, sondern nur Beziehungen, in denen ich auftrete. Ich denke, dass jeder Gedanke, der mir wert scheint, festgehalten zu werden, auf Begegnungen beruht, auf dem, was wir in der Kunst «Projekte» nennen. Ich kann nicht denken, wenn ich allein bin, ich glaube: Es gibt kein einsames Denken. Das klingt etwas postmodern, deshalb füge ich hinzu: Die Bedeutung der Dinge, des Daseins, vielleicht ja des Seins eröffnet sich mir auch, und vielleicht noch unmittelbarer, dadurch, dass ich selbst ein Ding bin, ein «Erdling», wie Bruno Latour gesagt hätte. Man hat nicht eine Heimat, eine Kultur, eine Biographie – die Heimat, die Kultur, die Biographie hat uns. Was ist also die Zeit, aus der heraus ich spreche? Was ist diese Zeit, dessen zufälliger Bewohner, deren Erzeugnis ich bin?
Totale Gegenwart: Es ist, möchte ich anfangen, ein Zustand ohne Vergangenheit und ohne Zukunft. Dieser Zustand ist einerseits ganz allgemeiner Natur. Jeder Mensch durchlebt ihn bei jedem neuen Ereignis, das seine Aufmerksamkeit fesselt. Ekstatische Präsenz: Das will jede Performance, jedes Gedicht sein, nicht wahr? Waren wir nicht kurz unserer Zeit enthoben, als wir vorhin Sappho sprechen hörten, über die Jahrtausende hinweg? Die Fülle des Moments macht das Verfließen der Zeit überhaupt erst erfahrbar. Und bei melancholischen Charakteren wie beispielsweise mir muss man hinzufügen: überhaupt erst erträglich. Andererseits, und darum geht es mir, ist dieser Zustand in kapitalistischen Spektakelgesellschaften nicht nur eine individuelle, sondern eine gesellschaftliche Dauererfahrung. Totale Gegenwart: die absolute Seinsvergessenheit, das absolute Wegsacken des Zusammenhangs, der metaphysischen Leitlinie. Eine Musik ohne Thema, die absolute Performance, in der alles gleich ist. Die Kunst, und das ist meine persönliche Überzeugung, muss dagegen vor allem eines tun: Vergangenheit erforschen und Zukunft zurückerobern. Sie muss der Gegenwart hinten und vorne die Ausgänge freihalten, um uns, in einem Satz, wieder in geschichtliche Bewegung zu bringen. Denn nur eine offene Gegenwart, in der man aus Distanz zum Geschehen Stellung nehmen kann, ist darstellbar. Und nur eine darstellbare Gegenwart kann als veränderbar begriffen werden.
Bevor ich, im zweiten und dritten Teil, näher auf diese Ein- und Ausgänge eingehen will, also auf die Vergangenheit und die Zukunft, möchte ich nun ausschließlich die Gegenwart betrachten.
Die fünf Reiter der Posthistoire
Sie kennen die Reiter der Apokalypse, die im 6. Kapitel der Offenbarung des Johannes erscheinen, zur Ankündigung der letzten vier Dinge: Tod, Gericht, Himmel oder Hölle. Es ist eine meiner Lieblingsstellen aus der Bibel, auch eine der rätselhaftesten, wenn das Lamm (also Jesus) das Buch der sieben Siegel öffnet: