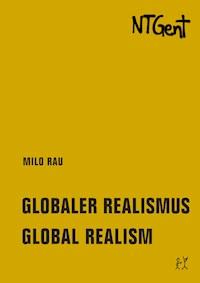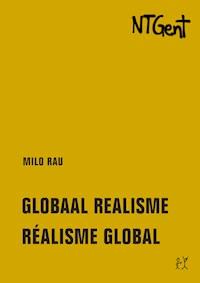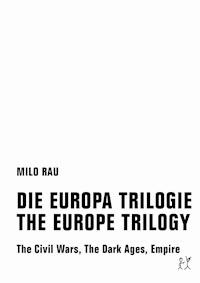Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verbrecher Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Die Wahrheit tritt nicht in unser Leben, um uns mit Küssen und Tränen zu wecken, aber wir alle sind unruhig, wir alle sind bereit", schreibt der Schweizer Autor und Regisseur Milo Rau in seinem 2008 entstandenen autobiografischen Essay "Nachmittag eines Linksfaschisten". Der vorliegende Band versammelt Texte Raus aus 10 Jahren und zeigt den "Theaterrevolutionär" (Der Spiegel) in allen erdenklichen Facetten: als kämpferischen Reporter und ironischen Autobiografen, als Liebhaber von Euripides genauso wie von Nicole Kidman. Ob Filmkritik zu David Lynch, Essay zu Roland Barthes oder Traumprotokoll, ob ästhetisches Manifest oder soziologische Miniatur: Rau ist stets ganz nahe am Gegenstand und zugleich auf Augenhöhe mit der Weltgeschichte. Und auch die tiefsinnigste Betrachtung greift aus ins politische Engagement. Er agiert ganz nach dem Motto seines legendären Weblogs "Althussers Hände": "Ich weiß sehr wohl, wie widersprüchlich man sein muss, um wirklich konsequent zu sein."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 321
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Milo Rau
ALTHUSSERS HÄNDE
Herausgegeben von Rolf Bossart Bilder von Nina Wolters
Rolf Bossart
HEROISMUS DER ERFAHRUNG
Milo Rau als Essayist
Die Wahrheit des Erlebens im Beschreiben zu wiederholen – die Welt also kühler, unverständlicher, unheimlicher, fremder, unmenschlicher und zugleich heißer, gegenwärtiger, zudringlicher, sichtbarer, menschlicher zu machen –, das ist das Schwierigste.
Milo Rau, Die Welt ohne uns (Fragen der Methode)
Nun war das Theater für mich immer nur das: ein theoretischer Text, Theorie – diese traumhafte Erweiterung des Willens, diese unwahrscheinliche Möglichkeit, dem Denken zuzusehen, wie es den Tatsachen nachsinnt – und seinem ganzen Schweif aus Ängsten, Wünschen, Erinnerungen, Späßen, Irrtümern.
Milo Rau, Hymne auf Nikolai Evreinov I
Die Arbeit an der Theorie entfaltet in den Werken von Milo Rau eine unmittelbar praktische Wirkung. Raus Bühnenarbeiten, Schriften und Statements sind geprägt von zahlreichen Bezügen zu Kunst, Philosophie, Geschichte und Politik. Bevor er 2009 mitDie letzten Tage der Ceausescusinternational bekannt wurde und seither in hoher Frequenz Erfolge als Regisseur und Essayist feiert, gab es eine längere Phase des Nachdenkens, Schreibens und Ausprobierens, in der vieles, was in seinen späteren Arbeiten wesentlich wurde, angelegt ist. Dieser Band versammelt eine Auswahl wichtiger Texte aus dieser Zeit und leistet somit einen Beitrag zur Genese von Milo Raus Ästhetik und des IIPM – International Institute of Political Murder.
Der Band enthält neben einzelnen Kritiken und Essays aus NZZ und WOZ überwiegend Texte aus dem BlogAlthussers Hände, den Milo Rau seit 2007 betreibt, die im Zeitraum von 2007 bis 2010 entstanden sind. Der ursprünglich geplante »theoretische Roman« mit dem TitelAlthussers Händesteht noch aus (vgl. hierzu das Nachwort von Milo Rau). Louis Althusser, dieser strukturalistische Erneuerer der marxistischen Theorie, der seine Ehefrau erwürgt hat und dessen Werk trotz – oder gerade wegen – seiner theoretischen und biografischen Verwerfungen und seiner Arbeitsweise der permanenten, destruktiv-produktiven Umschreibungen immer noch eine enorme Faszination ausübt, macht sich aufAlthussers Händeauf vielfältige Weise bemerkbar: als Metapher für das Problem der Wirkungen der individuellen Erfahrung auf die Theorie, als Patron der theoretischen Durchlöcherung strukturalistischer Determinierungen der Postmoderne oder als Prinzip einer »bösartigen« Handlungstheorie, deren implizite Frage lautet: Was könnten die Hände von Althusser tun? Wozu sind die Hände jenes Mannes fähig, dessen Denken kein Denken eines Torsos war, sondern ein Leibdenken, ein Denken, das die Imaginationen des Unbewussten mit den Fingerkuppen kurzschloss. Aber auch in der zentralen Einsicht, dass die politische Gewalt, wie sie Milo Rau in seinen Arbeiten zeigt, personaler ist und weiter weg von der Ideologie, als die Postmoderne glauben machte.
Raus Erkundungen der Begriffe auf dem BlogAlthussers Händezielen letztlich immer auf die politische Geschichte. Das Material dazu, so zumindest die Behauptung der entsprechenden Kapitelüberschriften im Buch, liefert indessen wesentlich die Befragung derKunst, derIdeologie, desStilsbeziehungsweise derMethodeund immer wieder desSelbst.
Dieses Selbst – ironisch und zugleich ernst gesetzt – ist deutlich als essayistisches Ich zu erkennen und operiert doch an zentralen Punkten mit autobiografischen Details. Das Private dient Rau als Anlass, um den Dingen allgemein auf den Grund zu gehen. So geht es in dem wichtigen EssayWas mit »Lynch« gemeint istzunächst einfach darum herauszufinden, was ein realistisches Set-Design ist. Rau geht von der selbst erfahrenen Schwierigkeit aus, den von ihm gesuchten »unheimlichen Realismus« für seine Mitarbeiter in Worte zu fassen, und von seiner sprachlichen Notlösung: »wie bei Lynch eben«. Diese praktische Problematik bringt ihn dazu, den Lynchkosmos genauer zu beschreiben: »Die sogenannte Zivilgesellschaft, der ›öffentliche Raum‹ ist hier höchstens ein guter Witz, eben der Ort, an dem sich die Käuze treffen (oder über den Tisch gezogen werden), unfähig, sich selbst (oder ihre Welt) zu analysieren.Twin Peaksist eine Welt der Hinterzimmer, mit allen damit verbundenen paranoischen Wundern der Innenarchitektur.«
Der Realismus, der in diesen Texten aus einer fundamentalen Kritik von Begriffen wie Naturalismus, Konstruktion oder Abbildung destilliert und so gewissermaßen der Postmoderne abgetrotzt wird, bleibt bei Rau zwar die Kunstform der Klassischen Moderne und diese insofern sein immer wieder – etwa in denHymnen auf Evreinov– genannter Bezugspunkt. Aber das Unheimliche, das hinter dem leichten Plauderton und der Ironie bereits in Raus frühen Filmen und Stücken zu spüren war, ist dabei das Zentrum des Deutungsprozesses. Der Realismus, so Rau in seinem Essay über David Lynch, sei »geborgt«. Er sei ein Effekt des Set-Designs, der Beleuchtung. Das Reale, welches den Realismus übersteige, habe deshalb die Qualitäten, wie Lacan sie beschreibt, und nicht die eines additiven Fernsehrealismus. Hier ist also bereits genauestens angelegt, was Rau bei späteren Stücken wieDie letzten Tage der CeausescusoderHate Radiozur beklemmenden Szenerie formen wird, in der sich aus der Assemblage des Gegensätzlichen – in denCeausescusetwa der realen Farben und der Farben aus der TV-Übertragung – eine klaustrophobische Welt ergibt, in die sich alles, was passiert, zwanghaft integriert. Die fröhliche Zufälligkeit, wie sie noch in der Postmoderne als Befreiung gefeiert wurde, ist des Feldes verwiesen. Es gibt keine Beliebigkeit des Gegenständlichen, keine Beliebigkeit der Handlung mehr. Geist und Materialität können nicht auseinander gedacht werden.
Die Themen der hier ausgewählten Texte sind für Rau immer auch ein Anlass, sich mit seiner eigenen Arbeit auseinanderzusetzen, um die Reizkräfte der verschiedenen Dinge zu erproben und sie in eine bestimmte Komposition zu bringen. Es sind Essays, Texte des Suchens und Versuchens. Doch gehen sie nie vollständig auf im rein Experimentellen, sondern haben immer eine Art prospektiven Bedeutungsüberschuss, woraus sich Linien zu späteren Positionen und Aktionen Raus ziehen lassen.
Im EssayCéline und die Schafewird auf zwei Ebenen deutlich, weshalb manAlthussers Händeals eine Vorbereitungs- oder Übergangsplattform bezeichnen kann.Céline und die Schafeist ein Text über den französischen Dichter Louis-Ferdinand Céline und im zweiten Teil auch eine für einige Aspekte von Raus Arbeitsweise aufschlussreiche Besprechung einer Inszenierung von Célines spätem Interview-RomanEntretiens avec le Professeur Yan der Berliner Volksbühne. Zum einen werden darin Fragen gestellt, die sehr plastisch die Art von Raus dramatischem Zugang zu den Figuren vorführen: »Wie haben die diese verdammte, eingebildete, unsympathische Ratte, diesen Übersteigerer und Selbsterniedriger, exakt lebensgroß auf die Bühne gebracht? Wie spielt Herbert Sand [der Darsteller Célines in der Inszenierung, Anmerkung d. Hg.] einen Mann, der uns beleidigt, um geschätzt zu werden? […] Wie spielt man das: diese absichtliche Schizophrenie – ohne expressionistisch zu werden? Den Größenwahn des genialischen Verlierers – ohne nur Theatergesichter und Theaterideen aufeinanderzuhäufen? Wie spielt, wie inszeniert man das so menschlich, so sanftmütig bei allem besserwisserischem Zorn, dass der Zuschauer am Ende versöhnt und wie aufgehoben von der Menschlichkeit dieses doch so hinterhältigen und rachsüchtigen und auch noch ziemlich schwer verständlichen Textes aus dem Saal geht?« Zum anderen vollzieht Rau in seinem Céline-Text bereits diese für ihn so typische Konzentration auf das Zweideutige des Menschlichen – seinen eigenen künstlerischen Ansatz, dass es keine taugliche Theorie oder Aktion gibt, wenn nicht Gut und Böse zugleich auftreten. »Es ist in der Kunst einfach nicht möglich, das Gute zu tun«, hat Rau es einmal in einem Interview das Céline-Prinzip auf einen Nenner gebracht. Célines Ausgangspunkt – etwa in seinem berühmten RomanReise ans Ende der Nacht– war die Auseinandersetzung mit dem Ersten Weltkrieg. Das, was damals kaputtgegangen ist, der Optimismus der Aufklärung, ist nicht mehr zu heilen. Und Céline, dieser großartige Stilist und pathogene Schreibtischtäter, hat – wie sein ferner Nachfahre Michel Houellebecq – für sich den Schluss gezogen, dass man selbst ekelhaft sein muss, um das Ekelhafte zu beschreiben. Denn die Aufnahme und Verinnerlichung von Erfahrung bis hin zu ihrer Sakralisierung im Genuss ist nicht zu trennen von ihrer Verwerfung und Ausscheidung als Exkrement und Ekel. Diese verstörende Untrennbarkeit von Schönheit und Schrecken ist das Thema von Raus Essayistik und Dramatik. Raus emphatischer, mit Begriffen wieErlösungoderWahrheitstilisierter Bezug zu Film, Theater oder Literatur fällt daher zusammen mit einer fundamentalen Faszination für die Zwiespältigkeit des Menschen und seiner Geschichte, deren Medium Raus Kunst wiederum zu sein beansprucht. Das ist es auch, was Rau den »Heroismus der Erfahrung« nennt. (Wie vorsätzlich ignorant die Kunstkritik oft daran vorbeischreibt, ist mit viel Witz und Pathos in den zwei PolemikenGegen das DramaundDie Dummheit der Kunstfestgehalten.)
Der unverkennbare Stil der Leichtigkeit und Sorglosigkeit aufAlthussers Händeund auch der früh und mühelos adaptierte alterslose Stil in den hier aufgenommenen, etwa zeitgleich entstandenen Texten aus dem Feuilleton der NZZ oder der WOZ vermitteln einen Eindruck vom sportlichen Charakter von Raus Denken und Schreiben. Doch zugleich ist dieses Schreiben auch besessen vom unbedingten Stilwillen, von Kaskaden originärer Gedankenketten, pathetischer Wortprägungen, des Hin und Her zwischen exakter, privater Erfahrungsreflexion und geschichtsphilosophischer Phantasmagorie. Kurz: nichts, was man schreibt, wenn man nicht muss. Es gibt die Aussage vonGillesDeleuze, dass man nicht denken kann, wenn man normal und gesund ist, dass es zum Denken immer die Erfahrung von Brüchen braucht. In welchem Maße trifft dies auf Milo Rau zu? Kann man von einer schicksalhaften »Berufung zum Schreiben« in Proust’scher Manier ausgehen oder doch eher von einer klaffenden Lücke infolge einer traumatischen Urverwundung? Die verstreuten autobiografischen Angaben und Selbststilisierungen lassen beide Deutungen zu, oder aber sie drängen zur Einsicht, dass beides – Berufung und Verwundung – ein und dasselbe sind.
KUNST
Was ist Unst?
Die Unst bevölkert die Gesellschaft und schlägt ihr Gedächtnis auf. Die Unst sammelt, kopiert, zeigt. Die Unst ist der Resteverwalter jener Wirklichkeit, die im Vorwissen der Kunst vergessen wurde. Die Unst ist die reine Wiederholung. Denn wir haben begriffen, dass die Kunst sich loswerden muss, um wieder eine zu werden.
Was bedeutet Unst?
Die Unst ist ein Wort. Es schreibt sich wie Kunst, nur ohne K: Unst. Sagt jemand: »Kunst«, so antworten wir ihm wörtlich: »Unst«. Schreibt jemand: »Kunst«, so benutzen wir den Radiergummi und gelangen zur Unst. Begegnet uns ein Künstler, so bekehren wir ihn durch ein einziges Wort. Denn die Unst ist die Wörtlichkeit. Und die Liebhaber der Unst sind die Ünstler.
Was begeistert den Ünstler?
Der Ünstler ruft außer sich: »Süße Schönheit!«, wenn das Mikrofon des Diktators rauscht, wenn der Kies unter den Füßen des Zeugen knirscht, wenn ein Flugzeug ein verlassenes Braunkohlegebiet überfliegt, wenn der Scherz dem Erzähler entgleitet, wenn die Quellen sich widersprechen, wenn der Dezember für Klarheit sorgt, wenn ein Berg ein Echo wirft, wenn ein Unbekannter einen Einkaufszettel schreibt. Denn das alles ist Unst, und die Unst ist das ureigene Gebiet des Ünstlers.
Warum feiert die Unst das Leben?
Die Unst feiert das Leben nicht, weil es widersprüchlich ist (aber auch). Die Unst feiert das Leben nicht, weil es lustig ist (aber auch). Die Unst feiert nicht das Tragische, nicht das Wahre, nicht die Geschichte, nicht die Revolution, nicht die Melancholie, nicht das fremde Geschlecht und nicht die Naivität (aber manchmal schon). Die Unst verkündet nicht die Lehre der Hysterie, der Poesie oder des Understatements (nur ab und zu). Die Unst gründet seine Belehrungen nicht auf die Armut oder den Reichtum, die Jugend oder das Greisenalter, die Bildung oder den Pop, die Linke oder die Rechte, die Tradition oder die Revolution, Hollywood oder den Iran, das Rätselhafte oder das Klare (all das zwischendurch). Die Unst ist weder elitär noch mittelständisch, weder gründlich noch oberflächlich, weder dramatisch noch episch, weder poetisch noch kalt (höchstens zum Spaß).
FRAGE: Für welche Qualität aber feiert die Unst das Leben?
ANTWORT: Die Unst feiert das Leben, weil es GENAU SO ist. Die Unst liebt den Iran, das logische Rätsel, den Dezember und die Revolution, weil sie GENAU SOsind. Die Unst erforscht die Geschichte, die Hysterie, das Lustige und das Wahre, weil all das GENAU SO ist. Die Unst liebt sogar die Zukunft, weil sie GENAU SO ist.
FRAGE: Was also ist die Unst?
ANTWORT: Die Unst ist die Betrachtung des GENAU SO.
Wie löst die Unst das Zeitproblem?
FRAGE: Wie steht die Unst zur Jetztzeit, zur Geschichte und zu den Problemen der Zukunft?
ANTWORT: Die Unst ist die Analyse des GENAU SO der Jetztzeit, welche aber im Augenblick ihrer Betrachtung bereits eine vergangene, also eine Vorzeit ist.
FRAGE: Die Jetztzeit ist eine Vorzeit?
ANTWORT: Oder umgekehrt.
FRAGE: Und weiter?
ANTWORT: Gegeben das gestische Voranschreiten der Unst im jeweils gegebenen Moment in beide Richtungen der Vor- und der Nachzeit, ist jede Erkenntnis des Ünstlers über das GENAU SO der Jetztzeit zugleich eine Handlungsanweisung für eine ebenfalls völlig gleichzeitig sich ereignende Nachzeit.
FRAGE: Die Gegenwart des Ünstlers ist also eine Handlungsanweisung an die Zukunft?
ANTWORT: Richtig. Unter der Voraussetzung natürlich, dass diese Anweisung nicht in irgendeiner übertragenen Weise, sondern ausschließlich GENAU SO, also FÜR DEN GEGEBENEN MOMENT, also WÖRTLICH gemeint ist. Aber ein Ünstler spricht immer wörtlich, sonst wäre er kein Ünstler.
FRAGE: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft werden durch die Arbeit des Ünstlers ein und dasselbe?
ANTWORT: Natürlich.
FRAGE: Produziert ein Ünstler also Nachzeit?
ANTWORT: Selbstverständlich. Jeder Ünstler ist eine völlig objektive Weisungsagentur der Nachzeit.
FRAGE: Der Ünstler kennt die Zukunft?
ANTWORT: Richtig. Aber nur für den jeweils gegebenen Moment. Nur innerhalb der jeweiligen Recherche. Nur wörtlich.
FRAGE: Was also liefert der Ünstler der Gesellschaft?
ANTWORT: Der Ünstler liefert eine völlig wörtliche Wiederholung der Gegenwart durch die Vergangenheit für die Zukunft.
Fragen der Methode I
Der Ünstler unterscheidet sich vom Künstler durch seinen wissenschaftlichen Eifer und seine vollkommene Objektivität. Für den Ünstler ist jeder Augenblick seiner privaten Arbeit ein Teil der großen Arbeit am Welt-Objekt, welches wiederum bloß Voraussetzung des Augenblicks ist. Schauspiel, Beleuchtung, Sprache, Musik. Der Blick der Zuschauer, der Diktatoren, ihrer Verräter, der Statisten, der Kameras. Die Kleinschreibung, die Großschreibung, das Exposé, die Recherche, die Kritik, der Absatz und die Abweichung. Die Kosten des Schauspiels, die künstlerische Wahrheit, das Husten im Publikum. Das Gerede, die Urteile, die Benachrichtigungen, die Plötzlichkeit, die Montage. Die Komik, die Unsicherheit, die Wut, das Missverständnis und die Absicht. Die Glut des Dokuments, des Augenblicks und der Zukunft. Die Gerechtigkeit, die Ironie und das Geld. Die drei Akte, die Übergänge und das Fragment. Die Dramaturgie, die Geschichte, die Zeugnisse und der Zufall. Alle Stimmen, alle Reisen, alle Fahrpläne, das Frühstück, der tiefere Sinn, die Tugend, die Witterung und die Geometrie. Der aktuelle Krieg und der Persische, der Nebensatz, die Dialektik, die Erdanziehung, die Pause, der Schlaf. All das ist Teil der großen Arbeit des Ünstlers. All das gehört zur Methode der Unst. Die Hilfsmittel des Ünstlers sind also zahllos in ihrer Art und unendlich in ihrer Wirksamkeit.
Fragen der Methode II
Wir wiederholen (um der Wiederholung willen): Die Arbeit des Ünstlers ist niemals subjektiv, sondern immer völlig objektiv. Denn der Ünstler vertraut auf den GEGEBENEN MOMENT, der die Lehrsätze der Kybernetik, des Varietés, der Kriminologie, der Evolutionstheorie, der Quantenphysik, der Gesprächsanalyse, der Mystik, der Autobiografie und so fort bis ans Ende der Wissenschaften in sich vereinigt. Der Ünstler handelt wie jener Weise, der das Fleisch nicht teilt, indem er es schneidet – sondern das Messer dort ansetzt, wo das Gewebe sich WIE VON ALLEIN teilt.
FRAGE: Aber woher nimmt der Ünstler dieses Messer, welches WIE VON ALLEIN teilt?
ANTWORT: Jeder Moment enthält das Messer, mit dem er vom Ünstler WIE VON ALLEIN geteilt werden kann.
FRAGE: Wie erkenne ich das Messer?
ANTWORT: Das Messer zeigt sich erst in der ünstlerischen Teilung.
FRAGE: Es geht also darum, das Messer, das den Moment WIE VON ALLEIN teilt, in demselben Moment zu finden, in dem er sich dank des Messers teilt?
ANTWORT: Natürlich.
FRAGE: Und wie komme ich zu diesem Moment?
ANTWORT: Wie von allein. Das ist die Objektivität der Unst.
Genau dies.
Was ist in einem Wort das Ziel der Unst?
Was ist der Lebenszweck des Ünstlers?
Sich zu erheben
Zu hören
Und zu sehen.
Was?
Alles, aber nur DIES.
Wann?
Immer, aber nur in DIESEM Moment.
Wie?
Auf alle Arten, aber nur GENAU SO.
Wo?
Überall, aber nur HIER.
Denn GENAU DIES
Ist das Ziel.
3.10.2008
Die Welt ohne uns
Vorgestern war es, dass ich anlässlich eines kleinen Essays über Christoph Ransmayr und seinen RomanMorbus Kitaharawieder einmal auf den Morgenthau-Plan gestoßen bin: den hirnrissigen und poetischen Plan, das Dritte Reich in ein reines Agrarland zu verwandeln.
Ich mag die Literatur nicht, die Ransmayr schreibt, obwohl mich seine Themen faszinieren: Alternativgeschichten, narrative Rekonstruktionen, Reisen durch Länder, die so fremd sind, dass sie auch erfunden sein könnten. Aber alle Beobachtungen Ransmayrs sind derart in einem übergeordneten Stil aufgelöst, dass sie diese Art von Wahrheit, diese einzige Art von Wahrheit, die mich wirklich interessiert, eingebüßt haben – die Wahrheit des Sehens, Hörens, Erlebens, die weder mit einer Geschichte noch mit einer Form etwas zu tun hat, sondern mit einer eher philosophischen Fähigkeit:genausein zu wollen. Sich beim Schreiben nicht ans Beschreiben oder ans Beschriebene, sondern an die genaue seelische Mechanik des Beobachtens zu erinnern und die Wirklichkeit aus diesen geistigen Aggregatzuständen rückwärts wieder abzuleiten. Die Wahrheitdes Erlebens im Beschreiben zu wiederholen, sie zu erwecken, ohne dabei den Elektroschock- und Herzmassagen-Expressionismus zu praktizieren, wie man ihn aus dem deutschen Theater kennt – die Welt also kühler, unverständlicher, unheimlicher, fremder, unmenschlicher und zugleich heißer, gegenwärtiger, zudringlicher, sichtbarer, menschlicher zu machen – das ist das Schwierigste.
Es ist ja etwas sehr Kaltes, sehr Kartesianisches an dieser Vorstellung einer Genauigkeit diesseits der Form. Es ist die Angst, auf Vorgefertigtes hereinzufallen, sich von fertigen Bildern und fertigen Sätzen und Erzählgewohnheiten für dumm verkaufen zu lassen – »von einem Geist«, wie René Descartes sagt, und damit meint: von den Scholastikern, von den schlechten Philosophen, von den Formalisten. »Ich übte mich in meiner Methode des Zweifelns«, schreibt er, »und hielt alles für ungewiss, was andere für wahr halten.« Descartes deduziert und zögert, versteht und verwirft, tastet sich einen Schritt vorwärts und einen halben zurück, denkt wie auf Eis, beweist alles Mögliche, philosophiert sich einmal quer durchs Grand Siècle, kommt auf die numerische Unendlichkeit und schließlich sogar auf Gott.
Wenn nun Descartes ein System gebraucht hat – die Logik, die Zahlen und Gott – um zu beweisen,dasses eine Welt und eine Wahrheit diesseits aller Formalismen gibt, dass Zweifel angebracht, aber nicht das Ende der Geschichte sind: Wie soll da ein einfacher moderner Schriftsteller, der uns unterhalten will, der vielleicht eine Geschichte erzählen will, der uns sagen will, wie etwas zugeht und in welcher Reihenfolgeundaus welchen Gründen, wie soll der nicht immerhin ein paar ganz kleine Gewissheiten, einen kleinen Stil, einen praktischen Formalismus zu seiner Verfügung haben dürfen? Es ist einfach zu viel verlangt, bei aller Gottlosigkeit auch noch auf den Stil zu verzichten. Die großen Kartesianer des Beobachtens: Claude Simon, Harold Brodkey – sie erzählen uns keine Geschichten. Aber Ransmayr, der erzählt ja, der will ja erzählen.
InMorbus Kitaharawird beschlossen, ein im Krieg besiegtes Land nicht wieder aufzubauen, der Rest des Buches, eine Art Kampf aller gegen alle, eine Degeneration aller Propositionen des BegriffsMensch, folgt aus dieser Idee. Es ist der Morgenthau-Plan, den Ransmayr da zu Ende denkt, nicht uninteressant, wenn auch eine ganz und gar faschistische Erzähl-Idee – hätte der Faschismus in Wahrheit über Ideen, und nicht nur über vage Vorstellungen, über mit Worten getarnte Großstimmungen verfügt. Politisch obszön, anthropologisch hirnrissig ist diese Idee, aber von den möglichen Bildern her natürlich so reichhaltig wie SpeersTrümmerarchitektur– eine Bauweise, die darauf angelegt war, auch in allen Stadien des Verfalls noch schön auszusehen, einCadavre Exquis.
Das Böse aus der Welt schaffen, indem man die Zivilisation insgesamt zerstört: Winston Churchill und Theodore Roosevelt haben Morgenthaus Plan in Erwägung gezogen. Nicht ernsthafter als andere Pläne, aber sie haben ihn auch nicht als absolut grotesk abgelehnt. Bezeichnenderweise scheiterte der Plan, als er dann durch eine Indiskretion einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde, nicht an seiner Absurdität, sondern an einer für heutige Verhältnisse sehr nebensächlichen Tatsache: Der Finanzminister Morgenthau war Jude. Man vergisst ab und zu, dass nicht nur die Deutschen und, wie man gern hinzufügt, die Letten, die Polen und die Russen Antisemiten waren – sondern auch die Engländer, die Franzosen und die Amerikaner.
Nun gut, man wollte also das Deutsche Reich als Machtfaktor vernichten, das ist verständlich, man wollte Hitler völlig und restlos besiegen, man wollte die Deutschen vom Meer, von der Kohle, dem Eisen, vom Osten und vom Westen, von der Bildung, der Weltwirtschaft und jeder Form von Zivilisation abschneiden, damit sie keine morbiden Geschichten mehr erzählen, keine Geschichte mehr machen konnten – aber bitte nicht mit einer jüdischen Idee. So hat die nationalsozialistische Ideologie ihren von Hannah Arendt inDie vollendete Sinnlosigkeitanalysierten Höhepunkt nur deshalb nicht erreicht, weil der letzte Akt von einem Juden hätte inszeniert werden sollen: »die sorgfältige und kalkulierte Errichtung einer Welt, in der nur noch gestorben wurde, in der es keinen, aber auch gar keinen Sinn mehr gab« – die Vernichtung aller menschlichen Spuren, aller menschlichen Ideen, jeder Form von Sinn und Kultur und damit, als wagnerianisches Schlussgetöse, Deutschlands selbst.
Worauf will ich eigentlich hinaus? Ich glaube, dass jeder Kunst ein Morgenthau-Plan als ästhetische Methode zugrunde liegt: dieser Wunsch, einen Nachher-Blick zu haben; dieser Wunsch,methodischin einem Zustand zu leben, in dem die Erkenntnis den nötigen Umweg durch die Zeit (durch unsere, durch meine Zeit) immer schon gemacht hat und in dem man, in einer ruinierten Zukunft lebend, die Drohung und den Schauder seiner Auslöschung leibhaftig erfahren kann. Die Vorstellung ständiger Konzentration, ständiger Inspiration, unerschöpflicher Schaffenskraft, die seltsamerweise mit Jenseits- und Vernichtungsfantasien einhergeht. Wie verschiedenartig auch ihre Werke sind, immer handelt die Kunst vom gleichen Moment des Erwachens, von der gleichen blitzartigen Nachdenklichkeit, mit der uns das Erlebnis des Daseins trifft. Wir begreifen nur, was uns bereits unrettbar verloren gegangen ist.
Es ist also nicht so, dass ich das nicht verstehen würde: in einer Endzeit zu leben, und alles ist da wie ausgestellt. Was gibt es Großartigeres als die Vorstellung einer Welt, in der wie in einem Kinosaal die ganze Zivilisation Revue passiert? Die Vorstellung einer sterbenden Welt, in der die Kulturgeschichte wie in einem Todes-Atelier rückwärtsläuft, eine Welt, die insgesamt von der Kultur ins Sinnlose kippt, in der die Städte zerfallen, die Sprache verloren geht, die Freiheitsstatue im Sand versinkt, die Wölfe die Herrschaft übernehmen – was wäre verführerischer?
Ich verstehe Ransmayr, sein Buch ist vollkommen. Es gibt einige andere Bücher zu dem Thema –Die Arbeit der Nachtund natürlichDie Wand–, die weniger vollkommen sind. Aber was ich nicht verstehe, ist die Form von Ransmayrs Buch, diese gewissenhafte Genauigkeit, als wäre man mit dem Ende tatsächlich am Ende – als wäre die verfließende Zeit nicht nur eine Methode, das Leben ein bisschen genauer zu verstehen und ansonsten eine ungeheure Gemeinheit. Was mich langweilt, ist diese Stilisierung, diese Endgültigkeit und Zufriedenheit, die so anders ist als bei Thomas Glavinic oder Marlen Haushofer: Glavinics Held, der plötzlich allein ist auf der Welt, in Österreich, in Wien, stellt Scherze an mit dieser langweiligen, schwerfälligen Stadt, tut, was er immer schon gern getan hätte.
Recht hat er. Für sich genommen ist das Ende der Welt der reine Blödsinn. Für sich genommen ist es nichts und wieder nichts. Melancholie macht dumm, jeder spürt das. Schön ist die Flucht des Denkens vor dem Tod, das Geschwätz der Erinnerung, die Zweifel der Philosophie, das Glück, dieses unendliche Glück, ein Mensch zu sein.
Schön schreiben, für die Ewigkeit schreiben, das ist Zeitverschwendung. Ich will nur so viel Gewissheit, wie ich fürs Leben gebrauchen kann. Wer sieht meine Welt, wer denkt an sie, wenn ich es nicht tue?
26.1.2008
Céline und die Schafe
Es gibt Menschen, die tun alles doppelt, die denken A, und ihre Stimme sagt B – und wenn man ihnen dann auf B antwortet, sind sie beleidigt, weil sie doch A gedacht haben. Ja, es gibt Menschen, die fragen nach dem Weg und fühlen sich bevormundet, wenn man ihnen hilft. Es gibt Leute, die leben dialektisch, bei denen ist das Gegenteil immer genauso wahr, die fallen sich, redend, selbst ins Wort. Die wünschen sich Gemeinschaft und ertragen die Menschen nicht, die wollen geliebt werden und finden Liebende dumm, die wollen Künstler sein und hassen den Kunstbetrieb, die reden von gewaltigen Triumphen und verirren sich im Spiegelkabinett ihrer Niederlagen.
Der französische Dichter Louis-Ferdinand Céline war ein solcher Fall. Er wollte Kommunist sein, aber er schrieb ganze Bücher zur Verspottung des sozialistischen Realismus. Er wollte die Verheerungen des Kapitalismus anklagen, aber er schrieb antisemitische Manifeste, in denen er die absurdesten bürgerlichen Vorurteile bis ins Groteske steigerte. Er wollte vom Publikum gefeiert werden, aber er ließ keine Gelegenheit aus, es zu beleidigen und gegen sich aufzubringen. Er wollte ein Held der Franzosen sein, aber er tat alles, um die Grande Nation als ein Land der Kriecher, Kollaborateure, Kriminellen und Geisteskranken bloßzustellen. Von jedem, der sich nicht (wie die heutige Kritik) in den Kopf gesetzt hat, ihn vorbehaltlos zu bewundern, ist er deshalb für wahnsinnig gehalten worden – und hat seine bittere Freude daran gehabt.
Céline, das ist der dunkle Schatten auf dem swingenden Frankreich der Existenzialisten, das ist der übel riechende Fleck auf den Fotos Bressons. Letzthin saß ich einen Nachmittag lang mit Philippe Djian in einem Pariser Kaffeehaus, und er erzählte mir, wie er auf dem Weg zur Schule immer an Célines letztem Haus in Meudon vorbeikam und instinktiv den Kopf einzog; wie noch damals, in den späten 1950er-Jahren, Frankreich voll war von diesen zänkischen, schlecht gelaunten, emotional gestörten Überlebenden des Ersten Weltkriegs, denen jedermann aus dem Weg ging, ohne ihnen helfen zu können; wie die Welt Célines, diese Millionen lebendiger Kriegstoten, diese Zombies der Grande Nation, diese Welt aus existenzieller und ideologischer Inkontinenz, wie dieses gewaltige, hasserfüllte, in den Gräben debil geschossene Kleinbürgertum – wie diese Welt erst im Mai 1968 endgültig gestürmt, endgültig erobert, endgültig entmistet wurde und Céline, sieben Jahre nach seinem Tod, zum Klassiker, zum Chronisten eines Zeitalters erklärt wurde, das von Verdun bis zu den Pariser Barrikaden ein halbes Jahrhundert gedauert hatte.
Sein Werk ist das Porträt eines Mannes, der voller Hass war, eines Schriftstellers, der den Hass und den Ekel wie eine zweite, emotionalere Sprache gebrauchte – eine Sprache der rasenden Emotion, die in die richtige wie ein Teufel hineinfuhr, sie beschleunigte und zerfetzt liegen ließ. Célines biografische Taktik, das eigene Leben so unerträglich und widersprüchlich wie möglich zu gestalten, um noch die verborgensten gesellschaftlichen Frustrationssphären anzuzapfen, sich immer in nächster Nachbarschaft zum jeweils, wie er sagte, »größten vorhandenen Misthaufen« anzusiedeln – dem Grabenkrieg, dem untergehenden französischen Kolonialreich, dem faschistischen Subproletariat, dem untergehenden Dritten Reich – macht sein Leben zu einem Dokument der Widersprüche des 20. Jahrhunderts. Es reichte Céline nicht, den irre gewordenen Kapitalismus der Zwischenkriegszeit bloß theoretisch, bloß literarisch zu hassen, wie das sein ästhetischer Gegenpart, der Schöngeist André Gide tat; er wollte nicht nur ein bisschen Dreck am Stecken haben, er wollte im Dreck versinken, er war die Hauptfigur all seiner Bücher: Er kämpfte im sinnlosesten Krieg der Menschheitsgeschichte, er wurde lahm und halb taub geschossen, er fuhr für den Völkerbund nach Afrika, wurde Seuchenarzt, forschte in den amerikanischen Ford-Werken, wurde Kommunist, bereiste die Sowjetunion, überwarf sich dort mit jedermann und wurde genau in dem Moment Faschist, als in Frankreich die Volksfront an die Macht kam und sich auf einmal auch der dümmste Nationalist für den Nationalkommunismus begeisterte.
So wie er als Sozialist über das Proletariat und die Moral desNeuen Menschengespottet hatte, so wie er seinen Gegenstand hassen musste, um ihn zu verstehen, so war auch Célines Variante des Faschismus schizophren. Céline verfasste bösartige antisemitische Pamphlete, denen er aber, als Anhänge, seine Doktorarbeit (eine Jubelschrift auf den jüdischen Chirurgen Ignaz Semmelweis) und abstruse Ballettmanuskripte beilegte. Während er sich von den Besatzungsoffizieren feiern ließ, veröffentlichte er antideutsche Leserbriefe und machte – obwohl der Holocaust offiziell geheim gehalten wurde – mehrfach den Vorschlag, ihn, Céline, gleich gemeinsam mit den Juden zu ermorden. In den letzten Kriegstagen floh er nach Deutschland und von dort nach Dänemark, wo er als Verräter eingesperrt wurde. Zum Tode verurteilt und begnadigt, als französischer Autor inmitten der selbst ernannten Résistance-Kämpfer um Jean-Paul Sartre unmöglich geworden, kehrte er doch nach Frankreich zurück und lebte als Armenarzt in der Pariser Banlieue: immerhin zwölf Jahre, in denen er mit wachsender Wut den verlogenen Neoklassizismus, den schöngeistigen Humanismus der Nachkriegsjahre aus der Froschperspektive des (neben Ezra Pound) weltweit berühmtesten Kollaborateurs beobachtete. Gide, der den Krieg im deutsch besetzten Nordafrika mit Voltaire-Lektüren und auf Sektempfängen der Wehrmacht verbracht hatte, wurde der Nobelpreis verliehen. Célines Alterswerk dagegen wurde von seinem Hausverlag Gallimard ohne Werbung und am Publikum vorbei in Kleinstauflagen beerdigt.
Der Regisseur Ron Rosenberg hat nun, im dritten Stock der Berliner Volksbühne, Célines späten Interview-RomanEntretiens avec le Professeur Ymit Herbert Sand als Célines Alter Ego inszeniert. Mit nichts als einem Stuhl, einem Tisch und einer Pflanze als Bühne. Mit einem fast vorgangslosen, aber tief berührenden Video (Cornelius Onitsch), das als Tafelbild über der Szene hängt und einen leeren Schafstall zeigt, der sich am Ende der Vorführung mit eben diesen Tieren füllt. Mit vier, fünf Takten klassischer Musik. Mit eigentlich gar nichts, keinen Lichtspielereien, keinen Zitaten, keinen Theater-Aufgeregtheiten, mit rein gar nichts: kein Eiffelturm, kein Hakenkreuz, kein Pariser Jugendstil und keine Banlieue, überhaupt kein Paris und kein 20. Jahrhundert, auch fast kein Theater, keine existenzialistischen und keine postmodernen Gesten – außer einem unfassbar präsenten Herbert Sand und einem auf drei, nein vier, nein: 100 Ebenen gleichzeitig spielenden Selbsterklärungstext des einsam in Meudon vor sich hin brüllenden, des durch tausend Ideen und Wachträume hetzenden, die üblichen Céline-Abenteuer erlebenden, in Hass- und Trotzfragmente zerfasernden Autors Céline.
Nun: Wie haben die das gemacht? Wie haben die diesen Mann, der wusste: Ich bin der größte Schriftsteller Frankreichs, und ein verblödetes, verkitschtes, verlogenes Frankreich schweigt mich tot, – wie haben die diesen Schriftsteller, der gleichzeitig ein Menschenfeind war und sich nach der Liebe der Menschen, nein, viel lächerlicher: seines Lektorsgesehnt hat – wie haben die diese verdammte, eingebildete, unsympathische Ratte aus Meudon, diesen Übersteigerer und Selbsterniedriger, exakt lebensgroß auf die Bühne gebracht? Wie spielt Herbert Sand einen Mann, der uns beleidigt, um geschätzt zu werden? Der seine Intelligenz und sein Herz unter allen Misthaufen begräbt, damit er sie, seine Intelligenz, seine Sprache, sein Herz besser und glanzvoller nutzen kann? Wie spielt man das: diese absichtliche Schizophrenie – ohne expressionistisch zu werden? Den Größenwahn des genialischen Verlierers – ohne nur Theatergesichter und Theaterideen aufeinanderzuhäufen? Wie spielt, wie inszeniert man das so menschlich, so sanftmütig bei allem besserwisserischen Zorn, dass der Zuschauer am Ende versöhnt und wie aufgehoben von der Menschlichkeit dieses doch so hinterhältigen und rachsüchtigen und auch noch ziemlich schwer verständlichen Textes aus dem Saal geht?
Es gibt, wenn man sich mit Céline befasst, zwei Möglichkeiten: Man versteht ihn, oder man erklärt ihn. Man lässt sich auf ihn ein, oder man baut aus ihm etwas anderes, etwas Theatrales. Ihn zu erklären, ihn als Baumaterial zu verwenden, das hat – unter anderem, unter sehr viel anderem – Frank Castorf in seiner InszenierungNordgemacht. Rosenberg und Sand haben versucht, Céline zu verstehen. Sie haben sich, stelle ich mir vor, also vor diesen Text gestellt, und ihn von ihrem eigenen Leben aus durchquert. Castorf sieht in Céline das Besondere, das Ekelhafte, das Wunderbare, die Rubens- und Brueghel-Dimension. Céline ist, das stimmt, eine Art Lautsprecher gewesen, der das Gerede seiner Zeit – der 1930er-, 1940er-, 1950er-Jahre: diesen Willen zur Reinheit und zur klassischen Form – laut und in seiner ganzen tiefen Vulgarität und Gemeinheit in die Welt hinausgeschleudert hat. Und als solchen, als Stimmenimitator, als emotionales Aufzeichnungsgerät hat ihn Castorf auch benutzt.
Rosenberg und Sand (und vor allem auch Onitsch) sind viel bescheidener. Was sie zeigen, ist die Art, wie der wahre, der richtige Céline, dieser Armenarzt, dieser einst so angesehene Schriftsteller, sich selbst versucht hat zu verstehen in jenen Jahren, als die beiden Edel-Moralisten Gide und Mauriac den Nobelpreis bekamen, Céline aber von aufrechten Franzosen hölzerne Särge zugeschickt wurden: von den gleichen aufrechten Franzosen nebenbei bemerkt, die den Mythos der Résistance genau in dem Moment erfanden, als die Amerikaner die Wehrmacht über den Rhein trieben. Was Herbert Sand zeigt, ist die verworrene Gefühlswelt eines Mannes, der A sagt und B meint, der uns beleidigt, verspottet, fertig macht, um bei uns Erlösung zu finden, der interviewt werden und wieder berühmt sein will, und doch nur Hass empfindet für seinen Interviewer; eines Mannes, der es einfach nicht glauben kann, dass nicht einmal 60 Millionen Tote ausgereicht haben, um die oberflächlichen, kindischen und so offensichtlichen Lügen des französischen Literaturbetriebs zu beenden.
Céline erklärt uns seine literarische Theorie; Céline tobt und erzählt uns fäkale Fantasien; Céline schwitzt, schweigt, spricht ins Leere, zetert wie ein Prolet: Das alles kennt man, das alles ist gar nicht so wichtig und wird in Rosenbergs Inszenierung auch mehr oder weniger ausgeblendet. Nicht unterdrückt, nein, nicht durch irgendwelche Formalismen von der Bühne gedrängt, es ist nur nicht so wichtig. Wichtig, ja unvergleichbar sind diese Momente: Wenn Herbert Sand auf die Bühne kommt, sich steif auf die Bühne schiebt, in dieser aus allen Maßstäben gefallenen, aggressiven, überheblichen Wunderlichkeit des Céline’schen Menschen zu sprechen beginnt, in einem Stummfilmkostüm, mit Stummfilmschminke, mit einer Stummfilmstimme wie aus Papier, die nur langsam und mit ganz geringer Distanz zur Figur an Farbe und Volumen gewinnt. Wenn er auf einmal eine Bodenklappe öffnet und springt, nur um sofort wieder aufzutauchen – wie als Beweis der eigenen Vorläufigkeit in diesem blödsinnigen Welttheater. Und wie er sich aufbläht, wie er in sich zusammenfällt, sich gegen Gespenster verteidigt, die ganze Zeit nur recht hat! Wie er sich immer enger einwebt in sein Netz aus Vorhaltungen, Rechtfertigungen, Angriffen und Literaturtheorien, in diese Scheißhausideen, Prügeleien, Beleidigungen und Weltuntergangspläne, in denen er, Céline, natürlich immer als Erster gelyncht wird vom Laufpublikum seines Traum-Theaters. Was für einen exzentrischen Ton er anschlägt, was für eine Energie, und was für eine schonungslose Intelligenz er entwickelt, um sich gegen alle möglichen eingebildeten und wirklichen Feinde zur Wehr zu setzen. Und unweigerlich wird man eingesogen in diese Ekstase des Nein, in diesen unglaublichen Hass auf die Gesellschaft, die Literatur, Frankreich, Europa, in diesen Überdruss, ständig irgendwelchen Leuten Rede und Antwort zu stehen, sich verteidigen, sich anbiedern, sich erklären zu müssen – und deshalb ganz konsequent alles zu tun, um ein Paria zu bleiben. Liebt mich, aber liebt mich in meiner ganzen Verworfenheit!
Herbert Sand als Céline: Das ist das eine. Das zweite ist die Inszenierung. Sie ist, um es mit einem Wort zu sagen: zärtlich. Sie ist verständnisvoll, sie ist unglaublich zurückhaltend, sie drängt sich nie in den Vordergrund, sie steht, fast unsichtbar, einen halben Schritt hinter dem Schauspieler Herbert Sand. Die Inszenierung verdoppelt die ohnehin überspannte Theatralität von Célines Vorlage in keinem Moment, sie vermeidet (von einigen Ausnahmen, etwa einer Hitler-Persiflage abgesehen) jede theatrale Erklärungs- oder Verdeutlichungshaltung. Sogar, wenn Herbert Sand schreit, und er schreit ab und zu, wird es nicht wirklich laut, nicht wirklich hysterisch – und Céline, dessen Bücher von der Übertreibung und der Übersteigerung, einer gewissen emotionalen Lautstärke leben, tut dieses Understatement erstaunlich gut. Was dieser Céline redet, wird von der Regie so ausdrücklich, so eindeutig, und doch ohne jede existenzielle oder ironische Geste auf den, der da spricht, zurückgeschrumpft, dass nicht Herbert Sand hinter Céline, sondern der Popanz Céline hinter Sand vollständig verschwindet. Es geschieht dabei etwas Seltsames: Indem nichts erklärt und nichts unterstrichen wird, erscheint auf einmal, vielleicht zum ersten Mal überhaupt, ein Mensch namens Louis-Ferdinand Destouches auf der Bühne, dieser Armenarzt aus der Pariser Banlieue, dieser Großschwätzer und aufgedonnerte Überfaschist, dieser bedauernswerte Verlierer an allen Fronten, dem so viel Gemeinheit widerfuhr und der so viel Gemeinheit in sich trug, dass die Gemeinheit zu seiner künstlerischen Methode wurde.
Es ist wohl so, dass Céline mit demProfessor Yseine geistige Überlegenheit über seine Zeitgenossen noch einmal, ein letztes Mal, fein säuberlich ableiten und vor dem Leser auftürmen wollte – ein Trash-Monument, der Zombie eines Monuments – natürlich. Aber doch ein Monument mit all seiner einseitigen Lügenhaftigkeit. Diesen rhetorischen Täuschungszusammenhang wie einen Radarschirm unterflogen zu haben, ist die nicht zu überschätzende Leistung der Inszenierung. Der Mythos Céline, dieses im großen Spaß des Mai 1968 untergegangene Geister- und Gegen-Frankreich wird in RosenbergsProfessor Yfür einmal beiseitegelassen, und worauf man trifft, ist ein derart vermenschlichter und präsenter und aktueller Céline, ist ein derartig intimes Kennenlernen einer literarischen Figur, dass ich mir in Zukunft diesen so berühmten und doch so unbekannten Céline als Herbert Sand werde vorstellen müssen. Als den Schauspieler Herbert Sand, als Mann im Frack und mit Stummfilmschminke, der in seinem Leben kein Glück gehabt hat und darauf besteht, dass wir von seinem Unglück Kenntnis nehmen. Als Mann, der sich Gemeinschaft gewünscht hat und die Menschen nicht ertrug, der Künstler sein wollte und den Kunstbetrieb hasste, der von gewaltigen Triumphen sprach und sich doch nur im Spiegelkabinett seiner Niederlagen verirrte.
Herbert Sand ist ein wunderbarer, charmanter, unbeirrbarer, anstrengender, selbstverliebter, herzzerreißender Schauspieler, der unser Wissen über Céline vergrößert und unsere Liebe zum Theater steigert. Am Ende, wenn die Bühne leer ist und die Schafe eines nach dem andern in Onitschs Stallbild laufen und sich an der Futterkrippe aufreihen, fast wie in einer Choreografie, fast als hätte eine geheime Regie am Boden unsichtbaren Lockstoff ausgelegt, ist einem seltsam leicht ums Herz. Herbert Sand geht ab, etwas Zeit vergeht, und die Schafe trippeln ins Bild und beginnen zu fressen.
Professor Y – nach Louis-Ferdinand Célines Gespräche mit Professor Y. Volksbühne Berlin. Mit: Herbert Sand. Regie: Ron Rosenberg. Fassung: Mottel Schuscha. Bühne und Video: Cornelius Onitsch. Dramaturgie: Katrin Wächter.
28.01.2008
Wenn die Psychoanalyse zweimal klingelt
Paare bei Wes Anderson
Dass Tiefsinn und Slapstick nicht die zwei entgegengesetzten Pole jener wirren Ansammlung von Gefühlszuständen und Zufällen bilden, die wirdas Leben