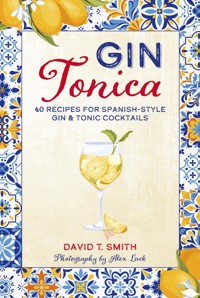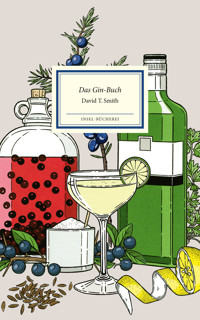
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Weltweit erlebt der Gin gerade eine beispiellose Renaissance und ist der Star in jeder Bar. Was liegt also näher, als mehr erfahren zu wollen über den Lieblingsdrink, über seine Geschichte, ungewöhnliche Brenntechniken und exotische Zutaten?
Der Liebhaber findet hier ein ABC des Gin, ein Handbuch, das alles Wissenswerte vermittelt, für den gelegentlichen Gin-Genießer ebenso wie für echte Gin-Nerds. Ob Bombay Sapphire, Hendrick’s oder Tanqueray; Negroni, Singapore Sling oder der klassische G & T: David T. Smith nimmt uns mit auf eine Reise durch die aufregende Geschichte der Kultspirituose, erklärt die unterschiedlichen Herstellungsmethoden, was die besten Botanicals sind und garniert das Ganze mit klassischen Cocktailrezepten.Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 161
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
David T. Smith
Das Gin-Buch
Alles Wissenswerte von Gin & Tonic bis Wacholder
Mit Illustrationen von Stuart Patience
Aus dem Englischen von Susanne Hornfeck
Insel Verlag
Das Gin-Buch
Einleitung
Gin ist ein höchst spannendes Thema, weil es eine Brücke von der Vergangenheit in die Zukunft schlägt. Gin hat sich in schwindelnde Höhen erhoben und ist in die Tiefen der Gosse gesunken, doch seinen Tiefpunkt erreichte er zweifellos gegen Ende des 20. Jahrhunderts, als er schlichtweg ignoriert wurde.
Heutzutage lässt sich vom Gin genau das Gegenteil sagen. Weltweit erlebt das Getränk eine beispiellose Renaissance und steigt immer weiter auf der Beliebtheitsskala. Möge dieser Trend noch lange anhalten.
Angesichts der illustren Geschichte, ganz zu schweigen von exotischen Zutaten und ungewöhnlichen Herstellungsmethoden, gerät, wer etwas mehr über seinen Lieblingsdrink erfahren will, in ein Labyrinth obskurer Begriffe und Definitionen.
Dieses Buch soll Klarheit schaffen und wendet sich an den gelegentlichen Gin-Trinker ebenso wie an Barkeeper, Destillateure und echte Gin-Nerds. Komplexe Zusammenhänge werden hier verständlich und amüsant dargestellt, sodass der Leser tief in die Welt des Gin eintauchen kann und mit einem besseren Verständnis für dieses faszinierende Getränk aus der Lektüre hervorgeht.
Meine eigene Begeisterung für Gin begann wie bei vielen anderen auch: Ich mochte ihn einfach. Zum Glück fiel diese persönliche Entdeckung in die Phase des neuerlichen Aufstiegs der Spirituose. Im Jahr 2005 begann ich mich eingehender für die vielen Erscheinungsformen des Getränks zu interessieren. Bereits ein Jahr später verkostete ich meinen hundertsten Gin, eine Marke, die zu knacken ich nie für möglich gehalten hätte.
Inzwischen kann ich die Zahl der neuen Gins, die ich probiert habe, längst nicht mehr genau beziffern – es dürften rund fünfzehnhundert aus nahezu fünfzig Ländern sein. Heute verbringe ich meine Zeit hauptsächlich damit, meine Leidenschaft mit anderen zu teilen, neue und historische Brennverfahren und Rezepturen zu erforschen und Destillateuren zu perfekten Gin-Kreationen zu verhelfen, sei es in kleinen Start-ups oder in multinationalen Konzernen.
Ein Buch über Gin zu schreiben, war mir schon deshalb ein Vergnügen, weil es über diesen vordergründig so schlichten Drink so viel Interessantes zu berichten gibt: seine illustre Geschichte, die unterschiedlichen Sorten, Herstellungsmethoden, Craft-Brennereien und vieles mehr. Man kann sich in dem Thema buchstäblich verlieren und auf jeder Seite neue, unbekannte Fakten entdecken. Einige Details in diesem Buch – und das war das Spannende daran – waren für mich genauso neu, wie sie es für die Leser sein dürften.
Ich hoffe, dass dieses Lexikon eine nützliche Ergänzung zu einem tieferen Blick ins Gin-Glas sein kann, ganz gleich ob Sie gerade erst die Bekanntschaft Ihres Lieblingsgetränks machen oder bereits ein kenntnisreicher Gin-Trinker sind. Lassen Sie sich erklären, was es mit dieser wunderbaren Spirituose auf sich hat.
A
Aged Gin | SORTE
SIEHE AUCH: Negroni | Roter Wermut | Sipping Gin | Yellow Gin
Ein in oder mit Holz gereifter Gin, wobei Holzfässer, Holzspäne oder einzelne Fassdauben benutzt werden. Es gibt zwei Arten von gealtertem Gin: Yellow Gin, der nur einen geringen Einfluss von Holz erkennen lässt, und Sipping Gin, eine moderne und populäre Variante. Traditionellerweise erfolgt der Reifeprozess durch Lagerung in Fässern aus frischem Eichenholz oder solchen, die zuvor bereits in Gebrauch waren (zum Beispiel Bourbon-Fässer, die eine würzige Süße abgeben). Diese Gins bekommen eine zusätzliche geschmackliche Abrundung, zum Beispiel durch Weinaromen von Sherry, Port oder Wermut, die eine komplexe Fruchtigkeit beisteuern. Im Vergleich zu anderen Reifungsmethoden hat der Einsatz von Fässern den Vorteil, dass sie bereits vorhanden sind und Atmung und leichte Oxidation zulassen, für manche Experten ein entscheidender Faktor bei der Reifung.
Fassdauben oder Holzspäne bieten hingegen eine größere Vielfalt, zum Beispiel Kiefer, Mahagoni oder Pekan – Holzsorten, die sich nicht unbedingt zur Herstellung von Fässern eignen, weil sie entweder zu teuer, nicht verfügbar oder zu porös sind. Die meisten Gin-Trinker haben zur Reifung ein entspanntes Verhältnis und schätzen die verschiedenen Methoden wegen ihrer jeweils spezifischen Vorzüge.
Alkoholgehalt | HERSTELLUNG
SIEHE AUCH: Navy Strength Gin
Er gibt den Anteil des reinen Alkohols in der Gesamtmenge des Gemischs an, wird in Vol.-% (Volumenprozent) gemessen und entspricht der Volumenkonzentration reinen Alkohols bei 20 Grad Celsius. Wasser hat einen Alkoholgehalt von 0 Vol.-%, reiner Alkohol hat 100 Vol.-%. Der Mindestalkoholgehalt von Gin innerhalb der Europäischen Union (EU) beträgt 37,5 Vol.-%, in den USA sind es 40,0 Vol.-%. Wird Alkohol in einem Destillationsapparat hergestellt, so verfügt er zunächst über etwa 86 Vol.-% und muss deshalb auf Trinkstärke reduziert werden, bevor er in die Flasche kommt. Diesen Vorgang nennt man Proofing. Sobald dem Alkohol Wasser zugefügt wird, kommt es zu einer exothermen Reaktion, wobei Hitze freigesetzt wird. In den USA ist die Maßeinheit Proof eine weithin verbreitete Angabe des Alkoholgehalts von Spirituosen, allerdings ist sie freiwillig und muss in jedem Fall durch eine Angabe in Volumenprozent ergänzt werden. Das amerikanische Proof entspricht dem Doppelten des Alkoholgehalts in Volumenprozent, demnach sind 40 Vol.-% 80° amerikanische Proof. In Großbritannien gelten eigene Regeln; die Einheit Proof war vor der allgemeinen Einführung von Volumenprozent in Gebrauch. So entsprechen zum Beispiel 100° Proof (hundert Grad Proof) dort einem Alkoholgehalt von 57,15 Vol.-% (siehe auch Navy Strength Gin). Das britische Proof erhält man, indem man die Volumenprozente mit dem Faktor 1,75 multipliziert; 40 Vol.-% entsprechen also 70° britischen Proof.
Alpen-Gin | SORTE
SIEHE AUCH: Campari | Hernö | Kräuternote | Negroni | Roter Wermut
Eine Gin-Sorte, die in Alpenländern wie Deutschland, Österreich und der Schweiz hergestellt wird. Typisch sind präsente Zirben-, Kiefer- und Wacholderaromen, eine holzig-harzige Kräuternote und ein Hauch von Floralität. Im Vergleich zu anderen Gin-Sorten treten die Zitrusnoten hier in den Hintergrund. Die Idee zur Herstellung von Alpen-Gin entstand wohl in der Tradition der Kräuterschnäpse und -liköre, die dort gebrannt werden. Obwohl diese Sorte meist mit der Alpenregion in Verbindung gebracht wird, sind ähnliche Geschmacksprofile auch bei Herstellern in skandinavischen Ländern wie Norwegen, Schweden, Finnland und Island beliebt. Solche Gins bestechen durch ihren starken Ausdruck und harmonieren auch mit geschmacksintensiven Ingredienzien wie Campari oder rotem Wermut, zum Beispiel in einem herben Negroni-Cocktail.
Anethol | CHEMISCHE VERBINDUNG
SIEHE AUCH: Louche-Effekt | Myrthe | Sternanis | Süßholzwurzel
Eine organische Verbindung, auch bekannt als Anisöl, die zu den Phenylpropanoiden gehört. Ihr starkes Aroma findet sich in vielen Botanicals, die dem Gin seinen typischen Geschmack geben. Außerdem ist ihre Süße zehnmal stärker als die von Zucker. Anethol kommt in der Natur häufig vor, zum Beispiel in Anis und Fenchel, und sorgt dort für das charakteristische Aroma. Man findet es auch in Süßholz, Sternanis, dem Anisbaum (Syzygium anisatum), Estragon, Basilikum und der Süßdolde. Die Verbindung lässt sich gut in Alkohol lösen, in Wasser jedoch weniger gut. Das führt zu dem charakteristischen Louche-Effekt, der milchigen Eintrübung, die man von Absinth, Ouzo, Pastis und in seltenen Fällen auch von Gin kennt.
Angosturabitter | COCKTAIL-ZUTAT
Ein aromatischer, nicht trinkbarer Cocktailbitter. »Nicht trinkbar« bezieht sich auf die Tatsache, dass er nicht zum Purgenuss geeignet ist, sondern in kleinen Mengen zum Aromatisieren von Drinks und zum Hervorheben anderer Zutaten verwendet wird. Das Rezept für Angosturabitter wurde zu Beginn des 19. Jahrhunderts von Johann Gottlieb Benjamin Siegert, dem deutschen Stabsarzt der venezolanischen Armee, als hochprozentiges Tonikum entwickelt. Siegert war damals in der Stadt Angostura (heute Ciudad Bolívar) stationiert, daher der Name. Angosturabitter sollte nicht mit Magenbitter verwechselt werden, der mit Angosturarinde, einer in Südamerika beheimateten Arzneipflanze, hergestellt wird, obwohl diese ihren Namen ebenfalls von der Stadt in Venezuela ableitet.
Ausgangsdestillat | HERSTELLUNG
SIEHE AUCH: Alkoholgehalt | Botanical-Rezeptur | Botanicals | Honig
Gin wird hergestellt, indem man neutralen Alkohol zusammen mit geschmacksgebenden Botanicals noch einmal destilliert. Dieser Alkohol wird Ausgangsdestillat oder auch Grundalkohol genannt; er ist das unbeschriebene Blatt, auf dem die botanischen Aromen ihren Duft und ihren Geschmack entfalten können. Viele Gin-Brennereien und praktisch alle großen Hersteller verwenden neutralen Alkohol aus hausfremder Produktion. Dieser Neutralalkohol wird meist aus Getreide gewonnen, auch Destillate aus Trauben, Trester oder Melasse werden benutzt. In Europa muss das Ausgangsdestillat für Gin 96 Vol.-% haben. Der Vorteil bei der Nutzung von Neutralalkohol ist, dass man sich die Anschaffung einer Column Still für das Säulenbrennverfahren spart, mit dem hohe Alkoholgehalte erzielt werden können. Manche Hersteller produzieren trotzdem ihr eigenes Ausgangsdestillat. Diese Praxis ist vor allem in den USA verbreitet. Der Vorteil des Verfahrens liegt darin, dass man größeren Einfluss auf das Produkt hat und auf Destillate zurückgreifen kann, die nicht aus dritter Hand stammen oder aus ungewöhnlichen Rohstoffen wie Honig oder Äpfeln gewonnen werden.
Charakteristika einiger Rohstoffe von Ausgangsdestillaten:
Weizen: sauber und neutral
Mais: sauber mit leichter Süße
Gerste: sauber mit einer leicht cremigen Würze
Gemalzte Gerste: sorgt für eine brotartige Note
Äpfel: frisch und spritzig mit leicht fruchtigem Bouquet
Trauben: floral und fruchtig
Melasse: weich und seidig mit leichter Süße
Honig: mild mit zäher Textur und floraler Süße.
Aviation | COCKTAIL
SIEHE AUCH: Crème de Violette | Eis | Gläser | Shaken / Shaking
Ein Cocktail, der Hugo R. Ensslin, dem Chef-Bartender des Wallick Hotels in New York zugeschrieben wird. Das Originalrezept verwendete El Bart Gin, ein populärer Zeitgenosse von Gordon’s und Plymouth zu Beginn der 1920er Jahre. Der Gin wird mit Zitronensaft, Maraschino und Crème de Violette gemixt, der er seine markante blaue Farbe verdankt. Um die Mitte des 20. Jahrhunderts war Crème de Violette nur schwer zu bekommen, daher verzichten manche Rezepte auf diesen Likör. Die Süße kommt stattdessen vom Maraschino, was allerdings nicht nur den Geschmack, sondern auch die Farbe des Cocktails verändert.
Rezepte für Aviation:
50 ml Gin
20 ml frischer Zitronensaft
10 ml Maraschino
10 ml Crème de Violette
Man gebe alle Zutaten in einen mit Eis gefüllten Cocktailshaker, schüttle gut durch und gieße den Drink durch ein Barsieb in ein Cocktailglas.
B
Bathtub Gin | SORTE
SIEHE AUCH: Compound Gin | Prohibition
Der Ausdruck Badewannen-Gin stammt aus den Anfangstagen der amerikanischen Prohibition in den 1920er Jahren. Man bezeichnete damit illegal hergestellten Compound Gin, der in den Flüsterkneipen getrunken wurde. Die genaue Herkunft des Begriffs liegt zwar im Dunkeln, es gibt aber zwei gängige Theorien. Die eine besagt, dass die Gefäße, in denen die Zutaten gemischt wurden, zu groß waren, um in einem Waschbecken befüllt zu werden, sodass man auf die Wasserhähne der Badewanne auswich; die andere meint, die Badewannen selbst seien wegen ihrer Größe dazu benutzt worden, um darin den Alkohol mit den verschiedenen Botanicals anzusetzen, ohne dass anschließend noch einmal destilliert wurde. Zunächst war es ein eher abwertender Begriff, bis 2011 die Firma Atom Supplies ein Produkt lancierte, das sie Bathtub Gin nannte. Grundlage ist ein relativ einfacher London Gin, der durch das Einlegen weiterer Botanicals aromatisiert wird. Diese Kreation erhielt viel Zuspruch in der Szene und hat das Image des Badewannen-Gin deutlich verbessert.
Bergamotte | CITRUS BERGAMIA | BOTANICAL
SIEHE AUCH: Bitterorange | Botanical-Rezeptur | Botanicals | Limette (Persische)
Eine Kreuzung aus Süßer Limette (Citrus limetta) und Bitterorange (Citrus aurantium), die bei der Aromatisierung mancher Gins Verwendung findet. Die Frucht hat etwa die Größe einer Bitterorange, ihre Schale ist aber auch im reifen Zustand grün. Das aus der Schale gewonnene ätherische Öl gibt dem Earl Grey Tee seinen charakteristischen Zitrusgeschmack. In der Gin-Herstellung wird die Bergamotteschale wegen ihrer blumigen Zitrusnote und leichten Bitterkeit geschätzt. Man kann sie entweder getrocknet oder in frischer Form zusetzen. Typische Beispiele für Gins mit Bergamotte als Botanical sind Fifty Eight Gin und Boxer Gin, beide aus London. Beim Fifty Eight Gin kommt Bergamotteschale aus hauseigener Verarbeitung zum Einsatz.
Bitter Lemon | COCKTAIL-ZUTAT
SIEHE AUCH: Chinin | Eis | Garnituren | Sloe Gin | Soda(wasser) | Tonic Water
Dieses Erfrischungsgetränk, auch bekannt als Lemon Tonic, ist eine Variante des Tonic Waters und wird den Bitterlimonaden zugerechnet. Es ist mit Zitrone, Limette, Zitronensäure und Chinin aromatisiert. Die Frühform des Getränks bestand schlicht aus einer Mischung von Schweppes Sodawasser und Limettensaft und wurde 1834 erstmalig schriftlich erwähnt. Schweppes hat Bitter Lemon zusammen mit Bitter Orange am 1. Mai 1957 auf den Markt gebracht. Bitter Lemon wird in der Regel allein als Erfrischungsgetränk konsumiert, obgleich sein im Vergleich zu Tonic Water eher säuerlicher Geschmack es zu einem guten Partner für süßliche Spirituosen und Liköre wie etwa Sloe Gin (Schlehenschnaps) macht. Der Long Pedlar ist eine Mischung aus Sloe Gin, Bitter Lemon und Eis. Sowohl der Name als auch der Drink wurden von der James Hawker and Co Ltd. in Plymouth in Verbindung mit ihrem Hawkers Pedlar Sloe Gin entwickelt. Auf diese Weise kann man Sloe Gin, ein typisches Getränk für die kältere Jahreszeit, auch bei warmem Wetter trinken.
Rezept für The Long Pedlar:
50 ml Sloe Gin
150 ml Bitter Lemon
Garnitur aus Zitrone und Limette
Man füllt ein Glas mit Eis, gießt Sloe Gin und Bitter Lemon darüber und garniert mit Zitrone und Limette im »Evans Style« (siehe Seite 54).
Bittermandel | PRUNUS DULCIS VAR. AMARA | BOTANICAL
SIEHE AUCH: Mandel | Bombay Spirits Company | Botanical-Rezeptur | Botanicals
Einige Varietäten des Mandelbaums produzieren Nüsse, die etwas kleiner und bitterer sind als die Süßmandel (Prunus dulcis var. dulcis). Sie sind in Asien und im Nahen Osten heimisch und als »Bittermandel« bekannt. Der Begriff wird gelegentlich auch zur Bezeichnung für die Steinkerne von Aprikosen (Prunus armeniaca), Pfirsichen (Prunus persica) oder Pflaumen (Prunus domestica) gebraucht. Das ätherische Öl der Bittermandel besteht zu ca. 95 Prozent aus Benzaldehyd. Früher wurde es häufiger als Zusatz in Speisen und Getränken, einschließlich Gin, verwendet, doch Gebrauch und Verfügbarkeit wurden wegen der Anteile an hochgiftigem Cyanwasserstoff (Blausäure) mittlerweile stark eingeschränkt. Die Bittermandeln kommen meist aus den USA oder aus Spanien. Beispiele für Gins mit Bittermandel als Botanical sind Beefeater, Bombay Dry Gin und Oxley.
Bitterorange | CITRUS x AURANTIUM | BOTANICAL
SIEHE AUCH: Botanical-Rezeptur | Botanicals | Gordon’s | Kardamom | Limonen | Linalool | Orange | Zimtkassie | Zitrusnote
Diese Zitrusfrucht, auch bekannt als Pomeranze oder Sevilla-Orange, ist als Aromastoff in vielen Gins enthalten. Wie ihre Cousine, die Orange, ist sie eine Kreuzung zwischen Pomelo und Mandarine. Sie stammt aus Südostasien und wurde im 10. Jahrhundert nach Spanien eingeführt. Varietäten des Baums wachsen weltweit in zahlreichen Ländern. Die Schale der Bitterorange verfügt über ein starkes Aroma und eine markante Bitterkeit. Sie wird gern zu Marmelade verarbeitet. Auch bei der Aromatisierung von Getränken, insbesondere Spirituosen und Likören, findet sie Verwendung; sie ist der Hauptbestandteil von Orangenbitter. Unter den für das Aroma der bitteren Schale verantwortlichen chemischen Verbindungen sind vor allem Limonen, Myrcen und Linalool zu nennen. Wird sie dem Gin als Botanical zugesetzt, sorgt sie, ähnlich der Orange, für würzige Vollmundigkeit, jedoch mit einer tieferen, dunkleren Note und unverkennbarer Bitterkeit. Sie harmoniert gut mit anderen süßlichen Botanicals wie Zimtkassie und Kardamom. Wegen ihrer Intensität sollte man die Bitterorange als Gin-Botanical allerdings sparsam verwenden. Die Schale kann frisch zugesetzt werden, kommt aber meist getrocknet zum Einsatz. Beispiele für Gins mit Bitterorange sind Gordon’s, Hayman’s London Dry Gin, City of London Dry Gin und Sipsmith.
Blended Gin | SORTE
SIEHE AUCH: Botanical-Rezeptur | Botanicals | London Gin | Rotationsverdampfer | Vakuumdestillation
Ein Gin, bei dem jedes Botanical in einem separaten Lauf destilliert wird und man die Destillate am Ende zum gewünschten Geschmacksprofil vermischt. Manche Destillateure fassen sie auch in Gruppen zusammen, etwa verschiedene Arten von Zitrusschalen oder Blüten, die dann gemeinsam destilliert werden. Verfechter von Blended Gins sind der Ansicht, dass die Methode dem Produkt eine größere Ausgewogenheit und Stimmigkeit verleiht, als das bei traditionellen Brennverfahren möglich ist. Außerdem kann der Destillateur dabei besser beeinflussen, in welchem Maß den Botanicals Aromen und Geschmacksstoffe entzogen werden, zum Beispiel indem er Mazerationszeit, Temperatur und den Alkoholgehalt jeder Charge genau festlegt und die Aggressivität des Brennvorgangs für jedes Botanical oder jede Botanical-Gruppe einzeln festlegen kann. Bei frischen Blättern oder Blüten wird die Brennblase auf niedrige Temperaturen eingestellt, damit es nicht zu einem Verkochen der Geschmacksstoffe kommt. Es lässt sich allerdings darüber streiten, ob Blended Gin gemäß der EU-Spirituosenverordnung noch zu den London Gins gerechnet werden kann. Das Problem besteht darin, dass bei der Verabschiedung der Richtlinie im Jahr 2007 noch kein Brenner diese Methode angewandt hat. Beispiele für Blended Gins sind Sacred, Sloane’s und Gin Mare.
Bombay Spirits Company | MARKE
SIEHE AUCH: Bergamotte | Botanical-Rezeptur | Botanicals | Dampfdestillation | Greenall’s | Kubebenpfeffer | London Gin | Paradieskörner | Schwarzer Pfeffer | Zitronengras |
Die Geschichte der Marke Bombay Gin reicht ins Jahr 1957 zurück, als der New Yorker Anwalt Allan Subin beschloss, in den USA eine neue Gin-Marke zu lancieren. Das Produkt sollte eine dezidiert englische Note haben, und er beauftragte die Greenall’s Destillery, ihm einen getreidebasierten, geschmacksschonend destillierten Gin nach ihrem Rezept von 1761 zu brennen. Diese Spirituose kam 1960 unter dem Namen Bombay Dry Gin auf den Markt; 1964 wurden 10.000 Kisten jährlich umgesetzt, 1970 waren es bereits 100.000 Kisten. 1980 wurde die Firma an International Distillers and Vintners verkauft.
Doch Ende der Siebziger kam der Gin aus der Mode; man trank lieber Wodka, ein Trend, der sich in den Achtzigern mit der Einführung von Absolut Vodka fortsetzte. Bombay reagierte darauf mit der Entwicklung von Bombay Sapphire. Die Marke hat ihren Namen vom Star of Bombay, dem berühmten blauen Saphir, der auch die Idee für die kultige blaue Flasche lieferte. Mit zwei neuen, exotischen Botanicals – Kubebenpfeffer und Paradieskörner – war Bombay Sapphire der erste echte Luxus-Gin. Durch seinen weichen, durch schonende Dampfdestillation erzielten Geschmack gewann der Gin zahlreiche neue Liebhaber.
1997 wurde die Marke von Diageo an Bacardi verkauft, und 2011 brachte Bombay Spirits mit Bombay Sapphire East einen Gin speziell für den amerikanischen Markt heraus. Er war mit zusätzlichen Botanicals wie Zitronengras und schwarzem Pfeffer aromatisiert. 2014 folgte ein Aged Gin namens Bombay Amber, dessen Produktion allerdings noch im selben Jahr wieder eingestellt wurde. Zur gleichen Zeit eröffnete man die Bombay Sapphire Distillery in Laverstoke Mill, Hampshire England. Ein Jahr später wurde dort Star of Bombay entwickelt, bei dem die traditionelle Botanical-Rezeptur um Bergamotte und die Samen des Bisameibisch (Abelmoschus) erweitert wurde. Dieser Gin wurde 2016 anlässlich der International Wine and Spirit Competition mit der London Dry Gin Trophy ausgezeichnet.
Booth’s | MARKE
SIEHE AUCH: Aged Gin | Gin House | London Gin | Martini | Sipping Gin | Yellow Gin
Eine Gin-Marke und ein Gin House, gegründet um 1740 von John Booth, dem Vater von Sir Felix Booth. Das Erkennungsmerkmal der Marke ist der charakteristische rote Löwe auf dem Etikett. Die Firma findet sich erstmals unter dem Namen Philip Booth & Company Distillers of Clerkenwell in einem Branchenverzeichnis von 1778. Sie blieb bis 1896 in Familienbesitz und wurde dann in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Inzwischen gehört sie dem weltweit tätigen Getränkehersteller Diageo. In den 1920er und 1930er Jahren expandierte Booth’s durch die Übernahme von Boord’s Gin. Die Destillerie produzierte zwei London Dry Gins unter dem Booth’s Lable: Booth’s Finest (House of Lords) und Booth’s High and Dry.
Angeblich soll Booth’s House of Lords entstanden sein, als man einen im Fass gelagerten, fertigen Gin vergaß. Als man ihn probierte, stellte man fest, dass ihm das Holz einen milden Geschmack verliehen hatte. Daraufhin ging man bei Booth’s dazu über, einen der Dry Gins absichtlich einem Reifungsprozess von mehreren Wochen zu unterziehen. Dazu benutzte man ehemalige Sherryfässer, wechselte dann aber in den Achtzigern zu Burgunderfässern. In den frühen Neunzigern wurde die Produktion von Booth’s Finest eingestellt. Alte Werbeanzeigen verweisen auf seine goldene Farbe und bezeichnen ihn als »unerlässlichen Bestandteil eines perfekten Martini«. In den 1990er Jahren war Booth’s High and Dry nur noch in den USA erhältlich; dort wurde er in einer Plastikflasche als Billigprodukt vermarktet. 2016 ließ Booth’s seinen House of Lords im Premiumsegment wieder auferstehen. Er bekam eine dekorative Glasflasche und wird in ehemaligen Sherryfässern zu einem intensiv gereiften Gin ausgebaut.