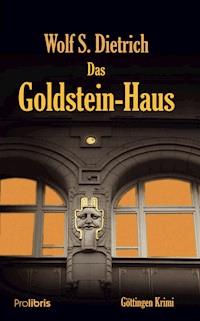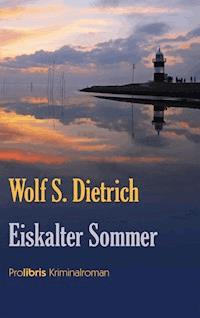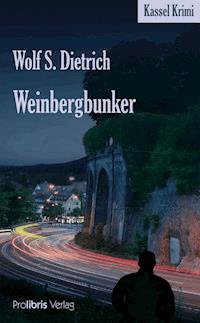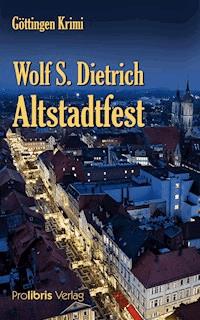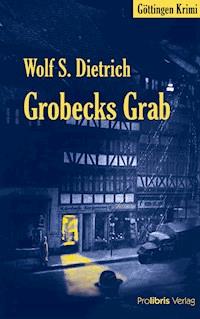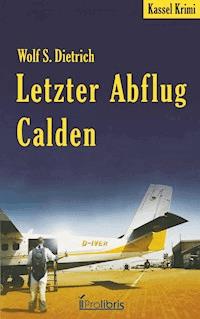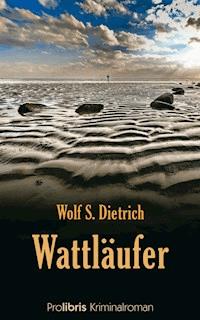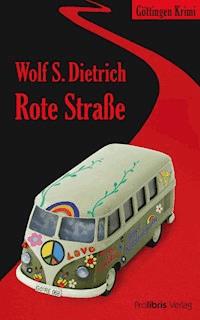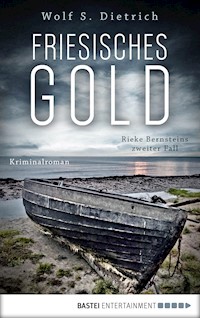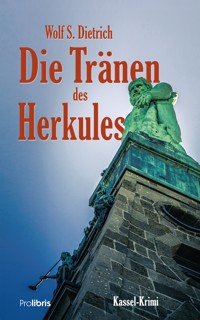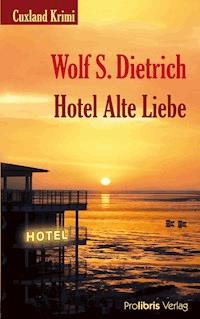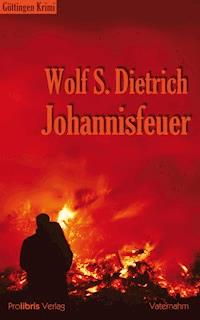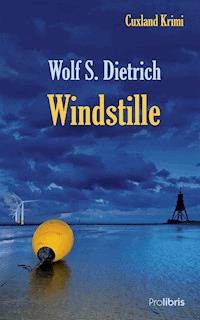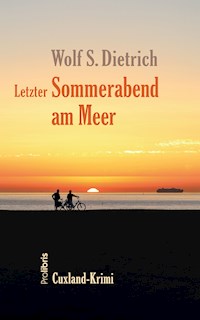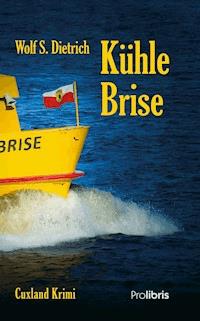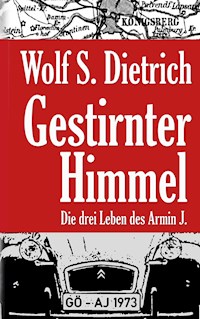1
»In zwei Stunden bin ich zurück.« Susanne Rudloff stand in der Schlafzimmertür und sah ihren Mann besorgt an. »Nur ein paar Einkäufe. Kannst du so lange allein bleiben?«
»Selbstverständlich«, murmelte Jörg, der den Blick aus dem Fenster gerichtet hatte. Er schüttelte kaum wahrnehmbar den Kopf. »Ich bin doch kein Pflegefall.« Seit ihn diese seltsame Lähmung befallen hatte, waren ihm nur wenige Bewegungen selbständig möglich. Mit einiger Mühe konnte er Hände und Arme benutzen und seinen Rollstuhl durch die Räume im Erdgeschoss manövrieren. Er hatte gelernt, sich hochzustemmen und auf der Toilette
niederzulassen. Oder sich ins Bett zu rollen. Er konnte ein Bier aus dem Kühlschrank holen oder eine kleine Mahlzeit zubereiten. Darum weigerte er sich,
eine Rehabilitationsklinik aufzusuchen oder professionelle häusliche Pflege anzunehmen. Die wöchentlichen Besuche des Arztes akzeptierte er widerwillig, seinen Status als
Pflegebedürftiger jedoch keineswegs. Als großes Glück erwies sich nun, dass sich die meisten Räume auf einer Ebene befanden. Auch Garage und Terrasse ließen sich mit dem Rollstuhl erreichen. Nur Autofahren konnte er nicht. Und der Weg
in die Einliegerwohnung blieb ihm versperrt.
»Also gut. Bis nachher.« Susanne schlüpfte in eine Jacke, griff nach ihrer Handtasche und verließ das Haus. Kurz nachdem die Tür zugefallen war, hörte Jörg Rudloff, wie der Motor des kleinen Smarts gestartet wurde und der Wagen aus
der Einfahrt rollte. Er schloss die Augen und sah Susanne in die Hannoversche
Straße einbiegen. Wahrscheinlich fuhr sie wieder zu schnell, durchquerte Weende in
Rekordzeit, beschleunigte den Kleinwagen auf achtzig Stundenkilometer und
erreichte wenige Minuten später das Parkhaus im Carré. Von dort aus würde sie die Weender Straße entlangschlendern, bei Cron & Lanz einen Cappuccino trinken und dann die Geschäfte und Boutiquen aufsuchen, deren Namen er sich nie merkte. Rudloff seufzte.
Was würde er dafür geben, durch die Fußgängerzone laufen zu können. Selbst wenn Susanne ihn in Läden schleppte, die ihn nicht wirklich interessierten.
In seine Vorstellung vom Leben und Treiben in der Göttinger Innenstadt mischte sich ein Ton, der nicht zu den Bildern passte. Er öffnete die Augen und lauschte. Ein Kratzen oder Schaben, wie von einem Hund oder
einer Katze, drang vom Flur her an seine Ohren. Unwillig schüttelte Rudloff den Kopf. Wer machte sich an der Haustür zu schaffen? Der Postbote kam gewöhnlich später. Im nächsten Augenblick gab es ein vertrautes Geräusch. Die Tür sprang auf und fiel wieder ins Schloss. Also war Susanne zurückgekommen. Wahrscheinlich hatte sie ihr Portemonnaie vergessen. »Suse«, rief er, »bist du’s?«
Statt seiner Frau trat ein Mann ins Zimmer. Er trug dunkle Kleidung, Handschuhe
und eine Sturmhaube mit Seeschlitzen für die Augen. »Nicht erschrecken«, sagte er. »Ich bin gleich weg.« Mit wenigen Schritten war er am Rollstuhl, ließ einen Rucksack von den Schultern gleiten und zog ein Fahrradschloss hervor.
Damit blockierte er eins der Räder. »Wenn Sie vernünftig sind, passiert Ihnen nichts«, versicherte er.
Rudloff wollte schreien, doch seine Lunge war zu geschwächt, die Stimme kraftlos. Er schloss seinen Mund wieder. »Was wollen Sie?«, krächzte er schließlich.
»Mich ein wenig umschauen.« In aller Ruhe öffnete der Fremde Schranktüren, durchstöberte Fächer und Schubladen, suchte gründlich und systematisch. In Susannes barockem Sekretär wurde er fündig und breitete rasch den Inhalt ihrer Schmuckkästen auf der Schreibtischplatte aus. Zielsicher trennte er Gold- und
Diamantschmuck von minderwertigeren Ketten, Ringen und Ohrringen, ließ die teuer erworbenen oder ererbten Stücke in den Rucksack gleiten. Dann fuhren seine Finger über das Möbelstück, suchten nach Vertiefungen, Knöpfen oder beweglichen Teilen. Das Geheimfach durfte er nicht finden. Eigentlich
hätten die wertvollsten Schmuckstücke dort aufbewahrt werden sollen. Doch Susanne war mit den Jahren nachlässig geworden und hatte es immer seltener genutzt. Nur der Schlüssel für den Safe lag noch darin. Rudloff stockte der Atem, als sich der Mann auf den
Boden kniete und seine Hände dem verborgenen Hebel gefährlich nahe kamen.
Er warf Rudloff einen prüfenden Blick zu, nickte und verstärkte seine Bemühungen. Schließlich sprang der Riegel auf, ein Fach kam zum Vorschein, und im nächsten Augenblick hielt die behandschuhte Hand den Schlüssel in die Höhe. »Wo ist der Tresor?«, fragte der Fremde und richtete sich auf.
Rudloff presste die Lippen zusammen und schüttelte kaum merklich den Kopf. Schlimm genug, dass Susanne ihren Schmuck
verlieren würde. Im Tresor lagerte eine hohe fünfstellige Summe. Schwarzgeld. Den Verlust würde er weder der Polizei noch der Versicherung melden können. Fieberhaft suchte Rudloff nach einer Möglichkeit, den Mann in die Irre zu führen.
»Es gibt hier keinen Tresor«, flüsterte er heiser. »Der Schlüssel gehört zum Safe in meinem ehemaligen Büro.«
»Und die Erde ist eine Scheibe.« Der Einbrecher hielt plötzlich ein Messer in der Hand. »Dann warten wir auf die Dame des Hauses.« Er ließ sich in einen Sessel fallen. »Einer von euch wird es mir verraten. Eine Messerklinge am Hals bringt jeden zum
Reden.«
Jörg Rudloff schwieg. Während der nächsten Minuten herrschte Stille. Bis plötzlich das Telefon klingelte. Automatisch griff er in die Speichen des
Rollstuhls, doch der drehte sich nur um das blockierte Rad.
Ohne Eile erhob sich der Fremde, durchquerte das Wohnzimmer und warf einen Blick
auf das Display des Apparats, der neben dem Sekretär auf einem Tischchen aus Kirschholz stand. »Mobilfunknummer«, murmelte er. »Vielleicht die Gattin?«
Wenig später meldete sich der Anrufbeantworter, und dann klang Susannes Stimme durch den
Raum. »Hallo Jörg, warum nimmst du nicht ab? Ist alles in Ordnung? Stell dir vor, bei Kolbergs
wurde eingebrochen. Gerade habe ich Barbara getroffen. Sie ist völlig fertig. Über die Terrassentür sind die, haben den gesamten Schmuck, und das in Nikolausberg! Du musst überall abschließen! Ich habe jetzt gar keine Ruhe mehr zum Einkaufen, hole noch die Medikamente
für Vater aus der Apotheke, dann fahre ich nach Hause. Bis gleich!«
Der maskierte Mann nickte. »Wir kommen der Sache näher.« Seine Hand verschwand im Rucksack und brachte eine Rolle Klebeband zum
Vorschein. »Ich muss Ihnen leider den Mund verbieten.«
Rudloff spürte die Panik in sich. Was geschehen würde, ließ sich voraussehen. Sobald Susanne das Haus betrat, würde der Verbrecher ihr das Messer an die Kehle setzen. Dann musste Jörg Rudloff sich entscheiden. Traute er dem Einbrecher zu, ernst zu machen? Dann
müsste er ihm verraten, wo sich der Safe befand. Oder würde der Kerl davor zurückschrecken, Susanne ernsthaft zu verletzen?
Der Tresor war im Arbeitszimmer eingemauert. Dafür hatte er beim Bau des Hauses gesorgt. Vor über dreißig Jahren. Entsprechend alt war die Technik. Stabil, aber mit dem Schlüssel leicht zu öffnen.
Seine Gedanken wurden unterbrochen, als das Klebeband seine Lippen berührte und sie gegen die Zähne presste.
»Du hast nicht abgeschlossen«, rief Susanne in vorwurfsvollem Ton, als sie im Flur ihre Taschen abstellte und
die Schlüssel in die Schale aus Muranoglas fallen ließ. »Man sollte das ernst nehmen, hat Barbara gesagt. Die Polizisten haben ihr sogar
geraten …« Mit einem Schreckenslaut brach sie ab. Entsetzt starrte sie auf die unheimliche
Erscheinung, die plötzlich neben ihr stand und ihren Oberarm mit eisernem Griff umfasste. Vor ihren
Augen blitzte ein metallischer Gegenstand auf. Eine Messerklinge.
»Ganz ruhig!«, sagte eine Stimme dicht an ihrem Ohr. »Wir unterhalten uns jetzt ein wenig.« Er dirigierte sie durch den Flur ins Wohnzimmer.
»Mein Schmuck!«, schrie Susanne, als sie die offenen Schübe des Sekretärs entdeckte. »Das sind Erbstücke. Von meiner Großmutter. Sie dürfen nicht …«
»Ich darf noch viel mehr«, unterbrach sie der maskierte Mann und stieß sie in Richtung Rollstuhl.
»Jörg!«, rief sie, »was hat er mit dir …?« Sie brach ab, als ihr klar wurde, dass er nicht sprechen konnte.
An seiner Stelle antwortete der Einbrecher. »Einer von euch sagt mir jetzt, wo der Tresor ist.«
Susanne schüttelte den Kopf. »Niemals!«
Der Fremde stieß einen Lacher aus. »Also gibt es ihn. Danke für die Information. Ich finde ihn sicher auch allein. Aber das kann dauern. Für die Zeit muss ich euch fesseln und notfalls knebeln. Das überlebt nicht jeder. Besser, ihr lasst es nicht darauf ankommen.«
Susanne spürte die Spitze der Messerklinge an ihrem Hals. Voller Entsetzen starrte sie
ihren Ehemann an. Ihre Stimme zitterte. »Ich weiß nicht, wo sich der Tresor befindet. Das hat mein Mann immer geheim gehalten.
Ich glaube, er ist im Keller.«
»Das haben wir gleich«, knurrte der Maskierte. Sein Griff um Susannes Oberarm verstärkte sich. Die Klinge fuhr unter das Klebeband an Jörgs Mund und entfernte es mit einer schnellen Bewegung. »Also los! Zuerst schlitze ich ihr die Ohrläppchen auf. Dann die Wangen. Gibt wunderschöne Narben.«
Susanne drohten die Beine einzuknicken, ihr Puls raste, über den Nacken kroch kalter Schweiß, Schwindelgefühl verbreitete sich im Kopf. »Jörg! Tu etwas!«
Rudloff biss sich auf die Lippen. Plötzlich schrie Susanne auf. Blut rann über eine Wange und den Hals, versickerte als rotes Rinnsal im Ausschnitt ihres
Kleides. Ein Ohrring fiel zu Boden. Mit der Messerspitze hatte der Mann ihn aus
dem Ohrläppchen gerissen.
»Also gut«, keuchte Rudloff. »Im Arbeitszimmer. Hinter dem Monet. Das ist das Bild mit dem blauen Himmel über einer grünen Landschaft, in der eine Frau mit Strohhut …«
Der Maskierte steckte das Messer ein, zog erneut Klebeband hervor und umwickelte
Susannes Handgelenke. Dann stieß er sie zum Sofa und fesselte auch ihre Füße. Wenig später vernahm sie Geräusche aus dem Arbeitszimmer. Das Bild polterte zu Boden, ein vertrautes
Quietschen erklang, als die Tür des Tresors geöffnet wurde. Sie hörte ein zufriedenes Grunzen. Mit Tränen in den Augen und voller Verzweiflung sah sie Jörg an. »Was machen wir jetzt?«, flüsterte sie. Ihr Mann zuckte mit den Schultern. »Hoffentlich nimmt er nur das Geld.«
»Nur?« Mit offenem Mund starrte Susanne ihn an. »Was soll das heißen: nur das Geld?«
Rudloff antwortete nicht, vermied es, seine Frau anzusehen, und heftete seinen düsteren Blick vor sich auf den Boden.
»Jörg! Sprich mit mir! Was ist noch im Tresor?«
Ihr Mann schüttelte nur stumm den Kopf. In dem Augenblick hasteten Schritte über den Flur, im nächsten Moment fiel die Haustür ins Schloss.
»Der ist weg«, stellte Susanne erleichtert fest und zerrte an ihren Fesseln. »Jetzt schnell, die Polizei anrufen. Irgendwie muss ich diese Dinger loswerden.
Wusste gar nicht, dass Klebeband so stabil …«
»Nein«, flüsterte Rudloff. »Keine Polizei.«
Susanne war es gelungen, aufzustehen. Sie schwankte auf ihren gefesselten Beinen
und ruderte mit den zusammengebundenen Armen, um das Gleichgewicht zu halten. »Was ist in dich gefahren?«, rief sie. »Selbstverständlich rufen wir die Polizei. Ich will meine Sachen wiederhaben. Die sollen das
Schwein fassen und mir den Schmuck zurückbringen.« Sie hüpfte zum Sekretär, fand einen Brieföffner, klemmte den Griff zwischen die Zähne und begann an ihren Fesseln zu säbeln. Rasch aufsteigende Wut verlieh ihr ungeahnte Kräfte. Nach wenigen Sekunden war sie frei und griff zum Telefonhörer.
»Warte!«, befahl Jörg. »Schau erst mal in den Tresor! Wenn du ganz hinten eine flache Schachtel findest,
die sich ziemlich schwer anfühlt, kannst du anrufen.«
Kopfschüttelnd verließ Susanne den Raum. »Hier liegt eine Schachtel auf dem Boden«, rief sie kurz darauf. »Aber die ist leer. Das Geld ist jedenfalls weg. Ich gehe schnell ins Bad. Danach
telefoniere ich.«
»Bitte befrei mich vorher aus diesem Karussell. Im Keller ist ein
Bolzenschneider. Damit …« Er brach ab, als die Tür zum Badezimmer zugeschlagen wurde, und sackte seufzend in sich zusammen. Wie
sollte er Susanne erklären, welche Gefahr von dem Inhalt der Schachtel ausging, den der Einbrecher
offenbar mitgenommen hatte? Ungeduldig zerrte er an den Rädern des Rollstuhls. »Susanne!«, rief er so laut wie möglich, doch sie reagierte nicht. Verärgert ließ er die Arme hängen und verfluchte die Abhängigkeit, in die er durch die Lähmung geraten war.
Als Susanne endlich zurückkehrte, hatte sie das blutende Ohrläppchen mit einem Pflaster versehen und sich umgezogen. In der einen Hand hielt
sie den Bolzenschneider, in der anderen ihr Smartphone. »Ich habe die Polizei angerufen. Sie kommt gleich.«
Jörg Rudloff schloss die Augen und ließ den Kopf nach vorn sinken. »Ich kann nur hoffen, dass die nicht groß ermitteln.«
»Mir reicht’s jetzt!« Der Bolzenschneider landete polternd auf dem Parkett. »Gerade hat einer meinen gesamten Schmuck geklaut, und du willst keine
Ermittlungen? Bist du von Sinnen? Du sagst mir sofort, was los ist!« Sie deutete auf das blockierte Rad des Rollstuhls. »Oder du fährst weiter im Kreis herum.«
»Das gibt ein Unglück«, stöhnte Jörg. »Der … Einbrecher hat etwas mitgenommen, das mir gefährlich werden kann.«
»Du sprichst in Rätseln«, fauchte Susanne. »Etwas Gefährliches in einer Schachtel? Was soll das sein? Und wenn ...« Sie zuckte mit den Schultern. »Jetzt ist es eh weg.«
»Es ist nicht weg«, zischte Rudloff. »Es ist … in den falschen Händen.«
»Belastende Papiere«, mutmaßte Susanne. »Aus deinen krummen Geschäften. Kontoauszüge! Ja, die würden in so eine Schachtel passen.« Sie nickte und machte eine wegwerfende Handbewegung. »Die schmeißt der Typ weg. So einem geht es nur um Geld. Und davon hat er ja jetzt
reichlich. Und wenn er meinen Schmuck verkauft …« Susannes Stimme wurde zittrig.
Jörg Rudloff ergriff die Chance. »Wahrscheinlich hast du Recht! Aber wenn er die Brisanz der … Auszüge … erkennt, wird er versuchen, uns zu erpressen. Oder – noch schlimmer – die Polizei schnappt den Einbrecher und findet bei ihm die … Unterlagen. Das kann nur in einer Katastrophe enden.«
»Du liest zu viele Krimis.« Susanne schüttelte energisch den Kopf und bückte sich nach dem Bolzenschneider. »Jetzt machen wir erst mal dieses Ding da weg. Und dann erklärst du mir, worin die Katastrophe bestehen soll.«
»In Ordnung«, stimmte Rudloff zu. »Aber vorher brauche ich einen Whisky.«
Nachdem der Hausherr den Inhalt eines Glases hinuntergestürzt hatte und sein Rollstuhl wieder frei beweglich war, erfand er eine
komplizierte Transaktion, die sich aus den verschwundenen Papieren erschließen lassen konnte und schließlich auch den nicht ganz korrekten Ablauf seines bereits Jahre zurückliegenden Insolvenzverfahrens ans Licht bringen würden. »Wenn das alles rauskommt«, schloss er, »sind wir finanziell und gesellschaftlich ruiniert, und ich wandere ins Gefängnis. Uns bleibt nur eine Lösung.«
»Und die wäre?«, fragte Susanne.
»Wir müssen aus dem Raubüberfall einen relativ harmlosen Einbruchdiebstahl machen. Dann gibt es keine großen Ermittlungen.«
»Was heißt das? Schließlich ist mein Schmuck weggekommen.«
»Dafür findet sich schon eine Lösung. Und selbst wenn wir ihn nicht zurückbekommen, ist das immer noch besser als …«
»Und das Bargeld?«, unterbrach Susanne ihren Mann.
»Das müssen wir abschreiben.«
»Bist du von Sinnen?« Voller Empörung ergriff Susanne die Oberarme ihres Mannes und schüttelte sie. »Achtzigtausend Euro! Willst du auf das Geld verzichten?«
Rudloff zuckte mit den Schultern. »Achtzigtausend ersetzt uns keiner. Wenn sich die Summe herumspricht oder gar in
der Zeitung steht, macht das Finanzamt uns Ärger. Also werden wir den Tresor nicht erwähnen.«
»Aber mein Schmuck«, murmelte Susanne. »Das sind doch wertvolle Stücke.«
»Die bekommst du zurück«, versicherte ihr Mann. »Auch ohne die Hilfe der Polizei. Ich kümmere mich darum. Jetzt kommt es erst einmal darauf an, dass wir keinen Fehler
machen, wenn die Polizisten uns befragen. Wir sagen, dass es um Werte von
einigen hundert Euro geht. Du warst nicht im Haus, als der Einbrecher gekommen
ist. Ich war im Bad und habe nichts gehört.« Er deutete auf das verletzte Ohr seiner Frau. »Falls einer danach fragt, ist das Ohrläppchen eingerissen, als du mit einem Ohrring irgendwo hängen geblieben bist, zum Beispiel im Garten. Hast du alles verstanden?«
Susanne war nicht überzeugt, aber sie nickte. In dem Augenblick klingelte es an der Haustür.
*
Nachdem Jörg Rudloff den Vorfall geschildert und den Wert des gestohlenen Schmucks mit
neunhundert Euro angegeben hatte, machten die Beamten Aufnahmen von den
Einbruchsspuren an der Haustür und von den aufgebrochenen Fächern am Sekretär. »Sie bekommen Nachricht von uns, wenn wir den Täter gefasst haben oder wenn es Hinweise auf den Verbleib Ihres Schmucks geben
sollte«, informierten sie Rudloff schließlich. Man merkte ihnen an, dass sie das Prozedere schon häufig erklärten hatten. »Falls das Verfahren eingestellt wird, erhalten Sie eine Mitteilung der
Staatsanwaltschaft. Und denken Sie daran, alle Außentüren abzuschließen. Auch wenn Sie zu Hause sind.« Nach dieser Ermahnung verabschiedeten sie sich.
Susanne befühlte das Ohrläppchen, das sie provisorisch mit einem Pflaster versehen hatte. »Ich geh zum Arzt«, murmelte sie. »Damit das richtig verbunden wird und wieder ordentlich zusammenwächst«
Ihr Mann nickte abwesend. In Gedanken arbeitete er an einer Lösung. Er würde jemanden beauftragen, sich in einschlägigen Kreisen umzuhören. »Ich muss telefonieren.« Er rollte aus dem Raum, überquerte den Flur zum Arbeitszimmer und schloss die Tür hinter sich. Aus der Schublade seines Schreibtischs zog er ein abgegriffenes
Notizbuch, in dem er die persönliche Nummer seines Rechtsanwalts notiert hatte. Nur für Notfälle, hatte sein Freund Frank Seibold gesagt. Dies war ein Notfall. Er wartete,
bis Susanne das Haus verlassen hatte, dann griff er zum Telefon und wählte.
»Da kann ich dir auch nicht weiterhelfen«, sagte Seibold, nachdem Rudloff ihm die Situation erklärt hatte. »Aber ich kann dir einen Privatdetektiv empfehlen. Julian Pawlowski. Stammt aus
Berlin, hat weitere Büros, eines in Göttingen, wo er sich inzwischen mehr oder weniger zur Ruhe gesetzt hat. Hat gute
Leute, die für ihn arbeiten. Doch hin und wieder übernimmt er noch einen Auftrag. Jedenfalls wenn ich ihn darum bitte. Soll ich
ihn anrufen?«
»Ich wäre dir dankbar«, antwortete Rudloff. »Ich weiß nicht, was ich sonst tun könnte.«
»Gut. Er wird sich bei dir melden. Viel Glück!« Seibold legte auf.
Noch gab es keine Lösung. Aber Hoffnung. Auf ein positives Ergebnis. Rudloffs Laune besserte sich.
Er rollte zurück ins Wohnzimmer und genehmigte sich einen Whisky.
Fast wäre ihm das Glas aus der Hand gefallen, als ein metallisches Geräusch vom Hauseingang her an seine Ohren drang. Anschließend überquerten Schritte den Flur.
»Gutten Tagg, Herr Ruudloof. Wie geht?«
Erleichtert kippte er sein Getränk hinunter. Valentina. Natürlich. Susanne hatte ihr einen Schlüssel gegeben. Statt einer Antwort ließ er nur ein unwilliges Knurren hören. Ein Gedanke schoss ihm durch den Kopf. Konnte die deutsch-russische
Putzfrau mit dem Einbrecher unter einer Decke stecken? Hatte sie ihn darüber informiert, dass es in seinem Haus etwas zu holen gab? Dass er einen
wehrlosen Mann im Rollstuhl antreffen würde? Immerhin hatte der maskierte Mann ein Fahrradschloss dabei gehabt, um ihn
schnell und sicher blockieren zu können.
Misstrauisch musterte er die junge Frau. Wie immer strahlte sie ihn fröhlich an. »Habe ich Frau Susanne getroffen. Bei Doktor. Hat mir erzählt. Schrrääcklich! Ganzes Schmuck weg. Frau sährrr traurig.«
Jörg Rudloff nickte nur und schenkte sich einen zweiten Whisky ein. Blödsinn. Valentina putzte seit zwei Jahren das Haus. Wenn sie Kontakte zu
Kriminellen hätte, wäre der Überfall nicht erst heute erfolgt.
Das Telefon klingelte und gab ihm Gelegenheit, sich in sein Arbeitszimmer zurückzuziehen. Der Anrufer stellte sich als Julian Pawlowski, private Ermittlungen,
vor. »Ich bin in einer halben Stunde bei Ihnen«, sagte er, ohne zu fragen, ob der Zeitpunkt recht wäre. Rudloff war dankbar, dass der Detektiv den Auftrag so schnell angenommen
hatte, und überging die Unhöflichkeit.
*
Pawlowski sah aus, wie man sich einen in die Jahre gekommenen Schnüffler vorstellte. Er trug einen billigen Anzug, eine unpassende und schlecht gebundene Krawatte. Auffällig waren seine Glatze und eine kräftige, ein wenig zu breite Nase. Einen Augenblick lang zweifelte Rudloff an der
Empfehlung seines Anwalts. Doch die Augen des Privatdetektivs wirkten klug,
blickten ihn offen und mit seltener Intensität an.
Rudloff bat ihn herein und bot Cognac und Whisky an. Pawlowski lehnte dankend ab und setzte sich. »Herr Seibold hat angedeutet, dass es um einen – sagen wir – etwas heiklen Verlust geht, von dem die Polizei nicht unbedingt erfahren
sollte.«
»So ist es«, bestätigte Rudloff zögernd. »Kann ich auf Ihre Diskretion rechnen?«
Pawlowski lächelte nachsichtig. »Was glauben Sie, wie ich mein Geld verdiene? Indem ich die Probleme meiner
Kunden öffentlich mache? Ich bin seit über vierzig Jahren im Geschäft. Mir gehören eine Zentrale in Berlin und Niederlassungen in einigen großen Städten.«
»Entschuldigung.« Rudloff hob die Handflächen. »Von dieser Angelegenheit hängt sehr viel ab. Mein Ruf, meine berufliche Existenz und meine persönliche Zukunft. In gewisser Weise sogar mein Leben.«
Der Detektiv zog einen Notizblock aus der Tasche. »Wenn Sie erlauben, mache ich mir ein paar Notizen.« Er nickte Rudloff aufmunternd zu. »Bitte!«
»Es geht … um … eine Pistole. Sie befand sich in einem Safe, der von … einem Einbrecher … ausgeräumt wurde.« Er machte eine Pause und deutete mit dem Zeigefinger auf Pawlowski. »Ihre Aufgabe besteht darin, sie aufzuspüren und zurückzubringen.«
»Das ist mal eine klare Auftragslage.« Der Detektiv steckte seinen Block wieder ein. »Dafür brauche ich keine Notizen. Hier in Göttingen gibt es nicht viele Möglichkeiten. Ich werde gewisse Spielhallen aufsuchen und mich umhören, außerdem im sogenannten Bunker in der Groner Landstraße, im Idunazentrum und am Hagenweg. Falls dort eine Pistole angeboten wird,
bekomme ich das heraus. Schwieriger wird es, wenn der Dieb sie übers Internet verkauft. Meine Mitarbeiter werden im Darknet recherchieren. Dazu brauche ich genaue Angaben über die Waffe. Marke, Modell, Kaliber, Herstellungsjahr.«
Rudloff nickte. »Es handelt sich um eine Walther PPK von 1938. Ein Erbstück. Während des Zweiten Weltkriegs war sie im Besitz meines Großvaters, mein Vater hat sie später im Nachlass gefunden. Seitdem …«
»Haben Sie ein Foto?«, unterbrach ihn der Detektiv. »Oder Unterlagen, aus denen Einzelheiten hervorgehen? Die PPK wurde in
verschiedenen Ausfertigungen produziert. Mit und ohne Gravur zum Beispiel.
Mancher hat sie sich nachträglich gravieren lassen. An solchen Merkmalen könnte man Ihre Waffe zuverlässig erkennen.«
»Ich suche Ihnen die Informationen heraus«, antwortete Rudloff. »Wie kann ich sie Ihnen übermitteln?«
Pawlowski erhob sich, griff in die Tasche und reichte ihm eine Visitenkarte. »Am besten per E-Mail. Lassen Sie sich nicht zu viel Zeit!« Er wandte sich zum Gehen. »Ich darf mich jetzt verabschieden. Bitte bemühen Sie sich nicht, ich finde allein hinaus.«
In der Tür drehte er sich noch einmal um. »Warum wollen Sie die Pistole eigentlich wiederhaben? Sie haben doch sicher keine
Verwendung dafür.«
Rudloff zögerte. »Ich möchte nicht, dass sie … in falsche Hände gerät und dann womöglich mit mir in Verbindung gebracht wird.«
Der Detektiv schien die Erklärung zu akzeptieren. Er nickte und verließ das Haus.
2
»Erst bei den Kolbergs hier in Nikolausberg, dann bei Rudloffs in Weende. Zwei
Einbrüche an einem Wochenende. Das muss man sich mal vorstellen.« Die Frau in der Schlange vor dem Tresen der Bäckerei-Filiale hatte die Stimme gesenkt, aber Anna hatte jedes Wort verstanden.
Sie spitzte weiter die Ohren. In der Vergangenheit hatte es Diebstähle in Kellerräumen von Mehrfamilienhäusern gegeben. Bevorzugte Objekte der Langfinger waren hochwertige Fahrräder. Dass auch das Villenviertel heimgesucht wurde, war ihr neu.
»Bist du sicher?«, fragte eine der Frauen. »Woher weißt du …?«
Die Antwort war ein geflüsterter Name. Irgendwas mit …tina. »Meine Schwägerin. Sie putzt bei Kolbergs und bei Rudloffs.«
Der Name war Anna Lehnhoff nicht unbekannt. Als sie vor sechzehn Jahren nach Göttingen gekommen war und beim Tageblatt angefangen hatte, galt der
Immobilienmakler als einer der erfolgreichsten Unternehmer seiner Branche. Er
vermittelte Grundstücke und gewerblich genutzte Gebäude und besaß eine Bauträgergesellschaft, die im Ostviertel hochwertige Eigentumswohnungen und in Grone
Einfamilienhäuser errichtete.
Vor einigen Jahren hatte Anna ihre Kollegin aus der Wirtschaftsredaktion
vertreten und einen Artikel über Rudloff geschrieben. Er war ein wichtiger Anzeigenkunde und musste deshalb
gelegentlich im redaktionellen Teil berücksichtigt werden. Doch plötzlich bezahlte er seine Rechnungen nicht mehr. Schließlich ging der Betrieb in die Insolvenz. Wie es dazu kommen konnte, wurde nicht
bekannt. Es gab Gerüchte, wonach Rudloff sein Geld rechtzeitig in Sicherheit gebracht haben sollte.
Seine Frau war vermögend, so dass er seinen aufwändigen Lebensstil nicht einschränken musste. Anna hatte Rudloff als wenig durchschaubaren Menschen erlebt, der
nichts Persönliches preisgab und großen Wert auf ein positives Bild in der Öffentlichkeit legte.
»Wie immer, Frau Lehnhoff?« Die Bäckereiverkäuferin sah sie fragend an. Anna nickte. »Ein Croissant, ein Küster- und ein Mehrkornbrötchen, bitte.« Sie zahlte, überlegte im Hinausgehen, ob sie beim Friseur nebenan einen Termin machen sollte,
entschied sich, es später telefonisch zu versuchen, und machte sich auf den kurzen Heimweg zu ihrer
Wohnung.
Seit der Block aus den sechziger Jahren einen neuen Anstrich in verschiedenen
Rottönen bekommen hatte, wirkte die Anlage nicht nur freundlicher, sondern auch
hochwertiger. Das Haus sah weniger nach Plattenbau aus, fast nach besserer
Wohnlage. Immer mal wieder hatte sie überlegt, ihre Wohnung und damit Nikolausberg zu verlassen, um zu Ingo zu ziehen.
Ihr Freund besaß eine große Altbauwohnung im Rohnsweg, in der mehr als genug Platz gewesen wäre. Doch so verlockend die Vorstellung auch war, letztlich war ihr ihre Unabhängigkeit wichtiger gewesen. Außerdem passten ihre Arbeits- und Tagesabläufe nicht zusammen. Ingo war um diese Zeit schon in der Schule, und wenn er am
Nachmittag nach Hause kam, saß sie noch in der Redaktion oder war unterwegs zu einem Termin. An freien Tagen
und während der Ferien übernachtete sie gern bei ihm, genoss die gemeinsamen Stunden, besonders die
Mahlzeiten. Ausgiebiges Frühstück ebenso wie ein abendliches Menü, das Ingo mit viel Liebe und stetig wachsender Sachkenntnis zubereitete.
Vor dem Haus entdeckte sie einen Streifenwagen der Polizei. Unwillkürlich beschleunigte Anna ihre Schritte. Ein uniformierter Beamter stand vor dem Eingang, umringt von mehreren Personen.
»Ist was passiert?«, fragte sie, als sie sich der Gruppe näherte. »Schon wieder ein Einbruch«, antwortete ein Nachbar. »Diesmal haben sie ein Mountainbike geklaut.«
»Über zweitausend Euro Schaden«, ergänzte eine Nachbarin, als Anna nicht sofort mit einem Entsetzensschrei reagierte.
»Das muss man sich mal vorstellen. Am helllichten Tage holen die unsere Sachen
aus den Kellern.«
»Bestimmt Ausländer«, mutmaßte ein dicklicher junger Mann, zog an seiner Zigarette und stieß eine Qualmwolke aus. »Flüchtlinge!« Er spuckte das Wort regelrecht aus. Anna wusste, dass er von Hartz IV lebte und
regelmäßig kistenweise Bier aus dem nahen Edeka-Markt in seine Wohnung schleppte. »Die machen sich hier breit, nehmen uns die Arbeit weg und klauen wie die Raben.«
Und welcher Flüchtling hat Ihnen die Arbeit weggenommen?, hätte Anna ihn gern gefragt, doch sie verspürte wenig Lust, mit der Dumpfbacke zu streiten, und wandte sich an den
Polizisten. »Gibt es schon Hinweise auf den oder die Täter?«
»Wir haben eine recht brauchbare Beschreibung eines jungen Mannes, der überrascht wurde, als er sich in einem benachbarten Mehrfamilienhaus an einem Münzautomaten für die Waschmaschine zu schaffen machte.« Mit dem Daumen deutete er auf den Block auf der gegenüberliegenden Straßenseite. »Eine aufmerksame Bewohnerin hat ihn angesprochen. Er hat ihr daraufhin erklären wollen, dass er die Geräte im Auftrag der Hausverwaltung überprüfen müsste. Sie hat ihm nicht geglaubt und uns informiert. Unterdessen hat sich der
Einbrecher auf das zuvor entwendete Mountainbike geschwungen und ist verschwunden.«
»Südländisches Aussehen, gebrochenes Deutsch, oder?« Anna fixierte den qualmenden Jüngling.
»Nein«, antwortete der Polizist. »Er ist wohl Deutscher. Blond, blauäugig, hat fehlerfrei gesprochen. Jetzt ist er wahrscheinlich untergetaucht oder
hat Göttingen verlassen. Aber früher oder später kriegen wir ihn.«
»Ihr lasst die doch wieder laufen.« Die Frau aus der Nachbarschaft verschränkte die Arme und sah den Beamten herausfordernd an. »Denen passiert ja sowieso nichts.«
Anna mochte sich an dieser Diskussion nicht beteiligen. Sie wandte sich zum
Gehen, hörte aber noch die Antwort des Polizeibeamten. »Wenn der Beschuldigte freigelassen wird, ist das nicht unsere Entscheidung. Darüber befindet die Justiz.«
Sie erreichte die Haustür, zog das Göttinger Tageblatt aus dem Briefkasten und stieg die Treppe hinauf. Auf dem Weg
nahm sie sich vor, Sven Petersson anzurufen. Mit dem Kriminaloberkommissar war
sie früher zusammen gewesen. Er war im Fachkommissariat 1 für Tötungsdelikte zuständig, hatte mit Einbrüchen also kaum zu tun. Doch sie konnte ihn bitten, sich umzuhören. In der Redaktionskonferenz würde sie vorschlagen, einen Artikel über die aktuellen Einbrüche zu schreiben. Nein, besser über nicht aufgeklärte Diebstähle in der Stadt. Über die aktuellen würden sich alle hermachen. Am liebsten würde sie gleich eine Serie daraus entwickeln. Sie würde im kriminellen Milieu recherchieren.
Während die Kaffeemaschine arbeitete, wählte sie Svens Nummer. Als sich die Mailbox meldete, hinterließ sie eine Nachricht mit ihrem Anliegen, nicht ohne zu erwähnen, dass sie sich lange nicht gesehen hätten und vielleicht mal wieder zusammen frühstücken könnten, wie sie es früher oft getan hatten. Dann packte sie den Inhalt der Bäckertüte aus und biss schmunzelnd in ihr Croissant. Sven würde ebenfalls anbeißen.
*
Julian Pawlowski glaubte Rudloffs Begründung nicht. Die Walther PPK zurückzubekommen, würde ihn eine Menge Geld kosten. Nur um zu verhindern, dass ein schlechtes Licht
auf ihn fallen würde, falls jemand damit herumballerte und die Polizei die Herkunft aufklären konnte, gab ein Geschäftsmann wie er keine nennenswerten Summen aus. Dazu würde es genügen, die Polizei über den Verlust zu informieren. Wahrscheinlich ist die Waffe heiß, dachte Pawlowski. Wäre interessant, herauszufinden, wer wann und in welchem Zusammenhang damit
geschossen hatte. Aber das war nicht die Aufgabe, für die er bezahlt wurde. Wenn sich aus seinen Ermittlungen nebenbei etwas ergab,
was den Wert der Pistole für Rudloff wesentlich erhöhte, würde sich das in der Rechnung niederschlagen.
Zwei Spielhallen hatte er ergebnislos aufgesucht, in der dritten traf er auf
einen alten Bekannten, der sich in der Szene auskannte. Der Geschäftsführer des Jackpot bot in einem Hinterzimmer für betuchte Interessenten Poker, Blackjack und illegale Sportwetten an. Er
wusste, dass Pawlowski davon wusste, und war deshalb bereit, dem Privatdetektiv
hin und wieder einen Tipp zu geben. Um sich nicht selbst zu gefährden, beließ er es bei Andeutungen, gab keine Auskunft am Telefon und belastete niemals
einen seiner Kunden. Auf Pawlowskis Frage nach der PPK schob er die Unterlippe
vor und schüttelte den Kopf. »Ich dachte, du kommst wegen der Klunker.«
»Und?«, hakte der Privatdetektiv ein. »Weißt du dazu was Konkretes?«
»Nur dass anscheinend jemand einen Abnehmer sucht. Von einem Deal habe ich bis
jetzt nichts gehört. Scheint noch keinen Kunden gefunden zu haben. Vielleicht ist es auch nur ein
Gerücht. Mehr kann ich dir wirklich nicht …«
Pawlowski winkte ab. »Danke, das genügt mir.« Er verabschiedete sich, verließ die Spielhalle und machte sich auf den Weg zu seinem nächsten Informanten. Jesko von Arnsberg war Inhaber eines Antiquitätengeschäfts. Seine Familie stammte aus dem westfälischen Werl. Jesko war zum Studium der Rechtswissenschaft nach Göttingen gekommen, hatte aber lieber Geschäfte gemacht, statt trockene Vorlesungen zu besuchen. Damals, in den achtziger
Jahren, hatten sie sich bei Bine Gassmann kennengelernt, waren gemeinsam um die
Häuser gezogen, hatten sich im Pink zu Depeche Mode ausgetobt und meistens gegen
Morgen das Coconut aufgesucht, um dort die Nacht zu beschließen.
Schon damals hatte sein Kommilitone angefangen, mit Antiquitäten zu handeln. Ohne Laden. Im Landkreis, besonders im Eichsfeld, hatte er alte
Tische und Stühle, Schränke und Kommoden aufgetan, die er in einer angemieteten Garage aufgemöbelt und mit hohem Gewinn an zahlungskräftige Interessenten im Göttinger Ostviertel verkauft hatte. Irgendwann hatte er das Studium aufgegeben,
um sich ganz dem Antiquitätenhandel zu widmen. Mit Erfolg. Inzwischen liefen die Geschäfte eher mäßig, aber Jesko hatte längst seine Schäfchen im Trockenen. Ihm gehörten mehrere Häuser in der Innenstadt, die beträchtliche Einnahmen abwarfen. Den Handel mit alten Möbeln betrieb er nur zum Vergnügen weiter.
»Wertvoller, antiker Schmuck, sagst du?« Jesko sah seinen Besucher über den Rand seiner goldenen Lesebrille hinweg an. Er hatte ihn in sein Büro gebeten, das mit edlen Biedermeiermöbeln ausgestattet war. Pawlowski fiel auf, dass von Arnsberg noch immer schlank,
von kräftiger Statur und in den letzten Jahren kaum gealtert war, sah man von dem weißen Haarschopf und dem grauweißen Bart ab. »Mir hat niemand etwas Derartiges angeboten. Aber ich kann mich gerne mal umhören. Dafür brauche ich ein paar Einzelheiten.« Er stand auf und wandte sich zur Tür. »Jetzt hole ich uns erst einmal einen guten Wein. Ich hätte da einen Brunello di Montalcino. Drei Jahre im Eichenfass gereift. Ein
himmlischer Tropfen.«
Pawlowski seufzte innerlich. Ohne einen kleinen Vortrag über die Qualität des himmlischen Tropfens angehört und mindestens ein Glas getrunken zu haben, würde er Jesko nicht entkommen. Was der Tageszeit nicht angemessen war, aber
durchaus seine Vorzüge hatte, denn die Weine aus dem Keller seines alten Freundes waren in der Tat
stets eine Offenbarung.
Eine Stunde später verließ der Privatdetektiv das Antiquitätengeschäft, leicht angeschlagen, jedoch mit der Gewissheit, sofort zu erfahren, wenn in
Göttingen Schmuck in bemerkenswertem Umfang angeboten würde.
*
Anna war auf dem Weg in die Redaktion, als Sven zurückrief. Er schien regelrecht beglückt über ihre Nachricht und machte gleich einen Vorschlag. »Morgen früh im Kartoffelhaus. Ich würde mich freuen.« Anna nannte eine Uhrzeit. Sven stimmte zu, die Verabredung war perfekt.
Anschließend hatte sie ein schlechtes Gewissen. Sven war immer noch ein bisschen in sie
verliebt. In keiner seiner Beziehungen nach ihrer war er richtig glücklich geworden. Und sie nutzte das aus, weil sie Informationen von ihm wollte.
Aber es war schließlich ihre Aufgabe, als Journalistin nach der Wahrheit zu suchen und den Dingen
auf den Grund zu gehen. Sven konnte dabei helfen, und er tat es gern.
Man musste das Private vom Beruflichen trennen. Allerdings hatte sie es damit
nicht immer so genau genommen. Nachdem sie schon längere Zeit mit Ingo Steinberg zusammen gewesen war, hatte sie sich einmal hinreißen lassen, mit Sven … »Kein Sex mit dem Ex«, murmelte sie und drehte das Radio auf, in dem gerade die ersten Takte eines
alten Liedes von Bob Dylan erklangen. Anna fiel ein und sang laut mit. »Knock, knock, knockin’ on heaven’s door …« Als Dylan im vergangenen Jahr den Literaturnobelpreis bekommen hatte, war sie
begeistert gewesen. Denn für sie war er einer der größten Lyriker der Gegenwart. Ingo hatte ihre Freude nicht geteilt. »Es gab grandiose Schriftsteller auf der Liste«, hatte er gesagt. »Einen von ihnen auszuzeichnen, wäre ein Leuchtfeuer für die Literatur gewesen.«
*
Als Kilian Kaltenbach erwachte, schlug die Turmuhr der nahen Marienkirche zwölf Mal. Trotzdem zog er die Decke über den Kopf und drehte sich noch einmal um. Doch dann durchrieselte ihn ein
seltenes Glücksgefühl und machte ihn schlagartig wach. Schließlich wartete ein neues Leben auf ihn.
Bis heute war sein Dasein eine endlose Abfolge von Niederlagen gewesen. Begonnen
hatte es bereits mit der Taufe, denn seine Eltern hatten ihm diesen
bescheuerten Namen gegeben, unter dem er schon als Kind hatte leiden müssen. In der Schule war er oft Außenseiter gewesen und hatte den Unterricht so häufig geschwänzt, dass seine Eltern ihn schließlich in ein Internat gesteckt hatten. Ihre ganze Zuwendung hatten sie auf seine
kleine Schwester konzentriert. Während sein Vater der Tochter jeden Wunsch von den Augen abgelesen hatte, war das
Verhältnis zu seinem Sohn in dem Maße schlechter geworden, in dem Kilian hatte erkennen lassen, wie wenig ihn die väterlichen Vorstellungen von Erfolg in Schule, Studium und Beruf interessierten.
Dank seiner guten Reputation als Gynäkologe gehörte sein Vater zur besten Gesellschaft Göttingens. Die Ehe mit einer Professorentochter hatte seinem Ansehen ebenfalls
nicht geschadet.
Nachdem Kilian aus dem dritten Internat geflogen war, hatte es zwischen Vater
und Sohn dermaßen gekracht, dass Kilian ausgezogen war. Mit achtzehn Jahren. Anfangs hatte er
bei Freunden gewohnt, seinen Lebensunterhalt mit dem Sammeln von Pfandflaschen
und kleinen Gelegenheitsjobs bestritten und in der Mensa der Universität gegessen. Als er herausgefunden hatte, wie leicht es war, als Zusteller Pakete
mit wertvollem Inhalt zu identifizieren und verschwinden zu lassen oder bei
Jobs in der Gastronomie in die Kasse zu greifen, hatte er ein eigenes Zimmer in
der Angerstraße gemietet. Seine Einkünfte waren unregelmäßig, aber ausreichend. Sie wurden erst wieder knapp, als aus gelegentlichem
Kiffen regelmäßiger Konsum von Cannabis wurde. Ein Freund aus der Szene zeigte ihm, wie man in
Gartenhäuser, Keller und Wohnungen eindringen konnte. Seitdem bestritt er seine Ausgaben
aus dem Erlös durch dem Verkauf der Wertgegenstände, die er bei Einbrüchen erbeutete. Und ärgerte sich oft über ein mageres Ergebnis.
Doch jetzt würde alles anders werden. Zum ersten Mal in seinem Leben hatte er Erfolg gehabt.
Statt als Kleinkrimineller sein Dasein zu fristen, würde er in Zukunft ein richtiges Unternehmen betreiben. Sein Plan war aufgegangen
und hatte ihm, unterstützt durch eine Portion Glück, das Startkapital beschert. Er beglückwünschte sich erneut zu seiner Idee, die Lebensumstände der Freundinnen seiner Mutter näher anzusehen. Professorengattinnen und andere grüne Witwen, die ihre nicht unerheblichen Ausgaben aus den Einkünften ihrer Ehemänner bestritten. In deren Villen gab es wesentlich mehr zu holen als in
Kellerverschlägen von Wohnungsmietern. Und dort hineinzukommen, war kaum schwerer als in
Mietshäuser. Man musste nur wissen, wer wann zu Hause war und welche Sicherungssysteme
es gab.
Schon länger hatte er davon geträumt, sich mit einem kleinen Café selbständig zu machen. Frei und unabhängig sein, mit einem legalen Gewerbe seinen Lebensunterhalt und die notwendigen
Mittel für sauberen Stoff verdienen. Sobald das Geschäft in Schwung gekommen wäre, würde er das nächste Ziel anpeilen: ganz mit dem Kiffen aufhören. Er stellte sich vor, wie aus dem kleinen Café im Laufe einiger Jahre ein gefragtes Restaurant würde, in dem die Göttinger Prominenz verkehrte. Irgendwann würde auch sein Vater dort auftauchen und nicht umhinkönnen, Anerkennung und Bewunderung zu zeigen.
Kilian warf die Decke von sich und rollte aus dem Bett. Es war Zeit, sich auf
die Suche zu machen. Um seine Pläne zu verwirklichen, musste er seine Beute so teuer wie möglich verkaufen. Aus seinem Umfeld, in dem er sich umgehört hatte, gab es keine brauchbaren Tipps. Unter Trödlern und auf Flohmärkten würde er keine Abnehmer finden. Kleindealer, die Smartphones, Kameras und E-Bikes
abnahmen, boten keine akzeptablen Preise. Andere Händler hatten seine vorsichtigen Anfragen mit Ablehnung oder wenig ermutigenden Kommentaren quittiert. »Klingt nach heißer Ware, die nehme ich nicht.« Oder: »Wenn ich so was anbiete, habe ich sofort die Bullen auf dem Hals.« Einer hatte ihn kopfschüttelnd angesehen und gefragt: »Bist du lebensmüde?«
Juweliere und Antiquitätenhändler dagegen würden den Wert der Schmuckstücke erkennen und zu schätzen wissen. Und akzeptable Preise zahlen. Um mit ihnen ins Geschäft zu kommen, musste er sich ein seriöses Auftreten zulegen. Er zweifelte nicht daran, dass er hinreichend überzeugend reden konnte. Wortschatz und Sprechweise der Oberschicht waren ihm
geläufig. Nur für sein Äußeres sollte er etwas tun. Aber zuerst würde er ein paar Aufnahmen anfertigen, um sie interessierten Händlern vorzulegen. Das Smartphone lieferte Fotos in ausreichender Qualität, die er in einem Elektronikmarkt im Carré ausdruckte.
*
Der Anruf des Antiquitätenhändlers erreichte Pawlowski zwei Tage später. »Es gab ein Angebot«, berichtete Jesko von Arnsberg. »Möglicherweise ist das für dich interessant. Ein junger Mann, angeblich aus Baden-Württemberg, hat bei einem Kollegen vorgefühlt. Er sei beauftragt, den Schmuck einer älteren Dame zu veräußern. Er hatte Fotos dabei.«
»Ist es möglich, aufgrund der Bilder den Wert der Schmuckstücke einzuschätzen?«
»Der Verkaufswert wäre fast eine halbe Million, wenn es sich wirklich um Erbstücke handeln sollte, deren Herkunft belegt werden kann. Hehlerware lässt sich nur über kostspielige Umwege verkaufen. Weder mein Kollege noch ich würden sie annehmen. Woanders, zum Beispiel in Frankfurt, findest du dafür Käufer. Allerdings zu einem Preis, der nur einen Bruchteil des tatsächlichen Werts ausmacht.«
»Wie viel?«, fragte Pawlowski.
»Maximal fünfzigtausend Euro. Wahrscheinlich eher weniger.«
»Für einen Kleinganoven, der über diesen Schatz gestolpert ist, eine Menge Geld. Aber er scheint sich nicht
auszukennen. Sonst würde er woanders nach einem Abnehmer suchen.«
»Du sagst es«, bestätigte von Arnsberg. »Ich weiß keinen Kollegen, der sich darauf einlassen würde. Auch keinen Juwelier. Mich wundert, dass sich die Polizei nicht bei uns
gemeldet hat.«
»Das wird sie sicher noch«, vermutete der Privatdetektiv. »Vorerst wollen sie anscheinend die Sache unter der Decke halten, weil der rechtmäßige Besitzer darum gebeten hat. Außerdem gehen sie wahrscheinlich davon aus, dass der Schmuck erst nach einiger
Zeit angeboten wird. Und dann nicht hier in Göttingen, sondern in Frankfurt, Hamburg oder Berlin. Oder im Internet. Vielleicht
wissen sie ja gar nichts von dem wahren Wert. Ich könnte mir vorstellen, dass mein Auftraggeber polizeiliche Ermittlungen eher
vermeiden will. Wie auch immer, wir werden nicht warten. Ich kenne jemanden,
der sich auf den Handel einlassen wird.«
»Dann weißt du mehr als ich«, wandte der Antiquitätenhändler ein. »Es würde mich doch sehr überraschen, wenn einer meiner Kollegen ...« Er brach ab und schnaufte unwillig.
Pawlowski lachte. »Der Groschen ist gefallen.«
»Das ist nicht dein Ernst«, schimpfte Jesko von Arnsberg. »Du kannst von mir nicht verlangen ...«
»Natürlich nicht, mein lieber Jesko. Aber du wirst es dir überlegen. Um der alten Zeiten willen. Und weil du dich daran erinnern wirst, wie
ich dir aus der Patsche geholfen habe, als sich unter deinen Antiquitäten einmal ein wertvolles Gemälde unklarer Herkunft befand und der Eigentümer dir schon die Polizei in den Laden schicken wollte. Darauf setze ich eine
Kiste Brunello. Habe erst kürzlich erfahren, wie großartig dieser Wein ist. Drei Jahre im Eichenfass …«
»Du bist und bleibst ein hinterhältiges Schlitzohr, Julian«, unterbrach von Arnsberg ihn und schnaufte erneut. »Also gut. Ich denke darüber nach und rufe dich an.«
*
»Nicht aufgeklärte Diebstähle?« Sven Petersson hob die Augenbrauen und sah Anna über seinen Milchkaffee hinweg fragend an. Sie saßen im Obergeschoss des Kartoffelhauses, das um diese Zeit gut mit Frühstücksgästen gefüllt war. »Da gäbe es ein paar interessante Fälle. Nur nicht im Bereich der Kleinkriminalität. Bei Einbrüchen ist die Aufklärungsquote niedrig. Wir haben nicht die Leute für kriminalistische Feinarbeit. Der Polizeipräsident hat zu Beginn des Jahres eine Koordinierungsstelle dafür eingesetzt. Mit zwei Kollegen. Aber im Zuständigkeitsgebiet der Direktion Göttingen werden jährlich über zweitausend Wohnungseinbrüche gezählt. Nicht mal ein Viertel davon können wir aufklären. Was willst du darüber schreiben? Es läuft jedes Mal gleich ab. Wir werden zu den Opfern gerufen, stellen den Schaden
fest, fertigen ein Protokoll für die Staatsanwaltschaft und eine Bestätigung für die Versicherung der Betroffenen. Die kriegen dann sechs Wochen später eine Mitteilung, aus der hervorgeht, dass die Ermittlungen eingestellt
werden mussten.«
»Das ist doch frustrierend.« Anna dachte an den Nachbarn, dem das hochwertige Mountainbike gestohlen worden
war. Und an ihr eigenes Rad. Aber das war schon älter. Waren Fahrräder im Keller eigentlich versichert?
Sven setzte seinen Milchkaffee ab und griff nach einem Vollkornbrötchen. »Das kannst du wohl sagen. Nicht nur für die Betroffenen, auch für meine Kollegen. Wenn sie mal einen Täter schnappen, wird der meistens kurze Zeit später wieder auf freien Fuß gesetzt. Da sieht’s bei uns im Kommissariat besser aus.«
»Ihr habt eine deutlich höhere Aufklärungsquote«, vermutete Anna.