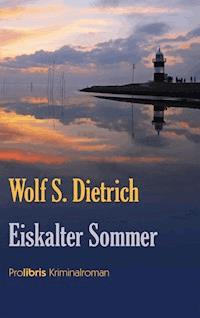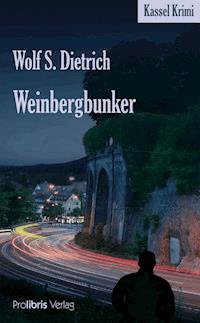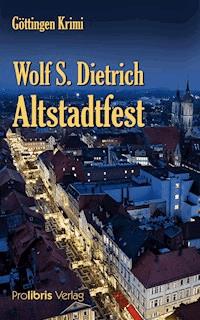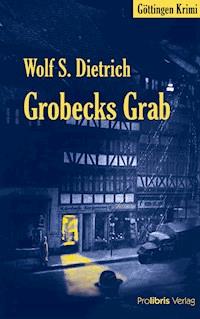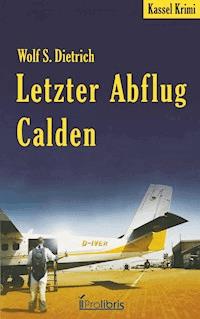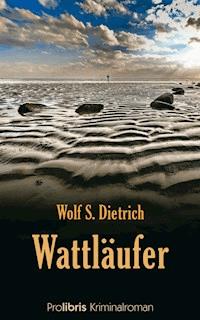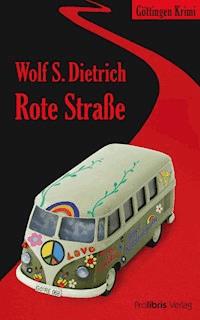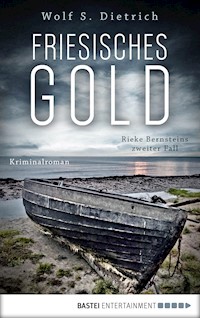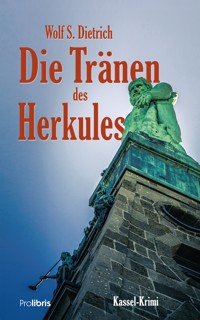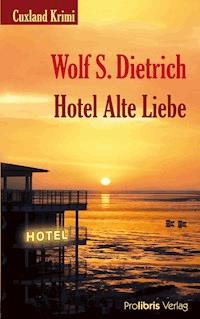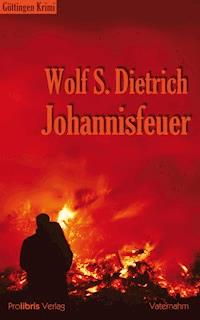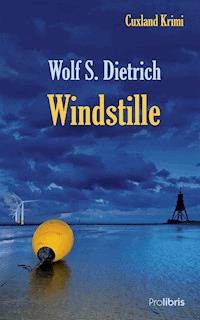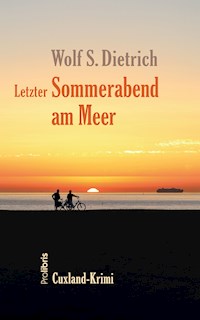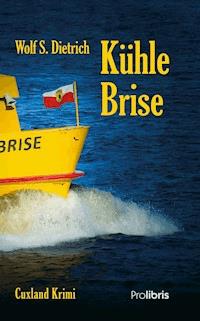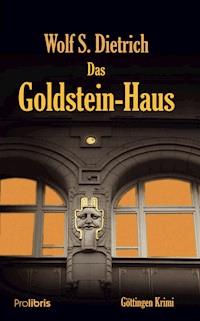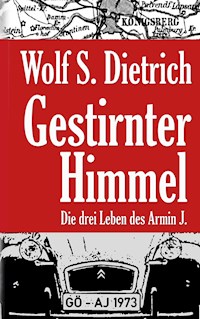Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Kriminalhauptkommissarin Hanna Wolf will einfach nur Urlaub machen, an der schönen Müritz. Aber ihr Beruf holt sie auch hier ein. Während sie zusammen mit ihrem Freund die Seenlandschaft entdeckt, gerät sie in einen mysteriösen Kriminalfall - ausgelöst durch einen räuberischen Fisch und einen makabren Fund. Zusammen mit ihren Kollegen vor Ort begibt sich Hanna auf Spurensuche. Doch eine einflussreiche Geheimorganisation versucht, die Ermittlungen zu behindern und schreckt dabei auch vor gewaltsamen Mitteln nicht zurück.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 328
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wolf S. Dietrich
Fische lügen nicht
Müritz Krimi
Prolibris Verlag
Die Handlung des Romans spielt im Sommer 2011, ihre Vorgeschichte beginnt im Jahr 1983. Das Geschehen in beiden Teilen – ebenso wie alle Figuren – entspringt der Phantasie des Autors. Das gilt auch für die Verquickung mit tatsächlichen Ereignissen. Darum sind eventuelle Übereinstimmungen mit lebenden oder verstorbenen Personen zufällig und nicht beabsichtigt. (Dieses trifft nicht für bekannte Personen der Zeitgeschichte zu.)
Für die Dramaturgie der Vorgeschichte war es notwendig, von der örtlichen Praxis bei den staatlichen »Sicherheitskräften« abzuweichen: Die in der Handlung beschriebene Zusammenarbeit von Volkspolizei und Staatssicherheitsdienst der DDR (anderenorts als »politisch-operatives Zusammenwirken – POZW« praktiziert) hat es in Waren in dieser Form in den 80er Jahren nicht (mehr) gegeben. Die Dienststellen auf dem Mühlenberg waren in getrennten Gebäuden untergebracht. Zwischen ihnen befand sich der Sitz der SED-Kreisleitung. Und der – höchst bürokratische – Dienstweg.
Das Gebäude der Volkspolizei wird heute als Polizeidienststelle genutzt, in dem ehemaligen Haus der Stasi befindet sich eine Anwaltskanzlei. Von deren Dienststelle ist noch ein Eisenträger sichtbar, der die Sicherheitsschleuse begrenzt hat, in der Fahrzeuge und ihre Insassen überprüft wurden, bevor sie den Innenhof erreichen konnten. Im früheren Sitz der SED-Kreisleitung befindet sich heute ein Hotel.
Nicht erfunden sind alle anderen Institutionen sowie Straßen und Schauplätze rund um die Müritz. Kamerun ist der Name eines Warener Ortsteils, der von einem Afrika-Heimkehrer der Kolonialzeit stammt.
Die Protokolltexte der Stasi-Akteure sind den Dokumenten möglichst originalgetreu nachempfunden, die von der Behörde des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik veröffentlicht wurden.
Prolog
Gegen den Strom zu schwimmen, war ein seltsames Gefühl. Die Menschen, die ihr entgegenkamen, waren auf eine unwirkliche Weise ausgelassen. Mit erwartungsvollen, neugierigen, hoffnungsfrohen Gesichtern zogen sie in Richtung Westen.
Es herrschte ein unbeschreiblicher Lärm. Zweitaktmotoren knatterten. Ihre bläulichen Abgase schwebten über der endlosen Karawane von Trabbis und Wartburgs und über den Menschen, die neben den Autos liefen. Wie bei einem Karnevalsumzug winkten, riefen und johlten junge Männer und Frauen, Kinder und Alte. Nur dass sie keine bunten Kostüme trugen, sondern Alltagskleidung. Ost-Kleidung. Marmor-Jeans, darüber helle, wattierte Jacken oder dunkle aus Kunstleder.
Wildfremde Menschen umarmten sie, eine Frau küsste sie auf den Mund. Sie schmeckte nach Erdbeeren. Unwillig wischte sie sich über die Lippen.
Aus ihrer Richtung drängten Westdeutsche, die ihre Landsleute aus dem Osten mit lautem Hallo, Flaschenbier und knallenden Sektkorken begrüßten. Nicht wenige stürzten sich auf den nächstbesten Ostler, um ihn wie eine Beute abzuschleppen.
An allen Grenzübergängen strömten in diesen Tagen die Menschen aus der untergehenden DDR in den Westen, vor allem in die grenznahen Städte. Das Ende der DDR beherrschte die Gespräche und Nachrichten. Täglich berichteten Rundfunk, Fernsehen und Zeitungen über die großen und kleinen Ereignisse während und nach der Grenzöffnung. Es schien nur noch eine Bewegungsrichtung zu geben. Von Ost nach West.
Sie wollte in die andere Richtung.
Auf diesen Tag hatte sie gewartet. Auf das Wunder gehofft, an das niemand so recht zu glauben vermochte. Auch sie hatte es nicht für möglich gehalten, zurückkehren zu können. Aber nun fieberte sie dem Augenblick entgegen, in dem sich der See vor ihren Augen ausbreiten würde. Dort, im Wasser der Müritz, würde sie ihre Albträume ertränken.
Schon bald.
Drei Wochen musste sie noch warten. Drei Tage dauerte die Suche. Dann hatte sie ihn gefunden. In der Nacht zum vierten Tag schlug sie zu.
Mit einem Fischmesser unter der Jacke hatte sie ihm aufgelauert. Als er sich der Haustür näherte, ließ sie die Klinge hervorschnellen und richtete die Spitze gegen den Kehlkopf ihres Opfers.
Er war so überrascht, dass er kaum Gegenwehr leistete. Blitzschnell knebelte und fesselte sie ihn. In einem alten Renault 4, aus dem sie die hintere Sitzbank entfernt hatte, transportierte sie ihn zum See. Das Motorboot, das sie nach ihrer Ankunft organisiert hatte, war an einer einsamen Stelle vertäut. Unter großer Anstrengung schleifte sie den Mann zum Steg, ließ ihn ins Boot gleiten und startete den Außenborder.
Es war eine klare Nacht, der See war ruhig.
Nach einer halbstündigen Fahrt drosselte sie den Motor, stellte ihn ab und beugte sich über das Opfer. Mit einem schnellen Griff zog sie den Knebel aus seinem Mund. »Erkennst du mich?«
Aus aufgerissenen Augen sah der Mann sie an. Er röchelte, brachte aber kein Wort heraus. Angst stand ihm ins Gesicht geschrieben. Todesangst.
Zu mehr als einem Nicken schien er nicht fähig.
»Gut. Dann weißt du, warum du jetzt sterben wirst.«
Entsetzt schüttelte der Mann den Kopf. »Ich war es nicht«, krächzte er. »Ich habe nur auf Befehl ...« Er verstummte, als das Messer vor seinen Augen aufblitzte.
»Auf Befehle wirst du in Zukunft nicht mehr hören.« Die Klinge fuhr an seiner Schläfe entlang. Erst, als auch sein zweites Ohr ins Wasser flog, begann er zu schreien.
Sie packte den gefesselten Mann und zerrte ihn zur Bordwand. Schwer atmend wuchtete sie den Körper über die Reling. Es klatschte, die Schreie gingen in ein Gurgeln über, schließlich herrschte Stille über dem See.
Nur die Wellen plätscherten leise gegen das Boot.
1
Schwer lag die Nacht über dem Wasser. Als die Wolkendecke aufriss und blaues Mondlicht die eben noch schwarze Oberfläche des Sees in eine bleigraue Landschaft verwandelte, konnte er für einen Augenblick seine Verfolger erkennen. Ihre Silhouetten hoben sich nur schwach gegen die grauen Häuser im Hintergrund ab. Zu dritt standen sie auf dem Weg, der an den Bootshäusern entlangführte, sprachen halblaut und gestikulierten. Einer ließ den Lichtkegel einer Taschenlampe über den Uferbereich wandern. Warum gingen Volkspolizisten immer zu dritt auf Streife? Ungewollt kam ihm die Frage aus der Schulzeit in den Sinn. Und auch die Antwort: Einer kann lesen, der andere schreiben, und der dritte überwacht die beiden Intellektuellen.
Frank Peters grinste und versuchte, seinen rasselnden Atem zu bändigen, drückte sich tiefer in die schmale Türnische. Der schwache Lichtstrahl der Handlampe tanzte im Uferbereich umher, erreichte ihn aber nicht. Dass er sich in einem Bootshaus verstecken würde, um später mit einem gestohlenen Ruderboot über den See zu entkommen, hatten sich sogar die Vopos zusammenreimen müssen. Nachdem er zum See gelaufen war, gab es für ihn nur noch diesen einen Weg. Das wussten sie wahrscheinlich auch. Um die Bootshäuser durchsuchen zu können, brauchten sie eine Genehmigung von oben. Aber die dürfte auf sich warten lassen. Denn unter den Eigentümern befanden sich etliche Parteifunktionäre. Darunter der Erste Sekretär der SED-Kreisleitung, Herbert Jähn. Und der würde seine Hütte niemals filzen lassen. Schon gar nicht von einfachen Vopos. Sein Atem beruhigte sich; beim Gedanken an Jähns Geheimnis umspielte wieder ein kurzes Lächeln seinen Mund. Im nächsten Augenblick schob sich eine Wolke vor die Sichel des Mondes. See, Ufer und Bootshäuser verschmolzen zu einer schwarzen Masse.
Als die Stimmen leiser wurden und sich entfernten, tastete er nach dem Schlüssel. Zu seiner Erleichterung lag er noch immer an seinem Platz. Er hielt den Atem an und lauschte in die Nacht. Bald erklang das charakteristische Knattern eines Wartburgs. Rasch öffnete er die Tür, schlüpfte ins Bootshaus und schloss hinter sich ab. Um keine Aufmerksamkeit zu erregen, verzichtete er darauf, Licht einzuschalten.
Herbert Jähn hatte seine Hütte komfortabel eingerichtet. Mit Stromanschluss für Beleuchtung, für den tragbaren Kühlschrank der Marke Monsator. Der war gut gefüllt. Statt Ochsenblut, Eselsmilch oder Balkanfeuer – Sorten, die für den normalen DDR-Bürger vorgesehen waren – enthielt er guten sächsischen Wein. Frank hätte gern Wasser getrunken, doch es gab weder Selters noch Margon, also öffnete er eine Flasche Pillnitzer Müller Thurgau und ließ sich auf dem bequemen Sofa nieder.
Während er trank, fiel sein Blick auf das Telefon. Sekundenlang starrte er auf den grauen Tischapparat Variant. Wie gern würde er jetzt Kathrin anrufen. Der Anschluss von Herbert Jähn wurde wohl kaum von der Stasi überwacht. Oder doch? Das Risiko war nicht kalkulierbar. Außerdem war es viel zu spät. Ein nächtlicher Anruf könnte Kathrins Eltern auf den Plan rufen. Und sie beunruhigen. Er sah auf die Uhr und gähnte. Statt zu träumen sollte er sich ausruhen und versuchen, ein wenig zu schlafen. Der neue Tag würde anstrengend genug werden. Er musste sich verstecken. Für mehrere Tage. Es gab nur wenige Freunde, die es riskieren würden, ihn unterzubringen und ihm weiterzuhelfen.
Vielleicht lag es am Wein, vielleicht an der überstürzten Flucht. Frank fand keine Ruhe, döste zwischen Wachen und Schlafen, schreckte gelegentlich auf, wenn irgendwo ein Hund bellte. Seine Gedanken kreisten um die Erlebnisse der letzten Monate.
Angefangen hatte alles mit einem Flugblatt, das ein Mitschüler aus Berlin mitgebracht hatte. »Fordert Volksdiskussion über das neue Wehrdienstgesetz!«, war darauf zu lesen. Unbekannte hatten die Blätter in der Hauptstadt und in Dresden verteilt. Sie verlangten eine Debatte über die Verschärfung des Gesetzes und bezogen sich dabei auf die Verfassung der DDR. Staatssicherheit und Volkspolizei, wurde gemunkelt, suchten die Urheber in kirchlichen Kreisen, blieben aber erfolglos. Es gab keine Verhaftungen.
In seiner Klasse an der EOS Richard-Wossidlo löste das schwarze Blättchen mit den weißen Blockbuchstaben heftige Diskussionen aus. Einige hätten es gerne vervielfältigt und verteilt, andere warnten vor den damit verbundenen Gefahren. Der Kreis derer, die es zu sehen bekamen, war begrenzt. Trotzdem flog die Sache auf. Es gab eine Untersuchung, alle Schüler der Klasse wurden verhört. Von einem Hauptmann der Staatssicherheit, den keiner zuvor gesehen hatte. Doch die Nachforschungen verliefen im Sande, da niemand Angaben zur Herkunft des staatsfeindlichen Pamphlets machen konnte oder wollte. Staatsfeindlich? In der Verfassung stand doch: »Entwürfe grundlegender Gesetze werden vor ihrer Verabschiedung der Bevölkerung zur Erörterung unterbreitet.« Als Frank im Staatsbürgerkundeunterricht nach diesem Artikel 65 fragte, wurde er scharf zurechtgewiesen. An der Verfassung der DDR habe niemand zu zweifeln, schon gar nicht ein vorlauter Schüler.
Ihm wurden die Widersprüche zwischen offiziellen Aussagen und der Wirklichkeit bewusst. Plötzlich verstand er die sarkastischen Zweideutigkeiten eines Lehrers, der im Gegensatz zu seinen Kollegen über eine eigene Meinung zu verfügen schien, während die anderen nur wiedergaben, was im Neuen Deutschland und in der Zeitung des Bezirks Neubrandenburg, Freie Erde, zu lesen war. Von Tag zu Tag stieß Frank auf neue Propagandalügen, und von Tag zu Tag hasste er sich mehr dafür, dass er im Strom der Unwahrheiten mitschwamm.
Zu Hause musste er seine neue Sicht der Welt vor dem Vater verbergen, der für den FDGB-Feriendienst arbeitete, viel unterwegs war und im übrigen den SED-Staat völlig in Ordnung fand. Seine Mutter vermied es, über Politik zu reden, und war stets darauf bedacht, den Familienfrieden zu erhalten. Sie arbeitete halbtags im großen Konsum, so dass es bei den alltäglichen Bedürfnissen für die Familie kaum Engpässe gab. Aber sie besaß eine Schwester im Westen. Und wenn sie von ihr sprach, glaubte Frank, einen sehnsüchtigen Unterton in ihrer Stimme zu spüren.
Seine Eltern reagierten sehr unterschiedlich, als es in der Schule Ärger gab und der Vater zum Direktor zitiert wurde. Voller Wut kehrte er von dem Besuch zurück und versetzte Frank eine gewaltige Ohrfeige. Schweigend. Die Mutter schien verängstigt, fragte ihren Sohn immer wieder, von wem er sich habe verleiten lassen.
»Warum ist das Wirtschaftssystem der DDR gut, modern und erfolgreich, und warum ist das Wirtschaftssystem der BRD schlecht, unmodern und ohne Aussicht auf Erfolg?«, hieß das Aufsatzthema im Fach Staatsbürgerkunde. »Die Frage ist falsch formuliert«, hatte Frank geschrieben. »Richtig muss sie lauten: Warum ist das Wirtschaftssystem der DDR schlecht, unmodern und ohne Aussicht auf Erfolg, und warum ist das westdeutsche Wirtschaftssystem gut, modern und erfolgreich?«
Sein Vater versuchte, den Skandal unter den Teppich zu kehren, und schickte ihn zu einer FDJ-Schulung nach Leipzig. Dort betreute ihn eine Physikstudentin mit dem schönen Namen Angela – Frank schwärmte zu dieser Zeit noch für Angela Davis. Sie gehörte dem FDJ-Leitungskader für Agitation und Propaganda an der Akademie der Wissenschaften an. Und von ihr wurde er über die Tugenden eines klassenbewussten Sozialisten aufgeklärt, der die entwickelte sozialistische Gesellschaft in der Deutschen Demokratischen Republik mitgestalten sollte.
Der Nachhilfeunterricht bewirkte eher das Gegenteil. Frank perfektionierte zwar sein Vokabular zur Theorie des Marxismus-Leninismus, erkannte jedoch zunehmend Widersprüche zur Lebenswirklichkeit der Menschen. Nach seiner Rückkehr eckte er noch öfter an. In der Schule, in der FDJ, in der Familie. Während Lehrer, Jugendfunktionäre und sein Vater von Fortschritten bei Produktion und Warenangebot sprachen, hatte seine Mutter immer größere Schwierigkeiten, die gewohnte Versorgung mit Lebensmitteln, Haushaltswaren oder Kleidung aufrechtzuerhalten. An Jeans oder bestimmte Schallplatten aus dem Westen war ohnehin nicht zu denken. Wie gern hätte er Udo Lindenbergs »Sonderzug nach Pankow« auf den Plattenteller gelegt. Wer über Westgeld oder reichlich DDR-Mark verfügte, konnte die gesamte Warenpalette aus der Produktion der offiziell verhassten BRD kaufen. In Intershop-, Exquisit- und Delikatläden. Für Frank hatte es diese Möglichkeit nicht gegeben.
Irgendwann musste er doch eingeschlafen sein, denn als er hochschreckte, war es draußen hell. Er sprang auf und hastete zum Fenster. An den Bootshäusern war es ruhig, in Richtung Osten leuchtete der Himmel rötlich. Offenbar war es noch sehr früh am Morgen. Ein Blick auf die Uhr bestätigte den Eindruck. Halb fünf. Trotzdem musste er so schnell wie möglich verschwinden. Die ersten Werktätigen würden sich schon bald auf den Weg zur Arbeit machen. Und jeder würde sich über einen jungen Mann wundern, der sich um diese Zeit bei den Bootshäusern der Bonzen herumtrieb.
Nachdem er sich mit Wein den Mund ausgespült und seine Blase an der Außenwand der Hütte erleichtert hatte, untersuchte er das Schlauchboot mit dem Außenbordmotor. Den zugehörigen Benzintank fand er auf einer Abstellfläche unter dem Bootshaus. Er war fast voll.
Frank zog noch zwei Ruder heraus und warf sie ins Boot. Dann stieg er mit dem Tank in der Hand hinein und schloss die Benzinleitung an. Der Motor brauchte einige Versuche, bis er ansprang, doch schließlich tuckerte das kleine Boot in Richtung Müritz hinaus, folgte dem "Binnensee", diesem Arm der Müritz, der sich weit ins Land bis zum großen Wünnow erstreckte. In einer guten Stunde würde er Eldenburg erreichen.
Zuerst hörte er nur ein fernes Brummen. Dann sah er den Punkt auf dem Wasser, der rasch größer wurde. Das Motorboot hielt direkt auf ihn zu. Rasch änderte er den Kurs, lenkte das Schlauchboot in Richtung Ufer. Plötzlich stotterte der Motor, blieb schließlich ganz stehen. Hastig schob er die Ruder in die Dollen und zog mit aller Kraft durch. Schweiß lief ihm in die Augen und tropfte von der Stirn. Wenn es ein Polizeiboot war, hatte er schlechte Karten. Aber wer sonst sollte um diese Uhrzeit über den See rasen? Vielleicht waren die Vopos doch nicht so blöd.
Wenn er das Schilf rechtzeitig erreichte, wurde er für die Bootsbesatzung unsichtbar. Zumindest vorübergehend. Diese Chance musste er nutzen, es war seine einzige. Schon kratzten die ersten Halme an der Bordwand. Er warf einen Blick in Richtung des Motorbootes. Noch war nicht auszumachen, ob Uniformierte an Bord waren.
Ein Ruder verhakte sich im Schilf, das Boot drehte zur Seite, schwankte bedrohlich. Frank spürte Panik aufsteigen, zerrte an dem widerspenstigen Riemen. Schließlich gelang es ihm freizukommen. Doch an Rudern war nicht mehr zu denken. Er sprang über Bord. Das Wasser reichte bis zu den Oberschenkeln, seine Füße versanken im morastigen Untergrund. Trotzdem gelang es ihm, tiefer in das Schilf vorzudringen. Es reichte jetzt deutlich über seinen Kopf hinaus. Das Boot zog er hinter sich her, es sollte vom Wasser aus nicht mehr zu sehen sein. Allerdings hatte auch er nun keine Sicht auf den See. Dafür war das Motorboot zu hören.
Die Drehzahl des Motors wurde zurückgenommen. Wahrscheinlich hatten sie die Stelle erreicht, an der er verschwunden war. Er sah die Szene vor sich. Ein Mann steuerte, die anderen hatten sich erhoben, um nach ihm Ausschau zu halten.
Plötzlich erstarb der Motorenton. Frank hörte Kommandos, dann ein rhythmisches Klatschen. Offenbar benutzten die Männer Paddel, um in das Schilf vorzudringen.
Frank sah sich um. Das Ufer war noch zu weit entfernt. In wenigen Sekunden würden die Vopos ihn erreichen. Er ließ die Leine fahren, an der er das Boot durchs Schilf gezerrt hatte, hastete weiter, suchte in seiner Hosentasche nach dem Klappmesser. Hinter ihm ertönte ein Ruf. Hatten die Männer ihn entdeckt? Ihm blieb keine Zeit, sich zu vergewissern. Er schnitt aus einem kräftigen Schilfrohr ein Stück heraus, ließ sich unter die Wasseroberfläche gleiten und benutzte das Rohr als Schnorchel. Die Luft reichte nicht für seinen schnellen Atem. Frank zwang sich, ruhig und flach zu atmen. Er spürte den Drang, aufzutauchen, kämpfte dagegen an und hoffte, dass seine Verfolger rasch aufgaben.
Das Wasser übertrug ihre Geräusche. Sie verrieten ihm, dass die Männer das Boot gefunden hatten. Dumpf, aber unverständlich vernahm er ihre Stimmen. Schließlich entfernten sie sich. Nach einer endlos erscheinenden Weile startete der Motor, einige Zeit tuckerte er im Leerlauf, dann wurde die Drehzahl erhöht, und das Motorengeräusch wurde leiser. Frank tauchte auf und schnappte nach Luft. Keuchend watete er in Richtung Ufer. Er musste die nassen Klamotten loswerden und sich die Haare trocknen. So würde er auffallen. Nach Hause zu gehen, war zu riskant. Also musste er zu Kathrin. Ihre Eltern würden ihn nicht verraten. Sie waren nicht in der SED. Und Kathrins Vater hielt wenig von Partei- und Gewerkschaftsbonzen.
Ein ungutes Gefühl ergriff sie, brachte ihr Herz zum Rasen, als es in aller Frühe an der Haustür klingelte und der Ton sie aus dem Schlaf riss. Kathrin Bergmann warf einen schnellen Blick auf ihren Wecker: noch nicht einmal sechs Uhr. Sie setzte sich auf und lauschte nach unten. Würde ihr Vater öffnen, oder war er schon zum Fischen hinausgefahren? Die Treppe von ihrem Zimmer unter dem Dach führte direkt zum Flur im Erdgeschoss. Wenn an der Tür gesprochen wurde, konnte sie die Worte meistens gut verstehen.
Es klingelte erneut und anhaltend. Schließlich vernahm sie Schritte, die Kette wurde ausgeklinkt, dann hörte sie die raue Stimme ihres Vaters. Er klang verärgert. »Was soll das? Um diese Zeit sollten anständige Leute ...«
»Wir müssen Ihre Tochter sprechen, Herr Bergmann. Machen Sie keine Schwierigkeiten!« Der unbekannte Besucher klang herrisch und befehlsgewohnt.
»Kathrin? Um diese Zeit. Was wollt ihr von ihr?«
»Das werden wir ihr schon sagen. Und nun lassen Sie uns bitte rein. Oder schicken Sie Ihre Tochter raus.«
Ihr Vater schwieg einen Moment, dann hörte sie ihn wieder. »Kommt nicht in Frage. Nicht um diese Zeit. Kommt später wieder. Oder sagt mir, was ihr wollt!«
Kathrin befiel eine Ahnung. Sie sprang aus dem Bett, stürzte zur Tür und streckte den Kopf hinaus. »Lass gut sein, Papa! Ich komme. Zieh mir nur schnell was über.«
»Na gut«, knurrte Heinrich Bergmann. »Wenn du es willst.« Er hob die Stimme. »Aber ihr bleibt draußen!«
Hastig warf sie das Nachthemd von sich, schlüpfte in Unterwäsche, Jeans und Pullover und spülte ihren Mund mit Odol. Kathrin war sicher, dass die Männer Vopos oder Stasi-Beamte waren. Wer sonst klingelte im Morgengrauen an Haustüren und trat so bestimmt auf? Der respektlose Umgang ihres Vaters mit den Besuchern war Ausdruck seiner Verachtung für die Handlanger des Systems und zugleich seines Selbstbewusstseins als alteingesessener Müritz-Fischer. Während sie ihr Haar mit einem Gummiband zu einem Pferdeschwanz zusammenband, dachte sie an Frank. Bestimmt kamen die Männer seinetwegen. Irgendwann musste es ja mal so kommen. Seine staatskritischen Äußerungen hatten ihm schon viel Ärger eingebracht. Und wenn, wie sie vermutete, mehr als nur Worte dahintersteckten, war er jetzt wohl zu weit gegangen. Oder jemand hatte ihn angeschwärzt.
Ihr entgingen die anerkennenden Blicke nicht, mit denen der Uniformierte und sein Begleiter in Zivil sie musterten, als sie aus der Haustür trat. Gern hätte sie in diesem Augenblick darauf verzichtet, denn ihr Herz schlug bis zum Hals. Sie musste sich sehr bemühen, ihrer Stimme einen gelassenen Klang zu geben.
»Worum geht es?«, fragte sie und fixierte die Männer nacheinander.
Der Jüngere, der kaum älter als sie selbst war, starrte sie unter seiner Uniformmütze mit großen wässrig-blauen Augen an, öffnete den Mund und schloss ihn wieder. Der Ältere räusperte sich. Er mochte um die dreißig sein – schwer zu schätzen, sein Gesicht war voller Narben. Als er zu sprechen begann, bewegte er kaum die Lippen. Seine Stimme klang schnarrend. Mundgeruch schlug ihr entgegen. Kathrin wich unmerklich zurück.
»Kathrin Bergmann?«
Sie nickte.
»Bekannt mit ... äh ... Frank Peters?«
»Warum wollen Sie das wissen?«
»Die Fragen stellen wir.«
Kathrin zuckte mit den Schultern.
»Also kennen Sie den Bürger Peters?«
»Seit der Schulzeit. Wir sind zusammen auf die Polytechnische in Waren gegangen. Friedrich-Engels ...«
»Und sonst? Keine weitere Be ... äh, nähere Bekanntschaft?«
»Wir kennen uns eben.« Erneut hob Kathrin die Schultern.
»Wissen Sie, wo sich Peters aufhält?«
Es kostete Kathrin einige Mühe, den unbeteiligt neutralen Ton ihrer Stimme zu halten. »Nein. Ich nehme an, dass er zu Hause ist. Er wohnt in Röbel, in der Straße des Friedens.«
Das Narbengesicht verzog sich missbilligend. »Ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie sich mit falschen Angaben verdächtig machen, staatsabträgliche Umtriebe zu unterstützen.«
Kathrin nickte wortlos und ließ die Augen erneut zwischen den Besuchern hin- und herwandern. Dem jüngeren Vopo schien die Situation unangenehm zu werden. In seiner Miene las sie eine Mischung aus Anerkennung, Unbehagen und Entschuldigung. Er warf seinem Kollegen einen Blick zu. »Das war’s dann wohl, Genosse Leutnant. Oder?«
Der Angesprochene machte eine unwillige Bewegung. »Wenn ... der ... Peters versucht, mit Ihnen Kontakt aufzunehmen, haben Sie sich unverzüglich bei uns zu melden. Ist das klar?«
Kathrin nickte schwach. In ihrem Inneren brodelte es, am liebsten hätte sie laut geschrien. Haut ab! Verschwindet und lasst uns in Ruhe! Ich liebe Frank. Ich weiß, dass er nichts Unrechtes tut. Ihr seid diejenigen, die ...
Als die uniformierten Besucher außer Sichtweite waren, schloss sie die Haustür und stürmte die steile Treppe zum Dachgeschoss hinauf. Sie warf sich aufs Bett, schlug mit verzweifelter Wut auf die Kissen.
Wenig später klingelte es erneut an der Tür. Waren die widerlichen Kerle zurückgekehrt? Sie presste ihr Kopfkissen auf die Ohren. Noch einmal würde sie nicht mit denen reden können, ohne die Beherrschung zu verlieren. Sollte ihr Vater sich mit ihnen auseinandersetzen.
Frank hatte den Volkspolizisten und seinen zivilen Begleiter aus sicherer Entfernung beobachtet. Nachdem sie in ihren Lada gestiegen und losgefahren waren, hatte er die Straße noch eine Weile im Auge behalten und war dann zum Eingang des alten Fischerhauses gehastet. Die Tür wurde sofort geöffnet.
Heinrich Bergmann starrte ihn an wie eine Erscheinung. Doch dann packte er blitzschnell zu und zog ihn ins Haus. »Wie siehst du denn aus?«, brummte er. »Warst du um diese Zeit schon am See?«
Frank nickte. »Ich hatte ... habe ... ein kleines Problem.«
»Das sehe ich«, knurrte der Fischer. »Und das besteht nicht nur aus nassen Klamotten. Trotzdem musst du dich erst mal umziehen. Kathrin kann dir was von mir raussuchen. Alles andere besprechen wir später. Ich muss mich um meine Netze kümmern.«
»Danke«, murmelte Frank.
Bergmann winkte ab und musterte ihn von oben bis unten. »Wir hatten gerade Besuch von zwei Vopos. Ich nehme an, dein Zustand und das Interesse der staatlichen Organe hängen irgendwie zusammen. Ich weiß nicht, was sie wollten. Sie haben mit Kathrin gesprochen.«
»Ist sie oben?« Frank deutete auf die Stufen der Treppe.
»Geh rauf!« Der Fischer öffnete die Tür und verschwand.
Als es wenig später klopfte, schreckte Kathrin zusammen. Standen die Männer schon vor ihrer Tür? Sie verwarf diese Möglichkeit. Das würde ihr Vater nicht zulassen. Andererseits hatte sie oft genug von Fällen gehört, bei denen Volkspolizei und Stasi in Häuser eingedrungen waren und sich nicht um die Einwände der Bewohner gekümmert hatten. Sie rollte sich leise aus dem Bett und schlich zur Tür, um den Schlüssel herumzudrehen. Da hörte sie ihren Namen. War das Franks Stimme? Im nächsten Augenblick rief er erneut. »Kathrin? Bist du da? Ich bin’s.« Sie riss die Tür auf und breitete die Arme aus.
Frank stand auf der Schwelle und rührte sich nicht. Statt sie zu umarmen, grinste er und sah verlegen an sich hinab. Erst jetzt schaute sie ihn genauer an. »Du bist ja nass! Und wie du riechst!«
»Tut mir leid«, murmelte er. »Ich müsste wohl dringend aus den feuchten Sachen und mich waschen.«
Kathrin half ihrem Freund aus den Kleidern, die sich nur mit Mühe abstreifen ließen. »Du bist ganz kalt«, stellte sie fest. »Am besten nimmst du erst mal eine heiße Dusche. Ich suche dir etwas zum Anziehen heraus. Und dann erzählst du mir alles. Vorhin waren schon zwei Vopos hier und haben nach dir gefragt.«
»Ich weiß.« Während er auch die nasse Unterhose abstreifte und auf den Stapel mit den übrigen Sachen warf, fuhr er fort. »Sie waren hinter mir her. Ich musste mich am See und zeitweise unter Wasser verstecken.«
Kathrins Blick wanderte über Franks Körper. Es war nicht das erste Mal, dass sie ihn so sah. Dennoch erschien er ihr heute begehrenswerter als je zuvor. Seine Haut war leicht gebräunt und glänzte von der Feuchtigkeit. Die sonst ungebändigten Locken klebten am Kopf. Aus dem nassen Haar fiel ein einsamer Wassertropfen in den Nacken, rann wie in Zeitlupe den Rücken hinab und verschwand zwischen den Gesäßmuskeln. Die entblößten Schultern und Arme ließen die athletische Figur stark und verletzlich zugleich erscheinen. Sie spürte das Klopfen ihres Herzens und ein sehnsüchtiges Ziehen unter der Bauchdecke. Am liebsten wäre sie aus den Kleidern geschlüpft und hätte sich an ihn gepresst. Stattdessen deutete sie zum Vorhang, hinter dem sich die Dusche befand. »Ich bin gleich wieder da.«
Als sie mit Unterwäsche, Hemd und Hose aus dem Schrank ihres Vaters zurückkehrte, trat Frank gerade aus der Dusche hervor, ein Handtuch, mit dem er sich über die Haare fuhr, verdeckte sein Gesicht. Kathrin warf die Sachen auf einen Stuhl und schlüpfte rasch aus ihren Kleidern.
Frank ließ das Handtuch fallen und sah sie erstaunt an.
»Komm!«, murmelte sie heiser und streckte die Arme aus. Ihre Fragen verschob sie auf später.
2
»Fünf Kilometer können ganz schön lang sein.« Der Fahrer des silbergrauen Passats warf einen Blick in den Rückspiegel. »Ob wir hier noch richtig sind? Ich sehe weit und breit kein anderes Auto.« Misstrauisch betrachtete er die Anzeige auf dem Navigationsgerät. »Das Ding sagt auch nichts mehr. Zeigt nur einen geraden Weg.«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!