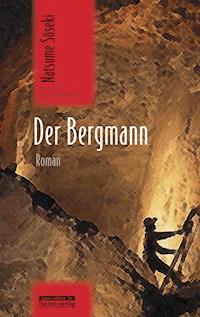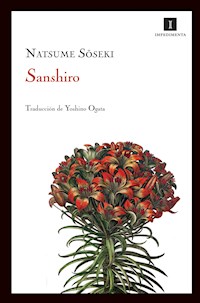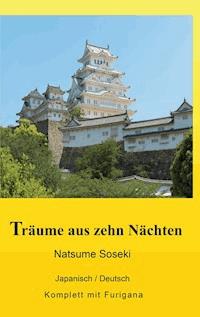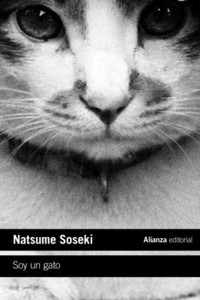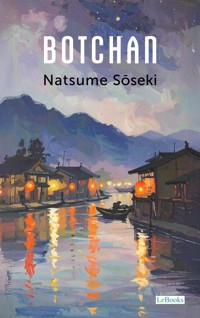Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BeBra Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kunstvolle Gedichte und tiefsinnige Gedanken über das Wesen der Kunst und der Natur sind das einzige, was der junge Protagonist dieses Romans, ein junger Maler, auf seiner ziellosen Wanderung durch die Berge zustande bringt. Als er unterwegs die Tochter eines Gastwirts kennenlernt, ist er auf Anhieb fasziniert von ihr. Langsam kommen die beiden sich näher, und die emotionale Distanz, mit der er sich bislang vor den Zumutungen der Welt zu schützen versuchte, gerät ins Wanken. Natsume Sosekis 1906 erschienener Künstlerroman verknüpft meisterhaft Motive westlicher und östlicher Literatur und besticht durch die Poesie seiner Sprache. Ein Meisterwerk der japanischen Moderne – erstmals seit 20 Jahren wieder auf Deutsch erhältlich.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 277
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
japan edition
herausgegeben von Eduard Klopfenstein, Zürich
Die Schreibweise der japanischen Namen wurde in ihrer ursprünglichen japanischen Gestalt belassen, also erst der Familienname, dann der persönliche Name.
Natsume Sōseki
Das Graskissen-Buch
Roman
Aus dem Japanischen übersetztund mit einem Nachwort versehenvon Christoph Langemann
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte vorbehalten.
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen, Verfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung auf DVDs, CD-ROMs, CDs, Videos, in weiteren elektronischen Systemen sowie für Internet-Plattformen.
Japanischer OriginaltitelKusamakura
Erstveröffentlichung des japanischen Originals 1906
ebook im be.bra verlag, 2020
© der Originalausgabe:
japan edition im be.bra verlag GmbH
Berlin-Brandenburg, 2020
KulturBrauerei Haus 2
Schönhauser Allee 37, 10435 Berlin
Lektorat: Ingrid Kirschey-Feix, Berlin
Umschlag: Hauke Sturm (unter Verwendung eines Fotos von Gabriel M. Corvian)
ISBN 978-3-83932-142-3 (epub)
ISBN 978-3-86124-922-1 (print)
www.bebraverlag.de
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Anmerkungen
Nachwort
I
Ich stieg auf schmalem Pfad bergan und dachte bei mir: Wer nur der Vernunft folgt, eckt an. Wer in den Strom der Gefühle hinausrudert, wird von ihm erfasst. Wer seinen Willen durchsetzt, dem wird es bald zu eng. Es ist auf jeden Fall schwer, in der Menschenwelt zu leben.
Wenn die Schwierigkeiten sich häufen, möchten wir in eine ruhigere Wirklichkeit hinüberwechseln. Irgendwann jedoch wird uns klar, dass das Leben überall schwer ist. Dann entsteht Poesie, wird Malerei geboren.
Nicht Götter, nicht Dämonen haben die Menschenwelt erschaffen, sondern Durchschnittsbürger wie die Nachbarn in unserer Straße, die wir regelmäßig ihren Geschäften nachgehen sehen. Unsere Welt stammt von ganz normalen Sterblichen ab, und wohl deshalb gibt es kein Land, in das wir hinüberwechseln könnten, denn dafür käme nur ein nicht menschliches Land in Frage – ein solches wäre aber noch schwieriger zu bewohnen.
Wir können diesem qualvollen Sein also nicht entfliehen, sondern müssen es uns darin bequem machen, so gut es geht, damit unser Leben erträglicher wird, und sei es nur für einen Augenblick, denn so kurz dauert es. Hierhin nun fällt die Berufung des Dichters, die naturgewollte Aufgabe des Malers: All diese Ritter der schönen Künste verdienen unsere Bewunderung, weil sie Frieden bringen in die Menschenwelt und unseren Geist bereichern.
Dichtung und Malerei, aber auch Musik, Skulptur, nehmen dem schweren Leben das Leid und bilden eine neue, freundlichere Welt vor unseren Augen ab. Genau gesagt müssen sie sie nicht einmal wirklich abbilden, denn schon wenn wir sie nur in unserer Vorstellung sehen, lebt ein Gedicht auf, sprudelt ein Lied hervor. Auch ohne dass wir unsere Einfälle zu Papier bringen, erklingen Harmonien in unserer Brust, und dem Blick bietet sich eine ganze Pracht dar, ohne dass wir Farben auf unseren Malgrund pinseln. Es genügt vollauf, wenn man die Welt, in der man selbst lebt, in dieser neuen Weise betrachten und mit der Kamera der Seele die schmutzige, trübe Wirklichkeit klären und aufhellen kann. Aus diesem Grund ist sogar ein stummer Dichter ohne Strophe oder ein farbenloser Maler ohne Leinwand, der fähig ist, seine Umwelt in der genannten Art zu sehen und sich dadurch von den Qualen des Lebens zu erlösen, um in eine reine Welt zu entfliehen und ein allumfassendes Universum zu erschaffen, glücklicher als ein vergoldeter Fürst, glücklicher auch als ein Heerführer mit zehntausend Reitern oder ein Liebling des irdischen Schicksals.
Nach zwanzig Jahren in dieser Welt habe ich erkannt, dass es sich dennoch lohnt, in ihr zu leben. Nach fünfundzwanzig ist mir bewusst geworden, dass hell und dunkel wie die Vorder- und Rückseite derselben Sache sind, dass dort, wo die Sonne scheint, bestimmt auch Schatten fällt. Und jetzt, mit dreißig, denke ich so: In Zeiten großer Freude ist die Trauer umso tiefer, und je mehr Glück wir erfahren, desto schlimmer ist unser Leid. Versuchten wir, diese Tatsache aus dem Weg zu räumen, hätte unsere Welt keinen Bestand. Geld ist wichtig … Nehmen aber wichtige Dinge überhand, sorgt man sich sogar nachts im Bett. Liebe ist wunderschön … Je mehr wir jedoch von Liebesglück erfüllt sind, desto lieblicher erscheint uns plötzlich unsere lieblose Vergangenheit. Auf den Schultern eines hohen Beamten ruht das Gewicht einiger Millionen Leute. Sein Rücken ist gebeugt unter einem schweren Staat … Bekommt man keinen Leckerbissen, so sehnt man sich danach. Ergattert man ein wenig davon, wird man nicht satt. Darf man aber nach Lust und Laune schmausen, fühlt man sich in der Folge unwohl.
Bis an diesen Punkt waren meine Gedanken geschweift, als mein Fuß plötzlich über den Rand eines kantigen Steines, der nicht festsaß, ausrutschte. Mein linker Fuß sauste sofort nach vorn, um das Gleichgewicht zu wahren und dem Fehler entgegenzuwirken – prompt landete ich mit dem Hintern auf einem gar nicht so unbequemen, etwa drei Fuß großen Felsbrocken. Die Schachtel mit den Malutensilien, die ich über die Schulter gehängt hatte, entglitt mir und flog in hohem Bogen nach vorn, ansonsten war glücklicherweise nichts Schlimmeres geschehen.
Als ich aufstand und meine weitere Umgebung wahrnahm, sah ich, dass links des Weges Berggipfel wie umgekehrte Eimer emporragten, die vom Fuß bis zur Spitze über und über mit dunklen, blaugrünen Bäumen bewachsen waren – ob Zedern oder Zypressen, wusste ich nicht. Dazwischen zogen sich rosa blühende Bergkirschen wie Girlanden hin. Dichte Nebelschwaden verdeckten die Übergänge zwischen den Bäumen. Etwas näher zu mir erhob sich aus der Menge der Berge ein kahler Hügel, der mir in die Augen fiel. Seine nackten Seiten stießen verzweifelt und scharf ins Tal, als habe sie ein Riese mit der Axt behauen. Auf dem Grat wuchs ein einzelner Baum, vermutlich eine Rotkiefer. Zwischen ihren Ästen konnte ich sogar Stücke des Himmels erkennen. In meiner Gehrichtung brach der Weg offensichtlich nach etwa zweihundert Metern ab. Weiter oben jedoch regte sich eine menschliche Gestalt, die in eine rote Decke gehüllt war. Es schien mir ratsam, dorthin aufzusteigen, um weiterzukommen. Der Weg war äußerst beschwerlich und schwierig zu finden.
Hier den Boden zu planieren, wäre zwar nicht allzu aufwendig gewesen, doch steckten in der Erde riesige Felsbrocken, die einzuebnen unmöglich gewesen wäre. Die Steine hätte man sprengen können, aber bei den Felsen wäre man nie an ein Ende gelangt. Die freigegrabenen Blöcke wären unverändert liegengeblieben. Sie gaben überhaupt nicht den Anschein, als wollten sie uns Menschen den Weg räumen. Da sie also nicht auf mich hörten, musste ich wohl oder übel darübersteigen oder um sie herumgehen. Sogar die felsenlosen Stellen waren unwegsam, denn der Pfad war tief eingegraben, mit hohen Wänden zu beiden Seiten. Im Querschnitt glich er, so könnte man sagen, einem umgekehrten Dreieck, dessen Spitze unten auf der Mittellinie lag, und das ungefähr sechs Meter lange Schenkel hatte. Es schien mir, als bewegte ich mich am Grunde eines Flusses fort, anstatt auf einem Weg. Da ich von Anfang an nicht die Absicht gehabt hatte, mich auf dieser Reise zu beeilen, nahm ich die vielen Windungen des Pfades gemächlich in Angriff.
Plötzlich ertönte unter meinen Füßen Lerchengesang. Ich blickte ins Tal, konnte jedoch weder den Vogel noch seinen Schatten erkennen. Nur die Stimme war deutlich zu hören: ein geschäftiges, pausenloses Zwitschern. Es wirkte so, als werde die Luft im Umkreis mehrerer Meilen so heftig von Flöhen gebissen, dass sie es nicht mehr aushielt. Dieser Gesang hatte keinen freien Moment zu vergeben. Man merkte, dass der Vogel keine Ruhe fand, bis er den milden Frühlingstag ganz und gar ausgefüllt und bis zur äußersten Klarheit, zum wahren Leben gebracht hatte. Höher, immer höher empor stieg der Gesang. Bestimmt stirbt die Lerche mitten in den Wolken. Vielleicht treibt sie, wenn sie ihren absoluten Höhepunkt erreicht hat, einfach in die Wolken hinein und schwebt dahin, bis sie entschwindet und nur noch ihr Gesang vom weiten Himmel erschallt.
An einer Stelle mit winkligen Felsen, bei der ein Blinder wohl kopfüber in die Tiefe gestürzt wäre, musste ich scharf nach rechts biegen. Ich blickte seitlich hinunter. Ein weites Feld von blühendem Raps tat sich vor mir auf. Vielleicht ließ sich die Lerche dort irgendwo nieder? Nein, dachte ich, eher ist sie von der goldenen Fläche aufgestiegen! Oder kreuzten sich eine steigende und eine sinkende Lerche im Flug? Schließlich dünkte es mich, die Lerche müsse wohl immerfort fröhlich singen, ob sie nun steige, sinke oder sich mit einer anderen kreuze.
Im Frühjahr wird alles schläfrig. Die Katzen vergessen, auf Mäusejagd zu gehen. Wir Menschen vergessen, dass wir Schulden haben. Manchmal vergessen wir sogar, an welchem Ort sich unsere eigene Seele befindet, und verlieren fast unser Selbstbewusstsein. Aber wenn wir von ferne ein blühendes Rapsfeld sehen, wachen wir auf. Und wenn wir eine Lerche zwitschern hören, wissen wir plötzlich wieder ganz genau, wo sich unsere Seele befindet. Die Lerche singt nämlich nicht nur mit dem Schnabel, sie jubiliert mit ihrem ganzen Sein. Unter allen Wesen, deren Seele sich in der Stimme äußert, ist sie wohl das lebensfrohste. Plötzlich fiel mir das Lerchengedicht von Shelley ein, und ich murmelte die paar Zeilen, die ich auswendig wusste, vor mich hin:
We look before and after
And pine for what is not
Our sincerest laughter
With some pain is fraught
Our sweetest songs are those
That tell of saddest thought[1]
(Wir schauen vorwärts und zurück/ Sehnen uns nach dem, was nicht ist/ Unser Lachen, und sei es noch so ehrlich/ Ist immer auch von Leid durchwirkt/ Unsere lieblichsten Lieder/ Enthalten die traurigsten Gedanken.)[2]
Ich begriff, dass ein Dichter, und wäre er noch so glücklich, sich nie wie jene Lerche voll darauf konzentrieren könnte, seine Freude hinauszusingen, ohne an Vergangenes oder Zukünftiges zu denken. Ganz zu schweigen von der europäischen Poesie – auch in der chinesischen erscheinen oft Ausdrücke wie tausend Tonnen Trauer. Wo es bei den Dichtern abertausend Tonnen sind, reicht bei den Durchschnittsmenschen schon etwa ein Pfund. Die Dichter neigen eben mehr als andere Leute dazu, sich abzuquälen, denn sie haben wohl doppelt so empfindliche Nerven wie jene. Wenn sie zeitweise überirdisches Glück erleben dürfen, so leiden sie doch auch an abgrundtiefer Trauer. Man muss es sich also gut überlegen, ob man Dichter sein will!
Eine Weile verlief der Weg eben. Rechts von mir setzten sich die bewaldeten Berge fort, links die Rapsfelder. Ab und zu trat ich unabsichtlich auf Löwenzahnpflanzen, die ihre gezackten Blätter zuversichtlich in alle Richtungen streckten, um die goldgelben Scheiben in ihrer Mitte zu schützen. Es tat mir leid, dass ich sie zertreten hatte, als ich mich von den Rapsfeldern hatte in Bann schlagen lassen. Aber als ich zurückschaute, thronten die gelben Blüten wie zuvor gelassen zwischen ihren zackigen Blättern. So unbekümmert! Ich hing weiter meinen Gedanken nach.
Während das Leid also vielleicht der unvermeidliche Begleiter eines jeden Dichters ist, war im Gefühl, das ich hegte, als ich jener Lerche zuhörte, nicht das kleinste Quäntchen Trauer enthalten. Und auch beim Anblick der Rapsfelder erfüllte meine Brust nichts als tanzende Freude. Beim Löwenzahn war es genauso, und auch die Kirschblüten … doch die waren in der Zwischenzeit nirgends mehr zu sehen. Alles was ich sah und hörte, wenn ich in die Berge stieg und direkt mit der Natur in Berührung kam, war für mich interessant. Es war reiner Genuss, ohne dass daneben irgendein besonderes Leid aufkam. Mir schmerzten höchstens einmal die Füße, oder ich konnte gerade nichts Gutes zum Essen auftreiben.
Aber wieso empfand ich denn überhaupt kein Leid? Wohl deshalb, weil ich meine Umgebung wie ein Bild betrachtete, wie ein Gedicht las. Wenn ich das tat, kam in mir nicht die Absicht auf, hier ein Grundstück zu kaufen und urbar zu machen, oder dort eine Eisenbahnlinie hindurchzuführen. Diese Landschaft an sich – nur diese Landschaft, die mich weder ernähren noch mein Monatsgehalt vergrößern konnte – erfüllte mich mit reiner Freude, der weder Leid noch Sorgen beigemischt waren. In dieser Hinsicht ist die Kraft der Natur bewundernswert: Sie vermag unser Wesen unmittelbar zu bilden, zu klären, und ist fähig, uns augenblicklich in das reine Land der Poesie zu entführen.
Die Liebe zwischen Mann und Frau, die Verehrung der Kinder für ihre Eltern sind wohl schön, und es mag auch recht sein, wenn ein Ritter seinem Fürsten Loyalität beweist,[3] doch wenn man all diese Pflichten auf sich nimmt, gerät man in den Sog des Eigeninteresses, so dass es einem schließlich vor lauter »schönen« und »guten« Dingen ganz schwarz vor den Augen wird. In diesem Zustand kann man nicht mehr entscheiden, ob etwas poetisch ist oder nicht.
Um dies zu tun, muss man sich in die Position eines Dritten versetzen, der genug Abstand hat. Gerade in einer solchen Sichtweise liegt der Reiz beim Drama oder beim Roman: Leute, die es genießen, ein Theaterstück zu sehen oder einen Roman zu lesen, stellen ihr Eigeninteresse für eine Weile hintan. Solange sie zuschauen oder lesen, sind sie Dichter.
Dennoch entziehen sich die meisten Schauspiele und Erzählungen nicht den Verwicklungen der menschlichen Gefühle. In ihnen kommen bald Leid und Zorn vor, bald Lärmen und Weinen. Und irgendwann wird der Zuschauer mit hineingezogen, leidet, wird zornig, lärmt und weint mit. Vielleicht ist der einzige Vorteil dieser Werke, dass in ihnen zumindest Gier und Habsucht keine Rolle spielen. Dafür sind allerdings die anderen Leidenschaften in noch höherem Maße als im Alltagsleben vorhanden. Das ist mir zuwider!
Leiden, Zornigwerden, Lärmen und Weinen gehören unabdingbar zur Menschenwelt. Auch ich habe sie dreißig Jahre lang bis zum Überdruss ausgekostet. Es ist mir zu viel, diese Erregungen auch noch in Theaterstücken und Romanen immer wieder über mich ergehen zu lassen. Poesie, wie ich sie mir vorstelle, reitet nicht ständig auf solchen weltlichen Gefühlen herum. Im Gegenteil: Sie gestattet mir, die gemeinen Gedanken abzuschütteln und mich von der staubigen Wirklichkeit zurückzuziehen, wenn auch nur für beschränkte Zeit. Bisher haben sich auch die besten Dramen nicht von den menschlichen Leidenschaften lösen können, und nur ganz wenige Erzählungen bewegen sich außerhalb der gängigen Moral. Es ist ein Kennzeichen dieser Werke, dass sie sich nicht aus dieser Welt wegheben können. In der Literatur des Westens tritt diese Eigenschaft besonders deutlich zutage. Hier ist auch die sogenannte »reine Poesie« unfähig, die Grenzen dieser Welt zu sprengen, da sie nur das Menschliche zur Grundlage hat. Sie besteht aus nichts als Mitgefühl, Liebe, Gerechtigkeit, Freiheit und beschränkt sich auf dasjenige, womit wir auf dem Markt unseres vergänglichen Lebens handeln. Wie poetisch sie auch sein mag, sie strampelt sich auf dem Erdboden ab und zählt immer nur einzelne Cent. Es ist kein Zufall, dass Shelley geseufzt hat, als er die Lerche singen hörte.
Glücklicherweise gibt es im Osten Gedichte, die sich davon haben lösen können.
Ich pflücke Chrysanthemen am östlichen Hag, betrachte gelassen die südlichen Berge.[4]
Mit wenigen Worten wird hier eine Szenerie beschrieben, die uns das hitzige Leben völlig vergessen lässt. Kein Nachbarsmädchen guckt schelmisch über den östlichen Hag, kein vertrauter Freund lebt in den südlichen Bergen. Es entsteht ein Gefühl, als sei man der Welt enthoben und könne sich endlich den Schweiß des Eigeninteresses, der Vor- und Nachteile, abwischen.
Allein sitze ich, verborgen inmitten eines Bambusdickichts
Zupfe Saiten, pfeife mir etwas vor
Tiefe Wälder, den Menschen unbekannt
Nur der Mond kommt und scheint mir ins Gesicht[5]
Diese vier Zeilen genügen dem Dichter, ein ganzes Universum zu erschaffen, dessen Qualität nichts gemeinsam hat mit derjenigen von Romanen wie Hototogisu[6] oder Konjiki yasha[7]. Sie ist vielmehr von einer Art, die uns, wenn wir von Dampfschiffen, Eisenbahnzügen, Macht, Pflicht, Tugend und Anstand völlig erschöpft sind, alles vergessen und ruhig schlafen lässt.
Wenn nun im zwanzigsten Jahrhundert Schlaf vonnöten ist, dann ist eine solche »weltenthobene Poesie« wichtig. Leider sind die heutigen Dichter, und mit ihnen auch die Leser, von den Europäern angesteckt, und es scheint unter ihnen nur sehr wenige zu geben, die bereit sind, frisch drauflos einen sorgenfreien, leichten Nachen[8] zu besteigen und zum Pfirsichblütenquell[9] hinaufzufahren. Ich selbst bin nie professioneller Dichter gewesen, habe also eigentlich nicht die Neigung, die Poesie eines Tao Yuanming oder Wang Wei in unsere heutige Welt zu verpflanzen. Ich meine nur, dass ihre Inspiration für uns eine bessere Medizin darstellt als Theaterabende und Bälle, vortrefflicher ist als Faust oder Hamlet.
Solche Gedanken waren es, die bewirkten, dass ich jetzt im Frühjahr, mit den Malutensilien in der Schachtel und dem dreibeinigen Klappsessel bewaffnet, gemächlich den Gebirgspfad entlangwanderte. Ich wollte die Poesie von Tao Yuanming und Wang Wei direkt aus der Natur saugen und – sei es auch nur für kurze Zeit – ziellos durch eine Welt streifen, die frei ist von menschlichen Leidenschaften. Das war eine Schrulle von mir, ein Rausch.
Da auch ich Teil der Menschheit bin, konnte ich freilich meine »Weltabgeschiedenheit« unmöglich ewig beibehalten, so sehr ich sie auch liebte. Schon Tao Yuanming starrte vermutlich nicht jahrelang auf die südlichen Berge, und Wang Wei mochte es wohl nicht besonders, ohne Moskitonetz in seinem Bambusdickicht zu schlafen. Wahrscheinlich verhökerte der eine seine überzähligen Chrysanthemen an einen Blumenladen, während der andere seine Bambussprossen einem Gemüsehändler verkaufte. Bei mir war es nicht anders. Zwar gefielen mir die Lerche und die Rapsblüten überaus, doch wollte ich meine »Weltabgewandtheit« nicht so weit treiben, dass ich in den Bergen im Freien übernachtete. Sogar hier traf ich übrigens auf Menschen: ländliche Gestalten, die ihre Kimonos in die Gürtel hochgesteckt hatten und Kopftücher trugen, Frauen, deren rote Unterröcke sichtbar waren, und hie und da auch ein Pferd, dessen Gesicht länger war als das der Menschen. Selbst hier, wo ich, umringt von Millionen Zypressen, einige hundert Fuß über dem Meeresspiegel die Luft ein- und ausatmete, konnte ich den Geruch der Menschheit nicht abstreifen. Doch wie dem auch sei, mein Ziel, an dem ich nach der Überquerung des Berges zur Ruhe kommen wollte, war das Dörfchen Nakoi mit seinen Thermalquellen. Dort würde ich die Nacht verbringen.
Es gibt unzählige Arten, ein Ding zu sehen. Leonardo da Vinci soll seinen Schülern einmal gesagt haben: »Hört zu, wenn die Glocke schlägt! Es gibt nur eine Glocke – ihren Ton jedoch kann man auf verschiedenste Weise hören.«[10] Auch über einen Mann, über eine Frau kann man sich vielerlei Meinungen bilden, je nachdem, wie man sie sieht. Ich hatte diese Reise in der Absicht angetreten, mich von den menschlichen Leidenschaften zu lösen, und wollte aus dieser Einstellung heraus auch die Menschen selbst sehen. Das unterschied sich ganz und gar vom engen, qualvollen Leben im x-ten Haus einer Gasse dieser unbeständigen Welt. Wenn es mir vielleicht auch nicht gelang, mich vollständig von den Leidenschaften freizumachen, so konnte ich meine Gefühle doch möglichst seicht halten, ähnlich wie beim Betrachten eines Nō-Spiels[11]. Auch im Nō kommen menschliche Leidenschaften vor. Ich kann nicht schwören, dass bei Shichikiochi oder Sumidagawa[12] niemand in Tränen ausbricht. Aber beim Nō ist die Aufführungspraxis so beschaffen, dass die Leidenschaften nur etwa dreißig Prozent ausmachen, während die restlichen siebzig aus Kunst bestehen. Der Reiz des Nō-Theaters liegt für uns nicht darin, dass die Leidenschaften der alltäglichen Welt genau nachgeahmt werden, sondern darin, dass über einen solchen Realismus die unzähligen Kimonos der Kunstfertigkeit gestreift werden, und auch darin, dass die Bewegungen der Schauspieler langsam sind wie nie in der Wirklichkeit.
Wie wäre es wohl, wenn ich eine Weile lang alles, was ich auf dieser Reise erlebe, als Nō-Drama, die Menschen, denen ich begegne, als Schauspieler betrachte? Ich kann die menschlichen Leidenschaften zwar nicht ganz abschütteln, doch will ich mich bemühen, sie auf ein Minimum zu beschränken, habe ich doch diese Reise von Anfang an als »poetische Reise« verstanden. Sicher ist dies etwas wesentlich Anderes als die »südlichen Berge« und das »Bambusdickicht«, und man kann die Menschen nicht mit Rapsblüten und Lerchen vergleichen. Aber ich will mich den Dingen nähern, so gut es geht, und von ihrem Standpunkt aus die Menschen betrachten. Der Mann Bashō[13] hat sogar aus einem Pferd, das in seiner Nähe pisste, ein elegantes Bild gemacht, indem er ein Haiku[14] darüber dichtete. Auch ich will von jetzt an versuchen, die Menschen, die ich treffe, ob Bauer, Bürger, Gemeindeschreiber, Großvater oder Großmutter, allesamt als gemalte Einzelheiten im großen Bild der Natur aufzufassen. Natürlich werden sie, anders als in einem Gemälde, tun und lassen, was ihnen beliebt. Aber es ist primitiv, die Gründe für jedes Verhalten zu suchen, sich in die psychologischen Prozesse einzumischen und Erörterungen über die menschlichen Konflikte anzustellen, wie es die meisten Schriftsteller tun. Sollen sich die Herrschaften doch nur bewegen! Nichts stört mich, wenn ich sie als Menschen betrachte, die es in einem Bild tun. Als Personen in einem Gemälde mögen sie sich regen, soviel sie wollen, sie können nicht aus der Fläche heraustreten. Erst wenn sie diese verlassen und wir ihr Wirken in drei Dimensionen sehen, geraten sie mit uns in Konflikt, der Streit um die Eigeninteressen beginnt, und es wird lästig. Und je mühevoller alles wird, desto weniger können wir ihre Schönheit empfinden. Ich will deshalb von jetzt an alle, denen ich unterwegs begegne, von einem erhöhten, unabhängigen Standpunkt aus betrachten, so dass der elektrische Kontakt der Leidenschaften zwischen mir und ihnen nicht unüberlegt hergestellt wird. So kann mein Gegenüber tun und lassen, was es will – es gelingt ihm nicht, sich in mein Herz zu wurmen. Ich stehe wie vor einem Bild und schaue zu, wie die Menschen darin hin- und herlaufen und lärmen. Ich kann in Ruhe zusehen, denn ich bin etwa drei Fuß weit von der Bildfläche entfernt – ganz ohne Gefahr kann ich es tun! Anders ausgedrückt: Da ich mir vom Eigeninteresse nicht die Besinnung rauben lasse, kann ich meine ganze Kraft nutzen, die Handlungen jener Menschen von der künstlerischen Seite her zu betrachten. So bin ich in der Lage, meine Aufmerksamkeit ausschließlich der Beurteilung zu widmen, ob sie schön sind oder nicht.
Als ich zu diesem Schluss gelangt war, bemerkte ich, dass der Himmel seltsam bedrohlich aussah. Ich hatte gemeint, dass die Wolken noch tief über meinem Kopf hingen und unschlüssig zögerten; irgendwann jedoch waren sie plötzlich zerflossen, bis sie zu meinem Erstaunen den ganzen Himmel wie ein Meer bedeckten, aus dem jetzt schon leise die ersten Tropfen eines Frühlingsregenschauers fielen. Die Rapsfelder waren allmählich in der Ferne entschwunden, und ich wanderte jetzt zwischen zwei Berghängen hindurch. Ihren Abstand zu schätzen, war schwierig, denn die Regenfäden waren so fein, dass sie fast einem Nebel glichen. Ab und zu kam ein Windstoß und wehte die hoch aufgetürmten Wolken für eine Weile auseinander, so dass ich den schwärzlichen Bergrücken zu meiner Rechten wahrnehmen konnte. Jenseits des Tals drüben schien sich eine Gebirgskette hinzuziehen. Zu meiner Linken war ganz in der Nähe der Fuß des Berges sichtbar. Durch den dichten Regen hindurch meinte ich, einzelne Kiefern erkennen zu können. Aber kaum traten sie hervor, wurden sie auch schon wieder verschluckt. Ich wusste nicht, trieb der Regen, trieben die Bäume oder trieben meine Träume vorbei, und das war ein wunderliches Gefühl.
Wider Erwarten wurde der Weg breiter und ebener. Es war nun nicht mehr so beschwerlich, darauf zu wandern, aber ich musste mich beeilen, denn ich hatte keinen Regenschutz mitgenommen. Von meinem Hut troff Wasser. Da hörte ich einige Meter weiter vorne Schellen läuten, und ein Pferdetreiber trat wie eine Geistererscheinung aus dem Dunkel hervor.
»Gibt es hier keinen Ort, an dem ich ausruhen kann?«
»Etwa anderthalb Kilometer weiter vorne werden Sie ein Teehäuschen finden. Nicht wahr, Sie sind recht nass geworden?«
»Anderthalb Kilometer?«, dachte ich und drehte mich um – da war der Pferdetreiber schon wie ein Schattenbild hinter den Regenschwaden entschwunden.
Die kleinen Tröpfchen, die mir wie Kleiestaub vorgekommen waren, wurden größer und länger, bis einzelne vom Wind gepeitschte Fäden sichtbar waren. Mein Überkimono war völlig durchnässt, und das Wasser war mir schon durch alle Kleider bis an die Haut gedrungen, wo ich spüren konnte, wie es vom Körper leicht erwärmt wurde – ein äußerst unangenehmes Gefühl. Ich zog mir den Hut tiefer ins Gesicht und eilte voran.
Wenn ich von mir als von einem anderen dachte, der bis auf die Haut durchnässt diese verwaschene, sepia-farbene Welt durchmaß, über die unzählige schräge Silberfäden dahinstrichen, fand ich, dass dies ein gutes Gedicht oder Haiku abgäbe. Erst wenn ich mein wirklichkeitsgebundenes Selbst völlig vergaß und mich von einem rein sachlichen Standpunkt aus betrachtete, konnte ich mich als Mensch in einem Bild sehen, die schöne Harmonie mit meiner natürlichen Umgebung wahren. In dem Moment jedoch, in dem ich am Regen litt oder meinen müden Füßen Aufmerksamkeit schenkte, war ich keine Person in einem Gedicht oder Bild mehr, sondern wie sonst nichts als ein gewöhnlicher Stadtbürger. Ich sah nicht, wie Wolken fliegen, Nebel brodeln, es berührte mich nicht, dass Blüten fallen und Vögel zwitschern.[15] Ich verstand plötzlich nicht mehr, was daran denn nun »schön« sein sollte, mutterseelenallein in diesen verlassenen Frühlingsbergen herumzustapfen. Zuerst drückte ich mir den Hut noch tiefer ins Gesicht. Dann schaute ich beim Gehen nur noch auf meine Fußspitzen. Schließlich zog ich die Schultern zusammen und hastete wütend drauflos. Soweit ich sehen konnte, drängten im Regen rauschende Wipfel auf mich ein. Das war nun wirklich zu sehr »der Menschenwelt enthoben«!
II
»Ist jemand da?«, rief ich, doch es gab keine Antwort.
Ich stand unter dem Vordach und spähte ins Haus hinein. Die rußgeschwärzten Papierschiebefenster waren geschlossen. Was sich dahinter befand, konnte ich nicht sehen. Von der Dachtraufe baumelten ein halbes Dutzend Paar verlassene Strohsandalen trübselig an ihren Senkeln hin und her. Unten waren drei Schachteln mit billigem Teegebäck aufgereiht, um sie herum lagen einige alte Bronzemünzen verstreut.
»Ist jemand da?«, rief ich wieder. Auf dem großen Steinmörser, der in einer Ecke des Vorraums auf der gestampften Erde stand, schreckten plötzlich zwei aufgeplusterte Hühner aus ihrem Schlaf auf und begannen zu lärmen: »Kukuku, kukuku«. Diesseits der Schwelle befand sich ein Lehmherd, dessen eine Hälfte anders aussah als die andere, weil sie soeben im Regen nass geworden war. Darauf stand ein rabenschwarzer Teekessel, ob aus Keramik oder Silber, ich wusste es nicht. Glücklicherweise brannte unten im Herd Feuer.
Da niemand Antwort gab, trat ich unangemeldet ein und setzte mich auf eine Bank. Die Hühner schlugen mit den Flügeln. Dann flatterten sie plötzlich vom Mörser herunter in Richtung des erhöhten Wohnbereichs. Wären die Schiebefenster nicht zu gewesen, die Hühner hätten vielleicht Lust bekommen, durch das ganze Haus zu rennen. Der Hahn krähte mit breiter Stimme, das Huhn fügte sein feines Gackern hinzu. Sie schienen mich für einen Fuchs oder Hund zu halten. Auf der Bank wartete ein japanisches Rauchservice, etwa so groß wie ein hölzernes Reismaß, still und geduldig auf einen Benutzer. Darauf schwelte ein spiralig gewundenes Räucherstäbchen gegen die Insekten äußerst gemächlich vor sich hin. Es schien nicht zu wissen, dass die Zeit vergeht. Allmählich verzog sich der Regen.
Nach längerem Warten ertönten aus dem Innern des Hauses Schritte. Die rußigen Schiebefenster öffneten sich vollständig, und eine alte Frau trat hervor.
Jemand muss kommen!, hatte ich mir die ganze Zeit über gesagt. Das Feuer im Herd glühte. In den Kuchenschachteln lagen die Münzen. Das Räucherwerk glomm sorglos dahin. Alles wies auf einen bevorstehenden Auftritt hin. Dass man sich hier nicht groß um den Laden kümmerte, obwohl er eigentlich geöffnet war, unterschied sich doch sehr von der Großstadt!
Und dass ich, als es keine Antwort gab, mich einfach auf die Bank setzte und wartete, schien in unserem zwanzigsten Jahrhundert fast nicht möglich zu sein. Dies alles war so weit von der alltäglichen Menschenwelt entfernt, dass es geradezu reizvoll erschien. Übrigens gewann ich das Gesicht der alten Frau sofort lieb, als sie heraustrat.
Zwei oder drei Jahre zuvor hatte ich auf der Hōshō[16]-Bühne das Nō-Spiel Takasago[17] gesehen, das ich damals für ein wunderschönes tableau vivant befunden hatte. Ein Greis, der einen Besen geschultert hatte, machte fünf oder sechs Schritte über den Laufsteg, bevor er langsam eine ganze Drehung vollführte, so dass er einer alten Frau gegenüberstand, die hinter ihm auftrat. Diese Szene ist mir jetzt noch gegenwärtig. Von meinem Platz aus hatte ich direkt auf die Maske der alten Frau geblickt. Wie schön!, dachte ich, und die Gesichtszüge prägten sich auf ewig der Kamera meiner Seele ein. Die Alte im Laden glich jener Fotografie so genau, als hätte man ihr Leben eingehaucht.
»Großmutter, ich habe es mir erlaubt, hier ein Weilchen …«
»Ach, ich habe überhaupt nichts gemerkt!«
»Das war ein schlimmer Regen, nicht wahr?«
»Dieses schreckliche Wetter muss sehr mühsam für Sie sein! Ach, Sie sind ja ganz nass geworden! Ich werde Holz aufs Feuer legen, dann können Sie sich trocknen!«
»Es reicht, wenn Sie das Feuer dort unten nur ein bisschen schüren, dann kann ich mich wärmen und trocknen. Mir ist recht kalt geworden hier beim Ausruhen!«
»Ja, ich lege sofort Holz auf! Aber zuerst einen Tee!«
Die Alte erhob sich und jagte mit zweimaligem Zischen die Hühner aus dem Wohnbereich. Gackernd flohen sie von den dunkelbraunen Reisstrohmatten auf den Boden herunter. Sie trampelten über die offenen Kuchenschachteln und flatterten ins Freie, wobei der Hahn noch seinen Mist auf das billige Teegebäck fallen ließ.
»Bitte sehr!« Jetzt bot mir die Frau eine Schale an, die sie auf ein geschnitztes Tablett gestellt hatte und auf deren schwärzlich-braunem Grund drei nachlässig mit einem Pinselstrich gemalte Pflaumenblüten eingebrannt waren.
»Süßigkeiten?« Nun brachte mir die Frau von den »Sesamzöpfchen« und »Reismehlstöckchen«, über die die Hühner vorher getrampelt waren. Ich untersuchte sie genau, um festzustellen, ob der Mist nirgends daran klebte. Er schien jedoch in der Schachtel zurückgeblieben zu sein.
Die Alte band sich die lockeren Ärmel ihres Kimonos über ihr Arbeitsgewand zurück. Dann kauerte sie sich vor dem Herd nieder. Ich zog mein Skizzenheft aus der Brusttasche hervor und begann, ihr Gesicht im Profil abzuzeichnen, während ich das Gespräch mit ihr fortsetzte.
»Schön ruhig haben Sie es hier!«
»Ja, wie Sie sehen, sind wir hier in einem Bergweiler!«
»Ob hier wohl die Oriole[18] singen?«
»Ja, fast täglich! Hier singen sie auch im Sommer.«
»Das würde ich gerne hören! Je länger es still bleibt, desto mehr Lust bekomme ich, sie zu hören!«
»Leider scheinen sie heute nicht … Der Regen hat sie wohl verscheucht.«
In diesem Augenblick begann es im Herd zu knistern. Im entstehenden Luftzug schoss plötzlich eine rote Flammenzunge mehr als einen Fuß hoch heraus.
»Also dann, wärmen Sie sich! Ihnen ist gewiss kalt!«
Ich sah, wie der bläuliche Rauch unter der vorstehenden Dachtraufe hängenblieb und sich langsam verzog, bis sich nur noch feine Spuren an die Bretter des Vordaches schmiegten.
»Ach, jetzt fühle ich mich wieder besser! Dank Ihnen sind meine Lebensgeister zurückgekehrt!«
»Ja, und auch der Regen hat glücklicherweise wieder ganz aufgehört! Sehen Sie mal, dort drüben kann man jetzt den Koboldnasen-Fels erkennen!«
Der Bergsturm fegte ungeduldig über den Frühlingshimmel, an dem die Wolken träge und zögernd verharrten. Entschlossen blies der Wind über die Berge, die uns gegenüber lagen, bis sich in einem Winkel der Himmel ganz geklärt hatte. Dort, wohin die Alte mit dem Finger wies, ragte aus dem schroffen Gebirge ein Fels wie eine grob behauene Säule hervor. Das war offenbar die »Koboldnase«.
Zuerst blickte ich auf den Fels. Dann betrachtete ich die alte Frau. Schließlich schaute ich auf beide zusammen und verglich sie miteinander. Wenn ich darüber nachdachte, welche Gesichter von alten Frauen in meinem Künstlerkopf herumgeisterten, so waren da nur zwei: die besagte Großmutter aus Takasago und die »Alte vom Berg«, die Rosetsu[19] gemalt hat. Das Gemälde hatte ich zuerst gesehen. Damals hatte ich die Empfindung, das Idealbild einer Greisin müsse furchterregend sein, so dass man sie sich nur inmitten von rotem Herbstlaub oder in kaltem Mondschein vorstellen könne. Erst als ich dann in einer besonderen Theateraufführung der Hōshō-Bühne das Nō-Stück sah, wurde mir klar, dass der Gesichtsausdruck einer alten Frau auch sanft sein kann. Ihre Maske war bestimmt von einem berühmten Künstler geschnitzt. Leider ist mir sein Name entfallen, aber in dieser Weise dargestellt ist sogar ein alter Mensch innerlich reich, mild und warm. Als Hintergrund würden ohne weiteres goldene Wandschirme, Frühlingsbrisen oder Kirschblüten dazu passen. Ich fand, die Alte mit ihrem ärmellosen Kimono, die den Körper emporreckte, mit der einen Hand die Augen beschattete und mit der anderen in weite Ferne wies, sei die viel angemessenere Sehenswürdigkeit für eine frühlingshafte Bergwanderung als der »Koboldnasen«-Fels. Ich hob mein Skizzenheft wieder auf, aber just in dem Moment, als ich hoffte, sie würde noch ein Weilchen so verharren, sackte die Pose wieder in sich zusammen.
Da ich jetzt nicht mehr wusste, was ich mit dem Heft anfangen sollte, hielt ich es ans Feuer, um es zu trocknen, und sagte: »Großmutter, Sie scheinen recht gut bei Gesundheit zu sein!«
»Ja, glücklicherweise bin ich wohlauf … Ich nähe, zwirne Fäden, mahle im Mörser Reis für Klöße …«
Wie gerne hätte ich gesehen, wie die Alte den Steinmörser in Betrieb setzte, aber solche Bestellungen konnte ich in diesem Laden wohl nicht aufgeben – also wechselte ich das Thema und fragte: »Nicht wahr, der Weg von hier bis nach Nakoi ist knapp ein ri[20]?«
»Wir sagen meistens 28 chō[21]. Hat der Herr vor, dort in den Thermalquellen zu baden?«
»Wenn nicht gar zu viele Gäste da sind, möchte ich gerne ein Weilchen dort bleiben – natürlich nur, wenn ich dazu Lust verspüre!«
»Seitdem der Krieg[22] ausgebrochen ist, kommt gar niemand mehr hin. Es ist ganz so, als wäre alles geschlossen!«
»Seltsam! Dann wird man mich vielleicht gar nicht aufnehmen?«
»Nein, Sie können jederzeit dort unterkommen, wenn Sie darum bitten.«