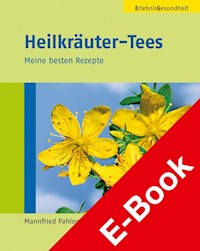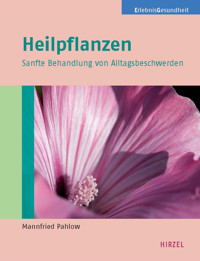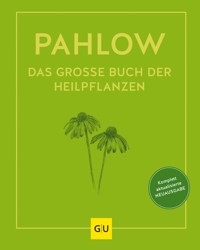
37,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRÄFE UND UNZER Verlag GmbH
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: Alternativmedizin
- Sprache: Deutsch
Das Standardwerk der Heilpflanzen - Der Klassiker jetzt in komplett aktualisierter Neuausgabe und hochwertiger Ausstattung Wissenswertes über 300 einheimische und fremdländische Heilpflanzen, ihre Inhaltsstoffe und Heilwirkung. Rezepte für Tees und Tinkturen, Anwendungsvorschläge für Bäder, Umschläge, Inhalationen. Heilpflanzen in der Homöopathie, ihre Anwendung und Dosierung. Ausführliches Beschwerden-Register - Wegweiser zur passenden Anwendung. Zur Neuausgabe des Klassikers: - Auf dem neuesten Stand: Das gesammelte Wissen eines der erfahrensten Kenner der Pflanzenheilkunde komplett aktualisiert. - Mit über 500 Farbfotos und botanischen Zeichnungen - Verständlich und fundiert - das Standardwerk sowohl für Laien als auch für Profis - In neuer hochwertiger Ausstattung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 872
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Unsere eBooks werden auf kindle paperwhite, iBooks (iPad) und tolino vision 3 HD optimiert. Auf anderen Lesegeräten bzw. in anderen Lese-Softwares und -Apps kann es zu Verschiebungen in der Darstellung von Textelementen und Tabellen kommen, die leider nicht zu vermeiden sind. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Impressum
© eBook: 2021 GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH, Postfach 860366, 81630 München
© Printausgabe: 2021 GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH, Postfach 860366, 81630 München
GU ist eine eingetragene Marke der GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH, www.gu.de
Es handelt sich um eine komplett überarbeitete und aktualisierte Neuausgabe von DAS GROSSE BUCH DER HEILPFLANZEN, GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH 1993, ISBN 978-3-7742-1472-9
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, sowie Verbreitung durch Bild, Funk, Fernsehen und Internet, durch fotomechanische Wiedergabe, Tonträger und Datenverarbeitungssysteme jeder Art nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages.
Projektleitung: Stella Schossow
Bearbeiter: Bernd Hertling
Bildredaktion: Henrike Schechter
Covergestaltung: independent Medien-Design, Horst Moser, München
eBook-Herstellung: Lea Stroetmann
ISBN 978-3-8338-8003-2
1. Auflage 2021
Bildnachweis
Coverabbildung: Getty Images/Andrea_Hill
Botanische Zeichnungen: Adolf Neuhofer
Fotos: Angermayer, Angermayer/Haselberger, Angermayer/Lange, Apel, Beat Ernst Basel, De Cuveland, Diedrich, Eigstler, Eisenbeiss, Getty Images/Andrea_Hill, Hagen, Hertling, Hölzl, König, Laux, Layer, Partsch, Pforr, Pretscher, Reinhard, Reuter, Riedmiller, Schimmitat, Schrempp, shutterstock, Silvestris, Silvestris/Alberti, Silvestris/Bohler, Silvestris/ Bruckner, Silvestris/Bühler, Silvestris/Gross, Silvestris/Maier, Silvestris/Prato, Silvestris/Riedmiller, Silvestris/Schug, Silvestris/Skibbe, Silvestris/v.Maydell, Silvestris/Wagner, Stocksy/Tim Booth, Strauß, Umweltbild/Kalden, Wichtl, Wikipedia/Hermy71, Wikipedia/Ted Bodner, Southern Weed Science Society, Wothe, Zettl
Syndication: www.seasons.agency
GuU 8-8003 08_2021_02
Unser E-Book enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Im Laufe der Zeit können die Adressen vereinzelt ungültig werden und/oder deren Inhalte sich ändern.
Die GU-Homepage finden Sie im Internet unter www.gu.de
www.facebook.com/gu.verlag
LIEBE LESERINNEN UND LESER,
wir wollen Ihnen mit diesem E-Book Informationen und Anregungen geben, um Ihnen das Leben zu erleichtern oder Sie zu inspirieren, Neues auszuprobieren. Wir achten bei der Erstellung unserer E-Books auf Aktualität und stellen höchste Ansprüche an Inhalt und Gestaltung. Alle Anleitungen und Rezepte werden von unseren Autoren, jeweils Experten auf ihren Gebieten, gewissenhaft erstellt und von unseren Redakteuren/innen mit größter Sorgfalt ausgewählt und geprüft.
Haben wir Ihre Erwartungen erfüllt? Sind Sie mit diesem E-Book und seinen Inhalten zufrieden? Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung. Und wir freuen uns, wenn Sie diesen Titel weiterempfehlen, in ihrem Freundeskreis oder bei Ihrem online-Kauf.
KONTAKT ZUM LESERSERVICE
GRÄFE UND UNZER VERLAG Grillparzerstraße 12 81675 München
HINWEIS UND WARNUNG
Im vorliegenden Buch werden auch Giftpflanzen vorgestellt. Dabei handelt es sich um hochwirksame Heilpflanzen, die, zu Arzneimitteln verarbeitet, ausschließlich für die ärztliche Praxis bestimmt sind. Die im Buch als Giftpflanzen gekennzeichneten Heilpflanzen dürfen keinesfalls zur Selbstbehandlung verwendet werden.
Wer Heilpflanzen selbst sammeln möchte, muss vor Verwechslungen gewarnt werden. Viele Heilpflanzen gehören beispielsweise zur Familie der Doldengewächse, in der es auch giftige Arten gibt. Gehen Sie beim Sammeln mit äußerster Sorgfalt vor; die Erkennungsmerkmale im Beschreibungstext, in Zeichnung und Foto müssen mit der gefundenen Pflanze voll übereinstimmen. Nur exakt bestimmte Pflanzen mitnehmen. Bei geringstem Zweifel: Pflanze nicht verwenden!
Wichtiger Hinweis
Die Gedanken, Methoden und Anregungen in diesem Buch stellen die Meinung bzw. Erfahrung der Verfasser dar. Sie wurden nach bestem Wissen erstellt und mit größtmöglicher Sorgfalt geprüft. Sie bieten jedoch keinen Ersatz für persönlichen kompetenten medizinischen Rat. Jede Leserin, jeder Leser ist für das eigene Tun und Lassen auch weiterhin selbst verantwortlich. Weder Autor noch Verlag können für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den im Buch gegebenen praktischen Hinweisen resultieren, eine Haftung übernehmen.
VORWORT DES AUTORS
Früher waren Heilpflanzen neben wenigen Mineralien und tierischen Produkten die einzigen Heilmittel, die man kannte. Die Erfahrungen im Umgang mit ihnen, erarbeitet von den Arzt-Botanikern der Antike, des alten Ägypten und von Mönchen mittelalterlicher Klöster, wurden in vielen Kräuterbüchern von Generation zu Generation weitergegeben.
Heute ist die Heilpflanzenkunde eine eigenständige Wissenschaft. Durch die Bestimmung der Pflanzeninhaltsstoffe und die Erforschung ihrer Wirkung findet Erklärung, was zuvor nur Empirie war. In der Medizin werden Heilpflanzen täglich und mit Erfolg eingesetzt: als Tee, Tinktur, Extrakt, als Arzneispezialität auch aus Einzelwirkstoffen. Viele erfolgreiche Medikamente beruhen auf Wirkstoffen pflanzlichen Ursprungs.
Heilpflanzen können Krankheiten heilen, sie können vorbeugen und lindern – Wundermittel allerdings sind sie nicht. Ihr Einsatz ist nur dann sinnvoll, wenn die Möglichkeiten und die Grenzen ihrer Anwendung genau beachtet werden. Das große Buch der Heilpflanzen enthält ausführliche Beschreibungen von mehr als 400 einheimischen und fremdländischen Heilpflanzen, über deren Inhaltsstoffe zumeist schon wissenschaftliche Erkenntnisse vorliegen oder deren therapeutische Wirksamkeit sich in der Praxis bewährt hat. Die meisten Heilpflanzen werden zusätzlich in Naturfarbfotos und botanischen Zeichnungen vorgestellt.
Besonders wertvoll für die Behandlung von Alltagsbeschwerden, akuten und chronischen Erkrankungen sind die vielen Rezepte für Tees, Bäder, Umschläge und Inhalationen.
Dieses Hausbuch der Heilpflanzenkunde dient aber auch Fachleuten als Nachschlagewerk in ihrem Arbeitsalltag.
Seit seinem Erscheinen im Jahr 1979 hat sich dieses Buch als Standardwerk durchgesetzt. Fundiert, zuverlässig, verständlich – so berät »der große Pahlow« alle Menschen, die auf die Heilkräfte der Natur vertrauen.
München 1993, Mannfried Pahlow
VORWORT ZU DIESER AUSGABE
Wir bewohnen einen blauen Planeten, aber die Welt, in der wir leben, ist grün. Fünfundneunzig Prozent aller Lebewesen auf der Erde sind Pflanzen. Allein die höheren Pflanzen – die Blütenpflanzen, ergänzt um Farne, Bärlappgewächse, Schachtelhalme und so fort – zählen annähernd 300.000 Spezies, von denen noch lange nicht alle eingehend erforscht sind. Die Natur gebärdet sich verschwenderisch und großzügig, eine Fülle, aus der alles Leben entspringt. Man könnte sagen: Ohne Pflanzen kein höheres Leben, ohne das Blatt kein Gedanke.
Immer wenn ich eine neue Klasse an der Josef-Angerer-Schule für Naturheilweisen in Phytotherapie unterrichte, mache ich in der ersten Stunde ein kleines Experiment. Ich lasse alle Schüler eine x-beliebige Pflanze aus ihrem persönlichen Umfeld mitbringen. Wir bestimmen die jeweilige Art und bilden dann drei Gruppen: Pflanzen, die man im weitesten Sinne als Heilpflanzen ansehen kann, solche, denen schädliches Potenzial innewohnt, und neutrale, die weder nutzen noch schaden. Alljährlich ist die letzte Gruppe mit Abstand die kleinste, auch die Giftpflanzen sind nicht übermäßig häufig vertreten, zumal bei ihnen oft die Dosierung ihre Giftigkeit ausmacht und sie in den meisten Fällen schon therapeutisch verwendbar sind. Wir stellen also fest, dass wir von einer unermesslichen Fülle erprobter und potenzieller Heilpflanzen umgeben sind. Kein Wunder, dass sich die Menschen, egal wann und wo sie lebten, pflanzlicher Heilmittel bedienten, ja es sich wie von selbst verstand, dass jegliche Arznei aus pflanzlichen Inhaltsstoffen bestand. Erst 1935 wurde es überhaupt notwendig, den Begriff Phytotherapie einzuführen, um pflanzliche Heilmittel als solche kenntlich zu machen und sie von den inzwischen vielfach hergestellten synthetischen Arzneimitteln abzugrenzen. Meist dienten allerdings wiederum pflanzliche Substanzen als Ausgangsstoff für die »Retortenmittel«: Ohne Mädesüß kein Aspirin, ohne Fingerhut kein Digitoxin – um nur zwei zu nennen. Natürlich gäbe es ohne pflanzliche Substanzen auch kein Morphin, Heroin, Opium oder auch Ecstasy, will sagen: Pflanzliche Ausgangsstoffe sind nicht immer harmlos und unschädlich, Pflanzenheilkunde ist nicht per se eine »sanfte Therapieform«. Nicht zuletzt aus diesem Grund ist eine gründliche Kenntnis der Heilpflanzen und ihrer sinnvollen Anwendungsmöglichkeiten nötig, ehe man als Heilpraktiker (oder auch als Arzt) zum Rezeptblock greift oder sich als informierter Laie in Selbstmedikation therapiert.
Um sich einen Überblick über die als wirksam und unschädlich bekannten, häufig verwendeten Heilpflanzen und ihre Darreichungsformen zu verschaffen, hatte der Apotheker und Autor Mannfried Pahlow seinerzeit eine Auswahl von 410 Heilpflanzen getroffen. Als Bearbeiter dieses grundlegenden Werkes sehe ich mich nicht ermächtigt, völlig Neues hinzuzufügen – schließlich soll kein neues Buch entstehen –, sondern das Bestehende an die gegenwärtige Situation und neue wissenschaftliche Erkenntnisse anzupassen. Dabei musste ich insbesondere die neuen gesetzlichen Richtlinien sowie die Empfehlungen der Kommission E des damaligen BGA sowie der ESCOP (European Society Of Phytotherapy) berücksichtigen. In Hinsicht auf Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten sowie unerwünschte Arzneimittelwirkungen, aber durchaus auch auf neue Fragestellungen bei Indikationen und Anwendungsmöglichkeiten hat sich seit der letzten Auflage einiges verändert. Die therapeutische Situation in der Naturheilpraxis ist ebenfalls nicht mehr dieselbe wie vor dreißig Jahren. Rezepturen, die Patienten damals klaglos schluckten, würden heute im Schrank ihrer langsamen Verpilzung entgegensehen, würde man nicht – um mit Galen zu reden – versuchen, mit möglichst gefälliger Medizin das Leben zu versüßen: Anpassungen waren notwendig, ohne die Originalrezepturen allzu sehr zu verfälschen. Weiteren Veränderungen musste Rechnung getragen werden: ein Sammelkalender mit monatlichen Sammelhinweisen ist angesichts des Klimawandels nicht mehr denkbar. Eine ganze Reihe von damals relativ knapp abgehandelten Monografien erfahren hier nun eine ausführlichere Würdigung, andere dagegen, die bereits in der letzten Auflage nurmehr dokumentarisch aufgelistet worden waren, mussten nun gänzlich weichen. Dies geschah sicher nicht zum Schaden des Lesers, den ja mit Sicherheit vor allem jene Heilpflanzen interessieren dürften, die gegenwärtig zur Verfügung stehen und auch in Apotheken erhältlich sind. Diese finden sich im Hauptteil, während in einem zweiten kleineren Teil, ganz im Sinne des Autors Mannfried Pahlow, Pflanzen vorgestellt werden, die aus mancherlei Gründen nicht völlig dem Vergessen anheimfallen sollen.
In diesem Sinne wünscht der Bearbeiter allen Lesern und Anwendern dieses Buches viel Freude beim Lesen und Stöbern sowie, eingedenk des Mottos Medicus curat, natura sanat*, gutes Gelingen bei der Arbeit mit diesem Baukasten, den uns die Natur zur Verfügung gestellt hat.
Grafing im Januar 2021, Bernd Hertling
*der Arzt/Therapeut bemüht sich (um den Kranken), die/seine Natur heilt (ihn). Oder kurz: Der Arzt behandelt, die Natur heilt.
EINFÜHRUNG UND ANLEITUNG
Wissenswertes über Heilpflanzen in komprimierter Form – die folgenden Kapitel liefern umfangreiche Informationen, die dem Verständnis der in den Heilpflanzen-Steckbriefen gegebenen Ausführungen dienen. Auch eine kleine historische Einführung in die Welt der Phytotherapie ist hier zu finden.
GENAUE BESTIMMUNG VON HEILPFLANZEN
PFLANZENMORPHOLOGIE (BOTANIK)
Es ist wichtig, dass derjenige, der sich mit Heilpflanzen befassen möchte, auch etwas über den Aufbau einer Pflanze weiß, über ihre Organe und deren Aufgabe. Einmal, weil er dann die Pflanzenbeschreibung besser verstehen kann, bei der es ohne den Gebrauch von Fachausdrücken kaum geht, zum anderen, weil er diese Kenntnisse braucht, wenn er Heilpflanzen sammeln und aufbereiten will.
Pflanzenschema mit oberirdischen Teilen und Wurzeln.
Die Wurzel, der Spross und die Blätter dienen der Ernährung der Pflanze, Blüten und Früchte der Fortpflanzung.
Normalerweise befinden sich die Wurzelorgane unter der Erde und verankern so die Pflanze im Boden. Über dem Erdboden finden wir in der Regel Spross, Blätter und Blüten. Natürlich gibt es auch Ausnahmen von dieser Regel. Beim Wurzelstock beispielsweise, der von Laien fälschlich auch Wurzel genannt wird, handelt es sich um einen Spross, der aber dennoch nur unter der Erde zu finden ist. Dass es ein echtes Sprossorgan ist, sieht man an den Blattschuppen: Es sind umgewandelte Blätter – und Blätter gehören zum Spross, aber nie zur echten Wurzel.
Die Wurzel
Mit der Wurzel nimmt die Pflanze Wasser und Nährstoffe in gelöster Form aus dem Boden auf; Wurzelhaare leisten hierbei eine wichtige Hilfe. Die Wurzel verankert die Pflanze an ihrem Standort. Sie kann ausdauernd sein und jährlich neue Triebe ausbilden, sie kann aber auch wie die oberirdischen Teile im Herbst absterben.
Wir unterscheiden verschiedene Wurzelformen: Die Pfahlwurzel wächst senkrecht nach unten und zweigt nach den Seiten schwächere Wurzeläste ab. So ist sie fest im Boden verankert, für die Nahrungsaufnahme erreicht sie zusätzlich große Tiefe und Breite.
Die fleischig verdickte Pfahlwurzel, wie wir sie beispielsweise bei der Möhre, dem Rettich und den Rüben finden, speichert Nährstoffe. Die Pfahlwurzeln, auch die Pflanzen, die aus ihnen wachsen, werden häufig als Gemüse genutzt oder sind Futterpflanzen für das Vieh.
Weist eine Pflanze mehrere bis viele gleich starke Wurzeln auf, so spricht man von Faserwurzeln.
Verschiedene Wurzelformen von Pflanzen.
Der Spross
Oberirdische Sprossorgane sind entweder der krautige Stängel oder der holzige Stamm. Krautige Stängel werden von einjährigen Pflanzen entwickelt, solchen, die innerhalb eines Jahres ihre Entwicklung abschließen: von der Keimung im Frühjahr bis zum Absterben im Herbst. Zweijährige Pflanzen, also solche, die »vom Werden bis zum Vergehen« zwei Jahre benötigen, oder mehrjährige Pflanzen haben meistens krautige, gelegentlich auch verholzte Stängel. Oft sind sie nur in der unteren Region verholzt. Von Heilpflanzen, deren Kraut verwendet wird, sollte man bevorzugt die oberen, unverholzten Teile einsammeln. Bäume und Sträucher sind ausdauernd und haben einen holzigen Stamm. Am Spross entwickeln sich die Blätter, in den Achseln dieser Blätter Seitensprosse, die ebenfalls Blätter ausbilden. Häufig entspringen den Blattachseln Blüten oder Blütenstände, gestielt oder ungestielt. Die Blätter sind ein unabdingbarer Bestandteil des Sprosses. Selbst wenn er als Wurzelstock dahinkriecht, hat er immer Blätter. Sie sind in solchen Fällen jedoch in Schuppen umgewandelt und kaum noch als Blatt zu erkennen. An den sogenannten Augen (Blattrudiment mit in der Anlage vorhandenem Seitenspross) erkennt man beispielsweise die Kartoffel als Sprossorgan. Die unter der Erde befindlichen Sprossorgane dienen vornehmlich der Nährstoffspeicherung.
Links: Entwicklung der Blätter und Seitensprosse.
Rechts: Blüten, die aus Blattachseln wachsen.
Der Wurzelstock kriecht waagerecht dicht unter der Erdoberfläche; die Zwiebel ist ein gestauchter Spross mit fleischigen Blättern; die Kartoffel ist eine sogenannte Sprossknolle.
Oberirdische Sprosse (Stängel) nennt man rund oder stielrund, wenn ihr Querschnitt kreisförmig ist; kantig (zweikantig, vierkantig), wenn der Querschnitt eckig ist; gefurcht, wenn die Sprossoberfläche mit senkrecht verlaufenden Rillen versehen ist. Auch dies sind Merkmale einer Pflanze und zu ihrer Erkennung wichtig. Beispielsweise kommen zweikantige Stängel selten vor – im Pflanzensteckbrief erwähnt, ist dies eine wichtige Bestimmungshilfe.
Unterirdische Sprossorgane (Wurzelstöcke, Knollen, Zwiebeln).
Oberirdische Sprosse (Stängel).
Die Blätter
Die Blätter dienen der Assimilation, der Versorgung der Pflanze mit organischen Stoffen: Sie bereiten aus der Kohlensäure (CO2) der Luft und dem Wasser aus dem Boden verschiedene Zucker sowie Stärke, die für die Pflanze lebensnotwendig sind. Dazu benötigen sie den grünen Blattfarbstoff, das Chlorophyll, und als Energiequelle das Sonnenlicht. Diesen Vorgang nennt man auch Photosynthese.
Durch die Spaltöffnungen, die sich in der Regel an der Unterseite der Blätter befinden und sich öffnen und schließen können, wird der Gas- und Wasseraustausch reguliert. Mithilfe von Haaren wird der Wasseraustausch (Verdunstung) bei manchen Pflanzen zusätzlich herabgesetzt. Die Behaarung von Pflanzen derselben Art kann unterschiedlich sein – sie wird bestimmt dadurch, ob die Pflanze an einem sonnigen oder an einem schattigen Standort wächst. So erklärt sich die Aussage in den Pflanzensteckbriefen »mehr oder weniger stark behaart« oder »kahl, zuweilen jedoch behaart«.
Selbst die Stellung der Blätter ist für den Wasseraustausch veränderbar. Während die meisten Pflanzen ihre Blätter mit der Blattoberseite (Spreite) dem Licht zuwenden, können einige Pflanzen sie bei besonders starker Hitze und Sonneneinstrahlung senkrecht zum Lichteinfall stellen (Kompasspflanzen). Dadurch wird weniger Wasser verdunstet. Blätter und Sprosse können auch zu Blatt- und Sprossdornen werden.
Verschiedene Formen der Blattanordnung.
Blätter sind flächig entwickelt, sie stehen seitlich am Spross und bilden gelegentlich am Boden eine Rosette aus. In ihren Achseln können Seitensprosse entspringen, die ihrerseits ebenfalls Blätter tragen. In den Blattachseln entspringen auch Blüten – gestielt oder ungestielt.
Blattstellungen am Stängel.
Formen zusammengesetzter Blätter.
Für die Bestimmung der Pflanzen sind Blattform und Blattstellung am Stiel wichtig: quirlig – gegenständig – kreuzgegenständig – wechselständig angeordnete Blätter. Blattquirle bestehen aus vier, sehr häufig aber auch aus weit mehr Blättern.
Der Blattstiel kann kurz oder lang sein; er kann aber auch fehlen. Ist das der Fall, nennt man die Blätter »sitzend«. Häufig sind auch an der Blattansatzstelle kleinere Blättchen vorhanden, die Nebenblätter. Die sogenannten Blattscheiden, die man bei manchen Pflanzen an der Ansatzstelle des Blattstiels findet (beispielsweise bei Doldengewächsen), sind häutig oder blattartig ausgebildet.
Die Blattspreiten – also die eigentlichen Blätter – weisen sehr unterschiedliche Formen auf. Blattrand und Blattaufteilung sind für die Bestimmung ebenso wichtig wie die Blattform.
Formen des einfachen Blattes.
Pflanzen, die mit nur einem Blatt keimen, den Einkeimblättlern oder Monocotyledonen, verlaufen die Blattnerven parallel, während bei den Zweikeimblättlern, den Dicotyledonen, eine Parallel- oder Bogennervatur (wie beispielsweise beim Wegerich) eine Seltenheit ist.
Die wichtigsten Ausbildungsformen von Blatträndern.
Blattspreiten und Blattadern (-nerven).
Die Blüten
Die Blüten sind botanisch Sprosse; da Sprosse Blätter ausbilden, spricht man von Blüten-, Kelch-, Staub- und Fruchtblättern. Sie sitzen spiralig an der gestauchten Blütenachse, die man auch Blütenboden nennt. Der botanisch Unerfahrene wird bei der Bestimmung einer Pflanze vor allem die Blüte beachten: Pflanzen, die blühen, sind leichter zu erkennen, jedoch sollte die Blütenfarbe als Merkmal nicht überbewertet werden. Eine Pflanze, die zum Beispiel normalerweise rosarot oder rot blüht, kann auch mal weiß anzutreffen sein, und eine blaue Blütenfarbe als Normalfarbe kann gelegentlich rötlich oder weißlich ausfallen.
Sehr selten schließt ein Spross sein Längenwachstum mit einer Einzelblüte ab, wie es beispielsweise bei der Tulpe der Fall ist. Meistens werden mehrere Blüten ausgebildet, die dann als Blütenstand vereinigt sind. Für die Pflanzenbestimmung ist es notwendig, die wichtigsten Blütenstände zu kennen: Traube – Doldentraube – Ähre – Kolben – Köpfchen – Dolde – Doppeldolde – Rispe – Doldenrispe.
Die wichtigsten Formen von Blütenständen.
Anatomie und verschiedene Formen von Blüten und Fruchtknoten.
Bei den Blütenständen gibt es viele Zwischenformen, sodass in den Pflanzensteckbriefen nicht in jedem Fall eindeutige Aussagen möglich sind. Sieht der Blütenstand beispielsweise wie eine Dolde aus, ist jedoch botanisch nicht eindeutig wie eine solche angelegt, dann wird auf die Ausdrücke »Trugdolde«, »doldig«, »doldenförmig«, »doldendartig« ausgewichen. Auch »rispenartig«, »traubenartig« oder gar »doldenrispig« sind genaugenommen Verlegenheitslösungen. Wer jedoch die typischen Blütenstände kennt, kann sich auch an diesen Beschreibungen orientieren.
Die Früchte
Aus den befruchteten Blüten entwickeln sich die Früchte. Die wichtigsten Fruchtformen: Der Balg ist aus einem Fruchtblatt gebildet und öffnet sich bei der Reife an der Bauchnaht. Die Schote bildet sich aus zwei Fruchtblättern, an einer falschen Scheidewand sitzen die Samen, sie öffnet sich durch Abklappen der Fruchtblätter.
Früchte, die sich bei der Reife in unterschiedlicher Weise öffnen und ihre Samen ausstreuen.
Die Hülse ist aus einem Fruchtblatt entstanden, sie öffnet sich an Bauch- und Rückennaht. Die Kapsel hat zwei oder mehrere Fruchtblätter; man unterscheidet nach Öffnungsweise: Spaltkapseln, die Fruchtblätter weichen auseinander, Deckelkapseln öffnen sich durch einen Deckel, Porenkapseln öffnen sich durch mehrere Löcher.
Die (echte) Beere (Heidelbeere) ist in allen Teilen fleischig; die meist einsamige Nuss ist von einem harten Gehäuse umgeben; die Steinfrucht ist fleischig und in ihrem Inneren mit einem Steinkern ausgestattet, beispielsweise Kirsche, Aprikose, Pflaume. Eine Sammelfrucht, bestehend aus kleinen Nüsschen, die auf einem fleischigen Blütenboden sitzen, ist beispielsweise die Erdbeere; eine Sammelsteinfrucht die Brombeere. Spaltfrüchte werden solche Früchte genannt, die sich bei der Reife wieder voneinander lösen, sie sind bei Doldengewächsen zu finden, beispielsweise beim Kümmel.
Früchte unterschiedlicher Art.
Die Samen
Die Samen sind die Verbreitungsorgane der meisten Pflanzen. Sie haben sich aus der Samenanlage der Blüte entwickelt und bestehen aus der Samenschale, dem Embryo und dem Nährgewebe, das bei der Keimung aufgebraucht wird.
Sammelfrüchte (auch Scheinfrüchte genannt).
ÜBER DAS SAMMELN UND TROCKNEN VON HEILPFLANZEN
Heilpflanzen, die gefährdet oder gar vom Aussterben bedroht sind und deshalb unter Naturschutz stehen – im Steckbrief-Kopf als »geschützt« ausgewiesen –, dürfen nicht gesammelt werden! Mit den ebenfalls gekennzeichneten Giftpflanzen ist die Selbstbehandlung verboten!
Das Wichtigste vor dem Sammeln der ausgewählten Heilpflanze ist ihre exakte Bestimmung; nur so lassen sich Verwechslungen mit giftigen Pflanzen vermeiden! Viele Heilpflanzen beispielsweise gehören zur Familie der Doldengewächse, in der es auch giftige Arten gibt. Deshalb muss sorgfältig bestimmt werden. Hilfen dabei sind die Pflanzenbeschreibungen im Steckbrief, die Zeichnungen und die Fotografien.
Gesammelt wird nur der arzneilich verwendete Pflanzenteil (wie im Steckbrief angegeben) – und niemals bei Regen, Nebel oder feuchtem Wetter. Der frühe Vormittag ist die günstigste Sammelzeit, die Pflanzen dürfen aber nicht mehr feucht sein vom Morgentau.
Es sollten nur saubere Pflanzen gesammelt werden. Schmutz und Staub machen sie wertlos. Sie dürfen nicht gewaschen werden (Ausnahme: Wurzeln). Achten Sie darauf, dass der Boden, auf dem die Pflanze wächst, und die Luft, die sie atmet, möglichst wenig, am besten gar nicht mit Schadstoffen belastet ist. Heilpflanzen sollte man niemals an vielbefahrenen Straßen und in der Nähe von Autobahnen sammeln. Auch die weitere Umgebung von Feldern und Weiden, die mit Unkrautbekämpfungs- oder sogenannten Pflanzenschutzmitteln bearbeitet wurden, sollten Sie als Sammelplätze für Ihre Heilpflanzen meiden, weil diese zum Teil auch giftigen Substanzen vom Wind weit in die Umgebung getragen werden können.
Die Blätter sollten ganz jung, doch voll entfaltet gepflückt werden, die Blüten am besten kurz bevor sie sich öffnen. Wenn sie bereits voll erblüht sind, dann besser junge und frische verwenden.
Ganze Kräuter, also alle oberirdischen Pflanzenteile, sammelt man zu Beginn der Blütezeit. Früchte werden vollreif geerntet.
Wurzeln werden ausgegraben, wenn sie kräftig und voll entwickelt sind. Das Gleiche gilt für Wurzelstöcke. Rinden werden von jungen Zweigen geschält; im Frühling lösen sie sich leicht ab.
Das Trocknen von Heilpflanzen verhindert, dass pflanzeneigene Fermente die Wirkstoffe umwandeln oder abbauen. Außerdem wird Pilzen und Bakterien durch die Trocknung der Nährboden entzogen. Das Trocknen von Heilpflanzen ist als Konservierung anzusehen und muss nach der Ernte schnell und schonend geschehen. Richtig ist dafür ein luftiger, schattiger Platz; in der prallen Sonne verlieren die Heilpflanzen leicht die in Blüten, Blättern und Früchten enthaltenen ätherischen Öle. Am besten breitet man das Sammelgut auf einem Sieb oder einer Darre (spezielle Trockenvorrichtung) in dünner Schicht aus und trocknet es an einem luftigen, aber nicht zugigen Ort. Ganze Pflanzen (Kräuter) kann man auch gebündelt luftig aufhängen.
Bei künstlicher Wärme können Heilpflanzen ebenfalls getrocknet werden, wenn man auf die richtige Temperatur achtet.
Alle Pflanzen und Pflanzenteile, die aromatisch riechen – sie enthalten ätherische Öle –, dürfen nur bei einer Temperatur bis zu 35 °C getrocknet werden. Die anderen Pflanzen oder Pflanzenteile vertragen eine Trockentemperatur bis zu 60 °C.
Wichtig ist die Luftzirkulation, damit Gärung oder Fermentierung vermieden wird.
Bei den Heilpflanzen, die nicht nach diesen Regeln getrocknet werden dürfen, sind in den Steckbriefen andere Verfahren beschrieben. Wurzeln und Wurzelstöcke sollten, sofern es sich nicht um sehr feine Wurzeln handelt, halbiert werden, Knollen werden in Scheiben geschnitten.
Ist das Sammelgut trocken, muss die Droge in luftdicht schließenden, mit entsprechend beschrifteten Etiketten versehenen Gefäßen, vor Licht und Feuchtigkeit geschützt, aufbewahrt werden. Weißblech, Holz oder getöntes Glas sind die geeigneten Materialien, die sich für diesen Zweck gut hernehmen lassen, oder man besorgt sich in der Apotheke spezielle, zur Aufbewahrung bestens geeignete Tütchen. Plastik (PVC) ist dagegen ungeeignet, denn es wird durch die Einwirkung ätherischer Öle weich.
HEILPFLANZEN ZUBEREITEN UND ANWENDEN
Heilpflanzen sind wirksam, darüber besteht kein Zweifel. Wie wirksam sie aber sind, das hängt weitgehend von der richtigen Anwendung ab. Man muss bestrebt sein, die entsprechenden Stoffe den Blättern, den Früchten und Samen, der Rinde oder den Wurzeln (aus der Droge also) unverändert und möglichst optimal zu entziehen. Das setzt die Verwendung hochwertiger Drogen voraus. Um ganz sicher zu sein, Qualitätsdrogen zu bekommen, kauft man sie am besten in der Apotheke, denn der Apotheker ist Fachmann auf diesem Gebiet. Er ist persönlich dafür verantwortlich, dass die von ihm verkauften Drogen den Anforderungen der gültigen Arzneibücher entsprechen, muss sie auf Identität, Reinheit und Wirkstoffgehalt untersuchen und darf auch die Heilkräuter, die in Arzneibüchern nicht aufgenommen wurden, nur in bester Qualität abgeben. Dass er darauf spezialisiert ist, bedarf keiner Erwähnung, denn solange es Apotheken gibt, solange haben dort die Heilpflanzen immer eine besonders wichtige Rolle gespielt. Natürlich kann jeder seine Kräuter auch selbst sammeln und aufbereiten. Besondere Hinweise stehen in den Abschnitten »Botanik« und »Ernte und Aufbereitung« der einzelnen Heilpflanzen-Steckbriefe.
ANWENDUNG – INNERLICH UND ÄUSSERLICH
Der Tee ist seit langem schon die am meisten genutzte Arzneiform der Heilpflanzen. Tees kann man aus einer einzelnen Heilpflanze bereiten, man kann aber auch Kräutermischungen verwenden. Ein Tee ist ein wässriger Auszug, der meist mit heißem Wasser oder aber auch durch einen Kaltansatz bereitet wird. Welche Form den besten Erfolg verspricht, ist nicht allgemeingültig zu beantworten. Deshalb wurde in den Heilpflanzen-Steckbriefen die richtige Art der Teezubereitung beschrieben. Halten Sie sich möglichst genau an die Vorschrift, es hat sich bewährt, was dort vorgeschlagen wird. Es ist nämlich nicht gleichgültig, ob man mit kaltem Wasser übergießt, dann zum Sieden erhitzt und abseiht oder ob mit sprudelnd kochendem Wasser übergossen, schließlich eine Zeit lang ausgezogen und dann erst abgeseiht oder gar mit kaltem Wasser ausgezogen wird. Auch die Zeitangaben für den Auszug sind nicht willkürlich gewählt. Hinweise auf Trinktemperatur, das Süßen oder darauf, dass der Tee langsam und schluckweise, vor oder nach dem Essen getrunken werden muss, sollten beachtet werden.
Einen Tee kann man innerlich und äußerlich anwenden. Man spricht auch von äußerlicher Anwendung, wenn damit gegurgelt wird, wenn Entzündungen in Mund und Rachen damit behandelt oder wenn Spülungen empfohlen werden. In solchen Fällen gebraucht man den Tee lauwarm (etwa 30 bis 35 °C). Sehr häufig ist für die äußerliche Anwendung eine Verdünnung mit der gleichen Menge Kamillentee empfohlen. Diese Empfehlung sollte beachtet werden, denn die Kamille besitzt viele gute Eigenschaften, die so zusätzlich genutzt werden können.
Wundbehandlung mit Tee (Heilpflanzenauszüge) kann auf verschiedene Weise geschehen. Man kann Teilbäder machen, indem man das verletzte Glied (Finger, Hand, Fuß) in dem Tee badet, was bei mäßiger Temperatur (35 bis 40 °C) etwa 10 bis 15 Minuten lang geschehen soll. Man kann aber auch feuchte Umschläge machen, auch Überschläge genannt, die einige Stunden auf der zu behandelnden Stelle verbleiben müssen, oder man macht feuchte Verbände, die so lange angelegt bleiben, bis sie getrocknet sind. Für Umschläge und Verbände legt man mit dem Tee (Pflanzenauszug) getränkte Watte oder Mullläppchen über die Verletzung und fixiert das Ganze unter luftiger Abdeckung mit einer Mullbinde. Das Abdecken mit Plastikfolie ist ein Fehler. Ein Luftzutritt muss gewährleistet sein. Um den Verband nicht zu häufig erneuern zu müssen, kann man nach dem Austrocknen (Verdunsten der Flüssigkeit) durch das Auftropfen von Tee den Verband wieder »beleben«.
Vielfach wird ein Drogenauszug (Tee) auch zu Waschungen bei Hautunreinheiten empfohlen. Wie schon der Name Waschung sagt, ist hier auch eine Reinigung beabsichtigt. Dafür taucht man ein sauberes Tuch in den lauwarmen Tee und wäscht unter leichten, kreisenden Bewegungen die unreinen Hautstellen. Die Wirkstoffe aus der Heilpflanze beeinflussen auf diese Weise die kranke Haut, regen zur Abheilung an und reinigen schonend. Das leichte Reiben wirkt durchblutungsfördernd.
Wenn es darum geht, Krusten zu beseitigen, drückt man zunächst ein Tuch, das mit heißem Tee (so heiß, wie man es gut vertragen kann) getränkt ist, auf die verkrusteten Stellen und beginnt erst nach etwa 10 Minuten ganz sanft mit der Reinigungsbewegung. Die Krusten sind dann aufgeweicht und lassen sich abwaschen. Man muss sich einfach etwas Zeit nehmen, damit alles mild und schonend geschieht.
Mit Kräutersäckchen verfolgt man zwei Ziele. Einmal dienen sie zum Erweichen, Reifen und Zerteilen von Geschwülsten, zum anderen zur Wärmetherapie. Folglich legt man sie gut warm auf.
Die Temperatur richtet sich nach der jeweiligen Verträglichkeit.
Für die Anwendung näht man sich ein Leinensäckchen oder eines aus Mull in der Größe der zu behandelnden Fläche, füllt die Droge ein und legt das Säckchen zunächst in sprudelnd kochendes Wasser. Nach 5 bis 10 Minuten drückt man es leicht aus, um es dann temperaturgerecht auf die kranke Stelle zu legen.
Auch Inhalationen und Dampfbäder sind äußerliche Anwendungen. Man gibt eine kleine Handvoll Droge in einen Topf mit etwa einem Liter Wasser und erhitzt dieses bis zum Sieden. Bei der Inhalation atmet man, Kopf und Gefäß mit einem großen Tuch abgedeckt, die Kräuterdämpfe langsam und tief durch Mund oder Nase (bei Schnupfen und Nebenhöhlenentzündungen) ein, beim Dampfbad lässt man sie auf die Haut einwirken – beides jeweils so lange, bis keine Dämpfe mehr aufsteigen. Derselbe Ansatz kann mehrmals zur Verwendung erhitzt werden. Ein Dampfbad oder eine Inhalation soll man 5 bis 10 Minuten lang durchführen. Für Dampfbäder im Anal-(After-) und Genitalbereich (die Partie der Geschlechtsorgane) braucht man ein standfestes Gefäß, auf das man sich setzen kann. Die Ansatzmenge wird auf 2 bis 3 Liter Wasser und entsprechend mehr Droge erhöht.
Vollbäder mit Heilpflanzenzusätzen macht man in der Badewanne bei Temperaturen um 35 °C, Dauer längstens 15 Minuten. Dabei sollte die Badetemperatur konstant gehalten werden.
Anschließende Bettruhe ist zu empfehlen. Bei einer Sitzbadewanne kommt man mit weniger Droge aus, wenn nur die unteren Körperpartien gebadet werden. Für Sitz- und Vollbäder gibt es geeignete Badeextrakte zu kaufen, man kann sich den Badezusatz jedoch auch selbst bereiten.
Und schließlich gibt es Einreibungen (meistens alkoholische Zubereitungen) aus Heilpflanzen. Damit behandelt man Schmerzzustände (beispielsweise bei Rheuma und Sportverletzungen, außerdem Muskelneuralgien), indem man die schmerzenden Stellen mit der Flüssigkeit benetzt und, mit der Hand leicht massierend, in die Haut einreibt. Einreibungen sollten zweimal täglich, morgens und abends, durchgeführt werden.
Auch Salben werden aus Heilpflanzen bereitet, beispielsweise aus Kamille, Arnika, Rosskastanie. Salben werden meistens zur Wundbehandlung gebraucht, aber auch zur Hautpflege oder als Einreibung. Zur Wundbehandlung ist ein Verband erforderlich: Man streicht die Salbe messerrückendick auf ein Mullläppchen, das man auf die zu behandelnde Stelle legt und mit einer Mullbinde fixiert; zwar haltbar fest, doch ohne die Blutzirkulation einzuengen. Luft soll den Verband durchdringen können – es darf keine Plastikfolie verwendet werden!
Gelegentlich werden auch Arzneiweine verschrieben. Hierzu verwendet man in der Regel süße Südweine beziehungsweise einen Wein, der dem Geschmack des Patienten entgegenkommt, schließlich ist der Medizinalwein gewissermaßen ein Mittelding zwischen Arznei und Genussmittel. Auf einen Liter Wein werden 30 bis 50 Gramm Droge oder ein alkoholischer Auszug der jeweiligen Pflanze gegeben. Bei Letzterem ist der Wein sofort verfügbar, legt man Drogen ein, müssen diese je nach Löslichkeit zwischen einem Tag oder einer Woche bei gelegentlichem Verschütteln eingelegt und ausgezogen werden. Dabei geht es nicht zuletzt darum, wenig schmackhafte Drogen wie Rosmarin, Wermut oder Baldrian mithilfe des Weins als Trojanisches Pferd der Medizin in den Körper zu schmuggeln. Sehr beliebt ist hier auch ein verdauungsfördernder Condurangowein oder ein Herz stärkender Weißdornwein. Als blutgefäßschützende Frühjahrskur kann man auch einen Bärlauchblütenwein mit Weißwein herstellen, der natürlich seine besondere Note entfaltet. Diese Weine werden dann likörglasweise, bevorzugt vor den Hauptmahlzeiten, eingenommen. Im Mittelalter, als noch kein hochprozentiger Alkohol bekannt war, basierten die meisten Flüssigarzneien auf Wein, Bier oder Essig.
Die Anwendung von Tinkturen geht auf Paracelsus zurück. Nach dem Deutschen Apotheker Buch (DAB), Ausgabe 9 sind Tinkturen »Auszüge aus Drogen (d. i. getrocknete Pflanzen), die mit Aethanol oder Aether (in der Regel 70%iger Alkohol) hergestellt werden«. Zur Unterscheidung vom Fluidextrakt, der in der Regel 1 zu 2 verdünnt wird, lautet das Mischungsverhältnis bei Tinkturen 1 zu 5. Eine Tinktur ist also schwächer als der Extrakt, dafür aber auch preisgünstiger. Bei giftigen Pflanzen werden grundsätzlich Auszüge im Verhältnis von 1 zu 10 durchgeführt. Alkoholische Auszüge verwendet man innerlich (tropfenweise auf Zucker oder in Wasser) oder äußerlich verdünnt für Spülungen und Umschläge.
Genauere Angaben über die Herstellung – sofern es sich lohnt, es selbst zu versuchen – sind in den Heilpflanzen-Steckbriefen zu finden.
Der Pflanzensaft, aus Frischpflanzen bereitet, wird immer beliebter. Früher wurde er in der Volksmedizin häufig verwendet. Bei den entsprechend geeigneten Heilpflanzen ist darüber berichtet.
Allgemeine Hinweise für die Herstellung von Frischsäften: Saftige Wurzeln (zum Beispiel Rettich, Möhren und Sellerie) kann man nach dem Zerschneiden ohne Flüssigkeitszusatz im Entsafter zu Frischsaft verarbeiten. Will man aus derberen Wurzeln, aus Blättern und ganzen Kräutern Saft bereiten, muss man die frischen Pflanzenteile zunächst grob zerkleinern, mit etwas kaltem Wasser übergießen und einige Minuten »weichen« lassen. Erst dann kann man die Pflanzenteile in den Entsafter geben. Ohne Entsafter ist die Frischsaftherstellung schwieriger: Die Pflanzenteile müssen vorher ganz fein zerschnitten oder zerstampft und dann mit wenig Wasser übergossen werden. Die Einweichzeit sollte etwa ½ Stunde betragen. Danach wird das Ganze in ein Tuch gegeben, durch Winden und Pressen wird der Saft gewonnen. Frischsäfte sollte man immer gleich verwenden.
VERGIFTUNG DURCH UNSACHGEMÄSSE ANWENDUNG
Wer sich genau nach den Vorschriften für die Anwendung der Heilpflanzen richtet, wer sich mit den als giftig bezeichneten Heilpflanzen nicht selbst behandelt, kann sich nicht vergiften. Dennoch gebe ich hier Verhaltensmaßregeln für den Fall einer Vergiftung. Diese Regeln sind unbedingt zu beachten.
Erste-Hilfe-Maßnahmen
Bei den ersten Vergiftungsanzeichen – Übelkeit, Brechreiz, Magenkrämpfe, Durchfälle – ist sofort der Magen zu entleeren. Das geschieht, indem man reichlich lauwarmes Wasser (Kinder auch Saft) trinkt, alsdann den Finger in den Hals steckt und kräftig auf den Zungengrund drückt, oder indem man den Rachen mit einer Feder kitzelt.
Es ist ratsam, gleich danach 10 bis 20 Kohletabletten zu schlucken oder 20 bis 30 Gramm Kohlegranulat, in Wasser aufgeschlemmt, einzunehmen. Die Kohle resorbiert die Giftstoffe und verhindert oder verzögert die Aufnahme ins Blut. Noch einmal den Magen mittels Erbrechen entleeren!
Auch der Darm muss entleert werden: 2 Teelöffel Glaubersalz, aufgelöst in 1 Glas Wasser, einnehmen.Bewusstlosen darf nichts eingeflößt werden!
Danach sofort zum Arzt!
Für den Arzt ist es wichtig, eine klare Auskunft zu bekommen. Sie sollten folgende Fragen genau beantworten können: Welches Heilkraut wurde in Überdosis genommen? Wann ist die Einnahme erfolgt? Welche Beschwerden sind aufgetreten? Welche Erste-Hilfe-Maßnahmen wurden bereits angewendet. – Der Arzt wird dann alle weiteren erforderlichen Maßnahmen treffen können.