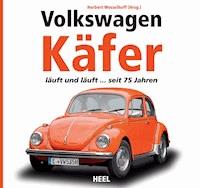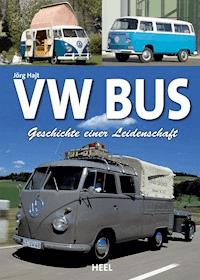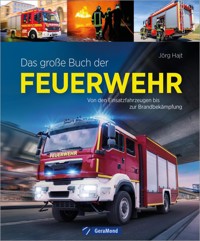
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GeraMond Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Alles, was man über die Feuerwehr wissen muss, in einem Band. Der Feuerwehr-Experte Jörg Hajt spannt den Bogen von der Einsatzzentrale über die Feuerwehrfahrzeuge und ihre Geschichte bis zum Einsatz vor Ort. So entsteht ein hoch informativer und reich bebilderter Überblick, der den Leser in die wichtige Arbeit der Feuerwehr eintauchen lässt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 161
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Das große Buch der Feuerwehr
Jörg Hajt
Das große Buch der FEUERWEHR
Von den Einsatzfahrzeugen bis zur Brandbekämpfung
Inhalt
Vorwort
Von Den AnfÔngen Bis Heute:
die Entwicklung des Feuerlöschwesens in Deutschland
Gut Eingespielt:
Aufgaben und Ziele der Feuerwehr
Aufbau und Organisation:
die Feuer- und Rettungswache
Für Alle Eventualitäten Gerüstet:
die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr
Hightech und Funktionalität:
die bedeutendsten Feuerwehrfahrzeughersteller
Jedem Topf Seinen Deckel:
Welche Löschmittel gibt es und wie kommen sie zum Einsatz?
Impressum
und
Bildnachweis
Nicht jedermanns Sache: Die Bekämpfung einer in Brand stehenden Wohnung unter Atemschutz gehört bei der Feuerwehr zum normalen Tagesgeschäft. Ob der Löschangriff über das Treppenhaus oder die Drehleiter erfolgt, entscheidet der Einsatzleiter je nach Gefahrenlage.
Ein beeindruckendes Schauspiel bot 2017 die Übergabe von 15 neuen Drehleitern an die Feuerwehr München. Für ein Gruppenbild stellten die Magirus M 32 L-AS n.B. vor der Bavaria die enorme Beweglichkeit ihres Leiterparks unter Beweis.
Die Metz Drehleiter L 32 PLC III löste bei vielen Feuerwehren zu Beginn der 2000er-Jahre die noch im Einsatz befindlichen DLK konventioneller Bauart ab und läutete damit die flächendeckende Verwendung der volldigitalen Leitersteuerung ein.
Vorwort
Tradition und Kameradschaft, Organisation und Hightech – das ist die Welt der modernen Feuerwehr. Wie kaum eine andere öffentliche Einrichtung begeistert die Feuerwehr bis heute Jung und Alt, was sicherlich nicht nur an den hochtechnisierten Einsatzfahrzeugen liegt, sondern auch an dem nicht immer ganz ungefährlichen, auf den Schutz und die Rettung jedes Einzelnen bedachten Engagements der unzähligen Feuerwehrmänner und -frauen.
Doch obwohl die Feuerwehr im Alltag der Bürgerinnen und Bürger nahezu allgegenwärtig ist, wissen nur wenige von ihnen, wie eine Feuerwehr wirklich funktioniert, welche Fahrzeuge sie einsetzt und wie physisch und psychisch anstrengend es ist, den Beruf des Feuerwehrmanns oder der Feuerwehrfrau zu erlernen und auszuüben.
Das vorliegende Buch lässt nicht nur die geschichtliche Entwicklung des deutschen Feuerlöschwesens Revue passieren, sondern gibt auch einen umfassenden Einblick in die Organisationsstruktur und den Alltag in einer Feuer- und Rettungswache; stellt die unterschiedlichen Feuerwehrfahrzeuge und ihre Hersteller vor und befasst sich mit der Feuerwehr als Beruf und Ehrenamt.
Der Dank des Autors gilt an dieser Stelle allen Feuerwehren, Fahrzeugherstellern und Feuerwehrfreunden, die durch die Zurverfügungstellung von Bildern, Fahrzeugen und fachlicher Information zur Entstehung des Buches beigetragen haben. Ein besonderer Dank geht an die Feuerwehr Essen sowie an Hauptbrandmeister a.D. H. Schmidt für seine fachliche Unterstützung.
Wattenscheid, im Frühjahr 2025
Jörg Hajt
Vor Erfindung des heutigen Sprungrettungsgerätes diente ein vergleichsweise einfaches Sprungtuch zur Personenrettung. Entsprechend akribisch musste der perfekte Ablauf dieser hoch riskanten Rettungsform geübt werden.
Als »Anschluss der Schlauchleitungen« wurde diese von den Feuerwehren in der DDR für Schulungszwecke verwendete Aufnahme betitelt.
Von den Anfängen bis heute: Die Entwicklung Des FeuerlöSchwesens In Deutschland
Bereits bei den Römern gab es Verordnungen zur Löschung von Bränden. Im späten Mittelalter wurden erstmals von offizieller Seite Regelungen für Löscharbeiten getroffen. Im Lauf der Zeit traten dann professionell organisierte Maßnahmen zur Brandbekämpfung in Kraft.
Die Entwicklung der Feuerwehr vom reinen Brandbekämpfer zum hilfetechnischen Dienstleister brachte im Lauf der Zeit eine Vielzahl von neuen Einsatzfahrzeugen hervor. Eines von ihnen ist das HLF, das sich bei kommunalen und nicht öffentlichen Feuerwehren inzwischen als »das« universell einsetzbare Lösch- und Hilfeleistungsfahrzeug etabliert hat.
Einem Großbrand, wie dem hier abgebildeten Brand der Hamburger Kirche St. Peter im Jahr 1842, waren die Bürger noch im 19. Jahrhundert nahezu wehrlos ausgeliefert.
Wie alt das organisierte Feuerlöschwesen in Deutschland tatsächlich ist, lässt sich heute nicht mehr genau datieren. Erste überlieferte gesetzliche Verordnungen zur gemeinschaftlichen Feuerbekämpfung stammen aus dem 13. Jahrhundert und verpflichteten die Bevölkerung oder Angehörige bestimmter Berufsgruppen, sich im Brandfall an den Löscharbeiten zu beteiligen. Eine Feuerwehr im heutigen Sinn war dies allerdings noch nicht. Zudem gab es bereits im Römischen Reich ähnlich lautende Feuerlöschverordnungen, die mit großer Wahrscheinlichkeit auch im besetzten Germanien gültig waren.
Erst mit der Expansion der Städte im späten Mittelalter und der damit verbundenen räumlichen Nähe der neu errichteten Gebäude sahen sich die meisten größeren Kommunen gezwungen, den vorbeugenden Brandschutz stärker in ihren Fokus zu rücken: Fortan musste jeder Haushalt einen mit Wasser gefüllten Eimer bereithalten und das eigene Kaminfeuer über Nacht stilllegen. Für die Überwachung war der städtische Nachtwächter zuständig, der etwaige Verstöße mit drastischen Strafen ahnden konnte.
Einrichtung von Feuerwachposten in Kirchtürmen
Darüber hinaus wurden in den Glockentürmen vieler Stadtkirchen erste Feuerwachen eingerichtet, in denen ein Türmer dauerhaft Ausschau nach etwaigen Bränden hielt. Im Alarmfall warnte er die Bevölkerung mit Glockenläuten oder dem Blasen eines Signalhorns vor dem Schadensereignis und zeigte durch Schwenken einer Fahne den Standort des Brandherdes an. Während die Alarmierung damit recht zuverlässig funktionierte, blieb der Brand selbst eine kaum abzuwendende Katastrophe, die nicht selten ganze Straßenzüge oder Ortschaften auslöschte. In den Dörfern stellte sich die Situation keineswegs besser dar, da auch hier die schlechte Verfügbarkeit von Wasserentnahmestellen und die völlig unzureichende technische Ausstattung eine erfolgreiche Brandbekämpfung nahezu unmöglich machten. Folglich konzentrierten sich die Anstrengungen der Bürgerfeuerwehren mehr auf das gezielte Abbrennenlassen des Schadensobjekts und die Errichtung von Brandschneisen als auf das eigentliche Löschen des Brandes. Dies änderte sich jedoch gegen Ende des 16. Jahrhunderts mit der Wiedererfindung der bereits in der Antike bekannten handbetriebenen Feuerspritze schlagartig. Durch die Einführung der technisierten Brandbekämpfung war es nun erstmals möglich, genügend Löschwasser gezielt auf einen Brandherd zu konzentrieren. Da ein wasserdichter Schlauch jedoch erst um 1800 zur Verfügung stand, mussten die Spritzen noch mit Eimern befüllt werden, sodass man der Bevorratung von Wasser noch größere Aufmerksamkeit schenkte. Wasserschöpfstellen wurden nun verstärkt mit Schwengelpumpen ausgerüstet und an zentralen Orten Löschteiche angelegt.
Feuerversicherungsvertrag von 1909.
Einfache Holzeimer waren über viele Jahrhunderte die einzigen Löschgeräte.
Gegen Feuer versichert
Die Erhebung von Brandsteuern und die Gründung der ersten Brandschutzversicherungen, die sich in den meisten Fällen auch an den Kosten für die Beschaffung von feuerwehrtechnischer Ausrüstung beteiligten, ermöglichten auch kleineren Gemeinden die Gründung einer eigenen Feuerwehr. Die erste urkundlich erwähnte Feuerversicherung war 1591 der Feuer-Kontrakt in Hamburg ansässiger Brauereien, aus der 1676 mit der Hamburger Feuerkasse die älteste Versicherungsgesellschaft der Welt hervorging. 1718 wurde das System der Solidarversicherung mit Gründung der Feuersozietät auch für Berlin übernommen und 1765 als Pflichtversicherung in ganz Preußen eingeführt. Damit war den Bürgern zwar die Sorge vor einem wirtschaftlichen Verlust ihrer Existenz durch ein Brandereignis genommen, doch fehlte in Deutschland noch immer ein professionell organisiertes Feuerlöschwesen. Eine Vorreiterrolle in Europa nahm hier die Stadt Wien ein, die bereits 1685 vier hauptamtliche Feuerknechte für die Brandbekämpfung verpflichtet und damit den Grundstein für den Aufbau einer Berufsfeuerwehr gelegt hatte. 1716 folgte auch Paris diesem Beispiel, das seine aus Zivilisten bestehende Berufsfeuerwehr bereits 1747 in den Rang eines militärischen Corps erhob. Als Konsequenz aus der schweren Brandkatastrophe vom 1. Juli 1810, bei der auf dem Ball des österreichischen Gesandten, Fürst von Schwarzenberg, dessen Gattin und der russische Botschafter in den Flammen ums Leben kamen, erweiterte Kaiser Napoleon I. die Rekrutierung der Feuerwehrmannschaft um freiwillige Mitglieder. Per Dekret vom 18. September 1811 verfügte er die Gründung einer der Kaisergarde direkt unterstellten Compagnie des Sapeurs-Pompiers, deren Mitglieder während der Dienstzeit fortan kaserniert untergebracht wurden.
Die technische Entwicklung des Löschwesens erlebte in der Blütezeit der Industriealisierung einen rasanten Aufschwung (Grafik von 1906).
Freiwillige Feuerwehren auf dem Vormarsch
Damit hatte der französische Kaiser die Grundlage für die noch heute bestehende Organisationsstruktur geschaffen, die in der Folgezeit auch von den anderen französischen Präfekturen übernommen wurde und mit der napoleonischen Expansionspolitik schließlich auch in Deutschland Fuß fasste. Hierunter fiel 1811 auch die Gründung der Compagnie des Pompiers der damals noch französischen Festungsstadt Saarlouis im heutigen Saarland, die, obwohl die Stadt erst 1815 preußisch wurde, heute als die älteste Freiwillige Feuerwehr in Deutschland gilt. Doch auch vor der französischen Besatzung hatte es in Deutschland bereits ernsthafte Bemühungen um den Aufbau straff organisierter Freiwilligenverbände gegeben. So verpflichtete zum Beispiel der Erzbischof von Köln, dem bis 1803 ein Großteil des heutigen Bundeslandes Nordrhein-Westfalen kirchlich und weltlich unterstand, bereits 1787 alle Pfarrbezirke zur Gründung einer aus mindestens zwölf Freiwilligen bestehenden Löscheinheit. Für eine effektive Brandbekämpfung waren regelmäßige Brandlöschübungen vorgeschrieben, die von leitenden Kirchenbeamten überwacht wurden. Mit der Säkularisation nahm auch der Einfluss nichtreligiöser Institutionen auf das Feuerlöschwesen zu. Vor allem die Turnerschaft machte sich hier um die organisierte Brandbekämpfung verdient. Nachdem der preußische Hilfslehrer Friedrich Ludwig Jahn im Juni 1811 in Berlin die Turnbewegung ins Leben gerufen hatte, schlossen sich die demokratisch organisierten Sportler in den Befreiungskriegen gegen Napoleon dem Lüzowschen Freikorps an, dessen Anteil am Sieg über Frankreich zwar militärisch unbedeutend war, das als Volksheer dagegen aber eine große Strahlkraft besaß. Da der Adel die Turnerschaft als Motor für einen politischen Umsturz fürchtete, schloss man die Turner fortan von allen politischen und militärischen Ämtern aus, was dazu führte, dass sich die um das Gemeinwohl bemühten Sportler verstärkt dem Feuerlöschwesen zuwandten. Spezielle Steigerabteilungen, die die Technik des Leitersteigens immer weiter perfektionierten, sowie Spritzentrupps, die sich auf den Löschangriff mit der Feuerlöschspritze spezialisierten, waren schon bald in nahezu jeder Turngemeinschaft zu finden. Da die Turner körperlich ungleich leistungsfähiger als die normale Bürgerschaft waren, lag es auf der Hand, dass sich die Kommunen verstärkt um die Turngemeinschaften als Brandbekämpfer bemühten. In vielen Gemeinden erfolgte daher ein Zusammenschluss aus den bisherigen freiwilligen Brandbekämpfern und den Turnvereinen zu sogenannten Freiwilligen Lösch- und Rettungscorps oder auch Pompier-Corps, die als Keimzelle der heutigen Freiwilligen Feuerwehren gelten können. Die Organisationsstrukturen entsprachen denen des Militärs, wobei heute unklar ist, ob man damit dem Volksheeresgedanken Friedrich Ludwig Jahns entsprochen hatte oder nur die bewährten Strukturen der französischen Feuerwehren fortführen wollte.
Die Erfindung der Handdruckfeuerspritze erleichterte die Brandbekämpfung ganz entscheidend, konnte doch mit ihr erstmals Wasser über einen längeren Zeitraum auf den Brandherd konzentriert werden.
Die von Pferden gezogenen Dampfspritzen waren »die« Hightech-Fahrzeuge ihrer Zeit und wurden häufig noch bis in die 1930er-Jahre hinein parallel oder alternative zu automobilen Feuerwehrwagen eingesetzt.
Die 1888 von Gottlieb Daimler zum Patent angemeldete Feuerspritze mit Motorantrieb gilt als Urahn aller heutigen Löschfahrzeuge.
Den ersten, weit über die damaligen Landesgrenzen hinaus bekannt gewordenen Großeinsatz hatte eine Turnerfeuerwehr beim Brand des Karlsruher Hoftheaters am 28. Februar 1847.
Die Körperbeherrschung der Turner kommt zum Einsatz
Nachdem die Karlsruher Bürgerfeuerwehr dem Einsatz nicht gewachsen war, gelang es dem ausschließlich aus gut ausgebildeten Turnern bestehenden Pompier-Corps Durlach, den Brand abzuriegeln und mithilfe von neuartigen beweglichen Metz-Handdruckspritzen zu bekämpfen. Dabei setzten die Turner erstmals auch neu entwickelte Hakenleitern ein, mit denen sie das Feuer von den benachbarten Dächern aus löschen und damit erstmals in der Geschichte des deutschen Feuerwehrwesens die Fähigkeit zum Brandangriff unter Beweis stellen konnten. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse bildeten nicht nur die Grundlage für die Weiterentwicklung der Leitertechnik, sondern lenkten auch die Aufmerksamkeit auf die sportliche Fitness der Einsatzkräfte. Sämtliche neu gegründete Feuerwehren verpflichteten fortan Turnlehrer als Ausbilder, wobei die von Carl Metz verfasste Denkschrift »Das Feuerlöschwesen ist Turnwesen« als Leitfaden diente. Der Feuerspritzenpionier war es auch, der gemeinsam mit dem Gewerbelehrer Christian Hengst am 27. Juli 1846 den Durlacher Pompier-Corps gegründet und damit die Basis für das moderne Feuerlöschwesen in Deutschland geschaffen hatte. Mit ihrer modernen technischen Ausstattung und Ausbildung wurde die Durlacher Turnerfeuerwehr schnell zum Vorbild für andere Feuerwehren im In- und Ausland.
Im Zuge der medialen Nachbetrachtung des Karlsruher Großbrandes hielt auch erstmals der Begriff Feuerwehr Einzug in den deutschen Sprachgebrauch. In der in Tübingen erschienenen »Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft« zunächst noch als Feuerlandwehr bezeichnet, wurde der Durlacher Pompier-Corps in einem internen Schreiben der Karlsruher Stadtverwaltung vom 24. August 1847 als Freiwilliges Feuerwehr-Corps bezeichnet. Diese Terminologie wurde am 19. November 1847 von der Karlsruher Zeitung übernommen und fand bereits ein Jahr später im badischen Bürgerwehrgesetz Anwendung. Damit hatte sich das organisierte Feuerlöschwesen von den genossenschaftlichen Pflichtfeuerwehren emanzipiert und erstmals auch einen einprägsamen »Markennamen« erhalten.
Für die damalige Zeit hochtechnisierte Einsatzfahrzeuge, wie diese Magirus-Drehleiter, revolutionierten ab den 1920er-Jahren die Effizienz des Feuerwehrdienstes ganz entscheidend.
Ein weiterer Meilenstein war die Professionalisierung der deutschen Feuerwehren. Bereits am 16. Januar 1851 wurde in Berlin die erste deutsche Berufsfeuerwehr aufgestellt. 1862 bzw. 1865 folgten Berufsfeuerwehren auch in Potsdam und Leipzig. 1880 wurden in Deutschland bereits 17 hauptamtliche Feuerwehren gezählt. Mit der Verschmelzung bislang selbstständiger Gemeinden und Vororte zu Großstädten nahm diese Zahl bis in die 1920er-Jahre hinein beständig zu. Hinzu kam der kriegsbedingte Verlust vieler freiwilliger Einsatzkräfte, der häufig nur durch die Gründung einer Berufsfeuerwehr kompensiert werden konnte.
Die öffentlichen Berufsfeuerwehren in Deutschland
Feuerwehr
Bundesland
gegründet
Mitarbeiter
Aachen
Nordrhein-Westfalen
1871
449
Altenburg
Thüringen
1921
33
Augsburg
Bayern
1899
315
Baden-Baden
Baden-Württemberg
2021
61
Bautzen
Sachsen
2009
50
Berlin
Berlin
1851
3900
Bergisch Gladbach
Nordrhein-Westfalen
2023
210
Bielefeld
Nordrhein-Westfalen
1899
450
Bochum
Nordrhein-Westfalen
1901
523
Bonn
Nordrhein-Westfalen
1941
370
Bottrop
Nordrhein-Westfalen
1922
162
Brandenburg an der Havel
Brandenburg
1917
60
Braunschweig
Niedersachsen
1875
416
Bremen
Bremen
1870
690
Bremerhaven
Bremen
1893
279
Chemnitz
Sachsen
1866
435
Cottbus
Brandenburg
1947
232
Cuxhaven
Niedersachsen
2005
98
Darmstadt
Hessen
1895
173
Delmenhorst
Niedersachsen
2012
120
Dessau-Roßlau
Sachsen-Anhalt
1923
68
Dortmund
Nordrhein-Westfalen
1901
1167
Dresden
Sachsen
1868
892
Duisburg
Nordrhein-Westfalen
1904
730
Düsseldorf
Nordrhein-Westfalen
1872
796
Eberswalde
Brandenburg
1947
37
Eisenach
Thüringen
1947
49
Erfurt
Thüringen
1910
215
Essen
Nordrhein-Westfalen
1894
839
Flensburg
Schleswig-Holstein
1904
99
Frankfurt am Main
Hessen
1874
1200
Frankfurt (Oder)
Brandenburg
1947
50
Freiburg im Breisgau
Baden-Württemberg
1945
132
Fürth
Bayern
1954
80
Gelsenkirchen
Nordrhein-Westfalen
1904
358
Gera
Thüringen
1923
135
Gießen
Hessen
1914
70
Görlitz
Sachsen
1897
63
Gotha
Thüringen
1945
35
Göttingen
Niedersachsen
1908
95
Greifswald
Mecklenburg-Vorpommern
1876
61
Gütersloh
Nordrhein-Westfalen
2011
120
Hagen
Nordrhein-Westfalen
1913
310
Halle (Saale)
Sachsen-Anhalt
1889
157
Hamburg
Hamburg
1872
3060
Hamm
Nordrhein-Westfalen
1975
270
Hanau
Hessen
2021
68
Hannover
Niedersachsen
1880
800
Heidelberg
Baden-Württemberg
1946
121
Heilbronn
Baden-Württemberg
1971
101
Herne
Nordrhein-Westfalen
1975
150
Herten
Nordrhein-Westfalen
2011
85
Hildesheim
Niedersachsen
1896
134
Hoyerswerda
Sachsen
1950
43
Ingolstadt
Bayern
1993
150
Iserlohn
Nordrhein-Westfalen
1974
128
Jena
Thüringen
1947
145
Kaiserslautern
Rheinland-Pfalz
1955
120
Karlsruhe
Baden-Württemberg
1926
250
Kassel
Hessen
1891
351
Kiel
Schleswig-Holstein
1896
250
Koblenz
Rheinland-Pfalz
1910
121
Köln
Nordrhein-Westfalen
1872
1710
Krefeld
Nordrhein-Westfalen
1890
237
Leipzig
Sachsen
1865
640
Leverkusen
Nordrhein-Westfalen
1976
267
Lübeck
Schleswig-Holstein
1898
450
Ludwigshafen
Rheinland-Pfalz
1918
190
Lünen
Nordrhein-Westfalen
2013
131
Magdeburg
Sachsen-Anhalt
1874
270
Mainz
Rheinland-Pfalz
1906
270
Mannheim
Baden-Württemberg
1891
300
Minden
Nordrhein-Westfalen
1990
91
Mönchengladbach
Nordrhein-Westfalen
1901
419
Mühlhausen
Thüringen
2018
29
Mülheim an der Ruhr
Nordrhein-Westfalen
1924
320
München
Bayern
1879
2100
Münster
Nordrhein-Westfalen
1905
350
Neubrandenburg
Mecklenburg-Vorpommern
1945
80
Neumünster
Schleswig-Holstein
1914
100
Norderstedt
Schleswig-Holstein
2022
60
Nordhausen
Thüringen
1946
40
Nürnberg
Bayern
1875
460
Oberhausen
Nordrhein-Westfalen
1910
240
Offenbach
Hessen
1921
136
Oldenburg
Niedersachsen
1937
180
Osnabrück
Niedersachsen
1926
142
Pforzheim
Baden-Württemberg
1975
90
Plauen
Sachsen
1907
63
Potsdam
Brandenburg
1862
250
Ratingen
Nordrhein-Westfalen
2008
120
Regensburg
Bayern
1927
175
Remscheid
Nordrhein-Westfalen
1901
140
Reutlingen
Baden-Württemberg
2004
85
Rostock
Mecklenburg-Vorpommern
1908
349
Saarbrücken
Saarland
1911
200
Salzgitter
Niedersachsen
1943
210
Schwerin
Mecklenburg-Vorpommern
1869
220
Siegen
Nordrhein-Westfalen
2023
120
Solingen
Nordrhein-Westfalen
1947
217
Stralsund
Mecklenburg-Vorpommern
1883
60
Stuttgart
Baden-Württemberg
1891
640
Suhl
Thüringen
2019
55
Trier
Rheinland-Pfalz
1914
250
Weimar
Thüringen
1926
70
Wiesbaden
Hessen
1903
280
Wilhelmshaven
Niedersachsen
1940
143
Wismar
Mecklenburg-Vorpommern
1928
50
Witten
Nordrhein-Westfalen
1975
100
Wolfsburg
Niedersachsen
1952
200
Worms
Rheinland-Pfalz
2017
92
Wuppertal
Nordrhein-Westfalen
1892
550
Würzburg
Bayern
1972
150
Zwickau
Sachsen
1904
176
Ausrüstung eines Feuerwehrmannes in der DDR um 1965.
Keine gemeinsame Strategie zur Einsparung von Kosten
Mit der Zunahme des hauptamtlichen Brandschutzes wurde auch der Ruf nach einer Standardisierung der Ausrüstung laut, der jedoch bei den meisten Städten und Gemeinden noch ungehört blieb. Während die einen Kommunen angesichts der Weltwirtschaftskrise nicht finanzierbare Investitionen befürchteten, sorgten sich die anderen um ihren kommunalpolitischen Individualismus, der nicht selten in der Bevorzugung der regionalen Wirtschaft begründet war. Statt Feuerwehrfahrzeuge kostengünstig mit anderen Städten und Gemeinden gemeinsam zu beschaffen, gönnten sich viele Feuerwehren stattdessen den Luxus einer prestigeträchtigen Spezialanfertigung, wobei in der Regel das Fahrwerk von der Stange bestellt wurde. Da es auch der Politik nicht gelungen war, die länderspezifischen Vorschriften und Gesetze in der Weimarer Republik zu vereinheitlichen, wird dieser Abschnitt in der deutschen Feuerwehrgeschichte noch heute die Ära der vertanen Chancen genannt.
Seit der Errichtung von Großfeuerwachen mit übereinander angeordneten Fahrzeug- und Wachräumen hat sich im Alarmfall die Rutschstange als schnellstes »Transportmittel« zwischen den beiden Etagen bewährt.
Hochbürokratisierte Neustrukturierung ab 1933
Seinen moralischen Tiefpunkt erlebte das deutsche Feuerlöschwesen erst im Dritten Reich. Wie alle dem Gemeinwohl verpflichteten Vereine und Organisationen wurde auch die Feuerwehr nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten gleichgeschaltet und für politische Umtriebe missbraucht. So wurden mit Inkrafttreten des revidierten Preußischen Gesetzes über das Feuerlöschwesen vom 15. Dezember 1933 alle Berufsfeuerwehren, Freiwilligen Feuerwehren und Pflichtfeuerwehren der Ortspolizei und den Polizeiaufsichtsbehörden unterstellt.
Mit der Eingliederung der Feuerwehren in den Polizeidienst wurden die Einsatzfahrzeuge unter den Nationalsozialisten ab 1938 tannengrün lackiert.
Hiermit verbunden war auch die Umbenennung in Feuerlöschpolizei und die Angleichung der Dienstgrade an das Polizeiwesen. Am 12. Januar 1936 erging zudem auch die Aufforderung an die nichtpreußischen Länder, sich unverzüglich der Neustrukturierung des Feuerlöschwesens anzuschließen und die Feuerwehren ihres Zuständigkeitsbereichs den örtlichen Polizeibehörden zu unterstellen. Nachdem die Freiwilligen Feuerwehren 1937 zunächst in die SA integriert werden sollten, wurden diese schließlich mit der schwindenden Bedeutung der einstigen Sturmabteilung der NSDAP am 23. November 1938 als technische Polizeieinheiten dem Reichsministerium des Innern unterstellt. Gleichzeitig wurden die Berufsfeuerwehren in Feuerschutzpolizei umbenannt.
Nach dem Krieg begannen die Alliierten umgehend damit, das Feuerwehrwesen wieder zu entflechten und die Organisationsstrukturen der Vor-NS-Zeit wieder herzustellen. In Regionen, in denen kriegsbedingt nicht genügend Feuerwehrkräfte oder Einsatzmittel zur Verfügung standen, übernahmen die Besatzungsmächte zunächst den Brandschutz in Eigenregie. Mit Gründung der beiden deutschen Staaten war die Neuorganisation der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehren schließlich weitgehend abgeschlossen.
Feuerwehrfahrzeuge aus der DDR-Zeit.
Heute gibt es in Deutschland insgesamt 114 Berufsfeuerwehren. Hinzu kommen rund 23.000 Freiwillige Feuerwehren mit über einer Million Mitglieder, womit das deutsche Feuerwehrwesen nicht nur der zahlenmäßig größte Aufgabenträger für öffentliche Hilfeleistungen ist, sondern zugleich auch einer der wichtigsten sozialen Stützpfeiler des Vereinslebens.
Berufs- oder Freiwillige Feuerwehr?
Ob eine Gemeinde eine Berufsfeuerwehr oder eine Freiwillige Feuerwehr aufstellen muss, wird in Deutschland durch die gesetzlichen Vorgaben der Bundesländer geregelt. Als allgemeiner Grundsatz gilt, dass nur Kommunen mit mehr als 100.000 Einwohnern sowie kreisfreie Städte zur Unterhaltung einer Berufsfeuerwehr verpflichtet sind. Ausnahmen bilden die Bundesländer Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz, in denen bereits 80.000 bzw. 90.000 Einwohner als Grenzwert gelten. Zudem ist in Baden-Württemberg unter bestimmten Voraussetzungen eine Pflichtbefreiung bis 150.000 Einwohner möglich.
Der Grenzwert folgt dabei in erster Linie kommunalen Sachzwängen: Während es für eine große, finanzstarke Kommune in der Regel kein Problem ist, mindestens einen Löschzug rund um die Uhr dienstbereit vorzuhalten, würde dies für eine kleine Gemeinde ein sowohl finanzielles als auch organisatorisch kaum zu überwindendes Hindernis darstellen. Wird allerdings auch der Rettungsdienst von der Feuerwehr erbracht, müssen für eine gesicherte Versorgung der Bevölkerung auch kleinere Gemeinden hauptamtliche Kräfte unterhalten. Allerdings gibt es auch Freiwillige Feuerwehren ohne Rettungsdienst, die Vollzeitkräfte beschäftigen; sei es aus organisatorischen Gründen oder zur Sicherung der Wehrfähigkeit. In einigen Bundesländern hängt es auch hier wiederum von der Einwohnerzahl ab, wann Berufsfeuerwehrleute in einer Freiwilligen Feuerwehr zu beschäftigen sind.
Die personelle Zusammensetzung ist Ländersache
In Nordrhein-Westfalen liegt diese Grenze beispielsweise bei über 60.000 Einwohnern für große kreisangehörige Städte und bei mehr als 25.000 Einwohnern für mittlere kreisangehörige Gemeinden. Ist diese Grenze erreicht, spricht man von einer Freiwilligen Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften.