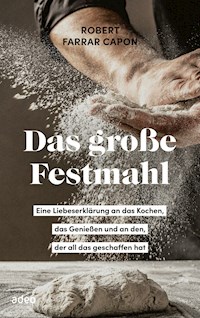
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: adeo
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Der Duft von Zwiebeln, die in frischer Butter gedünstet werden. Das Gefühl von Mehl zwischen den Fingern, wenn man einen Brotteig durchknetet - diese Momentaufnahmen lässt Robert Farrar Capon in seinem Buch lebendig werden. Als leidenschaftlicher Koch hat er es geliebt, für seine Mitmenschen köstliche Gerichte zuzubereiten. Aber er war auch ein Priester, dessen brillante Gedanken sich wie Blätterteig Schicht um Schicht zu Fantastischem entfaltet haben. Wer dieses Buch liest, wird nie wieder eine Zwiebel schneiden, ohne für die unaussprechliche Herrlichkeit der Schöpfung zu danken. Robert Farrar Capon lädt auf unvergessliche Weise in eine Welt voller Lachen und Genuss, Lebensfreude, tiefer Gemeinschaft und heiliger Momente ein. Dieses Buch ist ein zeitloses Meisterwerk und eine Pflichtlektüre für alle theologisch und philosophisch interessierten Essensliebhaber.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für meine Frau.Den Blitz hinter all dem Donner.
Inhalt
Vorwort
Eins – Die Zutaten
Zwei – Der erste Arbeitsschritt
Drei – Das Brandopfer
Vier – Der großzügige Ochse
Fünf – Erhebt Keule und Bruststück
Sechs – Die Blechgeige
Sieben – Lebendiges Wasser
Acht – Wasser in excelsis
Neun – Was lange währt oder: Das Geheimnis ist die Soße
Zehn – Und sie nahm Mehl …
Elf – Besser ein Gericht Gemüse …
Zwölf – Der geheimnisvolle Osten
Dreizehn – Brot erfreue des Menschen Herz
Vierzehn – Vielschichtiger Genuss
Fünfzehn – Die große Abendeinladung
Sechzehn – Brannte nicht unser Herz
Register zu den enthaltenen Rezepten
Vorwort
Es war einmal ein Musiker, der sich beschwerte, dass die Hälfte der Noten, die er spielen wollte, nicht auf dem Klavier waren. Sie lagen, so behauptete er, zwischen den Tasten, wo er sie nie erreichen konnte. Also begann er, die Geige zu spielen, die solche Einschränkungen nicht kennt, und lebte fortan glücklich und zufrieden.
Dies ist ein Buch über das Kochen; aber wie der Musiker konzentriert es sich mehr auf die Lücken und Zwischenräume der kulinarischen Klaviatur als auf die konventionellen Noten. Auch hier wird viel herumgefiedelt – mit hohen und tiefen Noten. Nichtsdestotrotz empfehle ich es Ihnen allen Ernstes. Vielleicht erfahren Sie darin Dinge, die Sie noch nicht wussten, oder Ihre Vorurteile werden bestätigt – oder Sie nehmen sogar das eine oder andere Rezept mit, das Sie Ihrer Sammlung hinzufügen können. In jedem Fall werden Sie es als ein gemächliches und entspanntes Buch empfinden: Das ausgefallene Rezept, mit dem es beginnt, zieht sich durch das ganze Werk und stellt weniger eine Gliederung dar als einen Fixstern, unter dem die ganze Bandbreite des Kochens erkundet wird.
Wenn ich mir das Buch so anschaue, scheinen mir zwei Dinge erklärungsbedürftig. Zum einen sind nur Rezepte, die logisch in den Rahmen des Buches passen, enthalten. Ich habe Ihnen nur die hineingeschrieben, die ich kenne und mag. Es ist ja schließlich mein Buch.
Zum Zweiten habe ich die Frage nach dem Geschlecht der Leser anscheinend nie geklärt. Einige meiner Kommentare sind offensichtlich für die Ohren von Frauen bestimmt; andere werden nur für Männer Sinn ergeben. Ich habe darüber nachgedacht, das Buch durchzugehen und das zu korrigieren, habe mich dann aber dagegen entschieden. Es ist genau diese Engstirnigkeit in Bezug auf das Geschlecht, die uns fast der herrlichen Höhen und Tiefen der Sexualität beraubt hat. Ich biete es Ihnen daher als das erste androgyne Kochbuch an und erspare mir die Mühe der Überarbeitung. Wir sind alle wahre Männer – oder Frauen. Vive la différence.
Vermutlich ist es wahr, dass Autoren die letzten sein sollten, die ihr eigenes Buch kommentieren. Bücher sind wie eine Flaschenpost – der größte Teil der Freude, die sie bringen, entspringt aus der Überraschung, wenn man sie entdeckt, nicht aus dem zweifelhaften Vergnügen, dass der Autor einem über die Schulter schaut, während man seine Ausführungen liest.
Doch da dies ein sehr merkwürdiges Kochbuch ist, das nicht nur Rezepte, sondern auch Theologie serviert, lassen Sie mich zu erklären versuchen, warum eine scheinbar so unverdauliche Mixtur sich dann doch für so viele Menschen als genießbar und sogar schmackhaft erwiesen hat.
Zum einen benutzt das Buch weder das Kochen noch die Theologie als Vorwand, um hinterrücks zu dem einen oder zu dem anderen zu gelangen. Dies ist kein Buch, in dem das Kochen dazu missbraucht wird, fromme kleine Analogien zu höheren Wahrheiten herzuleiten, und es ist auch keines, das dem langen Arm der Theologie erlaubt, sich in irgendeiner Weise in die anständigen irdischen Freuden des Kochens und Essens einzumischen.
Ich habe versucht, mich mit voller Kraft beiden Themen zu widmen – aus dem einfachen Grund, dass ich zufällig verrückt nach beiden bin. Wenn ich mich in die Aktivitäten am Schneidebrett oder am Herd stürze, dann deshalb, weil Schnippeln, Würfeln und Sauteusen schütteln zu den großen Lieben meines Lebens gehören. Und wenn ich im nächsten Atemzug von der Kreativität Gottes oder der Auferstehung der Welt als dem neuen Jerusalem schwärme, dann aus demselben Grund: Auch hier leide ich an einem unheilbaren Fall von endloser Begeisterung für diese Dinge.
Was mich zu dem vermuteten Hauptgrund für den Erfolg dieser unwahrscheinlichen Kombination bringt. Es gibt eine Angewohnheit, die viele kluge Köpfe plagt: Sie stellen sich vor, dass Materie und Geist irgendwie im Widerspruch zueinander stehen und dass der richtige Weg für das menschliche Leben darin besteht, aus der Welt der Materie in ein feineres und reineres (und zweifellos langweiligeres) Reich zu entkommen. Für mich ist das ein krasser Irrtum.
Denn in der Tat war es Gott, der Erde, Zwiebeln und Rübenkraut erfunden hat. Gott, der den Menschen erfunden hat, den Menschen mit seinem seltsamen Drang, sein Essen zu kochen. Gott, der am Ende eines jeden Schöpfungstages ein schallendes „Gut!“ über seinen eigenen Erfindungen aussprach. Und es ist Gottes unbeugsame Liebe zu all den Dingen dieser Welt, die sie in jedem einzelnen Moment im Sein hält. Wenn wir also von Materiellem fasziniert, ja berauscht sind, ist das keine Überraschung: Wir sind nach dem Bild des ultimativen Materialisten geschaffen.
Essen und Kochen – das sind keine leichtgewichtigen Themen. In der Tat gibt es im physischen Universum keine niederen Themen. Jedes reale Ding ist eine Freude, wenn man nur Augen und Ohren hat, um es zu genießen, eine Nase und eine Zunge, um es zu schmecken. Essen und Kochen gehören zu den gehaltvollsten Dingen der Welt. Jeden Tag unseres Lebens beschäftigen, erfreuen und erfrischen sie uns. Essen ist nicht nur der Treibstoff, den wir brauchen, um uns zu Höherem aufzuschwingen. Kochen ist keine Plackerei, die wir in Kauf nehmen, um diesen Treibstoff geliefert zu bekommen. Vielmehr ist jedes Mahl ein Freudenfest des Herzens. Es lässt uns vor Staunen innehalten. Mehr noch, Kochen und Essen bringen uns Abend für Abend an einen Tisch, und in der Gemeinschaft, die sich um unsere Esstische bildet, erschaffen sie tatsächlich unsere Menschlichkeit.
Wenn dieses Buch also irgendeine Botschaft hat, dann die, dass das Essen geradezu eine Epiphanie der Großartigkeit unserer Natur ist – oder, um das treffendste theologische Wort überhaupt zu verwenden, es ist ein Sakrament, die Fleischwerdung des herrlichen Mysteriums unseres Daseins. Ich glaube, die Menschen mögen dieses Buch, weil es ihnen nach der modernen Zerlegung des Essens in seine Bestandteile endlich wieder handfeste Gründe gibt, mit einer Wahrheit aufzutrumpfen, die sie schon die ganze Zeit geahnt hatten: dass nämlich Essen Leben ist und dass das Leben gut ist.
Zugegeben, das ist eine schwer zu verdauende Erkenntnis. Essen wird heutzutage oft als Feind betrachtet. Butter, Salz, Zucker, Eier sind alle darauf aus, uns umzubringen. Dabei wissen wir es doch eigentlich besser. Butter ist … nun ja, Butter. Sie verherrlicht fast alles, was sie berührt. Salz ist der souveräne Vervollkommner aller Geschmäcker. Eier sind, schlicht und einfach, eines der Weltwunder. Und wenn man sie alle zusammennimmt, ergibt das nicht den plötzlichen Herztod, sondern eine Hollandaise – die auf ihre Art kein kleineres Wunder ist als der Computerchip oder eine Fuge von Bach.
Essen ist, wie alle anderen Triumphe der menschlichen Natur, ein Beweis für die Zivilisation. Wir sind nicht die Nutzer der Schöpfung, sondern wir sind berufen, sie zu erweitern. Wir werden diese Welt einmal mitnehmen, wenn wir auferstehen. Gerade weil wir dieses alte Jerusalem genug geliebt haben, um es in unseren Knochen zu tragen, werden seine Texturen uns begleiten; gerade weil unsere Augen die Erde genossen haben, werden die Farben ihrer Länder für immer in unseren Herzen sein. Das Brot und die Pasteten, die Käsesorten, die Weine und die Lieder gehen ein in das Hochzeitsmahl des Lammes, weil wir es tun. Es ist unsere Liebe, die die Welt nach Hause bringt.
Ich selbst hätte es nicht besser sagen können.
Port Jefferson, New York
August 1968
Eins Die Zutaten
Lassen Sie mich ohne irgendwelche Vorreden beginnen.
Vier Mal Lamm für acht Personen
Zusätzlich zu einem gusseisernen Topf, zwei scharfen Messern und vier Salatköpfen benötigen Sie Folgendes:
Für das Ganze
1 Lammkeule (die größte, die der Markt hergibt. Wenn Sie nicht gut mit einer Küchensäge umgehen können, lassen Sie die Koteletts und die Keule einmal durchschneiden. Lassen Sie sie aber nicht vom Metzger komplett zerlegen. Wenn er es tut, verlieren Sie acht Portionen und die Hälfte des Spaßes.)Für die TeileVariante I (a) – Lammtopf
Olivenöl Knoblauch (frisch)Zwiebeln, Karotten, Champignons und PetersilieSalz, Pfeffer (frisch gemahlen), Lorbeerblatt, Majoran, Fond (jede Sorte außer Schinken; Wasser nur in absoluten Notfällen)Wein (trockener Rotwein, so guter wie möglich) Breite Nudeln (oder Spätzle, Kartoffeln, Rouladen oder Toast)Variante I (b) – Geschmortes Lammfleisch
Olivenöl (schon wieder)KnoblauchZwiebelnSalz, Pfeffer (halten Sie die Mühle griffbereit) und Thymian (mit Bedacht). Oregano ist auch möglich, aber er schmeckt ein wenig zu sehr vor, wenn Sie zu Variante III kommen.Wein (trockener Weißwein – sogar französischer Wermut – aber kein Sherry. Sparen Sie sich den. Oder trinken Sie ihn, während Sie kochen.)Variante II – Lamm-Spinat-Auflauf
Spinat (viel)Käse (gerieben: Parmesan oder Cheddar; oder vielleicht Feta –irgendwas mit ein wenig Schärfe und Biss)Mayonnaise (nicht fettarm und nicht süß), Sherry (nur ein Tropfen, aber spanisch)Brot (selbst gebacken; zwei Laibe) und Butter (oder Margarine, wenn es sein muss)Variante III – Gebratener Reis mit Lamm
Öl (Erdnussöl, wenn Sie welches haben; sonst Olivenöl) 3 EierZwiebelnGehobelter bzw. fein geschnittener Weißkohl (Bohnensprossen, wenn Sie zu viel Geld haben) Sherry (wenn Sie welchen übrig haben)Fond (wie zuvor, aber nur wenig) Reis (gekocht, aber nicht vorgekocht)Sojasoße (hiesige nur im äußersten Notfall)Variante IV – Lamm-Gerstensuppe
Zwiebeln, Karotten, Sellerie, Rüben (Mairüben)Öl, Fett oder ButterGerste (oder Kichererbsen oder getrocknete Bohnen – oder alle drei) WasserSalz, Pfeffer und Petersilie (Rosmarin?)(Makkaroni und fein gehobelter Kohl sind auch möglich. Ein paar Tomaten geben eine schöne Farbe.)Richtig zubereitet, ist das alles köstlich!
Erlauben Sie mir nun, mir die Hände abzuwischen und mich vorzustellen. Ich bin ein Autor, der schon immer vorhatte, über das Kochen zu schreiben, aber stets nach zwei Absätzen oder weniger geschlagen vom Feld getragen werden musste. Diesmal habe ich, wie Sie sehen, die Muse überlistet. Dieser Anfang, wenn auch verwirrend, ist der bisher verheißungsvollste.
Nun zu meinen Qualifikationen.
Erstens: Ich bin Amateur. Amateur und Nicht-Profi sind keine Synonyme. Ein Amateur (französisch, von lateinisch amator: „Liebhaber“) ist eine Person, die – im Gegensatz zum Profi – eine Tätigkeit aus Liebhaberei ausübt, ohne einen Beruf daraus zu machen oder Geld für ihre Leistung zu erhalten. Die Welt mag ein weiteres Kochbuch brauchen oder auch nicht, aber sie braucht alle Liebhaber – Amateure –, die sie kriegen kann. Sie ist ein wunderschöner alter Ort, voll von absurder Schönheit und nutzlosen Kuriositäten, und sie hat genug Texturen, Geschmäcker und Gerüche, um uns länger zu faszinieren, als wir Zeit haben.
Unglücklicherweise ist unsere Reaktion auf all diese Herrlichkeit nicht immer Freude, sondern ungerechtfertigte Langeweile. Und das ist nicht nur seltsam, sondern tragisch, denn Langeweile ist nicht neutral – sie ist der Wachstumsbeschleuniger der Lieblosigkeit. In einer solchen Situation ist der Amateur – der Liebhaber, der Unachtsamkeit für Sünde und Langeweile für Ketzerei hält – genau der Mann der Stunde. Seine Liebhaberei verpflichtet ihn, den Mund aufzumachen. Wenn er die Weisheit oder die Künste liebt, umso besser für ihn und für uns alle. Wenn er aber nur die Art und Weise liebt, wie Fleisch knusprig brät oder Zwiebeln sich häuten, wenn er sich einfach am Käsebruch oder an der Farbe seines Weins freut, dann ist er durch jeden dieser Genüsse zum Sprechen verpflichtet. Ein schweigender Liebhaber ist einer, der seine Berufung nicht kennt.
Der Mann, der sagte: „Schönheit liegt im Auge des Betrachters“, war also auf der richtigen Spur, auch wenn er in Bezug auf die Objektivität von Schönheit ein wenig daneben lag. Vielleicht war er ein Solipsist, der nur das eigene Ich für real hielt, oder einer jener Skeptiker, die denken, dass es keine absolute Wahrheit gibt – dass kein Messer in Wirklichkeit als scharf bezeichnet werden kann und kein Pudding als perfekt. Es spielt keine Rolle. Wie Kaiphas redete er weiser, als ihm bewusst war. Die reale Welt, die er anzweifelt, ist zwar die Mutter aller Herrlichkeit, der Schoß und die Matrix, in der sie gezeugt und genährt wird; aber das liebende Auge, das er feiert, ist der Vater. Die Annehmlichkeiten dieser Welt sind wie die Blicke einer verliebten Frau; ohne die Frau wären sie gar nicht da; aber ohne ihren Liebhaber könnten sie nie zu etwas Greifbarem wie Liebe oder Leidenschaft werden.
Das ist also die Rolle des Amateurs: die Welt wieder in ihre eigentliche Schönheit zurückzulieben. Und hier liegt auch die Notwendigkeit seines Tuns: Seinesgleichen sind zu wenige; die Welt ist in der Obhut einer Meute von Trollen zurückgelassen worden. Tatsächlich hängt die Unterscheidung zwischen Kunst und Schund, zwischen Nahrung und Müll ganz und gar von der An- oder Abwesenheit eines liebenden Auges ab.
Schälen Sie doch mal eine Orange. Tun Sie es liebevoll, in Viertel zerlegt wie kleine Boote oder sauber in flachen Schnitzen entrindet oder in einer langen Spirale, wie es mein Großvater zu tun pflegte. Nichts wird wahrscheinlich schneller zum Abfall geworfen als eine Orangenschale; aber solange irgendjemand sie genüsslich anschaut, ist sie eine Million triumphierender Meilen von jedem Komposthaufen entfernt.
Das ist der Grund, warum die Welt überhaupt existiert. Sie landet nicht im kosmischen Mülleimer des Nichts – nicht etwa, weil sie so unverzichtbar wäre, sondern weil sie die Orangenschale ist, die an Gottes Kronleuchter hängt – das vierblättrige Kleeblatt auf seinem Küchensims. Er mag die Welt; deshalb ist sie noch da. Diese ganze wunderbare Schatzsammlung von Steinen, Häuten, Federn und Schnüren existiert, weil zumindest ein Liebhaber sie nie ganz aus den Augen gelassen hat, weil der Herr allen Lebens seine Freude an den Menschenkindern hat.
Aber genug davon. Der Amateur ist rehabilitiert; lassen Sie mich mit meinen anderen Qualifikationen fortfahren.
Also, zweitens: Ich mag Essen. Als Kind mochte ich keinen Fisch, keine Eier und keine Haferflocken, aber als ich ein Mann wurde, legte ich ab, was kindlich war. Mein Geschmack ist jetzt katholisch, wenn nicht sogar omnivor. Meine Kinder nennen mich „den wandelnden Mülleimer“ (was ich natürlich ablehne, denn alles, was ich zu mir nehme, wird liebevoll aufbewahrt – es wird nicht zu Abfall, sondern zu Umfang. Aber sie haben insofern recht: Ich esse alles).
Zugegeben, es gibt einige Köstlichkeiten, die mich zögern lassen – Prärieaustern zum Beispiel oder Kalbsauge in einem tête de veau. Aber da ich sie nie gekostet habe, entsteht meine Ablehnung vielleicht nur durch die innere Distanz. Selbst die Meeresbrandung ist erschreckend, wenn man im Bett liegt und über sie nachdenkt. Jedenfalls ist es ein Teil meines persönlichen Glaubensbekenntnisses, dass es so gut wie keine Lebensmittel gibt, die nicht schmecken – vorausgesetzt, man bereitet sie richtig zu. Solange sie nicht verdorben sind … nein, das ist zu pauschal und würde Fasan und Wild ausschließen. Also: Solange sie nicht hoffnungslos verdorben sind, gibt es irgendwo auf der Welt ein Auge, das sie in Liebe annehmen kann, und ein Rezept, das sie zum Strahlen bringt. Ich bin überzeugt, dass sogar lederne Schuhsohlen mehr als genießbar wären, wenn sie auf provenzalische Art oder à la mode de Caen zubereitet würden.
Dritte Qualifikation: Ich trinke gern. Ungeachtet der Zeit, des Ortes oder der Umstände, ob als Mann oder als Junge, habe ich noch nie einen Wein oder eine sonstige Spirituose gekostet, für die ich nicht ein freundliches Wort oder zumindest eine kulinarische Verwendung finden konnte. (Ich habe einige wirklich üble Sachen probiert; aber mit genug Knoblauch im Rezept kann man so ziemlich jede Flüssigkeit in einen Eintopf oder ein Schmorgericht kippen – und alles ist besser als Wasser!) Soweit ich mich erinnere, habe ich noch nie eine Flasche von irgendetwas weggeworfen. Wenn der Wein gekippt ist, kann man ihn zu Essig für Salate verarbeiten, und es gibt keine Spirituose, die so übel wäre, dass man sie nicht mit einer stärkeren überdecken kann. Wenn es zum Äußersten kommt – Bitterstoffe können alles verzeihen.
Zugegeben, es gibt Spirituosen, die so dominant schmecken, dass sie nicht in die Knie zu zwingen sind. Allen voran der Marc oder Grappa, ein Schnaps, der aus den Resten der Weinlese gebrannt wird. Allerdings habe ich auch gar nicht das Bedürfnis, ihn mit irgendetwas zu überdecken. Ich finde ihn köstlich – voller nostalgischer Erinnerungen an den ersten Nachmittag, an dem ich einen getrunken habe. Er duftet nach Erde und Zweigen und der wiederauferstandenen Seele der Traube, alles kombiniert mit einer überwältigenden Andeutung von frisch gestrichenen Heizkörpern in einem Schuhgeschäft – was, wie Sie zugeben werden, die Essenz der Unvergesslichkeit darstellt.
Jede Regel hat jedoch ihre Ausnahme. Während ich noch nie einen Schnaps weggeschüttet habe, gibt es in meinem Haus eine Flasche, die nach zehn Jahren immer noch halb voll ist. Sie enthält einen synthetischen Kirschlikör, der von einem Hersteller von Insektiziden (sic) verkauft wird. Sie wurde mir, sieben Achtel voll, von einem befreundeten Chemiker geschenkt, der damals bei dieser Firma angestellt war. Er hatte gerade so viel davon getrunken, dass er seiner Verpflichtung gegenüber seinen Vorgesetzten nachkommen konnte, und überreichte mir dann mit unschuldigem Gesicht den Rest. Das Zeug ist schlicht und ergreifend schrecklich, und zehn Jahre haben an diesem Urteil nichts geändert.
Ab und zu nehme ich noch einen Schluck davon, zum einen, um mich daran zu erinnern, was für ein Ausbund an Schrecklichkeit er ist, zum anderen, um zu beweisen, dass er trotz all seiner Fehler nicht ungenießbar ist. In einer realen Welt ist nichts unendlich schlecht. Meine Flasche gefälschten Kirschs bezeugt, dass keine irdische Sache ein schwarzes Loch darstellt. Selbst der Teufel, sofern er existiert, ist gut. Was er mit seiner Existenz falsch macht, ist gering im Vergleich zu dem, was Gott an ihm richtig macht. Der Kirsch in meinem Schrank ist ein kleines Stück der Hölle; doch in einer Nachahmung der göttlichen Großzügigkeit betrachte ich ihn als wertvoll, auch wenn er sich nicht so verhält.
Meine übrigen Qualifikationen – Besonderheiten, wenn Sie so wollen – folgen in aller Kürze:
Kochbücher: Ich habe Henri-Paul Pellaprat in meinem Regal, aber Fannie Farmer und ihre bodenständige Küche in meinem Herzen. Sie können meine kulinarische Ausrichtung leicht rechts von Letzterer, aber deutlich links von Ersterem verorten.
Ausrüstung: Ich mag keine Küchengeräte. Der Gedanke an ein elektrisches Messer verursacht einen Kurzschluss in sämtlichen Synapsen meines Gehirns. Ich sammle keine Korkenzieher, aber ich empfinde tiefe Zuneigung für scharfe Messer (allerdings nicht für Messerschärfer) und für große Töpfe. Ich besitze genug Eisenwaren, um einen ausgewachsenen Kreuzer in einem Zwanzig-Knoten-Sturm zu verankern. Soweit ich weiß, ist in meinem Haus nichts mit Teflon beschichtet.
Zum Akt des Kochens: Ich verachte Rezepte, die Ergebnisse ohne Arbeit versprechen oder Erfolg ohne Technik. Ich habe zu viele mit Abkürzungen erzielte Kuchen gegessen, um jemandem zu vertrauen, der Frauen erzählt, dass mit Öl zubereitetes Gebäck genauso gut sei wie welches mit Butter.
Natürlich ist bloße Fertigkeit beim Kochen ebenso wenig eine Garantie für guten Geschmack wie in der Musik; aber ohne sie ist überhaupt nichts Gutes möglich. Man muss sich die Technik aneignen, und mit der Technik auch die Liebe zu den einzelnen Vorgängen des Kochens selbst. Kein Künstler arbeitet nur für Ergebnisse; er muss auch die Arbeitsschritte mögen, die dazu nötig sind. In jeder Art von Kunst steckt eine Menge Mühsal und harte Arbeit.
Und in der Kochkunst gilt mehr als in den meisten anderen Künsten: Wenn ein Mensch noch nie angenehm überrascht war von der Art, wie Eischnee steif wird oder Mehl die Soße bindet, gibt es nicht viel Hoffnung, dass aus ihm ein Koch wird. Die Geheimnisse der feinen Küche werden ihm für immer verschlossen bleiben, und er wird wahrscheinlich nicht einmal in der Lage sein, eine Bratensoße zweimal auf die gleiche Weise hinzubekommen. Das Interesse am Ergebnis wird nicht standhalten, wenn einen der Weg dahin langweilt.
Doch die Langeweile ist nicht unbesiegbar. Freude am Kochen ist eines der ältesten und vertrautesten Dinge der Welt. Nicht umsonst haben wir als Kinder tausend Sandkuchen gebacken. Wenn ein Koch bereit ist, sich einfach genau anzuschauen, was er tut, gibt es Hoffnung. Und sollte er einmal von der Tatsache fasziniert sein, dass Speisestärke und Mehl dasselbe bewirken, aber auf ganz unterschiedliche Art, dann, ja dann … gibt es einen leichten, aber deutlichen Vorgeschmack auf den Sieg. Fong wong gai und Baklava warten gleich hinter der nächsten Hügelkette.
Schließlich, meine Vorurteile: Ich meide, wenn möglich, milden Schinken, New York State-Weine, dünnen Speck, Wodka und alle Diäten. Ich denke, Truthahn ist, wenn nicht überbewertet, so doch zumindest überwürzt. Ich liebe Cocktails (außer die süßen), aber ich mag sie nicht vor dem Essen und finde sie danach unpassend. (Einige, wie der Martini, sind wunderbare Erfindungen, aber der Mensch hat noch keine zivilisierte Verwendung für sie gefunden.) Ich hege tiefe Abneigung gegen Margarine, vorgeschnittene Zutaten, Marshmallows und Sprühsahne.
Auf der anderen Seite bin ich ganz wild auf Erdnussbutter und Fruchtcocktail aus der Dose (sogar die Art, die nach der Dose schmeckt). Ich esse so viel Schmelzkäse, wie man mir vorsetzt, und ich bin bekannt dafür, dass ich Mayonnaise auf gekochte Birnen gebe. Ich bin auch ein notorischer Dieb von Spaghetti von den Tellern ahnungsloser Kinder und (wahrscheinlich) der führende Dosen-Ravioli-Experte an der Ostküste.
Nachdem ich auf diese Weise nicht nur meinen Heimatstaat beleidigt habe, sondern auch das Standardmenü der amerikanischen Christenheit und die Trinkgewohnheiten einer ganzen Nation – kurzum, mir alle zukünftigen Leser entfremdet habe (diejenigen, die mich nicht für einen Snob halten, werden mich einen Rüpel nennen) –, können wir wohl anfangen. Fahren Sie fort – auf eigene Gefahr. Sie sind mehr als ausreichend gewarnt worden. Ich bin kein „richtiger“ Koch und schreibe ein Buch, das kein … Aber warum sollte ich Sie vor allem warnen?
Zwei Der erste Arbeitsschritt
Sie haben zweifellos das Gefühl, dass ich Ihnen, was auch immer in diesem Buch noch kommen mag, zumindest einen Versuch schulde, das merkwürdige Rezept, mit dem ich begonnen habe, näher zu erklären. Sie haben recht; ich gedenke mich im Folgenden ausführlich damit zu befassen. Ich muss Sie jedoch bitten, mir zu gestatten, dies in meinem eigenen Tempo zu tun. Solche Dinge brauchen Zeit.
Legen Sie deshalb die Lammkeule erst einmal beiseite. Wenn Sie eine robuste Seele sind und sich beim Schneiden des Fleisches keine kalten Finger holen, stellen Sie es zurück in den Kühlschrank; oder, wenn Sie Wert auf Bequemlichkeit legen, lassen Sie es auf der Küchentheke ein wenig aufwärmen. In jedem Fall brauchen wir es noch nicht. Ich muss Ihnen erst erklären, wie man mit Zwiebeln umgeht.
Wählen Sie drei oder vier mittelgroße Zwiebeln – ich denke dabei an die gewöhnliche Speisezwiebel, die normalerweise im Supermarkt erhältlich ist. Der erste Teil (I a) meines Rezepts ist einfach ein Lammtopf; kleine weiße Zwiebeln sind zwar delikater, aber der Aufwand, sie zu schälen und zu schneiden, sprengt das vernünftige Maß.
Nehmen Sie als Nächstes eine Zwiebel (vorzugsweise die schönste), ein Schälmesser und ein Schneidebrett und setzen Sie sich an den Küchentisch. Versuchen Sie nicht, während dieser Eröffnungsmaßnahmen an einer Arbeitsfläche zu stehen. Um dem Ganzen gerecht zu werden, sollten Sie sich etwa sechzig Minuten Zeit für diesen Teil der Übung nehmen. Zugegeben, eine Stunde in der Gesellschaft einer Zwiebel zu verbringen, ist vielleicht etwas, was Sie noch nie getan haben. Vielleicht verspüren Sie einen gewissen Widerstand gegen das Vorhaben. Das muss nicht sein. Wie ich später zeigen werde, hat es bereits eine Reihe von höchst respektablen Mitgliedern der menschlichen Rasse vor Ihnen unternommen. Zwiebeln sind eine ausgezeichnete Gesellschaft.
Sobald Sie Platz genommen haben, widmen Sie sich der vor Ihnen liegenden Zwiebel. (Sie müssen entschieden der Versuchung widerstehen, sich blöd vorzukommen. Wenn nötig, schließen Sie die Türen, damit Sie niemand sieht; aber geben Sie nicht auf, weil es Ihnen peinlich ist.)
Sie werden zunächst feststellen, dass die Zwiebel ein Ding, ein Wesen ist, genau wie Sie selbst. Lassen Sie das einen Moment lang wirken. Sie beide sitzen sich gegenüber. Zusammen mit Messer, Brett, Tisch und Stuhl sind Sie die Bestandteile eines Ortes im höchsten Sinne des Wortes. Dies ist eine Versammlung, ein Treffen, eine Gemeinschaft der Dinge.
Sehen Sie, Sie haben schon etwas entdeckt: Die Einzigartigkeit, die Örtlichkeit von Orten ergibt sich nicht aus ihrer Lage, sondern aus Begegnungen wie der zwischen Mensch und Zwiebel. Irrende Theologen sind ins Grab gesunken, ohne das zu verstehen, worauf Sie gerade gekommen sind. Die oben genannte Spezies hat zum Beispiel darauf bestanden, dass der Himmel kein Ort sei, weil er nicht anhand von räumlichen Koordinaten definiert werden kann. Daher haben sie die ewige Behausung des Menschen zu einem „Geisteszustand“ degradiert. Aber sehen Sie, was Ihre Zwiebel für Sie getan hat: Sie hat Ihnen die Möglichkeit des Himmels als Ort zurückgegeben, ohne Sie mit der Irrelevanz seiner Lokation zu belasten.
Dieses Treffen zwischen Ihnen beiden könnte auf jeden beliebigen Breiten- und Längengrad gelegt werden und wäre doch immer die Begegnung, die sie zu Beginn war. Tatsächlich wird durch den Lauf der Erde, des Sonnensystems, der Galaxie und des Universums (falls das definiert werden kann) jeder Ort – jedes Zusammentreffen von Materie – zu einer Art kosmischem, schwebendem Würfelspiel: Der geografische Ort ist in seiner tiefsten Bedeutung zufällig. Was wirklich zählt, ist nicht, wo wir sind, sondern wer – welches reale Wesen – mit uns dort ist. In diesem Sinne ist der Himmel, wo wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen werden, vielleicht der ortloseste aller Orte, da er die herrlichste aller Begegnungen ist. Hier auf der Erde sehen wir vielleicht tatsächlich nur durch ein dunkles Glas; wir verwechseln eine der irdischen Hüllen des Ortes mit dem Herzen seiner tiefsten Bedeutung.
Aber zurück zu der Zwiebel selbst. Versuchen Sie nun, sie möglichst so zu betrachten, als hätten Sie noch nie eine Zwiebel gesehen. Versuchen Sie, sozusagen, ihr zu ihren eigenen Bedingungen zu begegnen und ihr nicht die Ihren zu diktieren.
Sie sind natürlich überzeugt, dass Sie wissen, was eine Zwiebel ist. Sie denken vielleicht, dass es sich um ein braun-gelbes Gemüse handelt, das kugelförmig ist und aus mehreren Schichten besteht. All diese Vorurteile sollten Sie aufgeben. Die Zwiebel ist, was sie ist, und Ihre Arbeit hier ist, herauszufinden, was das ist.
Stellen Sie also zunächst fest, dass Ihre Zwiebel zwei Enden hat: ein unteres, das durch den blaugrauen Fleck gekennzeichnet ist, aus dem die Wurzelfäden in die Erde hinabgestiegen sind, und ein oberes, das (sofern Ihre Zwiebeln nicht längst dahingeschieden sind oder zu keimen begonnen haben, weil Sie sie unter der undichten Spüle aufbewahrt haben) in einer verwelkten Spitze aus Zwiebelpapier endet. Merken Sie sich noch einmal, was Sie entdeckt haben: Eine Zwiebel ist keine in sich ruhende Kugel. Sie ist ein lineares Ding, ein Blütenkelch aus Vektoren, die von der Basis zur Spitze nach oben drängen.
Stellen Sie nun Ihre Zwiebel mit der Wurzel nach unten auf das Brett und betrachten Sie sie als das Paradigma des Lebens, das sie ist – ein Mitglied der riesigen, lebenden, der Schwerkraft trotzenden Truppe, die sich in Licht und Luft über das Antlitz der Erde bewegt, solange die Welt besteht.
Erst jetzt haben Sie die nötige Perspektive, um die Zwiebel selbst anzurühren. Beginnen Sie mit der äußersten papiernen Schicht, der Zwiebelschale. Seien Sie vorsichtig. Im Alltagsgeschäft des Kochens wird die äußere Schale einer gesunden Zwiebel entfernt, indem die unmittelbar darunterliegenden Fleischschichten mit abgeschält werden. Das ist eine legitime Form der Abkürzung; ein Koch kann sich die Zeit nicht nehmen, die es braucht, um nur das Papier abzulösen. Jetzt gerade kommt es aber nicht auf die Zeit an, sondern auf die Zwiebel. Arbeiten Sie also behutsam und heben Sie die Schale mit der Messerspitze an, um das darunter liegende Fleisch nicht zu verletzen. Das ist schwieriger, als Sie vielleicht gedacht haben. Alte Zwiebelschalen lösen sich leicht ab, aber frische können hartnäckig sein.
Sehen Sie sich jetzt die abgezogene Schicht vor Ihnen an. Sie ist trocken. Sie ist, alles in allem, eines der trockensten Dinge auf der Welt. Nicht staubtrocken wie Kartoffeln, sondern glatt-und-dünn-trocken, was nicht auf eine zufällige Austrocknung hindeutet, nicht auf ein Verwelken aufgrund des Alters oder äußerer Umstände, sondern auf eine frische und wesentliche Trockenheit. Trockenheit als Errungenschaft, nicht als Versagen. Elegante Trockenheit. Gewollte Trockenheit. Mehr als das, Zwiebelpapier ist, wie die Zwiebel selbst, gerichtet, vektorisiert, gerippt. (Seltsamerweise spaltet es sich genauso leicht quer zu seinen Rillen wie mit ihnen. Seine Maserung ist durch die Trockenheit auf eine rein optische Qualität reduziert worden.) Das Beste von allem ist jedoch, dass es zwei Farben hat: außen ein bräunliches Gelb ohne besonderen Glanz, aber innen ein weiches, poliertes Kupfergold, gezeichnet – besonders am oberen Ende – mit einer Feinheit, die außen nur angedeutet wird.
Wenn Sie das ganze Papier entfernt haben, drehen Sie die Fragmente auf dem Brett um. Sie sind eine elegante Gesellschaft. Denn mit ihrer unaufdringlichen Zurschaustellung von Reichtum führen sie Sie zu einem der ältesten und geheimsten Dinge der Welt: dem Anblick von etwas, was außer Ihnen noch nie jemand gesehen hat. Dieses schimmernde Gold und der edel mattierte Glanz der gelblich-weißen Zwiebel, die jetzt entblößt vor Ihnen liegt, sind jungfräuliches Land. Wie die perfekte Passform von Zwillingsmandeln in ihrer Schale präsentieren sie sich Ihnen wie die Tiere einst Adam: namenlos, bis sie gesehen werden vom Menschen; bis sie erkannt und in die Stätte unseres Seins hineingetauft werden. Sie kommen als Stellvertreter alles Verborgenen der Welt zu uns, all der stillen Abläufe, die unendlich tief in den Dingen wirken. Und sie kommen zu Ihnen – zu Ihnen als ihrem Priester und ihrer Stimme, um dem Erstaunen Ihres Herzens über ihre große Herrlichkeit geopfert zu werden.
Erst jetzt sind Sie bereit für den ersten Schnitt. Halten Sie die Zwiebel senkrecht, schneiden Sie sie sauber entlang der Mittellinie in zwei Hälften und sehen Sie sich an, was Sie getan haben. Sie haben die Schleusen des Seins geöffnet. Sofort wird Ihre Vorstellung von der Kugel innerhalb der Kugel ausgelöscht. Strukturell ist die Zwiebel keine Kugel, sondern ein ineinander verschachtelter Satz von Fingern in Fingern, und jeder stößt von der Basis aus durch die Mitte des vorhergehenden nach oben. Die äußeren Schichten sind in der Tat durch den Druck der inneren zur Kreisform angeschwollen, aber eigentlich ähneln sie der Form von Flammen.
Als Nächstes die Farben. Der Querschnitt jeder einzelnen Flamme folgt einer Regel: An ihrem inneren Rand ist sie weiß, an ihrem äußeren pigmentiert; die Farbe variiert vom blassesten Grüngelb in den mittleren Flammen bis zu den gewohnten Zwiebeltönen, je weiter man nach außen geht. Die Flammen im Zentrum sind offen und verblüffend grün; sie sind es, die schließlich nach oben ins Licht drängen werden. Das ist das Farbenspektrum der Zwiebel: von Grün über Weiß zurück zu Grün, und alles endet in der braunen Haut, die Sie abgeschält haben. Das Leben im Inneren des Todes. Die Kräfte des Seins, die die Wände der Leere stürmen. Frische im Angesicht der brennenden, oxidierenden Welt, die alles Leben letzten Endes zu der Farbe von geschnittenen Äpfeln und altem Sherry verblassen lässt.
Nächster Punkt: Druck. Sehen Sie sich die Schnittfläche an: Feuchtigkeit. Die tatsächliche, unglaubliche Nässe der Zwiebel können Sie natürlich noch nicht erkennen: Dies ist nur das erste angedeutete Auspressen des Saftes. Aber das Meer in allem Lebendigen hat sich angedeutet. Sie haben kein unbelebtes Ding aufgeschnitten, sondern ein lebendiges Wesen – ein Ganzes, das, wie alles Leben, kleiner und einfacher ist als seine Teile; das, wie alles Leben, die Einzelteile seines Seins komprimiert in sich trägt.
Versuchen Sie zum Beweis, die beiden Zwiebelhälften wieder aneinanderzupassen. Das ist nicht möglich. Die Innenseiten – zwei ebene Flächen, die von einer geraden Klinge getrennt wurden –, sind nun konvex nach außen gebogen und schaukeln gegeneinander. Drückt man sie auf einer Seite zusammen, zeigt die gegenüberliegende Seite eine Lücke von mehr als zwei Minuten auf dem Zifferblatt einer Uhr.
Wieder Druck. Aber jetzt Druck zu Ihnen hin. Der Geruch nach Zwiebel, freigesetzt durch den Fluss der Säfte. Das ist natürlich keine neue Entdeckung – jeder Depp kennt diesen Anteil der Zwiebel. Aber halten Sie trotzdem inne. Denken Sie daran, wie wenig eine heile Zwiebel riecht, wie wundersam der edle Geruch bis jetzt von der ihn umgebenden Trockenheit zurückgehalten wurde. Bedenken Sie auch, dass es die Säfte und Soßen des Seins sind, die der Welt Geschmack geben, dass alles Leben aus dem Meer kam, und dass ohne Wasser nichts eine Seele in sich haben kann. Denken Sie schließlich daran, was für eine Seele die Zwiebel haben muss, wenn sie mit solchen Säften aufwarten kann.
Ihre Augen werden noch nicht zu tränen begonnen haben, und die Schleimhäute Ihrer Nase werden noch nicht reagiert haben. Die Zwiebel hat Ihnen bisher nur zugeflüstert. Dennoch ist keine Silbe missverständlich gewesen. Wie werden Sie Ihre Sinne im Zaum halten können, wenn sich das Flüstern zu einem lauten Ruf erhebt?
Nun also liegen die beiden Zwiebelhälften mit der Schnittfläche nach oben vor Ihnen. Entfernen Sie mit der Spitze Ihres Schälmessers vorsichtig die Basis oder den Boden (oder das Herz), ähnlich wie Sie es tun würden, wenn Sie die Blätter einer Artischocke oder eines Salatkopfes befreien wollten. Nehmen Sie nur so viel weg, dass Sie die verschiedenen Schichten einzeln herausheben können. Heben Sie sie dann vorsichtig von der Mitte nach außen heraus. Ordnen Sie sie in einer Reihe an, wobei Sie passende Teile aus den einzelnen Hälften nebeneinanderlegen und paarweise von den kleinsten grünen Fingern über weiße Flammen bis zu den äußeren Schalen aufsteigen lassen, die wie russische Kirchtürme aussehen.
Und dann schauen Sie. Der Mythos von der Kugelgestalt der Zwiebel ist endgültig widerlegt. Die Zwiebel, wie jetzt sichtbar wird, besteht aus feurigen Zungen. Nehmen Sie eine solche Flamme in die Hand; fühlen Sie ihre Leichtigkeit und Starrheit, ihre Knackigkeit und Kraft. Befühlen Sie ihre Membranen. Die innere: dünn, durchscheinend, leicht zu entfernen; die äußere noch dünner, fast durchsichtig – und so fest mit dem Fleisch verbunden, dass sie sich hörbar gegen eine Trennung sträubt.
Die Membranen geben der Zwiebel ihr Feuer, ihren Glanz. Aber wenn sie entfernt werden, wird das Fleisch in einem neuen Licht offenbart. Wenn man es eine Minute trocknen lässt, erhält es eine blasse, kristalline Glattheit wie nichts sonst auf der Welt. Eierschale ist das einzige Wort dafür; aber im Vergleich zu dem bloßgelegten Fleisch einer Zwiebel ist eine Eierschale so „zart“ wie gegossener Beton.





























