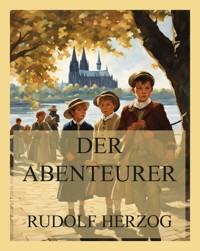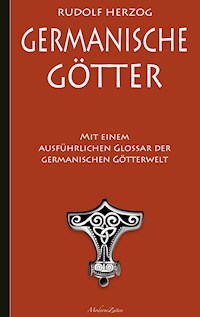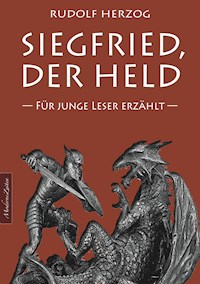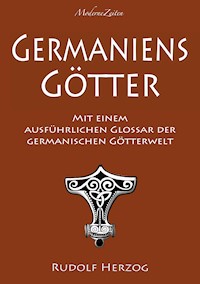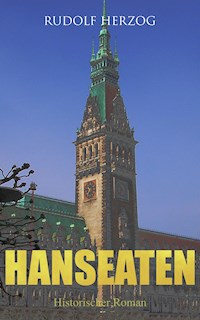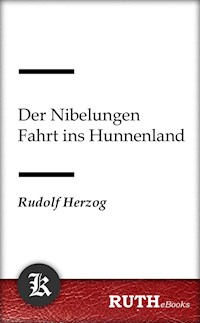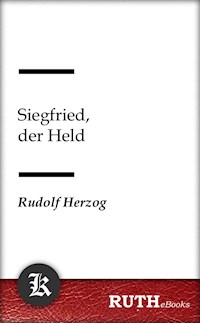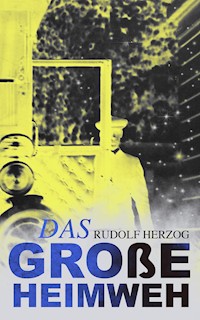
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Das große Heimweh" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Rudolf Herzog (1869-1943) war ein deutscher Schriftsteller, Journalist, Dichter und Erzähler. Herzog war zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein Bestseller-Autor, die meisten seiner Bücher erreichten Auflagen von mehreren Hunderttausend. Im September 1911 unternahm er eine Amerikareise zur Germanistic Society of America, auf welcher er das Ehrenband der Columbia University of New York verliehen bekam. Die Eindrücke dieser Reise verarbeitete er in seinem 1915 erschienenen Buch "Das große Heimweh", in dem er am Beispiel der deutschstämmigen Amerikaner dazu aufrief, sich der Pionierrolle des Deutschtums auf der ganzen Welt bewusst zu sein. Aus dem Buch: "Indianischer Sommer ... Die Luft angefüllt von der Wärme vergangener Sonnentage, geklärt und gemildert durch das wachsende Alter des Jahres. Die Wälder aufflammend wie Opferfeuer, die sich im Prunk ihrer purpurnsten, golddurchschossenen Farben in Selbstberauschung zu verbluten trachteten, bevor der Winterschnee sie erstickte. Die ganze Natur, das große Sterben vor Augen, nahm noch einmal alle ihre Kräfte zusammen zu einem leuchtenden Lebenslied, das den Tod nicht achtet im stärkeren Auferstehungsgedanken. Und das Lebenslied im pennsylvanischen Bergwald jauchzte in Wogen, die die Farbenskala des Goldes durchjagten, vom lichtesten Gelb zum blutigsten Rot, von den hellen Tönen der Zitterbirken und Blauweiden hinübergreifend zum gesteigerten Farbenrausch der Ahorne und Linden, der Ulmen, Platanen und Walnußbäume und im Triumph verharrend im Flammenmeer der Purpureichen. Wie Fahnenträger des urewigen Glaubens der Natur ragten über den Brand hinaus die sattgrünen Wipfel der Weymouthskiefer, der Hemlocktanne und Douglasfichte, die nach dem stillen, blauen Himmel langten."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 589
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das große Heimweh
Inhaltsverzeichnis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
Inhaltsverzeichnis
Indianischer Sommer ...
Die Luft angefüllt von der Wärme vergangener Sonnentage, geklärt und gemildert durch das wachsende Alter des Jahres. Die Wälder aufflammend wie Opferfeuer, die sich im Prunk ihrer purpurnsten, golddurchschossenen Farben in Selbstberauschung zu verbluten trachteten, bevor der Winterschnee sie erstickte.
Die ganze Natur, das große Sterben vor Augen, nahm noch einmal alle ihre Kräfte zusammen zu einem leuchtenden Lebenslied, das den Tod nicht achtet im stärkeren Auferstehungsgedanken. Und das Lebenslied im pennsylvanischen Bergwald jauchzte in Wogen, die die Farbenskala des Goldes durchjagten, vom lichtesten Gelb zum blutigsten Rot, von den hellen Tönen der Zitterbirken und Blauweiden hinübergreifend zum gesteigerten Farbenrausch der Ahorne und Linden, der Ulmen, Platanen und Walnußbäume und im Triumph verharrend im Flammenmeer der Purpureichen. Wie Fahnenträger des urewigen Glaubens der Natur ragten über den Brand hinaus die sattgrünen Wipfel der Weymouthskiefer, der Hemlocktanne und Douglasfichte, die nach dem stillen, blauen Himmel langten.
Zwei Reiter sprengten den federnden Moospfad hinan, zügelten hastig ihre Pferde und verhielten sie an einer Wegbiegung, die jäh den Ausblick öffnete in die schwermütige Pracht.
»Herrgott – – das nenn' ich als Sieger sterben ...«
»Indianersommer,« sagte der andere und nickte.
»Indianersommer ...« wiederholte der erste in Gedanken. »Da schafft sich ein aussterbendes Volk seinen eigenen Sommer. Oder man schafft ihn ihm. Das ist ja gleich. Kirmestage für die Enterbten. Es steckt eine bittere Ironie in diesem Kosewort für den amerikanischen Herbst.«
»Mein Junge, hierzulande nimmt man nichts tragisch. Und wenn die Axt den letzten Wald gefressen hat – du wirst dich wundern, wie bald bei unserer elenden Forstwirtschaft – gibt's auch keinen indianischen Sommer mehr. Über poetische Empfindsamkeiten geht's hier mit Eilzugsgeschwindigkeit in den einzigen, alles umklammernden und alle verblendenden Begriff hinein, und der heißt: Amerika.«
Ernst Wegherr wandte sich im Sattel mit einem Lachen nach dem Freunde:
»Ist das ein Dogma? Amerika?«
»Wer nicht daran glaubt, spürt's bis in die Magenhöhle,« erwiderte Georg Wuppermann und zündete sich gemächlich eine Zigarre an. »Vergiß nicht, daß ich seit fünfundzwanzig Jahren im Lande bin. Unglaube gegen das Dogma Amerika wird hier nicht mit Seelenstrafen, sondern mit ganz verdammtem Magenknurren geahndet. Das hilft überraschend.«
»Du, Georg –?« Ernst Wegherr schaute in das blutende Waldland.
»Sprich dich nur aus. Es wird schon was Vernünftiges sein.«
»Es wäre schade, Georg, wenn der indianische Sommer verschwände. Wenn er verschwände, weil nun der ›deutsche Sommer‹ an die Reihe käme, in derselben schwermütigen Bedeutung des Wortes. Du begreifst, da spricht der Geschichtsforscher aus mir.«
Wuppermann antwortete nicht sofort. Er blickte den Rauchringen nach, die er über den Kopf seines Pferdes hinweg in die blaue, schweigende Herbstluft hinaussandte. Und in der stillen Weile betrachtete Wegherr den alten Freund und Spielgefährten aus der nämlichen Gasse der rheinischen Heimatstadt, die kernfeste Gestalt, den runden, wetterharten Schädel, das offene, zielsichere Auge. Der kleine, stramme Georg des Schmiedes Wuppermann hatte sich in Amerika seinen Weg gebahnt.
Der Raucher ließ die Zigarre sinken und reichte vom Sattel her dem Freunde die Hand.
»Du verstehst in den Seelen zu lesen, Ernst. Das hast du schon als Junge so famos gekonnt, wenn minderwertige Bengels von den Nachbarstraßen sich in unseren Kreis drängten. Und ich weiß, was du meinst. Da spricht eben nicht nur der Geschichtsforscher aus dir, der die Völkerseele studierte, wo er nur konnte, sondern auch, – na ja – der überzeugte Teutone.«
»Der überzeugte Teutone, Georg.«
»Hm,« machte der und gab nach kräftigem Druck die Hand Wegherrs frei. »Hab' keine Angst. Wir sind ja auch noch auf der Welt.«
»Noch!«
»Zum Teufel, ja. Das ist ein Hexenkessel hier. Wirst noch dahinterkommen. Von der anderen Seite des großen Wassers sieht sich die Sache bequemlicher an. Aber mit der patriotischen Regeldetri, wie die Herren bei euch so gerne meinen, ist hier nichts zu machen. Altes Eisen. Hier braucht man schärfere Waffen.«
Ernst Wegherr reckte seine schlanke Gestalt. Er nahm den Hut herunter und strich aus der breiten Stirn, die sich über den Augenbrauen in zwei Hügeln wölbte, das noch volle blonde Haar zurück.
»Hältst du mich für ein Kind, das herübergekommen ist, um mit dir ›Deutschland, Deutschland über alles‹ zu singen? Dann hättet ihr ja hübsch daheim bleiben können. Auf die geistige Überlegenheit der Rasse kommt es an. Die schafft das Vaterland. Hüben wie drüben.«
Wuppermann lachte in fröhlichem Baß.
»Kultur ist hierzulande noch ein Fremdwort, an dem sie sich die Zungen zerbrechen. Mit Dollars läßt sich da vorderhand alles noch leichter machen. Wir sprechen noch darüber. Heute freut mich nichts, als daß du auch mal zu uns herübergekommen bist. Die anderen Erdteile hattest du wohl durch? Du glaubst ja nicht, wie vergnügt ich war, als du mir deine Ankunft in Neuyork meldetest. Seit fünfundzwanzig Jahren bin ich noch keinen Tag so vergnügt gewesen, mit Ausnahme meiner Hochzeit.«
»Davon mußt du mir erzählen.«
»Von der Hochzeit? Nee, du, lieber nicht. Das könnte dir Appetit machen.«
»Ich bin geschieden.«
In der Verlegenheit lüftete auch Wuppermann seinen Hut. Hastig fuhr er sich mit der Hand durch das borstige Haar. Und noch einmal.
»Entschuldige. Ich hatte ja keine Ahnung. Nicht mal von deiner Ehe. Und wenn man selber in glücklicher Ehe sitzt, denkt man ja gar nicht daran, daß es auch mal andersherum – Himmel, nun mache ich's noch schlimmer. Wollen wir weiter, Ernst? Laß Schritt gehen. Jetzt kommt eine Stunde steile Steigung. Dann sind wir auf dem Berg und unter einigen zwanzig Deutschen.«
Die Pferde schritten aus. Der Pfad wurde härter und steiniger. Aber zur Linken und Rechten lohte die Fackel des Waldes, triumphierte das flammende Jubellied des Lebens über das bißchen Jahressterben hinweg, neuem Leben entgegen: wir sterben nicht, wir erstehen.
»Ich komme als Heimatsucher,« sagte Ernst Wegherr.
Der Freund nickte.
»So kamen wir alle, Ernst. Der eine so – der andere so.« –
»Ja, ja. So wird es sein. Neues, keimfähiges Land erhofft man, und damit neue Arbeitsfreudigkeit, neue Begeisterungsfähigkeit.«
»Du, Ernst, steht die Herzbachstraße noch auf dem alten Fleck? Gibt's noch Salamander im Straßenbach? Weißt du noch, wie wir uns abends aus dem Hause stahlen und sie fischten? Der eine hielt die Laterne, der andere griff zu. Nachher wuschen wir uns gegenseitig die Schlammkrusten ab. Und dann hieß es, weiter den Abend nutzen. Links die Häuser, dann der Bach und schon die Gemüsegärten der Milchbauern. Und unsere Kaninchen im Stall wollten auch leben.«
»Aber wir verbanden das Nützliche mit dem Angenehmen. Wir nahmen nur die schadhaften Umhüllungsblätter von den Wirsing- und Krautköpfen und erleichterten dem Bauer die Arbeit.«
»Bis er sie uns erleichterte. Weißt du noch, wie der Kerl eines Abends hastdunichtgesehen aus einer Furche sprang? Wir sprangen nicht schlechter. Aber da bliebst du im Zaun stecken, Hinterfront frei für jede Attacke.«
»Jämmerlich bekam ich das Leder voll, und die Kaninchen wurden selbigen Abends vom zürnenden Vater dem zürnenden Bauern verhandelt.«
»Verdammt streng war dein Vater. Der meine lachte vom Fenster aus, daß die Scheiben zitterten: ›Hoho, hoho!‹ Ich hör's noch und saß damals, von meiner eigenen Laterne beschienen, mit der Hose in der Hecke fest. Na ja, mein alter Herr war Schmied, und der deine hatte Bandstühle laufen und fabrizierte und sah als gebildeter Mann im Kirchenrat. Das war damals das Feinste.«
»Er liegt nun schon lange auf dem Friedhof, auf dem wir Schmetterlinge fingen. Oben auf dem Berg. Neben der Mutter.«
»Und der meine hat seine achtzig auf dem Rücken und möcht' mich besuchen.«
»Das trau' ich ihm zu,« meinte Wegherr, und ein Lachen huschte um seinen Mund. »Ich suchte ihn vor meiner Abreise auf, um dir seine persönlichen Grüße mit herüberbringen zu können. ›Donnerwetter›, sagte er, ›die Herzbachstraße hat zwar nur vier Häuser. Aber Kerle sind daraus hervorgegangen, Donnerschlag, für die war ganz Europa zu klein, und jetzt packen sie sich Amerika in die Tasche. Was, Herr Doktor? War doch ein feiner Gedanke von mir, dem Georg die gute Erziehung zu geben samt Gymnasium. Für einen Grobschmied doch ein feiner Gedanke.›«
Sie lachten herzlich, und die Pferde wieherten in den leise dämmernden Abend hinein.
»Aber Salamander gibt's nicht mehr,« fuhr Wegherr fort, »und auch kein billiges Kaninchenfutter. Den Bach hat man unterirdisch gelegt, und die Gemüsegärten haben einer Fabrik Platz gemacht.«
»Schade, schade,« murrte Wuppermann. »Wie find' ich mich da noch zurecht?«
»Die Nachbarmädels aus dem ersten Hause sind Mütter geworden und sorgen, daß ihre Mädels sich nicht mit den Nachbarsjungen küssen. Als ob sie selber nicht ach so gerne mitgetan hätten. Nur von Wilhelm Finkler aus dem vierten Hause weiß ich nichts zu berichten. Der ist verschollen.«
»Verschollen? I wo! Der hat nur die Herzbachstraße vergessen.«
»Weißt du etwas von ihm?«
Wuppermann schmunzelte. »Er muß nicht in Neuyork gewesen sein, als dein Dampfer einlief. Sonst hätte er dich mit dem kaltblütigsten Gesicht bis auf die Knochen interviewt. Das wird ihn ärgern.«
»Was?« rief Wegherr erstaunt. »Er ist hier? Zeitungsmann bei einer deutschen Zeitung? In Deutschland war er hintereinander Theologe, Philologe, Jurist und Buchhändler. Dann verschwand er spurlos.«
»Für Amerika eine ganz gute Vorbereitung,« lachte Wuppermann. »Der Befähigungsnachweis für sämtliche Verwandlungsmöglichkeiten ist also erbracht. Er schreibt für deutsch-amerikanische und anglo-amerikanische Zeitungen, für republikanische und demokratische, wie der Dollar fällt. Er nennt das die Kultur ausbreiten im freundlichen und feindlichen Lager. Aber zum Höchstpreis.«
»Also gänzlich amerikanisiert?«
»So, wie diese Leute das Wort ›amerikanisieren› auffassen: ›Hier bin ich! 'raus mit dem Geld!›«
»Tut mir leid, Georg!«
»Aber der Kerl ist zu beachten. Als Muster für eine ganze Gattung. Kein Heimatsucher, wie du es nennst, Geldsucher. Und damit all right!«
Eine Weile ritten sie schweigend zwischen den beleuchteten Stämmen. Beide von demselben Gedanken befangen. Von dem Gedanken an das alte Daheim, an die Kindheit, die lustigen Gespielen, die kleinen und großen Freuden der Jugendzeit und all das heiße Planen. Und unvermittelt, als ob sie alle diese Erinnerungen laut ausgetauscht hätten, fragte Wegherr in die Stille hinein: »Und du bist glücklich geworden?«
»Ja,« sagte der Mann an seiner Seite. Und er sagte es ruhig und würdevoll.
»Könntest du mir nicht – einen Wink geben, wie man das hier ermöglicht?«
»Du meinst, aus meinen Erlebnissen?« fragte Wuppermann zurück und sog an seiner Zigarre. »Man muß jung in dieses Land kommen, harmlos und vorurteilsfrei. Das ist die erste Vorbedingung. Sonst stolpert man auf Schritt und Tritt. Und meine Erlebnisse? Die waren Arbeit, nichts als Arbeit. Ja, wenn ich dich so neben mir reiten sehe, dich sprechen höre, von allen Kulturerrungenschaften und Schönheiten der Welt, von der schwärmerischen Jugendzeit bis zum Höhenflug des Mannes, von dem ganzen Überschwang einer echten und rechten Seele, die sich an jeder Gottesgabe wie an ihrem Eigentum zu freuen weiß – dann will es mir wahrhaftig für einen Augenblick scheinen, als ob ich doch die beste Strecke danebenher gelaufen wäre mit der ewigen Arbeiterei. Nun, ich war achtzehn Jahre alt, als ich herüberkam, und hatte Gott sei Dank keine Ahnung. Mit fünfzehn Jahren hatte ich das Gymnasium verlassen, war drei Jahre als Lehrling ohne einen Pfennig Vergütung auf einem kaufmännischen Kontor ausgenutzt worden, hatte meinen alten Herrn in der Herzbachstraße das bißchen ersparte Geld gekostet und sollte nun für das glänzende Gehalt von 80 Mark im Monat weiterdienen. Das schien mir wenig aussichtsreich für die Zukunft. Denn selbständig wollte ich werden, das stand fest. Auf mich konnte ich mich verlassen. Ich war kein Dummkopf und hatte mehr in die Fabrikationsmethode hineingerochen, als meine Herren Prinzipale ahnten. Ein Betriebskapital hatte ich also. Fehlte nur das Land, wo es als bar Geld angesehen wurde. Ich dachte darüber nach, und eines Abends erklärte ich meinem alten Herrn, ich ginge nun nach Amerika, um dort so schnell wie möglich selbständiger Fabrikant zu werden. ›Jung,‹ sagte der Alte, ›du hast Gedanken wie ein Fürst.‹ Tags darauf beschlug er den Familienkoffer mit zolldicken Eisenbändern, brachte kunstgerecht ein Sicherheitsschloß an und gab mir dreihundert Mark und seinen Segen, der mehr wert war. Auf dem Bahnhof war er so vergnügt, als hätte ich Amerika schon im Sack. ›Jung,‹ rief er zum Abschied, ›nun zeig du den Indianern mal die Herzbachstraße!‹ und gab mir einen Klaps, daß ich wie eine Bombe in den Wagen flog. Als ich zum Fenster hinausschaute, hatte er sich gedrückt.«
Der Erzähler lächelte. Aber es war ein Schein von Heimweh in dem Lächeln. Und Wegherr bemerkte es wohl.
»Georg,« sagte er, »du hast es gut gehabt. Dein Vater kannte nichts als das felsenfeste Vertrauen auf seinen Jungen.«
»Umgekehrt ist's gerade so, Ernst. Und wir gäben uns gegenseitig nicht für eine Million her, obwohl wir uns nur einmal wieder zu Gesicht gekriegt haben. Das war vor zehn Jahren, als ich daran ging, die Fabriken zu gründen, und in Deutschland technische Studien machte. Gott, der liebe alte Mann.«
»Erzähle weiter!«
»Nun ja, eines Tages stand ich in Neuyork, wie Tausende vor mir und nach mir. Ich lief so lange herum, bis ich auf einem Kontor unterkam. Natürlich war ich auch hier zuerst abgelehnt worden, und die Wut darüber hatte mir einen echt heimatlichen Fluch durch die Zähne gejagt. ›Gottverdimmich!‹ knurrte ich, als ich die Türklinke packte. Da drehte sich ein Herr herum, der lachte übers ganze Gesicht. ›Ech gläuw, dä Käl is us minge Näh zo Hus. Sie da, es dat so?‹ Und ich antwortete prompt in der Mundart der Herzbachstraße: ›Dat sall woll sin, un et sin nit die Dommsten.‹ Daraufhin wurde ich mit zehn Dollars die Woche angestellt.
Jetzt ging das Schuften los. Von morgens bis in die Nacht. Was die Amerikaner im Textilgeschäft konnten und was sie nicht konnten, hatte ich bald heraus. Aber so schlau war ich doch, es ihnen nicht auf die Nase zu binden. Nach Jahr und Tag hatte ich das Doppelte, dann das Drei- und Fünffache des Anfangsgehaltes. Die Leute hatten Lunte gerochen und konnten mich brauchen. Zuerst hatte ich ein fröhlich Leben anfangen wollen, wie man es als junger Mann in Deutschland gewöhnt ist. Aber ich kam sehr bald dahinter, daß auch die Vergnügungen mit Dollars berechnet werden und nicht mit Mark. Der vierfache Preis. Da ließ ich es bleiben; denn jeher ersparte Dollar war auch seine vier Mark wert. Drüben natürlich. Und was ich zur Selbständigmachung brauchte, mußte ich von drüben holen. Ich wünschte nämlich, die deutschen Textilmaschinen eines Tages im Lande selber zu bauen und ein paar neue Modelle drüben zu erstehen.
Fünfzehn Jahre habe ich dies Arbeitsleben zäh ausgehalten. Dann war ich so weit. Ich reiste im Lande herum und suchte mir den geeignetsten Platz für meine Fabrikanlage, der den Vorzug der Billigkeit hatte. Hier in Pennsylvanien fand ich ihn. Dazu Arbeitskräfte durchweg deutscher Abkunft. Die wissen noch, was arbeiten heißt. Dann reiste ich nach Deutschland und hatte das Vergnügen, als Ausländer gewertet zu werden, dem sich bereitwillig die Fabriken zur freundlichen Besichtigung öffnen. Das ist nun mal im alten Vaterlande so. Und ich prüfte alles und behielt das Beste. Als ich hierher zurückkehrte, hatte ich nicht nur ein paar Modelle erstanden, sondern ein Dutzend der zweckmäßigsten Fabrikationsmethoden durch und durch studiert. In einem halben Jahre lief die Fabrik, und um die Kunden, die bis dahin für teures Geld aus Europa eingeführt hatten, von der Leistungsfähigkeit meiner Maschinen zu überzeugen, richtete ich zwei Schuppen ein und ließ meine Maschinchen in dem einen seidene Strümpfe, in dem anderen Bänder und Litzen zur Probe fabrizieren: Eintritt frei!«
Er stieß den Dampf aus den gewölbten Lippen und lachte das tiefe Lachen seines Vaters.
»Ja, so kam's. Ich war Dreiunddreißig darüber geworden, aber an Vergnügungen war nun erst recht nicht zu denken. Ich hatte Maschinen auf Vorrat fabrizieren müssen, um zur Besichtigung ein Lager aufweisen zu können, denn den Amerikanern importiert nur die Masse. Um die Kosten der Verzinsung nicht tragen zu müssen – denn mein Betriebskapital war arg zusammengeschrumpft – kam ich auf den Gedanken, die Maschinen die Zinsen selbst hereinbringen zu lassen. Sie standen ja fix und fertig da und konnten arbeiten. Also begann ich die Schuppen zu erweitern und ließ die Maschinen Seidenstrümpfe und Bänder und Litzen als Verkaufsware fabrizieren, was das Zeug hielt. Ein alter pennsylvanischer Herr hatte mich Wochen hindurch beobachtet. Er hatte wohl auch meine Sorgenfalten gesehen, als die Verfalltage der Wechsel für die Rohmaterialien in beängstigende Nähe rückten. Er war ein Yankee aus der Schule Penns, des Begründers der christlichen Bruderliebe, hatte in der Brust ein Herz und im Kopf eine Rechenmaschine. ›Mister Wuppermann,‹ sprach er mich eines Tages an, ›Sie sind ein nüchterner Mann. Das ist gut. Aber Sie sind zu viel allein. Und das ist nicht gut. Wollen Sie mit in mein Haus zum Dinner kommen?‹ Natürlich wollte ich, und wir gingen die paar Meilen bis zur nächsten Stadt. Dort fand ich Mary, seine Tochter. In einer Häuslichkeit von puritanischer Einfachheit, aber von einer Sauberkeit, die mir in die Augen blitzte wie meine polierten Maschinenteile. Vier Wochen darauf waren wir verlobt. Weitere vier Wochen, und wir waren verheiratet. Aber gar nicht puritanisch, kann ich dir sagen! Zuerst kam ein Zwillingspärchen. ›Schön wie die Engel,‹ meinte meine Mary, ›und dem Papa wie aus dem Gesicht geschnitten.›« Er schmunzelte. »Zum Dank gab's dann einen Jungen und dann noch ein Mädchen, die beide der Mary gleichen mußten.«
»Und die Maschinen, die seidenen Strümpfe und die Baumwollitzen?« fragte Wegherr heiter.
»O nein,« bemerkte der Erzähler, »die kamen nicht ins Hintertreffen. Der alte Pennsylvanier steckte das Heiratsgut seiner Tochter klug und gedankenvoll in die Fabriken. Da wuchsen aus den Schuppen Fabrikgebäude mit allen Errungenschaften der Neuzeit. Und ein jedes Unternehmen, die Maschinenfabrik, die Strumpfwirkerei und die Bandweberei, wird fein gesondert für sich betrieben, und nur der Gewinn fließt in eine Kasse. In welche, brauch' ich dir kaum noch zu sagen.«
»Du hast dir wirklich eine Heimat geschaffen, Georg,« sagte Ernst Wegherr nach einer Pause.
Und Wuppermann antwortete nach einigem Sinnen: »Ich glaube, mehr meinen Kindern, Ernst. Den Kindern und der Frau. Ich selber trage immer noch ein wenig Erde von der Herzbachstraße an den Stiefeln. Du verstehst. In Deutschland lebt sich eine Jugend und ein Leben doch wohl schöner, trotz der Arbeit. Und ich bin jetzt Dreiundvierzig. Aber es geht auch so, etwas lederner, aber es geht. Was hast du?«
Ernst Wegherr wies in die sinkende Sonne. Die stand wie ein Ordensstern am tiefen Himmel und sandte ihre Strahlen in alle Fernen. Und die Strahlen liefen zusammen in einen rotgelb leuchtenden Feuerkreis im ockergelben Himmel. Der Herbstwald aber, vom indianischen Sommer in Gold und Blut gefärbt, hob sich weit, weit ringsum wie eine einzige dankende Altarflamme zur scheidenden Sonne empor. Und der Feuerkreis ging in ein stürmisches Rosa über und in ein tief beruhigendes Violett. Die Luft stand still, von Leuchtkraft geschwängert. Ein grüner Schleier wehte über den Himmel hinweg, als wollte er die Hoffnung der Menschen heben und halten über die Nacht hinaus.
Die Sonne war untergegangen.
»Ah,« sagte Ernst Wegherr und schloß die Augen, um das Bild zu bewahren.
»Träumer,« rief ihn der Gefährte an, »wovon träumst du? Wir müssen weiter!«
»Als ich herüberfuhr,« sagte Ernst Wegherr, während die Pferde schnaufend aufwärts klommen, »sah ich an der englischen Küste einen Sonnenuntergang. Blutrot wiegte sich der Sonnenball, riesengroß, auf der Wasserlinie. Ein Segler zog vorüber. Tiefschwarz stand das weiße Segel gegen das Rot. Wie ein Totenschiff schien's. Und ich warf ihm alle meine schweren Gedanken zu wie totes Gut. Die Sonne schoß ins Wasser, und das Schiff war im Dunkel untergetaucht.«
»Gut, daß du auf dem anderen Schiffe fuhrst, Ernst, und das überflüssige Gepäck los warst.«
Wuppermann wußte nicht weiter. Der lebensfrohe Freund hatte Schweres erlebt. Aber der Mann der Arbeit vermochte nicht die Worte zu stellen zum Befragen der Seele, und so würgte er an einem Satz.
»Ich hoffe, du hast eine gute Reise gehabt, Ernst.«
»Sie konnte nicht besser für mich sein. Sturm durch den ganzen Atlantik hindurch. Das machte den Schädel frisch, sag' ich dir. Die Mehrzahl der Passagiere kam überhaupt nicht mehr an Deck. Da gehörte das Schiff und die See und der weite Himmel mir ganz allein. Nur eine kleine Stuttgarterin wagte sich aufs Promenadendeck und kämpfte sich mit vorgebeugtem Oberkörper stundenlang durch den Sturm, als gälte es, Land zu erreichen. Aber das Land, das uns mehr und mehr entglitt. Eine reiche amerikanische Kusine hatte sie mitgenommen aus dem Schwabenländle und den tausend Mädchenfreuden heraus und ihr ein goldenes Leben in Neuyork versprochen. Aber schon an Bord änderte sich die Sache, und über Nacht war das feine schwäbische Mädchenblümchen zur Pflegerin und Kammerfrau einer launenhaften Lady herabgedrückt. Nun lief sie mit weitaufgerissenen Augen durch den Sturm und suchte das Verlorene.«
»Armes Ding,« brummte Wuppermann.
»Noch ein Menschlein trieb sich in dem Unwetter umher,« fuhr Wegherr fort. »Ein kleiner, vierzehnjähriger Schiffsjunge. In Cuxhaven war seine Mutter an Bord gekommen, um ihren Jung' unter Tränen noch einmal in die Arme zu nehmen. Der aber riß sich los und warf sich mächtig in die Brust. Jetzt kroch er mutterseelenallein auf Deck herum und putzte die kupferne Laufstange an der Reling, wusch das an Deck geschlagene Wasser wieder herunter und fror in seinem dünnen Anzug, daß ihm die Zähne klapperten. Mit jedem Tag wurde es toller mit dem Sturm. Die groben Seen fegten über Bord in wildem Gischt. Einer Arena voll von Schimmelgespannen glich das Meer. Wo sie vorübergejagt waren, kreisten sekundenlang grünkristallene Flächen hinter ihnen drein. Da dachte ich an die Sage von den kristallenen Schlössern der Meerfrauen und ob sie im ersten Menschenhirn wohl so ihren Ursprung genommen hätte. Aber der kleine Schiffsjunge dachte ganz sicher nicht daran. Der fror und fror mit den ängstlichen Augen eines verlaufenen Hundes und wurde immer weniger. Dort drüben wogte ein Wellenkranz wie ein Reigen ausgelassener Nixen. Dort türmte und senkte sich ein ungeheurer Wasserberg wie eine gewaltig atmende Frauenbrust. Bilder, die uns alle Kleinheit wegreißen und an das Große gewöhnen. Fest stand eine schwarze Wolkenwand. Eine andere schob und zerrte sich daran vorüber. Nun hob sie sich ein wenig, und ein schwefelgelber Streifen lag über der stehenden Wolkenbank, wurde goldverklärt, wurde silberumsäumt und purpurdurchwirkt, und über den hastig entrollten Farbenteppich ging mitten im Sturm zwischen den beiden Wolkenbänken ruhig und gelassen die Sonne zu Bett. Überirdisch, ein Riese hinter einem zerrissenen Bettvorhang.«
»Donnerwetter« ... murmelte der Zuhörer. »Du hast Augen.«
»Auch die kleine Stuttgarterin hatte Augen. Ich sah es ihr an, daß sie alle ihre Sorgen und Besorgnisse vergessen hatte vor diesem kühnen Spiel der Natur. Nur der schmalgewordene Schiffsjunge kauerte totenblaß auf einem Haufen Schiffstaue und hatte blaue Lippen. Er tat recht, sich zu grauen. Und nie vergeß ich diese Nacht und die folgende. Pfeifend und heulend sauste der Sturm dem Schiff in die Flanke und legte es auf die Seite, daß in den Kabinen Tische, Stühle und Koffer krachend durcheinanderflogen. An Schlaf war nicht zu denken. Und der Tag wurde nur schlimmer. Gegen Abend tobt ein Orkan. Alle Satane heulen in der Luft. Eine Woge schlägt das Haus von der Kommandobrücke, eine andere reißt einen Haufen Matrosen zu Boden, eine dritte haut das Rettungsboot herunter, und es muß von Freiwilligen geborgen werden. Währenddem spielt die Musik im Gesellschaftsraum die ›Washington Post›, und ein Dutzend Snobs von Amerikanern und Amerikanerinnen wiegen sich in großer Toilette im Tanz. Und sie tanzten noch, als der Spuk der Nacht die Spitze erreichte und auf Achterdeck sechs Matrosen bei Lichterschein einen Schlafsack schleppten, um den die schwarzweißrote Flagge geschlungen war. Der kleine Schiffsjunge fror nicht mehr. Er war in der Nacht zuvor an heftiger Lungenentzündung eingegangen und lag nun warm im Schlafsack eingenäht. Der Kapitän, die dienstfreien Offiziere und der Arzt bildeten das Geleite. Ich schließe mich an. Das Schiff dreht auf Kommando bei und reitet atemschöpfend auf den Wogenkämmen. Der Kapitän spricht ein Vaterunser. Die Matrosen erklettern im brüllenden Sturm die Reling. Ein Bleigewicht an den Sack. Der Junge verschwindet im Wassergrab. Irgendwo in der Ferne schluchzt eine Mutter auf und weiß nicht weshalb ...
Ich fragte den Ersten Offizier, was für ein Tag heute ist. ›Merken Sie das nicht?‹ fragte er grimmig zurück. ›Sonntag! Der liebe Gott ist an Land, in die Kirche, deshalb ist der Deubel auf See!‹ – –«
»Menschenskind,« seufzte Georg Wuppermann tief auf, »was war das für eine Fahrt!« Und nach einer Pause: »Da wird dir wohl die Lust an Amerika mächtig vergangen sein!« –
Die letzte Bergkuppe lag vor ihnen. Schon gewahrten sie ein ruhig blinkendes Licht. Und über den Waldwipfeln hob sich still und klärend der Mond.
»Es ist dieselbe Sonne und derselbe Mond hüben wie drüben,« sagte Ernst Wegherr. »Was will da das Land besagen? Wer nichts zu verlieren hat, hat nur noch zu gewinnen. Und dennoch, der erste Blick auf die neue Welt war überwältigend.«
»Ah – also auch du – das freut mich wahrhaftig.«
»Ja, Georg, auch ich. Wie wohl jeder. Und nun denke dir den phantastischen Szenenwechsel. Eben noch stürmen die empörten Wellen hervor, und plötzlich, wie auf Befehl, kriechen sie winselnd zu Kreuze. Die See wird ruhiger. Der Himmel ist von wildgeformten Wolken bedeckt. Und jäh kommt der Mond. Alle Wolken durchleuchtet er, besiegt sie, frißt sie einzeln auf. Und in dem gleißenden Mondlicht erscheint, wie auf der Bühne das Ballett, am Himmel ein Tanz von Sternen.
Wir fahren durch die Nacht, und ich stehe vorn am Bugspriet und spähe, spähe immerfort in das Dunkel der Ferne. Da springt ein Licht auf, ein zweites, ein drittes, eine ganze Girlande jetzt, die unbeweglich in der Luft hängt. Die Lichter sind Amerika.
Und dann der Morgen. Die Nähe in zitternder Sonne, die Ferne noch geheimnisvoll verhüllt von zarten Nebelschleiern. Und nun – mir war, als hätte der Herrgott leise das Kommando: Vorhang hoch! abgegeben – löst sich aus den Nebelschleiern, einer Fata Morgana gleich, ein Ungeheueres in der Ferne, eine ragende Märchenburg, erst in den Umrissen zu erkennen. Der Block der Wolkenkratzer der unteren Stadt Neuyork. Dahinter, kühn geschwungen, die Brücken Brooklyns. Ein Gemälde, daß mir der Atem stockt.
Wir fahren ein. An dem prunkenden Freiheitsstandbild vorbei in den Hudson hinein. Die Märchenburg löst sich auf in Riesengebäude, die sich wie Türme und Kirchen gen Himmel dehnen. Dazwischen das Gewimmel der Häuser. Die Kais liegen vollgepackt von hochbordigen Ozeandampfern. Die Ferryboote, angefüllt von Arbeitermengen und Geschäftsleuten, schießen kreuz und quer über die Wasserfläche. Unsere Musikanten spielen wie toll. Wir drehen bei, landen in Hoboken. Ich gehe an Land und bin in einem Ameisenhaufen. Amerika!«
Georg Wuppermann lauschte, Spannung im Gesicht, der Schilderung. Und lauschte noch hinter ihr drein, als der andere längst geendet hatte.
»Zweimal,« sagte er dann endlich, »habe ich das Bild nun selber gesehen. Aber jetzt sah ich es erst richtig. Gib schnell noch mal deine Hand, die Sangesbrüder nahen. Gottverdimmich, wie ich mich freu', daß du herübergekommen bist. Willkommen in Amerika!«
Und wie auf ein Stichwort erklang es aus dem Gebüsch der Plattform, die die Pferde schnaubend erklommen hatten, im Männerchor:
»Willkommen hier, vielliebe Brüder, Seid uns mit Herz und Hand gegrüßt! Und wie der Klang geteilter Lieder In einen Klang zusammenfließt, Soll auch die Freundschaft uns umschlingen Mit ihrem jugendlichen Kranz. Auf, laßt die Becher lustig klingen: Dem Wohl des deutschen Vaterlands!«
Ernst Wegherr horchte auf. Was war das? Das erste Lied auf amerikanischem Boden sang das Lob – des deutschen Vaterlandes?
Er kam nicht weiter in seinen Gedanken. Ein Dutzend Hände hoben ihn aus dem Sattel, ein mächtiges Schulternpaar beugte sich vor ihm, nahm ihn entgegen und ließ ihn von seinem Thronsitz über die durcheinander rufenden Menschen ragen. Eine Stimme löste sich los. »Gentlemen: Unser Landsmann Doktor Ernst Wegherr – hipp – hipp – hurra! Hurra! Hurra!« Und unter Indianergetöse ging es in die Halle.
»Hallo, Ernst!«
Eine Hand klopfte auf Wegherrs Schulter. Da stand ein Mann vor ihm, Studentennarben auf Wange und Stirn, das Einglas im Auge.
»Finkler! Also doch nicht verschollen.«
»Auf diesem kleinen Planeten? Was da verloren geht, findet sich alles in Amerika wieder. Hier trifft man sich heute in Neuyork, morgen in Neuorleans, als gäbe man sich in Berlin heute am Potsdamer Platz, morgen am Alexanderplatz ein Stelldichein. Freut mich, dich zu sehen, Doktor!«
2
Inhaltsverzeichnis
Sie saßen in der Halle, aus deren hohen, vorhanglosen Fenstern der Blick über das weite, mondbeschienene Bergland schweifte, über das weiß schimmernde Gewoge von Tälern und Höhen. Als ob sie aus einem Adlerhorst lugten in die majestätische Einsamkeit.
Der Stimmaufwand, mit dem die Einführung Wegherrs begleitet worden war, hatte sich in ein lustig durcheinanderschwirrendes Geplauder gelöst. Zu beiden Seiten der langen Tafel saßen sich die Männer gegenüber, und die Tafel war geschmückt mit bunten Herbstblumen und zahllosen Fähnchen, die das Schwarzweißrot der alten Heimat zeigten und die Streifen und Sterne der neuen. Offenen Auges überschaute Wegherr die Versammlung und suchte in den Mienen der einzelnen zu lesen, was bedeutsam war.
Wuppermann saß ihm zur Linken. Er folgte aufmerksam den Blicken des Freundes und gab, während Wirt und Aufwärter die schweren Schüsseln herumreichten und die braunen Rheinweinflaschen auf die Tischplatte setzten, Erklärungen und Beschreibungen.
»Es ist eine alte Sitte,« sagte er, »daß wir uns hier versammeln. Jedesmal am Monatsende. Sozusagen, um uns für den kommenden Monat wieder das Rückgrat zu steifen. Das tat damals, als wir den Kreis gründeten, noch ganz besonders not. Wir waren ungefähr in denselben Jahren in Neuyork an Land gespien worden, Leute von mehr oder weniger Bildung, mit schwererem oder leichterem Herzen, aber alle in einem sich gleich: keinen Dollar in der Hosentasche, verdeubelt knurrende Mägen und den einzigen Wunsch: Durch! Der eine lernte den anderen kennen, ließ sich trösten oder anpumpen, und daraus wurde so eine Art Gemeinschaft. Es ist merkwürdig, wie die Menschen der bedrängten Lagen eine Witterung füreinander haben.«
»Und der Herr dort mit dem glattrasierten, kräftigen Gesicht und den leuchtenden Augen?« fragte Wegherr. »Gehört er auch eurer Brüderschaft an?«
Wuppermann blickte hinüber. »Ich sagte ja schon, du hast noch deinen scharfen Blick. Das ist Frank Willart, den du meinst. In Amerika geboren, aber von deutschen Eltern. Eine Sehenswürdigkeit, wenn du willst. Denn ob er auch als Amerikaner geboren ist und als echter vollwichtig gilt, glaubt er so stark an die Sendung des Deutschtums, wie du es unter den Eingewanderten wenig und in der nächsten Geschlechtsfolge überhaupt nicht mehr findest.«
»Ein fesselnder Kopf. Was will der Mann bei euch?«
»Er kommt schon seit Jahren. Ziemlich regelmäßig. Das Bild wechselt hier nämlich oft und bringt immer neue Gesichter aufs Tapet. Die alten Gründer sind längst über alle Staaten verstreut, finden sich aber immer ein, wenn sie zufällig in der Nähe sind. ›In der Nähe‹ nennt man in Amerika so einige hundert Meilen. Dazu kommen die Neuankömmlinge, die an den einen oder anderen von uns empfohlen sind. Zuerst war es uns heiliger Ernst mit dem Monatsabend. Zusammenhalt und Kräftigung des Deutschtums stand auf unserer Fahne. Na, und dann ging's, wie es immer geht, wenn ein paar Dutzend Deutsche sich zusammenfinden zu löblichem Tun: es wurde ein prachtvoller Kommers daraus.«
Wegherr lachte. »Und deshalb steigt auch Herr Willart auf den Berg?«
Wuppermann legte ihm beschwichtigend die Hand aufs Knie. »Er sieht herüber. Er trinkt dir zu. So ist's recht. Mr. Willart ist jemand, von dem man in der Geschichte dieses Landes noch einmal sprechen wird. Er sammelt einen Bund der Deutschen. Aus höheren Gesichtspunkten und zum Besten Amerikas. Das ist der Grund, weshalb er öfter von Philadelphia herüberkommt.«
»Der Mann gefällt mir,« murmelte Wegherr. »Und der Dicke dort? Neben dem kräftigen jungen?«
»Vater und Sohn Unkelbach. Sie nennen sich ›die letzten Rheinländer›. Erstens, weil sie allein noch weiterkneipen, wenn die sämtlichen Heerscharen um sie herum längst erledigt sind, zweitens, weil sie in guten und bösen Tagen immer gleich fidel bleiben, und drittens, weil Vater und Sohn aneinanderhängen wie Pech und Schwefel. Der Alte kam vor dreißig Jahren ins Land. Weshalb, weiß keiner. Man munkelt, er habe mal einen Freund seiner Frau kurzerhand durch das Fenster geworfen, weil ihm die Haustür für den Kerl zu anständig erschien. Jedenfalls kam er mit nichts anderem als seinem Jungen auf dem Arm vom Schiff heruntergeschritten und hat dann in Amerika so ziemlich alle Arbeiten verrichtet, die einer mit Muskelkraft verrichten kann. Nur für seinen Jung. Und die beiden sind sich wirklich alles: Heimat, Familie, Erinnerung und Hoffnung.«
Ernst Wegherr nickte. Dann nahm er sein Glas und trank dem Alten zu.
»Prosit!« donnerte der herüber. »Scheinen vernünftiger Mensch! Trink mit, Jupp!« Und der Junge schwenkte mit dem Alten zugleich sein Glas.
»Könnt ihr mich nicht auch auffordern, ihr Sackermenters?« schrie ein Hagerer, Sehniger, mit grauem Schnurrbart im ledergegerbten Gesicht, den beiden zu. »Ist das die rheinische Nachbarschaft übers Meer verpflanzt? Jawoll, Nachbarschaft! Wenn ich aus meinen Kleveschen Wäldern herausspuckte, flog's in den Rhein.«
»Aber über die holländische Grenze,« rief der Alte, »und das war Ihr Glück. Trinken wir's herunter, Baron. Prosit! Der Rhein!«
»Das ist eine Figur für sich,« erklärte Wuppermann vergnügt. »Ein Baron von Dachsberg. Woher er stammt, hast du ja gehört. War bodenlos reich und verjuxte so wild sein Geld wie der berühmte Graf von Luxemburg. Mit dem Rest kam er hier an, verjubelte ihn in Neuyork, ging nach Jahresfrist rein abgebrannt nach Virginien als Pferdehüter, von dort mit einigem Ersparten nach Neu-Mexiko und – ist ein großer Pferdezüchter geworden. Eine ganz famose Haut. Und Nummer Eins in seinem Fach.«
Wuppermann sah sich im Kreise um. »Wen nenn' ich dir schnell noch. Der Große dort, früherer preußischer Offizier, nach Amerika abgeschoben und jetzt ein Ingenieur von Ruf. Neben ihm, der mit dem versonnenen Blick, Inhaber einer chemischen Fabrik, vor Jahren Musikdirektor in Sachsen. Sein Nachbar, der Lange, hatte in Württemberg schon seine erste Probepredigt gehalten, mußte jahrelang auf Anstellung warten, ging nach Amerika, verkaufte auf den Straßen Zuckerzeug und fabriziert es nun im großen. Der mit dem Zeuskopf ist ein Professor aus Neuyork, dem in Deutschland das Pedantentum nicht mehr paßte und der hierzuland als Muster eines Schulmeisters wirklich Bedeutendes gewirkt hat. Die anderen Herren kamen meist herüber, um als Kaufleute ihr Glück zu machen oder als Farmer auf billigem Regierungsland schneller zur Selbständigkeit zu gelangen als drüben. Bleibt noch der Aufgeregte übrig, am Tischende. Ein Zeitungsverleger aus einer kleinen pennsylvanischen Stadt, die menschgewordene Empörung, daß sein Käseblatt – nun, meistens für Käse Verwendung findet. Damit könnten wir schließen.«
Wegherr dankte ihm. Doch immer wieder ging sein Blick von einem der Männer zu dem anderen, die sich willensstark aus dem Nichts emporgearbeitet hatten oder daran gingen, sich die Heimstätte zu schaffen. Und es zog ihm durch den Sinn, welche Unsumme an Kräften dem Vaterlande verloren ginge, gewönne man das Beste in ihnen nicht zurück zum Festhalten an deutscher Art.
Die Mahlzeit war zu Ende, die Tafel abgeräumt. Nur Flaschen und Gläser bedeckten noch den Tisch. Und jetzt erst erhob sich der erste Tischredner. Es war der Ingenieur, der vor langen Jahren als junger Mensch abgedankte preußische Offizier.
»Meine Herren,« sagte er, und lautlose Stille trat ein. »Wir haben die Freude, einen deutschen Landsmann unter uns zu sehen, einen Mann dazu, der den Ruhm deutscher Wissenschaft über die Meere trägt. Wir wollen ihn ehren, indem wir Deutschland ehren, wir wollen Deutschland ehren, indem wir unsere Gläser füllen und ausrufen: Es lebe der Kaiser!«
Aufrechtstehend leerten die Versammelten ihr Glas. Und setzten sich nieder.
Seltsam bewegt stand Wegherr am Tische. Ob dieses Hoch von der einsamen Bergkuppe des pennsylvanischen Waldes das Ohr des Kaisers erreichte? Das Hoch seines ehemaligen Offiziers, der sich zu neuer Stellung emporgearbeitet hatte? Geschah es, so müßte es Landesvatergedanken in ihm wecken, Vatergedanken, die den Söhnen gelten, und unter ihnen denen, die der stärksten Liebe teilhaftig werden müssen, den Söhnen, die in der Welt verstreut sind und nicht verloren gehen dürfen, sich nicht verlieren sollen.
»Meine Herren,« begann Wegherr, und die Blicke all der Männer, die nach zäher Arbeit hierherkamen, um allmonatlich sich für ein paar Stunden in die alte Heimat zurückzuversetzen, hingen an seinem Munde. »Ihr hochverehrter Redner hat mir eine doppelte Ehre erwiesen. Indem er mich willkommen hieß, widmete er sein Glas der Heimat, aus der ich komme, und dem Abbild unserer Heimat, dem Kaiser. Ich danke Ihnen für diesen starken Willkommengruß. Durch ein Weltmeer von Deutschland getrennt, darf ich dennoch unter Ihnen sitzen, als säße ich im wärmsten Winkel des deutschen Landes, und wieder einmal erfahren, daß Blut dicker als Wasser ist. Wir sind, was wir schaffen! Und mit Stolz sehe ich mich unter Männern, die trotz Schicksalsschlägen und Wetterstürzen, ja gerade durch sie, Männer geworden sind, die als Vorbilder dienen können, wie man das Leben meistert, willensstark und ohne Bangen, lachend und zähe. Das ist die alte deutsche Art, die sich nicht kümmert um das Achselzucken der Daheimgebliebenen und nicht um das Stirnrunzeln der neuen Umgebung. Männer, die sich durchsetzten, ohne den Humor am Leben zu verlieren, sind vom allerbesten Stoff, selbst wenn in der Jugend der Becher überschäumte. Nie und nimmer ist aus einem Duckmäuser ein Lebensbezwinger geworden.«
Der alte Unkelbach sprang auf. Seine Augen lachten. Seine Kinnbacken arbeiteten, als ob sie ein Wort herausstoßen wollten. Es ging nicht. Und er schlug mit der Hand durch die Luft, trank sein Glas aus und setzte sich.
»Sehen Sie, meine Herren,« fuhr Wegherr fort, »das ist es, was mich unter Ihnen erregt und bewegt. Ich weiß sehr wohl, daß der, der nach Amerika geht, sich nicht in eine deutsche Kolonie begibt. Aber den deutschen Namen tragen sie mit sich und die deutsche Art und bleiben dadurch, wohin sie auch in der Fremde kommen und welches Land das neue Heimatland wird, des alten Vaterlandes Verbündete von Blutes wegen. Mehr als je schieben sich in der Welt die Rassen gegeneinander und aufeinander. Kommt der Tag der großen Auseinandersetzung, den wir sicher nicht herbeiwünschen wollen, kommt er aber, so möge er die germanischen Elemente einig und stark an allen Ecken und Enden der Welt finden, damit das Wort von der Vereinsamung Deutschlands ein Wahn wird. Dann, ja dann, wird der Deutsche unbezwingbar sein. Meine Herren, ich trinke auf das Wohl von Deutschlands Söhnen in der Fremde, deren Liebe stärker ist als jedes Schicksal. Ich trinke Ihr Wohl!«
Er leerte sein Glas und setzte sich.
Es blieb still in der Halle. Keine Hand rührte sich zum Beifall, kein Mund öffnete sich zu einem Bravoruf. Aber der ehemalige preußische Offizier und der wilde Baron, der württembergische Theologe und der sächsische Musikant, die wettergebräunten Farmer und die nervösen Kaufleute, sie alle, die an der Tafel saßen, erhoben sich still, als schäme sich einer vor dem andern, von ihren Stühlen, gingen um den Tisch, schüttelten Wegherr fest die Hand und suchten still ihre Plätze wieder auf. Hinter seinem Sohn kam als letzter der alte Unkelbach. Er ergriff wie die anderen Wegherrs Hand, schüttelte dann den Kopf und zog den Überraschten an die breite Brust.
»Alles, wat recht is,« sagte er, und sein schallender Kuß löste den Bann.
»Gesangbücher her!« schmetterte der ehemalige Musikdirektor in den Jubel hinein. Der versonnene Blick war gewichen. Aus seinen Augen leuchtete die alte Musikantenfreudigkeit. »Wir singen: Mein Lebenslauf ist Lieb und Lust und lauter Liederklang!«
»Herr Kapellmeister, wie wär's mit: ›Der Graf von Luxemburg hat all sein Geld verjuxt, trallera›?«
»Kommt auch noch an die Reihe. Ehre, wem Ehre gebührt, Herr Baron. Siewünschen, Herr Unkelbach?«
»›Trinke nie ein Glas zu wenig,‹ Herr Kapellmeister.«
»Bereits vorgemerkt. Die anderen Herren brauchen sich nicht zu bemühen. Jedem das seine. Nun? Woran hapert's denn noch?«
Der Zeitungsverleger hatte das Wort verlangt. Der aufgeregte Mann drehte so lange und heftig sein Glas auf der Tischplatte, bis der Kelch vom Stengel sprang.
»Meine Herren,« rief er und tupfte mit der Serviette den Wein von der Weste, »die seltene Erhabenheit der Stunde verlangt doch wohl etwas anderes von uns als die Übungen eines Gesangvereins. Ich will bei Gott nichts gegen Gesangvereine sagen. Die edle Pflege des Gesanges –«
»Ja, was wollen Sie denn sagen?« rief der Baron.
»Herr Baron!«
»Hier!«
»Meine Herren, wir haben soeben beredte Worte gehört. Sie haben gehört –«
»Ja, wenn wir et doch schon mal gehört haben ...«
»Herr Unkelbach senior, mein Prinzip ist, eine gute Sache –«
»Kann man auch zweimal hören. Dat is doch nix Neues. Darum steht ja auch alles zweimal in Ihrer Zeitung.«
»Herr Unkelbach senior« – der aufgeregte Mann nahm das Glas seines Nachbarn und leerte es. »Schön, schön. Da Sie gerade von meiner Zeitung sprechen –«
»Gott sei Dank, et war et Stichwort.«
»Und es soll es bleiben. Kein wahres Deutschtum, keine wahre Kultur, kein – kein – rein gar nichts kann erhalten bleiben, wenn die wahren Träger dieses Deutschtums, dieser Kultur, dieser – dieser – um es kurz zu sagen: nicht die hinreichende und verständnisvolle Unterstützung finden. Ja, ich spreche von der Zeitung. Jeder kann hier mit geringfügigen Mitteln mithelfen, am großen Werk, jeder kann durch ein Abonnement –«
»Wir tun es ja doch nicht.«
»Herr Baron!«
»Wieso denn? Sie kaufen mir ja auch keine Pferde ab.«
Da gab der Kapellmeister das Zeichen.
Und aus den Kehlen der Männer, die sich das Leben um die Ohren geschlagen hatten und den Kampf suchten, wenn er nicht zu ihnen kam, denen nur wohl war in grimmer Schaffenslust, um den letzten Hauch von Heimweh zu betäuben, schallte es jugendselig durch die Halle:
»Mein Lebenslauf ist Lieb und Lust Und lauter Liederklang ...«
Ernst Wegherr sang es mit. Wie oft hatte er es als junger Student gesungen. In Deutschland – dazumal. So sorgenlos und heiter, wie wohl der Professor einst, der jetzt seinen Bariton schwelgen ließ, wie der Theologe und Zuckerzeugfabrikant, dem die Erinnerung inbrünstig die Stimme hob, wie der Leutnant, der es einst auf dem Marsch ins Manöverfeld gesungen und gepfiffen hatte, und die anderen alle, die mit roten Köpfen dem Liede ihre Stimme liehen. Der Baron hatte seine Umgebung vergessen. Seine Stimme schrillte. Sie tat keinem weh. Vater und Sohn Unkelbach aber saßen und sangen Auge in Auge:
»Herein, herein, du lieber Gast, Du, Freude, komm zum Mahl, Würz uns, was du bescheret hast. Kredenze den Pokal!«
Und nach jeder Strophe stießen sie kräftig miteinander an.
Und nun folgte Lied auf Lied.
»Wie gefällt es dir?« fragte Wuppermann schmunzelnd den Freund.
»Es tut mir gut.«
»Ja, siehst du, den anderen tut's auch gut. Das ist das große Vergessen im Erinnern. Schau sie dir an. Jeder glaubt, er wär' daheim.«
»Ah, es tut mir so unendlich gut, Georg.«
»Nimm dich vor der Heimatstimmung in acht. Herz in die Hand, feste, du Herzbachstraßensohn. Augen auf. Alles halb so schlimm, wenn man die andere Hälfte abzieht. Hörst du? Da jubiliert selbst der pennsylvanische Zeitungsverleger wie eine Lerche.«
Wegherr lachte schon wieder. »Unsinn,« sagte er. »Wo steckt denn unser guter Wilhelm Finkler?«
»Mr. Will Finkler läßt im Nebenzimmer gerad' einen Drahtbericht über den ›prominenten‹ Besuch des ›prominenten‹ deutschen Historikers Doktor Ernst Wegherr an seine Neuyorker Zeitung vom Stapel. Wir haben hier nämlich Telegraphenverbindung. Bis in die ödeste Einöde. Und Wilhelm Finkler von der Herzbachstraße müßte in Amerika nicht Mister Will Finkler geworden sein, wenn er nicht aus jedem Telegraphendraht Kapital schlüge. Da kommt er. Hallo, Finkler!«
»Hallo, gentlemen. What's the matter?«
»Sprich Deutsch, Mensch. Du bist hier nicht unter Botokuden.«
»Mein lieber Wuppermann,« erwiderte Finkler und zog sich gemächlich einen Stuhl heran, »die Fabrikation von seidenen Strümpfen scheint mir kein hinreichender Entschuldigungsgrund für sonstige gänzliche Unkenntnis. Die Botokuden, mein Lieber, treiben ihr freundlich Wesen mit allerlei Schießgewehr in den Urwäldern Brasiliens, haben weder von englischer Sprache noch von seidenen Strümpfen die entfernteste Ahnung und radebrechen höchstens ein wenig Portugiesisch. Stimmt's, Doktor?«
»Es stimmt geradezu bewundernswert, Finkler.«
»Ja,« meinte der Journalist gelassen und füllte sich ein Glas, »da redet man von den großen menschlichen Errungenschaften. Es gibt nur eine: das Konversationslexikon. Man braucht nur halbwegs des Lesens kundig zu sein und wird über die staunende Masse der Menschheit emporgehoben. Prosit, Doktor.«
»Und nach der Herzbachstraße erkundigst du dich gar nicht?«
»Sie ist sechzig Schritt lang und zehn Schritt breit. Anzahl der Häuser: vier. Sollte sich das geändert haben? Vielleicht stinkt's nicht mehr so grauenhaft nach dem alten Bach.«
»Riecht's in Amerika besser?«
»Wird nicht behauptet. Aber hier kann ich umziehen, wenn's mir zu toll wird, ohne an meinen Erinnerungen zum Rabenvater zu werden.«
»Wir haben ihn!« schrie Wuppermann und schlug auf den Tisch.
»Mir ist auch so,« meinte Wegherr lächelnd. »Da kam unter dem amerikanischen Dreß ein Stückchen von der alten Haut zum Vorschein. Er hat von Erinnerungen gesprochen. Weißt du noch, Georg, wie er mit der kleinen Marie aus dem ersten Hause jeden Samstagnachmittag zum Botanisieren in die Wälder zog?«
»Donnerwetter,« fuhr Finkler auf, ließ das Einglas aus dem Auge fallen und war ganz bei der Sache. »Die kleine Marie. Das liebe, süße, mollige Ding. Herrgott nochmal, haben wir uns in allen Torbogen abgeküßt. Noch, als ich Student war und sie damals achtzehn. Bis meine in der guten Universitätsstadt Bonn angebundenen Bären so furchtbar brüllten, daß ich als Zwischendecker einem sogenannten ehrenvollen Rufe nach Amerika folgte. Ach Gott, Kinder, die Marie. Was wird sie in all den Jahren ohne mich angefangen haben?«
»Vier reizende kleine Mädels hat sie,« sagte Wegherr, »ich habe sie gesehen.«
»Wa–as?« Finkler hob das Einglas und befestigte es im Auge. »So eine Gemeinheit.«
»Erlaube, lieber Freund, das kleine lustige Mädel hat als Frau ihre Mutterpflichten hervorragend erfüllt.«
Finkler schüttelte den Kopf. »Verstehst du das denn nicht? Diese vier Rangen führen nun die Sammelnamen Müller oder Schulze, und sie hatten die glänzende Aussicht, Finkler zu heißen. Das ist doch wohl ein himmelweiter Unterschied. Und im nächsten Jahre wollte ich hinüber und mir das Mädel holen. Aber hat je ein Mensch gehört, daß Frauenzimmer abwarten können?«
»Lieber Wilhelm, sie ist unterdes Vierzig geworden, geht ganz gewiß nicht mehr botanisieren und liebt die Torbogen nur noch, weil sie für stattliche Personen einen bequemeren Hauseingang darstellen. Sie ist sehr stattlich geworden, wenn es dich tröstet.«
»Gerechter Himmel,« sagte Will Finkler und griff sich an die Stirn. »Vierzig Jahre? Du kannst beschwören, daß sie nicht mehr achtzehn ist? Dann wäre ich ja schon zweiundzwanzig Jahre im Lande Onkel Sams? Wo ist die Zeit geblieben?«
»Nun, nun,« beruhigte Wuppermann, »es gibt ja auch Mädchen in Amerika.«
Finkler sah den Tröster von unten herauf an. »Mein Liebster, vorläufig bin ich noch durchaus nicht unterstützungsbedürftig. Ich bin noch sehr wacker auf den Beinen. So wacker, daß ich immer noch einen prachtvollen Hechtsprung machen kann, wenn das Netz heranschwirrt, um mich zu fischen. Und nun, Gentlemen, eine Bitte: wir wollen den Gegenstand wechseln.«
Quer durch die Halle kam sporenklirrend der Baron. Ein paar der jüngeren Deutschen drängten ihm nach. Nun hatte er die Freunde erreicht. »Erlauben Sie, meine Herren?« Und er setzte sich breitbeinig an den Tisch. »Auf ein Wort, Mister Finkler.«
»Es kommt mir auf eine Handvoll nicht an, Baron.«
»Hören Sie, diese Betbrüder da« – und er wies auf seine Begleiter – »wollen von dannen, weil morgen Sonntag ist. Die Bangebüxen fürchten sich vor ihren frömmelnden Nachbarn im Städtchen. Als ob nicht grad der Sonntag zur Freud' geschaffen wär'! Aber diese tapferen Teutschen müssen natürlich noch amerikanischer sein als die Yankees. Schön. Sind meinethalben Gewissenssachen. Und wenn nicht, geht's mich auch nix an. Aber haste nich gesehen, wie sie sich drücken wollen, setzen sie mir voll christlicher Nächstenliebe einen Floh ins Ohr.«
»Das ist kein Floh, Herr Baron,« verwahrten sich die Angegriffenen. »Der Ex-Präsident hat sich tatsächlich unvorteilhaft über die Regierenden Europas geäußert. Er hat sie doch besucht. Er muß es doch wissen.«
»Ruhe!« donnerte der Baron. »Nix muß er wissen. Natürlich, ihr Grünhörner glaubt, nur den geheiligten Boden Amerikas betreten zu brauchen, um waschechte Republikaner zu sein. Feixt nicht. Das ist die Stelle, wo ich sterblich bin. Bitte, Mister Finkler, Sie sind als Neuyorker Journalist verpflichtet, alleszu wissen.«
Finkler lehnte sich im Stuhl zurück. Mit dem Gesicht eines Diplomaten.
»Da haben Sie nicht unrichtig kalkuliert, Baron. Mein Freund Roosevelt, der Ex-Präsident, war erst kürzlich mit mir zum Lunch. Und zwischen Suppe und Pudding ließ er in seiner bekannten scharfsichtigen Weise die Häupter Europas vorbeimarschieren.«
»Ließ er. Hm. Vor drei Monaten erst war er Gast bei diesen Häuptern. Scharfsichtig beliebten Sie diese Weise zu nennen. Nun, wir wollen über den Ausdruck nicht streiten, obwohl ich einen besseren dafür wüßte.« Und er trommelte kurz und drohend auf der Tischplatte.
Finkler lächelte nur.
»Belieben Sie, mich ausreden zu lassen, Baron. Ich kalkuliere, Sie werden dann anders über den Fall denken. Es ist wahr, der Ex-Präsident nahm kein Blatt vor den Mund. Aber das tun Sie ja auch im vertrautesten Kreise nicht, Baron. Und die Hauptsache war: die Stimmung wurde sehr vergnügt. Da erzählte er zum Beispiel von der Königin von ...«
»Herr, ich verzichte darauf. Alle fremden Könige und Königinnen gehen mich den Deubel an. Was hat er über den Kaiser gesagt?«
Seine Hände ballten sich. In seinem ledergegerbten Gesicht zuckte es ein paarmal auf. Doch Finkler nahm nicht die geringste Notiz davon.
»Mr. Roosevelt meinte« – er sann nach – »richtig, der Ex-Präsident meinte, lediglich Wilhelm II., Deutscher Kaiser, wäre imstande, auch als Präsident von Amerika seinen Mann zu stehen.«
Die Fäuste des Barons schlugen auf die Tischplatte.
»Verdammt, das war Roosevelts Glück.«
Und dann lachte er schallend auf.
»Das ist Roosevelt, ganz Roosevelt, ganz Yankee. Merkt ihr denn nicht, wie er sich selber durch seine ›scharfsichtige› Charakterisierung den Platz Nummer I offen hält? Wie er mit beiden Zeigefingern auf sich selber zeigt und es doch dabei so fingert, als ob er dem ganzen erleuchteten Amerika eine Bombenschmeichelei sagte? Ach, er ist ein Schlauberger, euer Mr. Roosevelt, und ich hab' meine helle Freud' an ihm, weil er euch so niederträchtig richtig einschätzt.«
»Der Kaiser hat auch seine Fehler,« widersprach der eine von des Barons Begleitern.
»Nee,« trumpfte der andere auf, »ein Engel ist er auch nicht, Baron. Das möchten Sie wohl.«
Der Baron klatschte vor Vergnügen auf seine Schenkel.
»Muß es denn gleich in den Himmel gehen? Engel? Cherubim? Und seid ihr verjankisierten Misters Miller und Piper himmlische Heerscharen, ihr Rhinozerosse? Werdet zunächst Deutsche, ihr amerikanischen Betbrüder, das genügt dem Herrgott vollständig!«
»Wir entschuldigen Sie, Baron.«
»Bitte, bitte. Gern geschehen. Na, kommen Sie gut nach Hause.«
»Ach, Doktor,« seufzte er und nahm dankend ein Glas Wein entgegen, »wie schön muß es jetzt in Deutschland sein. So unter dem lieben vierbeinigen Rindvieh oder im Wald oder so ganz glückselig auf gestrecktem Pferderücken hinter der Meute her. Mußte da dieser Nirgendzuhaus Kolumbus Amerika entdecken. Nun soll er's gar nicht mal gewesen sein. Das gönn' ich ihm.«
»Ja,« sagte Wegherr, »Sie haben Recht, es ist nirgendwo schöner. Und Sie könnten das Glück doch haben.«
»Kann ich auch, Doktor, werde ich auch. Als ich vor zwanzig Jahren herüberwechselte, stach mir vor allem die Freiheit und Gleichheit in die Augen. Das, glaubte ich, liegt deinem Temperament am besten. Prost die Mahlzeit. Als ich an dem Freiheitsstandbild vorüberdampfte, in den Neuyorker Hafen hinein, klopft mir so ein alter Wetterkundiger auf die Schulter. ›Da, sehen Sie sich das Ding an, das ist das letzte Stück Freiheit, was Sie hierzulande zu sehen kriegen.‹ Der Mann sprach die Wahrheit. Das ist hier keine Gesetzgebung, das ist eine Gesetzgebungsseuche, in jedem Staat, in jedem Städtchen, die Weiber voran, und wo die nicht wollen, kriegen Sie als ausgewachsener Mann nicht mal 'nen Tropfen Whisky auf die Zunge. Die Gleichheit aber – Herr, verzeih's ihnen – die Gleichheit besteht in der Hauptsache darin, daß jeder Rüpel neben Ihnen seine gottverfluchten Beine über Ihren Tisch legen darf, ohne daß Sie sich nur wundern dürfen. Doktor, ich habe meinem alten Deutschland viel abgebeten.«
»Und haben es doch zwanzig Jahre ausgehalten?« fragte Wegherr.
»Da lag der Knüppel beim Hund. Der Bien' mußte. Rechnen war immer meine schwache Seite. Meine hochgeborene Vetterschaft behauptete sogar: meine schwachsinnige Seite, und versuchte darob, mich unter Vormundschaft zu stellen. Das gelang ihnen nun bös daneben. Tja, und in meiner Vergnügtheit machte ich dann einen Streich, der meine Börse – amerikasüchtig werden ließ. Man hatte Dachsbergschen Familientag angesetzt, im einzigen feudalen Hotel der Stadt, die allen am bequemsten lag. Mich hatte man als räudiges Schaf ausgeschlossen. Ich erhielt tags zuvor Witterung, reiste in der Nacht noch hinüber, lasse mir den Wirt kommen, kaufe ihm innerhalb einer Stunde den ganzen Hotelkram ab, mit gewaltigem Aufgeld notabene, und lasse durch den Hausknecht die ganze Vettern- und Basenschaft, wie sie nacheinander angerollt kommt, hinausweisen. So gelacht hab' ich mein Lebtag nicht. Ich verkaufte dann für die Hälfte, suchte die indianischen Jagdgründe auf, kriegte Geschmack an der Arbeit, spürte langsam den Segen in meine Kasse träufeln, unterhandle nun wegen Rückkaufs meines Gutes im Kleveschen, schlage dann meine Zuchtfarm los und hoffe, in Jahresfrist wieder« – er atmete tief auf, und sein helles Organ war plötzlich wie verschleiert – »daheim zu sein.«
Wegherr reichte ihm wortlos die Hand. Sie wurde mit festem Griff gepackt und geschüttelt. Dann erhob sich der Baron. Er sah älter aus.
»Mr. Finkler,« sagte er und lächelte, »ich appelliere an Ihre deutsche Kameradschaft. Unterschlagen Sie Ihrer Zeitung meine Beichte. Damit mir der Geschäftsabschluß nicht verdorben wird. Der Doktor hier hat so etwas Urheimatliches. Das brachte mich zum Schwätzen. Ich hab' Ihr Wort, meine Herren. Auf Wiedersehen.«
Und er stelzte aufrecht von dannen, suchte seinen Freund Unkelbach auf und rief bald mit Kommandostimme nach einer neuen Flasche.
»Ist und bleibt der alte Husar,« brach Wuppermann endlich das Schweigen. »Schade, daß er geht. Wird uns sehr fehlen. War hier der Sauerteig unter den Selbstzufriedenen.«
»Einseitig, aber vorwärtstreibend,« sagte eine ruhige Stimme.
»Ah, Mr. Willart.« Wuppermann war aufgesprungen. »Schön von Ihnen, daß Sie auch unsere Ecke mal beehren. Sie kennen meinen Freund Doktor Ernst Wegherr?«
»O, ich kenne ihn nicht erst seit heute abend. Und ich rechne mich in aller Bescheidenheit schon seit Jahren zu seinen Freunden. Herr Doktor, nehmen Sie es bitte nicht als eine der landläufigen Artigkeiten. Ich habe mit aufrichtiger Bewunderung Ihre historischen Forschungen verfolgt und mir zunutze gemacht.«
Wegherr hatte sich erhoben. Und Wuppermann gab Finkler einen Wink, die beiden Herren allein zu lassen.
»Es freut auch mich, Sie näher kennen zu lernen, Herr Willart,« sagte Wegherr herzlich. »Mein alter Freund Wuppermann spricht mit ganz besonderer Wärme von Ihnen. Und wenn ich meinen Augen nicht trauen dürfte, dürfte ich seinem Verstand trauen. Würden Sie mir erklären, weshalb Sie den Baron einseitig nannten?«
»Recht gern, Herr Doktor. Ich bitte, Platz zu behalten. So, jetzt plaudert es sich gemütlicher. Sehen Sie, ich habe mir im Laufe der Zeit und meiner Beobachtungen angewöhnt, die deutschen Einwanderer in drei Klassen einzuteilen: die einseitigen, die doppelseitigen und die vielseitigen. Die Vielseitigen verschmelzen sich auf der Stelle. Sobald sie an Land kommen, nehmen sie mit dem Volkstum Sprache, Ausdrucksweise, gute und schlechte Gewohnheiten – besonders aber die letzteren – der eingeborenen Bevölkerung an, um sofort für echt gehalten zu werden. Würden sie nach Afrika gehen, so würden sie sich keine Minute besinnen, Neger zu werden. Menschen ohne Vaterlandsgefühl, ohne Rassestolz, kurz: Abhub der Menschheit. Wenden wir uns von diesen Jammergestalten ab, die jedem Lande, aus dem sie stammen, zur Schande gereichen, obwohl sie sich Kosmopoliten dünken. Die Doppelseitigen sind bemerkenswerter. Sie stellen die Mehrzahl. Sie kommen herüber mit dem festen Willen, gute Bürger der Vereinigten Staaten zu werden, wünschen aber trotzdem ihr Deutschtum aufrechtzuerhalten. Das fangen sie nun meist an der verkehrten Seite an. Sie zersplittern sich in hundert deutsche Vereine und machen, wenn's darauf ankommt, vor dem eingeborenen Amerikaner eine tiefe Verbeugung. Das ist die tiefeingewurzelte deutsche Ehrfurcht vor allem Fremdländischen. Und gerade diese Ehrfurcht weiß der Anglo-Amerikaner überhaupt nicht zu würdigen. Er nimmt sie als Unterwürfigkeit, als Mangel an männlichem Selbstbewußtsein, dünkt sich turmhoch höher, und gerade er, der so stolz auf seine Stammesart pocht, hegt eine stille Verachtung gegenüber jedem Lakaientum. Unter den Doppelseitigen gibt es Ausnahmen, Männer, die den Kopf hoch tragen, die sich die neue Heimat gründeten in dem Bewußtsein, deutsche Kulturträger zu sein. Mit ihnen und den Unzähligen, die sich zu sich selber bekehren werden, wird dieses Land eines Tages rechnen müssen.«
Aufmerksam hörte Wegherr zu. »Und die Einseitigen?« fragte er.
»Die Einseitigen? Ja, wie soll ich sagen, um ihnen gerecht zu werden? Sie finden kein gutes Haar an Amerika, sie bleiben nach zwanzigjährigem Aufenthalt dieselben noch, die sie waren, als sie sich in Hamburg oder Bremen einschifften, sie sehen nur alles das, was dem Amerikaner noch fehlt, um ein eigenes Kulturvolk zu werden, und übersehen das Großartige, was der Amerikaner für die Zivilisation aus dem Nichts geschaffen hat. Da sie aber vor allem ihren eigenen Landsleuten scharf auf die Finger sehen und jede Anbeterei und Nachbeterei mit Hohn und Spott übergießen, so möchte ich sie das kritische Gewissen der Deutschamerikaner nennen. Leider treibt es sie nach Jahren in die alte Heimat zurück. Leider! Denn es fehlt an Sauerteig, wie Freund Wuppermann es soeben richtig benannte.«
»Wie hoch schätzen Sie die Gesamtzahl der Deutschen?« fragte Wegherr aus seinen Gedanken heraus.
»Wenn Sie deutsches Blut meinen, Eingewanderte und im Lande geborene Kinder deutscher Eltern: 15 Millionen und mehr.«
»Welch eine Macht in der Hand eines Führers!«
»Ich denke wie Sie, Doktor Wegherr.«
Beide hatten sie den Blick erhoben. Und klar und ruhig sahen sie sich in die Augen.
»Der Weg, Herr Doktor,« begann Willart nach einer Pause, »kann nur durch deutsche Kultur gewonnen werden.«
»Kultur kann nur von Selbstbewußtsein kommen, Herr Willart.«
»Also gilt es, die deutschen Elemente dieses Landes selbstbewußt zu machen, selbstbewußt im Hinblick auf ihre Rasse, auf die Kulturhöhe dieser Rasse und ihren Weltberuf. Dann erst können sie daran gehen, Hand in Hand mit den germanischen Geschwisterrassen die große Aufgabe dieses Landes zu lösen, mit den englischen, holländischen, skandinavischen Elementen vereint. Erst muß der Yankee Hochachtung lernen, und die gewinnt er nur vor unbeugsamem Willen und ziffermäßigen Tatsachen. Ein politisch Lied. Ich möchte Ihnen den schönen Abend nicht verderben.«
»Nein,« sagte Wegherr, »wie könnten Sie das! Sie, der Sie voller Hoffnung auf eine große Zukunft sind.«
»Das bin ich, Herr Doktor. Und die Tatsachen werden mir einst Recht geben. Werfen Sie einen Blick auf die Einwandererlisten. Wer nicht blind sein will, muß zur Vernunft kommen. Deutschland behält seine Söhne jetzt daheim, bis auf eine nicht mehr in Betracht kommende Zahl. Was uns heute überschwemmt, sind die minderwertigen Bestandteile osteuropäischer und südeuropäischer Völker: Russen, armselige russische Juden, Balkanleute, Italiener. Lassen Sie das noch eine Geschlechtsfolge so fortgehen, bis die Kinder sich mit unseren mischen – was für eine Rasse wird aus den Amerikanern werden? Wie weit wird sich ihre Kultur zurückgeworfen sehen? Wann wird es zu einer eigenen kommen, die mit Stolz die amerikanische heißt? Es stehen uns schwerere Aufgaben bevor, als nur das Land zu erschließen.«
Wegherr nickte. Dann fuhr er auf. Man hatte an der Tafel ein Abschiedslied begonnen. Die letzten Flaschen polterten eilig auf den Tisch.
»Glückliche Menschen,« sagte Willart mit leisem Lächeln. »Die machen sich keine Gedanken über das, was für die Söhne und Enkel sein wird.«
»Und wir sitzen hier wie die Verschwörer,« lachte Wegherr. »Kommen Sie, wir wollen heute zu den anderen gehören. Eine Mondnacht lang, eine Mondnacht auf pennsylvanischen Bergen, weg mit den Grillen und Sorgen.«
Eine Stunde noch saßen sie in der überlustigen Runde, jungen Studenten gleich. Bis sich der Zeitungsmann aus der pennsylvanischen Kleinstadt noch einmal vom Stuhl erhob.
»Meine Herren,« begann er, »meine Herren, Sie lassen die Dollars rollen. Wofür? Ich sehe scharf, für geistige Getränke. Was der Kehle recht ist, ist der Seele billig. Ein Abonnement auf meine Zeitung, ein Probeabonnement –«
Der Baron hieb auf den Tisch.
»Und ich tu's nicht, und wenn Sie mir 'nen Dahler zulegen.«
Und was noch zu reiten vermochte, stieg unter brausendem Gelächter in die Sättel.
3
Inhaltsverzeichnis
Quer durch den Wald zog der Reiterzug. Der steile Abstieg wurde vermieden. In Kehren, die nur in der Einbildung des Führers bestanden, mußte die Bergkuppe, auf der sich die mondbeschienene Halle hob, umritten werden, mitten durch krachendes und splitterndes Unterholz. Aber der Baron war der Führer. Den grauen mexikanischen Schlapphut in den Nacken geschoben, trabte er scharfen Auges voran, ließ auf wegsamen Strecken den Gaul angaloppieren und ruhigtastend im Schritt gehen, wenn ihm die Stämme von links und rechts wieder auf die Hacken rückten. Er ritt mit dem Instinkt des Reiters der Wildnis. Er hätte sich mit derselben Sicherheit in den Pampas Argentiniens und in den Urwäldern des Amazonenstromes zurechtgefunden wie in dem Menschengewühl der Pariser Boulevards.