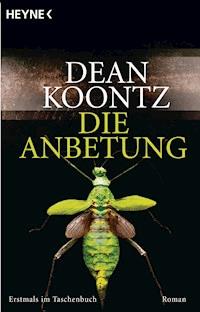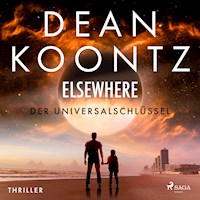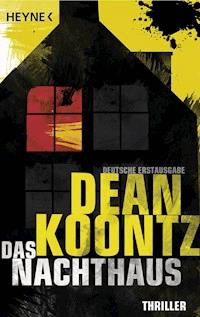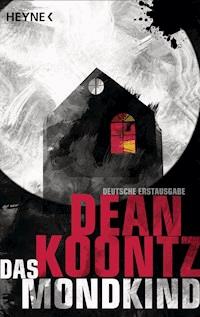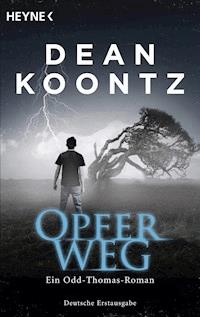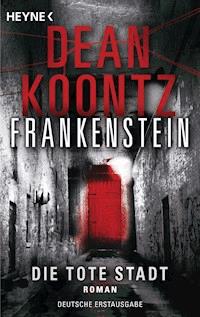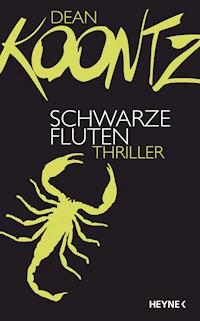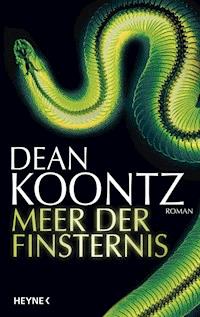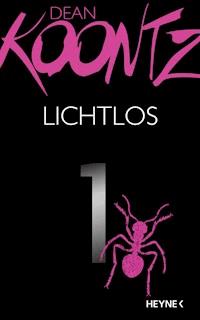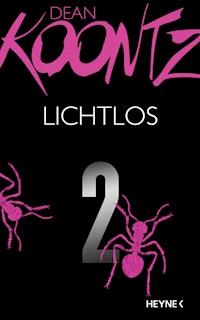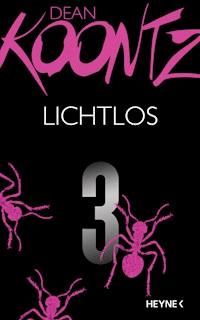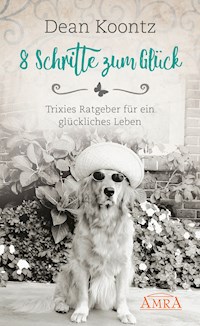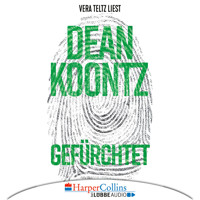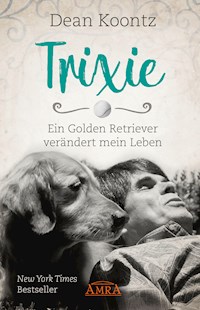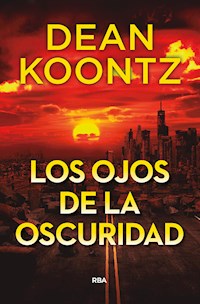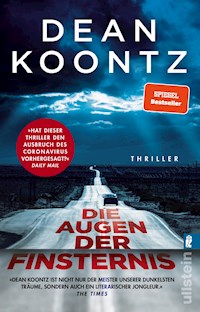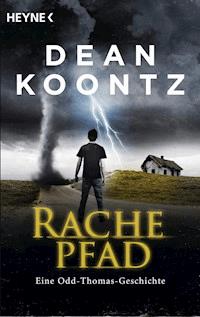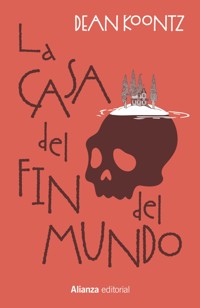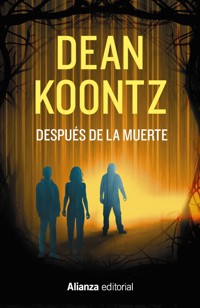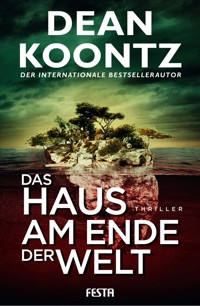
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Festa Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Katie lebt allein und fernab der Zivilisation in einem festungsartigen Steinhaus auf der abgelegenen Insel Jacob's Ladder. Einst war sie ein aufstrebender Star in der Kunstwelt – jetzt findet sie nur noch Trost in der Malerei. Auf der Nachbarinsel gibt es ein geheimnisvolles Forschungszentrum der Regierung. Von dort kommen eines Tages zwei Agenten, auf der Suche nach etwas, über das sie nicht sprechen wollen. Katie spürt, dass eine große Bedrohung die Insel heimsucht, die so seltsam ist, dass sogar die dort lebenden Tiere in tödliche Panik geraten. Und dann taucht mit einer gewaltigen Sturmböe ein Mädchen am Ufer auf … Der neue Koontz! Eine glorreiche Rückkehr zu seinen großen Monstergeschichten. Stranger Things ist nicht weit entfernt … Booklist: »Geradezu vibrierend vor Spannung. Ein weiterer Hit von einem Meister des Thrillers.« Los Angeles Times: »Koontz hatte schon immer die Beschreibungskraft eines Charles Dickens und die Fähigkeit, uns von einer Buchseite zur nächsten zu reißen, wie es nur wenige Autoren vermögen.« New York Times Book Review: »Berauschende, halluzinogene Prosa.« Playboy: »Wäre Stephen King die Rolling Stones in der Literatur, dann wäre Koontz die Beatles.« Tampa Tribune: »Weit mehr als ein Genreautor … Deshalb werden seine Romane noch lange gelesen werden, wenn die Geister und Monster der meisten Genreautoren schon auf dem Dachboden liegen.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 480
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Aus dem Amerikanischen von Heiner Eden
Impressum
Die amerikanische Originalausgabe The House at the End of the World
erschien 2023 im Verlag Thomas & Mercer.
Copyright © 2023 by The Koontz Living Trust
Copyright © dieser Ausgabe 2025 by Festa Verlag GmbH, Leipzig
Titelbild: didiwahyudi.trend / 99design
Alle Rechte vorbehalten
eISBN 978-3-98676-178-3
www.Festa-Verlag.de
Für Gerda. Zu 56 Jahren Ehe – Halbzeit!
EINS: ALLEIN
DAS LETZTE TAGESLICHT
Katie lebt allein auf der Insel. Und weniger für sich selbst als für die Toten.
Es ist ein gewöhnlicher Tag im April. Ein Dienstag, geprägt von Isolation und hart erkämpfter Beschaulichkeit – vorläufig.
Das in den 1940er-Jahren erbaute kleine Haus ist eine solide Konstruktion aus Stein. Neben einem Bad besitzt es eine Küche, ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine Waffenkammer und einen Keller.
Das Haus steht auf einem Hügel, auf vier Seiten von einem Garten umgeben, dahinter auf drei Seiten von Wäldern. Die Eingangstür weist zu einem Hang, der zu einem Kiesstrand, einem Steg, einem Bootshaus und offenem Wasser verläuft.
Katies kleines Reich ist ein stilles Refugium. Seit Monaten hat sie keine andere menschliche Stimme als die eigene gehört, und sie spricht selten laut.
Sie hat weder Fernsehen noch Radio oder Internet, aber sieben CD-Player mit Magazinen für sechs CDs, wie sie mittlerweile nicht mehr hergestellt werden. Mehrere Stunden am Tag hört sie Musik, immer Klassik – Mozart, Beethoven, Brahms, Chopin, Haydn, Liszt.
Pop oder amerikanischer Folk interessieren sie nicht. Auch wenn die Texte mit noch so schönen Stimmen vorgetragen werden, die meisten erinnern sie zu eindringlich daran, was sie verloren und aufgegeben hat.
Und sie will nicht den Frieden aufs Spiel setzen, den sie in der Abgeschiedenheit gefunden hat.
In den Hang eingelassene Betonstufen mit einem Geländer aus lackiertem Eisen führen hinunter zum Ufer. Während sie hinabsteigt, wartet unten auf dem Treppenpfosten eine Felsentaube auf sie.
Der Vogel scheint immer zu wissen, wann sie einen Spaziergang an der Küste unternimmt oder aus einem sonstigen Grund vom Haus herunterkommt. Die Taube fürchtet sich nicht vor ihr, erhebt sich nie in die Lüfte, wenn sie sich nähert, sondern wirkt nur neugierig.
Katie fragt sich, ob der Geruch der Zivilisation an ihr so verblasst ist, dass die Tiere der Insel sie als eine von ihnen betrachten statt als Eindringling oder Raubtier.
Bald werden über tausend Blaureiher zu einem Horst auf einer anderen Insel weit nördlich von Katies Refugium ziehen. Wenn die Fortpflanzung abgeschlossen ist, wird gelegentlich einer auf Nahrungssuche durch die Untiefen dieses Ufers staksen wie ein wunderschönes Relikt aus dem Jura.
Ein im Bootshaus vertäuter, sechs Meter langer Kabinenkreuzer mit vom Steuerhaus aus gesteuertem Innenbordmotor mit Z-Antrieb bietet sowohl Reichweite als auch Geschwindigkeit. Katie benutzt ihn zwei- bis dreimal im Monat für Fahrten ins Blaue und zurück.
Bei Bedarf – und nur bei Bedarf – steuert sie das Festland an und lässt das Boot im nächstgelegenen Jachthafen warten. In der Stadt war sie seit dem Besuch bei ihrem Zahnarzt vor fünf Monaten nicht mehr.
Dort unterhält sie einen Range Rover in einer gemieteten Garage. Außerdem bezahlt sie einen Einheimischen dafür, den Wagen zweimal im Monat zu fahren, damit er für sie funktionstauglich bleibt. Zwar gibt es auf der Welt keinen anderen Ort, zu dem sie möchte, doch die Erfahrung hat sie gelehrt, auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein.
Mittlerweile genießen sogar die Inseln an diesem abgelegenen Ende des Archipels Mobilfunkempfang. Allerdings telefoniert Katie selten. Textnachrichten sendet sie ausschließlich an Hockenberry Marine Services.
Die Firma liefert ihr zweimal im Monat Lebensmittel, Propangas und andere Waren. Man bietet ihr regelmäßig an, die Einkäufe die Treppe hinauf vor die Haustür zu bringen, aber sie lehnt immer ab. So auch heute.
Katie ist erst 36 Jahre alt und in hervorragender körperlicher Verfassung. Sie braucht keine Hilfe. Außerdem hat sie Hockenberry einen Schlüssel für das Bootshaus gegeben und zieht es vor, persönliche Begegnungen zu vermeiden.
Das Bootshaus besteht aus demselben Stein wie das Wohngebäude. Auf der landwärtigen Seite beherbergt eine geschlossene, schallisolierte Kammer den propangasbetriebenen Generator. Er liefert den Strom für das Haus und die Pumpe, die Wasser aus dem Brunnen fördert.
Der Kabinenkreuzer ist im vorderen Bereich an Belegklampen des Slips vertäut und von Gummifendern geschützt. Kaum merklich schwankt er in den leichten Strömungen, die unter dem großen Rolltor ins Innere gelangen.
Vom Slip führt eine Gangway zu einem Lagerbereich auf Höhe des Docks. Dort steht unter anderem ein Kühlschrank, in dem die Zusteller verderbliche Waren zurücklassen. Den Rest stellen sie in robusten Kartons daneben ab.
Wenn Propan geliefert wird, bringen sie die Gasflaschen in den Generatorraum, wo sie auch Zehn-Liter-Kanister mit Sprit für das Boot deponieren.
Katie schnallt die Kartons mit Lebensmitteln auf eine Sackkarre mit großen Rädern zur leichteren Bewältigung von Stufen und zieht sie zum Haus hinauf. Zwei Gänge sind für den Transport der gesamten Bestellung nötig.
Nachdem sie die Sackkarre zurück zur oberen Ebene des Bootshauses gebracht und die Tür geschlossen hat, stellt sie sich ans Ende des Stegs und betrachtet diese ihre Welt in den letzten 90 Minuten Tageslicht.
Der Himmel ist größtenteils blau, nur filigrane weiße Wolken zieren ihn willkürlich wie ein langes, zerlaufendes Spitzenband. Wenn die Sonne im Westen etwas weiter sinkt, werden ihre Strahlen jene Linien durch den schrägen Winkel in Gold tünchen.
Vor Jahrzehnten war das Wasser hier trübe. Seit der Einführung von Zebramuscheln, die sich von Algen ernähren, ist es klarer. Man kann den felsigen Grund und einige Wracks bis in eine Tiefe von 25 Metern oder mehr erkennen.
Hier am Ende des Archipels kann sie in südsüdwestlicher Richtung nur zwei andere Inseln sehen. Beim Kauf der knapp einen Kilometer langen und etwas weniger als 800 Meter breiten Immobilie hat deren Abgeschiedenheit sowohl zu ihrer Stimmung als auch zu ihrem Bankkonto gepasst.
Als sich 1946 der erste Bewohner auf der Insel niederließ, ein junger Veteran des Zweiten Weltkriegs, hatte sie keinen Namen, und er gab ihr keinen. Der zweite Besitzer, Tanner Walsh, ein Dichter, Schriftsteller und Mystiker, nannte sie Jacob’s Ladder – Jakobsleiter, eine Anspielung auf Jakob aus dem Alten Testament, der eine Treppe in den Himmel gesehen haben wollte.
Katie empfand ihr neues Zuhause in der ersten Woche vor lauter Verbitterung und Zorn als Insel der untersten Sprosse. Damals erschien ihr der Aufstieg in den Himmel unglaublich lang und beschwerlich und Erlösung schier unerreichbar.
Die kleinere der beiden nächstgelegenen Inseln, Oak Haven, befindet sich etwa 800 Meter östlich und näher beim Festland. Sie ist um zwei Drittel kleiner als Katies Zuflucht und beherbergt ein großes Haus im Cape-Cod-Stil mit Schindeldach und einer bezaubernden weißen Veranda.
Die Namen der Bewohner kennt sie nicht und will sie auch nicht erfahren.
Die andere Unterbrechung der Weiten des Wassers ragt etwa drei Kilometer südsüdwestlich von Katies Insel auf. Sie ist viermal so lang wie ihre und vielleicht doppelt so breit.
Wasserfahrzeuge und Helikopter – darunter große zweimotorige Modelle – verkehren zwischen dem Festland und jener letzten, abgeschiedensten Insel, an manchen Tagen öfter als an anderen. Der Steg aus Stein ist lang und imposant. Dort gibt es einen Tiefwasserhafen. Schon bei mehreren Ausflügen hat Katie beobachtet, wie es am Steg von Arbeitern wimmelte, die Boote entluden.
In der Mitte des Eilands befindet sich irgendeine Einrichtung, aber man kann die Gebäude nicht sehen. Ein dichter Kiefernwald säumt die Insel wie eine Palisade aus Nadelbäumen und schützt sie vor neugierigen Blicken.
Sie heißt Ringrock, benannt nach der gewaltigen natürlichen Säulenformation, auf der sie sich befindet. Sogar die Zusteller von Hockenberry wissen nicht mehr über Ringrock und fahren die Insel nie an.
Das Logo der einen oder anderen Teilstreitkraft der USA an den Helikoptern wäre der Beweis dafür, dass Ringrock Militärgebiet ist. Aber abgesehen von der Registrierung hinten am Rumpf und kürzeren Nummern auf der Triebwerksverkleidung weist keines der Fluggeräte je eine Kennzeichnung auf. Ähnliches gilt für die dort anlegenden Boote.
In der Woche, in der Katie Jacob’s Ladder zum ersten Mal besichtigt und ein Angebot dafür unterbreitet hat, war es auf dem entfernten Ringrock relativ ruhig. Deshalb hatte sie sich nicht den Kopf darüber zerbrochen.
Der Makler, Gunner Lindblom, meinte damals, Ringrock sei eine von der Umweltschutzbehörde betriebene Forschungsstation.
Das schien harmlos zu sein.
Und es stellte sich als bloßes Gerücht heraus.
Vielleicht wissen einige Bewohner der Hunderten Inseln nordöstlich von ihr oder in den Küstengemeinden, welche Einrichtung jenes letzte Eiland der Kette beherbergt. Allerdings pflegt Katie nie Umgang mit anderen Inselbewohnern, selten mit Leuten vom Festland, und wenn, dann tratscht sie nicht.
Wenn sie anderen Fragen stellt, wird man mit Sicherheit auch ihr welche stellen. Und wenn sie über ihre Vergangenheit spricht, schneidet sie sich an scharfkantigen Erinnerungen. Da sie endlich nicht mehr blutet, ist sie fest entschlossen, die Wunden nicht erneut zu öffnen.
Sie hofft, dass die mysteriöse Insel lediglich ein Rückzugsort für hohe Tiere eines Konzerns ist oder einen sonstigen Zweck für irgendein Privatunternehmen erfüllt. Von Profitgier getriebene Menschen jagen ihr keine Angst ein. Mit seltenen Ausnahmen besteht ihre Absicht letztlich darin, reich zu werden, indem sie Kunden das Geld aus der Tasche ziehen und sie nicht zermalmen.
Problematischer wäre es, wenn die Anlage unter der Schirmherrschaft der EPA, der CDC, der NSA, der CIA oder einer geheimen, namenlosen Bundeseinrichtung stünde.
Behörden gegenüber ist Katie argwöhnisch. Sie misstraut allen, die Macht gegenüber Geld vorziehen oder Geld nicht durch Arbeit, sondern durch den Einsatz von Macht anstreben.
Katie ist keine Überlebenskünstlerin, trotzdem will sie überleben. Obwohl sie Vorbereitungen trifft, ist sie keine Prepperin.
Sie glaubt nicht, in der Endzeit zu leben, auch wenn ihr gelegentlich Zweifel kommen.
Abgeschiedenheit ist eine gegen Angst und Verzweiflung schützende Mauer. Nur Natur, Stille und Zeit zum Nachdenken können sie heilen. Sofern das überhaupt möglich ist.
Nach 26 Monaten auf Jacob’s Ladder hat sich ihre Angst weitgehend gelegt, und die Verzweiflung verblasst allmählich zu erträglichem Kummer. Sie ist weder glücklich noch unglücklich, sondern zufrieden damit, durchzuhalten.
Als sie sich mit der Absicht vom Wasser abwendet, zum Haus zurückzukehren und sich während der Zubereitung des Abendessens ein Glas Wein zu genehmigen, erschreckt sie ein plötzlicher Ausbruch von Aktivität auf Ringrock. Sie wirbelt zu dem Lärm herum und späht mit zusammengekniffenen Augen gegen das schräg einfallende Licht der Spätnachmittagssonne.
Als schlüge eine Schweizer Präzisionsuhr zur vollen Stunde, steigen plötzlich zwei Hubschrauber aus der Mitte der Insel auf – einer ein Modell für nur einen Passagier, der andere mit vielleicht vier Sitzen. Gleichzeitig legt eine Flottille schnittiger Schnellboote aus Fiberglas vom Kai ab. Sie liegen flach im Wasser, und Katie vermeint, dass es sechs sind. Das Dröhnen von Turbinentriebwerken, das Wummern durch die Luft zischender Rotorblätter und das Gebrüll von Außenbordmotoren hallen wie hüpfende Steine über das Wasser.
Ein Helikopter fliegt nach Süden, der andere nach Norden. Sie scheinen auf Ringrock nach etwas zu suchen, denn sie fliegen die Insel erst von rechts nach links, dann von links nach rechts ab. Sonnenlicht streicht wie geschmolzenes Gold über das hochwertige Glascockpit der Maschine, die sich in Katies Richtung bewegt. Zwei Schnellboote folgen der Küste nach Nordosten, zwei nach Südwesten. Die restlichen beiden pendeln den Kai entlang hin und her wie eine Patrouille.
Ringrock ist kein Gefängnis. Von einer Strafanstalt würden sowohl Gunner Lindblom als auch andere Einheimische wissen, immerhin wäre das sowohl ein bedeutender lokaler Arbeitgeber als auch ein Grund für Besorgnis.
Höchstwahrscheinlich erlebt sie keine Flucht, sondern ein unerlaubtes Eindringen. Falls es sich bei der Einrichtung um einen Hochsicherheitsbetrieb handelt, würde man beim Auslösen eines elektronischen Alarms genau so reagieren.
Was auch immer gerade geschieht, es geht Katie nichts an. Sie entzieht sich der Gesellschaft Fremder bewusst. Interesse am Treiben anderer zu zeigen würde die Gefahr bergen, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.
Katie hat keine Angehörigen in der Außenwelt. Sie sind alle tot.
Eine ausbezahlte Lebensversicherung und die Erlöse aus dem Verkauf von zwei Häusern haben wesentlich dazu beigetragen, dass sie diese abgelegene, niedrigpreisige Insel kaufen konnte. Und es ist genug übrig, um sie länger zu versorgen, als sie zu leben erwartet.
Als die Suchenden auf Ringrock den Tag mit ihrem hektischen Treiben erschüttern, verlässt Katie den Steg.
Die Felsentaube hat den Pfosten am Fuß der Treppe verlassen.
Als Katie hinaufsteigt, entdeckt sie einen Raben auf der Schornsteinabdeckung. Der Vogel blickt nach Osten, als hätte er den Auftrag, die Nacht in Empfang zu nehmen, die gerade über den Horizont der sich drehenden Welt herbeikriecht.
EINE KLEINE FESTUNG
Joe Smith, der Kriegsveteran und erste Besitzer, der 1946 den Bau des Hauses beaufsichtigt hat, war ein hervorragender Zimmermann. Das Innenleben hat er liebevoll selbst angefertigt. Die Deckenbalken, die Überfälzung dazwischen, die Täfelung aus heimeligem, astigem, glänzendem Kiefernholz – alles so meisterlich konstruiert und zusammengefügt, dass es sich trotz aller Stürme und des Zahns der Zeit weder verzogen noch abgenutzt hat.
Auch die meisten Möbel stammen von ihm, einige aus Kiefer, andere aus Eiche, alle genauso gut erhalten. Der zweite Besitzer, Tanner Walsh, hat lediglich die Bezüge nach seinem Geschmack erneuert, genau wie nach ihm Katie.
Die Kamine aus Stein – einer in der Küche, einer im Wohnzimmer – reichen aus, um das gesamte Haus zu beheizen. Walsh hat es vorgezogen, auf einen umständlichen Holzofen zu verzichten, und stattdessen elektrische Heizgeräte in allen vier Zimmern installiert. Katie hat sie erneuert.
Die unechten Perserteppiche hat sie durch Navajo-Läufer von einem Weber mit einem besonderen Talent für traditionelles Design in weicherer, ziemlich schöner Ausführung ersetzt.
Die Eingangstür – die einzige des Hauses – besteht aus eisenbeschlagenem Eichenholz. Fast acht Zentimeter dick.
Die Flügelfenster sind kleiner, als ihr lieb ist, und gehen nach innen auf. Insektenschutzgitter halten Fliegen und Mücken fern, aber jedes Fenster besitzt zudem je einen vertikalen und horizontalen, fest in einer Betonlaibung verankerten Stahlstab.
In den 1940er-Jahren durfte sich die Nation über eine geringe Verbrechensrate freuen. Selbst heutzutage kommen in dieser abgelegenen Region der unzähligen, dicht beisammenliegenden Inseln so gut wie keine Straftaten vor. Höchstens weiter oben im Archipel nehmen in seltenen Fällen übers Wasser reisende Diebe das eine oder andere Haus ins Visier.
Tanner Walsh hat das Leben von Joe Smith recherchiert und seine eigenen Gedanken über das Haus und die Insel im Jahr vor seinem Tod niedergeschrieben. Da Walsh nicht nur Schriftsteller, sondern auch Mystiker war, vertrat er die Meinung, Joe hätte die Stäbe in Kreuzform beabsichtigt. Diese Überzeugung hat ihn veranlasst, eine Symbolik in nahezu jedem Aspekt des Gebäudes zu sehen.
Katie hält den Grund für die Stäbe für weniger überweltlich. Zum einen lässt sich durch zwei gekreuzte Stahlstäbe mit einem Minimum an Kosten und Aufwand sicherstellen, dass niemand durch ein Fenster eindringen kann.
Zum anderen hat Joe Smith 1945 einem Kontingent angehört, das die Gefangenen in Dachau befreit hat. Was der Bauernjunge aus dem Bundesstaat New York dort mitansehen musste, hat ihn den Rest seines Lebens heimgesucht und dazu getrieben, es abseits der meisten seiner Mitmenschen zu verbringen. 30 Güterwaggons voller verwesender Leichen. Ein »Häutungsraum«, in dem frisch ermordeten Gefangenen sorgfältig die Haut abgezogen wurde, um sie für »hochwertige Lampenschirme« zu verwenden. Eine Dekompressionskammer, in der Experimente über die Auswirkungen von großen Höhen die Probanden in den Wahnsinn getrieben und ihre Lungen zum Platzen gebracht haben. Alles im Namen des Volkes, dem die Behörden eingeredet hatten, es geschehe zur Schaffung einer gerechteren Gesellschaft. In Utopia kann es nie zu viel Gerechtigkeit geben.
Katie betrachtet diesen Ort als Haus am Ende der Welt, als ihre eigene Welt.
EIN KUNSTWERK
Anfangs verhindern die dicken Steinmauern, dass der anhaltende Wirbel auf Ringrock die Ruhe im Haus stört.
Nachdem sich Katie ein Glas feinen Cabernet Sauvignon eingeschenkt hat, beginnt sie nicht sofort, das Abendessen zuzubereiten. Stattdessen nimmt sie den Wein mit in die Waffenkammer.
Sie schnaubt höhnisch über sich, weil sie in Gedanken das Wort Waffenkammer dafür benutzt. In einer Ecke lehnen ungeladen eine Repetierflinte Kaliber 12 mit Pistolengriff und ein AR-15, das Leute, die nichts von Waffen verstehen, oft als Sturmgewehr bezeichnen. Katie besitzt auch einen beträchtlichen Munitionsvorrat für beide.
Den überwiegenden Platz im Raum jedoch nehmen ein großer Zeichentisch mit einem verstellbaren Hocker, eine Staffelei, Schränke mit Künstlerbedarf und ein Sessel ein, auf dem sie sich manchmal niederlässt, um über ein laufendes Projekt zu grübeln.
Neben den drei schlimmsten Ängsten – vor schrecklichen Schmerzen, einer Behinderung und dem Tod – braucht jeder Mensch mindestens einen zusätzlichen Lebensgrund, eine inspirierende Aufgabe. Für Katie ist Kunst seit ihrer Jugend einer ihrer Lebensgründe gewesen. Und seit sie auf der Insel wohnt, ist sie ihre einzige Inspiration geworden.
In jungen Jahren hatte sie eine aufblühende Karriere. Schon im Alter von 22 war sie in bedeutenden Galerien vertreten. Ihre Gemälde wurden zu stetig steigenden Preisen verkauft.
Derzeit erschafft sie Kunst nur für sich selbst, weil es für sie den innerlichen Tod verhieße, nicht kreativ zu sein. Allerdings hat sie nicht vor, je auf den Kunstmarkt zurückzukehren. Sie vernichtet mehr fertige Werke, als sie behält. An den Wänden in diesem Haus hängt kein einziges.
Sie malt rebellisch gegen den abstrakten Impressionismus und alle seelenlosen Schulen der Moderne und der Postmoderne an. Ihr charakteristischer Stil ist der Hyperrealismus, ein Versuch, all das festzuhalten, was ein Foto kann, und viel mehr – was man unterbewusst über eine Szene weiß und sie nicht offenbart; was das Herz über das Motiv vor den Augen empfindet; wie die Vergangenheit in die Gegenwart reicht und die Zukunft real, aber noch verschleiert darüber schwebt; was jeder Moment auf der Erde bedeuten könnte, sofern er überhaupt eine Bedeutung hat.
Mit dem Weinglas in der Hand stellt sie sich vor die Leinwand auf der Staffelei, ein Werk in Arbeit. 1,20 Meter breit, 90 Zentimeter hoch. Das banale Motiv sind drei Ladenfronten eines siebengeschossigen Einkaufszentrums – ein Nagelstudio, eine Eisdiele und eine Pizzeria.
Jeder außer Katie würde das Gemälde als fertig empfinden, ein fotorealistisches Werk mit der Tiefe eines Trompe l’Œil. Für sie jedoch ist es nach wie vor unvollständig. Die harte Arbeit daran wird sie morgen in Angriff nehmen.
Die meisten Künstler würden den Raum als unzulängliches Atelier einstufen.
Sie würden größere Fenster und gutes Licht aus Norden wollen.
Katie wünscht sich nicht mehr, als sie hat. In ihrem geschrumpften Leben ist sie zufrieden damit, bei künstlicher Beleuchtung zu malen. Neuerdings erzielt sie die besten Ergebnisse manchmal von Schatten umgeben, nur mit dem Licht, das sie auf die Leinwand bündelt.
Der Wein schwappt beinahe aus dem Glas, als eine ferne Explosion sie erschreckt. Obwohl sie gedämpft klingt, bringt sie die Fensterscheiben zum Rattern und die Deckenbalken zum Knarren.
UNTERWASSERBOMBEN
Aufgrund von gemeiner Neugier, vielleicht ergänzt um nachklingende Paranoia vom Leben auf dem Festland, interessiert sich Katie für alles Ungewöhnliche, das sich auf dem Wasser tut. Deshalb liegt auf einem kleinen Tisch im Wohnzimmer immer ein leistungsstarkes Fernglas bereit. Sie schnappt es sich, bevor sie nach draußen geht. Als sie die Tür öffnet, vibriert eine zweite gedämpfte Explosion durch den frühen Abend.
Sie eilt durch den Garten, bleibt am Rand der Klippe über dem Ufer stehen und hebt das Fernglas an die Augen. Die Schnellboote mit ihren Außenbordmotoren sind außer Sicht verschwunden.
Über Helikopter weiß Katie nicht so viel, wie sie sollte – oder erinnert sich nicht daran. Das mehrere Hundert Meter von Ringrock entfernt über dem Wasser patrouillierende Fluggerät ist größer als die Maschinen, die zuvor die Insel abgeflogen sind. Es scheint sich um ein Modell ähnlich einem Sea Horse oder Sea Stallion zu handeln. Wie die beiden ersten Hubschrauber weist es kein Logo auf, was es müsste, wenn es zum Militär gehören würde. Allerdings haben nicht viele Privatunternehmen eine Verwendung für Drehflügler solcher Leistung und Ladekapazität.
Im Gegensatz zu den kleineren Helikoptern geht von diesem etwas aus, das in diesem Umfeld keinen Sinn ergibt. Die Besatzung befördert im Flug ein Fass der halben Größe einer Öltonne über die hintere Laderampe aus dem Heck. Als das Objekt etwa 30 Meter tief ins Wasser stürzt und unter die Oberfläche sinkt, bewegt sich der große Hubschrauber weiter. Die Wucht der gedämpften Detonation legt nahe, dass sie innerhalb einer Tiefe von nur ein bis zwei Faden erfolgt. Die Oberfläche des Sees hebt sich an der Stelle, als könnte jeden Moment ein Monster daraus auftauchen. Das Wasser brodelt. Kurz schießt eine Fontäne empor, bevor sie in sich zusammenfällt. Eine weitere Unterwasserbombe wird abgeworfen.
Verblüfft senkt Katie das Fernglas. Sanfte Wellen von der ersten Explosion schwappen gegen die Pfeiler ihres Stegs und an den Kiesstrand.
Ihr fällt keine Erklärung dafür ein, was sie gerade bezeugt. Was greifen diese Leute an? Kein U-Boot könnte in dieses Gewirr von Süßwasserseen eindringen. Außerdem herrscht kein Kriegszustand, und selbst wenn, wäre es höchst unwahrscheinlich, dass diese Gegend je ein Schlachtfeld der Marine würde. Für Übungszwecke eignet sie sich ebenso wenig.
Nach der vierten Detonation scheint erfüllt zu sein, was auch immer zu dieser Torheit angeregt hat. Der Sea Horse – oder was das Fluggerät sein mag – schwenkt zurück in Richtung Ringrock und wirft nichts mehr ab.
Vom nordöstlichen Ende der Insel taucht der größere der beiden früheren Helikopter wieder auf, irgendein Bell, wie er in der Geschäftswelt verbreitet vorkommt. Katie richtet das Fernglas darauf und stellt fest, dass sich neben dem Piloten und dem Co-Piloten zwei Passagiere auf den hinteren Sitzen an Bord befinden. Auf die Entfernung zeichnen sie sich nur als Silhouetten ab. Sie kann nicht erkennen, ob sie Uniformen tragen.
Sie folgt dem Kurs der Maschine, die Sprengkörper abgeworfen hat. Der Pilot beginnt, den Bereich des Gewässers ähnlich abzufliegen, wie es zuvor auf einem Teil der Insel erfolgt ist.
Unten aus dem Bauch ragt ein bisher nicht sichtbares Instrument. Katie kann nur vermuten, dass es sich um verschiedene Sensoren handelt, die nach Beweisen dafür suchen, dass die vier Unterwasserbomben ihren Zweck erfüllt haben.
Ein U-Boot kann hier nicht unterwegs sein – weder ein russisches noch ein chinesisches oder ein von Kapitän Nemo gesteuertes aus der Fantasiewelt von Jules Verne. Also hält man vielleicht Ausschau nach den Leichen von Tauchern.
Welche Untat könnten sie begangen haben? Eindringen trotz der Sicherheitsvorkehrungen der Insel? Flucht mit streng geheimem Material oder Beweisen für Schwerverbrechen?
Der Gedanke mutet wie eine Szene aus einem James-Bond-Film an. Katie kann sich diese verschlafene Inselgruppe beim besten Willen nicht als Schauplatz eines so packenden Dramas vorstellen.
Selbst wenn Taucher versucht hätten, sich unerlaubt Zugang auf Ringrock zu verschaffen, wäre es eine unverhältnismäßige, ja geradezu lächerlich brutale Reaktion gewesen, derart riesige, tödliche Mengen Sprengstoff gegen sie einzusetzen. Das Gesetz sieht in solchen Fällen eine Verhaftung, eine Anklage und ein Gerichtsverfahren vor. Ob die Anlage auf Ringrock nun vom Staat oder von einem Privatunternehmen betrieben wird, in beiden Fällen würden die Verantwortlichen für eine mögliche Anklage wegen überzogener Gewalt mit Totschlag oder Mord als Folge nicht ihre Freiheit riskieren.
Allein der Aufschrei von Umweltschützern, die von Booten oder vom Festland aus die Explosionen miterlebt haben könnten, sollte die Zuständigen auf Ringrock davon abhalten, was sie anscheinend getan haben.
Ungeachtet dessen, was Katie gesehen hat, es muss etwas anderes dahinterstecken. Ihr fehlen entscheidende Informationen, um auf eine logische und vernünftige Erklärung zu kommen.
Der einzige verbliebene Hubschrauber fliegt von rechts nach links und zurück über das in diesem Bereich 90 Meter tiefe Wasser.
Da der frühabendliche Himmel zunehmend dunkler wird, reflektiert der gewaltige See weniger Blau. Unter Katie lecken graue Zungen aus Wasser an den Steinen des Ufers. Jahrhunderte solcher nassen Liebkosungen haben es glatt gewetzt wie den Granit von Grabsteinen.
Die filigranen, mittlerweile golden schimmernden Wolken ziehen über den Himmel wie Zierwerk aus Juwelierdraht.
Aus irgendeinem atmosphärischen oder sonstigen Grund treten Unterbrechungen im Wummern der Helikopterrotoren auf. In den Phasen der Stille entsteht der Eindruck, das Fluggerät hielte sich wie ein Fantasiegespinst ohne jeglichen Antrieb in der Luft.
Die Eigenartigkeit des Augenblicks beschwört das Gefühl herauf, ungeschützt und verwundbar zu sein und sogar beobachtet zu werden.
Wer auch immer auf Ringrock arbeitet – oder lebt und arbeitet –, besitzt zweifellos ebenfalls ein Fernglas. So offensichtlich und laut, wie man sich dort verhalten hat, musste man damit gerechnet haben, dass die Nachbarin neugierig werden würde. Es sollte also kein Problem sein, dass sich Katie umsieht.
Dennoch kehrt sie rasch zum Haus zurück, verriegelt die Tür und greift sich ihr noch nicht ausgetrunkenes Glas Wein.
Katie muss nicht wissen, was diese Leute gemacht haben. Sie gehören jener Welt an, die sie meidet und in die sie nie zurückkehren wird. Katie hat ihre eigene Welt. Nur hier kann sie das von ihr gegebene Versprechen erfüllen.
VERZICHT AUF DAS BETT
Nachdem Katie ein Buch als Zeitvertreib beim Abendessen ausgewählt und auf den Küchentisch gelegt hat, faltet sie im Schlafzimmer die gesteppte Tagesdecke zurück und drapiert sie über die Fußleiste.
Jeden Morgen schüttelt sie die Kissen auf und streicht die Bettwäsche glatt, als wollte sie nicht in Verlegenheit geraten, indem Besucher ein unordentliches Bett zu sehen bekämen.
Seit sie auf die Insel gezogen ist, hat sie noch nie einen Besucher empfangen. Aber das spielt keine Rolle. Standards müssen gewahrt bleiben. Routinen müssen eingehalten werden. Unordnung kann zu Schlamperei und Schlimmerem führen.
Ihre geistige Restgesundheit hängt davon ab, dieses Haus so in Schuss zu halten wie das davor – als wäre es immer noch wichtig. Als könnte jemand, den sie verloren glaubt, wie durch ein Wunder auf ihrer Schwelle erscheinen. Sie muss sogar für Unmögliches gewappnet sein. Keine Vorbereitung kommt keiner Hoffnung gleich.
Als sie die Überdecke und das obere Laken zurückschlägt, ereilt sie ein beunruhigender Gedanke über Ringrock. Was auch immer sich dort abgespielt hat, man hatte damit gerechnet, dass es eines Tages passieren könnte. Man war darauf so gut vorbereitet gewesen, dass man sogar Unterwasserbomben zur Hand hatte.
Ihre Bereitschaft dient dem Schutz geistiger Gesundheit, aber in deren Fall deutet sie darauf hin, dass man sich auf ein wahnsinnig gefährliches Unterfangen eingelassen hat.
EIN KÜNSTLER IST EIN MATHEMATIKER, DER DIE FORMELN DER SEELE KENNT
Drei Wochen vor ihrem 13. Geburtstag ist Katie früher als sonst zu Hause. Die letzten zwei Unterrichtsstunden sind ausgefallen, weil die Heizung in der Schule defekt ist. Sie hält sich allein im Haus auf.
Wie üblich ist sie in einer halben Stunde mit den Hausaufgaben fertig. Mit ihrer großen Zeichentafel auf einem schrägen Brett sitzt sie am Küchentisch und übt, um ihr Geschick mit dem Bleistift zu perfektionieren.
Ruhiges Wasser ist nicht einfach darzustellen, denn es wirkt wie ein Spiegel, der den Himmel, Bäume, Gebäude und Menschen reflektiert. Solche invertierten Bilder werfen verwirrende Probleme der Perspektive auf.
Stilles Wasser lässt sich mit weichen horizontalen Strichen porträtieren. Dabei profitiert der Künstler davon, dass sie eine leichte Verzerrung der reflektierten Bilder bewirken.
Bei einer anderen Technik müssen die Reflexionen durchgehend mit vertikalen Linien gezeichnet werden. Anschließend werden sie strategisch durch einige horizontale Unschärfen unterbrochen, die man mit einem Radiergummi erzeugt, um das stille Wasser eines Teichs zu suggerieren.
Während Katie mit dem zweiten Ansatz kämpft, nervt sie zunehmend das stete Tropfen des Wasserhahns in der Küche. Jedem Tropfen folgt ein widerhallendes Plonk, wenn er auf das Spülbecken aus Edelstahl trifft.
Katie stellt sich an die Spüle und setzt sich mit dem Problem auseinander. Sie hält eine Hand unter den Wasserhahn. Der Tropfen, der auf ihre Haut trifft, fühlt sich warm an.
»Dir werd ich’s zeigen«, droht sie dem Wasserhahn an, denn das hat ein gemeines Mädchen vor einigen Wochen in der Schule zu ihr gesagt.
Jener Kampf hat unentschieden geendet. Aber nur, weil Mr. Conklin, ein Lehrer, dazwischengegangen ist. »Katie, du überraschst mich«, sagte er damals zu ihr. Sie war davor noch nie in eine Rauferei verwickelt gewesen. Aber das hat er nicht gemeint. Das andere Mädchen ist zwei Jahre älter, größer und gilt als taffstes Miststück der Mittelschule. Trotzdem war Katie am Gewinnen. Das hat Conklin überrascht.
Katie geht in die Garage, wo ihr Vater eine Werkbank und Werkzeugschränke hat. Sie holt sich, was sie zu brauchen glaubt.
Ihr Vater ist ein geschickter Heimwerker. Ein paarmal hat sie ihm bei Reparaturen zugesehen, aber nicht oft.
Sie geht … nun ja, intuitiv vor.
Zuerst stellt sie unter dem Spülbecken die Wasserversorgung ab. Dann dreht sie den Wasserhahn auf, um sich zu vergewissern, dass es funktioniert hat. Nach einigen wenigen Tropfen kommt nichts mehr.
Sie entfernt den Griff des Wasserhahns. Mit einem verstellbaren Schraubenschlüssel lockert sie die Kontermutter vom Vorbau. Danach schraubt Katie sie von Hand heraus und legt sie beiseite.
Die Armatur sitzt fest im Vorbau. Um sie zu entfernen, rüttelt sie leicht daran und zieht gleichzeitig kräftig nach oben.
Wäre sie elf Jahre alt, würde sie an der Stelle vielleicht die Zuversicht verlieren und aufhören. Aber sie wird bald 13.
Mit einem Schraubenzieher löst sie die Befestigungsschraube des verschlissenen Dichtungsrings und zwängt ihn heraus.
Als Nächstes platziert sie den neuen Dichtungsring im Vorbau und achtet darauf, dass die abgeschrägte Seite zum Armaturensitz weist. Den Begriff Armaturensitz kennt sie nicht, aber das ist auch nicht nötig. Katie muss nur wissen, wie das Zusammenspiel funktioniert, und das tut sie.
Sie befestigt den neuen Dichtungsring mit der Schraube, die sie anzieht, bis sie den Ring leicht zusammendrückt. Dann stülpt sie die Armatur wieder über den Vorbau. Mit dem verstellbaren Schraubenschlüssel zieht sie die Kontermutter fest. Und bringt den Griff an. Anschließend dreht sie die Wasserversorgung unter dem Spülbecken auf. Es funktioniert.
Nachdem sie das Werkzeug an seinen Platz zurückgebracht hat, setzt sie sich wieder an den Küchentisch und kehrt zum Versuch zurück, stilles Wasser mit Grafitstiften darzustellen. Der Wasserhahn lenkt sie dabei nicht länger ab, weil er nicht mehr tropft.
An jenem Abend beim Essen lächelt Katies Mutter ihren Vater an und meint: »Ach, danke übrigens, dass du endlich den Wasserhahn repariert hast.« Als er erwidert, dass er noch nicht dazu gekommen ist, verkündet Katie, dass sie es war. Ihre Mutter zeigt sich angemessen erstaunt.
Ihr Vater hingegen nicht. »Sie ist eine Künstlerin.«
»Ja«, pflichtet ihre Mutter ihm bei. »Aber keine Klempnerin.«
Die Antwort ermutigt ihren Vater, philosophisch zu werden, was er gern tut. Zum Glück nicht so oft, dass er peinlich wird. »Du weißt ja, dass Musik und Mathematik eng miteinander verwandt sind. Tatsächlich ist Musik eine Form von Mathematik. Viele Musiker besitzen eine natürliche Begabung für Trigonometrie und dergleichen.«
Katies Mutter tätschelt ihr die Hand, um zu verdeutlichen, dass sie es nicht abwertend meint, als sie entgegnet: »Ich denke, die qualvollen Klavierstunden beweisen, dass unsere Kleine keine geborene Musikerin ist.«
»Muss sie auch nicht sein«, erwidert Vater. »Dafür besitzt sie ein außergewöhnliches Talent als bildende Künstlerin. Ich will darauf hinaus, dass für mich zweifelsfrei jeder große Künstler – ob Musiker, Maler, Bildhauer oder Dichter – auf unterbewusster Ebene zugleich Mathematiker, Zimmermann, Maurer und Ingenieur ist. Große Künstler verstehen intuitiv, wie die Welt aufgebaut ist, wie sie funktioniert und wie sich Menschen am besten in sie fügen. Dadurch können sie Schönheit schaffen – sie durchschauen die Wahrheit hinter den Dingen. Ein Künstler ist ein Mathematiker, der die Formeln der Seele kennt. ›Schönheit ist wahr und Wahrheit schön.‹«
Mutter seufzt. »Wenn die Klimaanlage wieder mal kaputtgeht, rufe ich Andrew Wyeth an.«
»Ein unbestreitbar guter Mann. Aber ich fürchte, er ist tot.«
»Wie nennt man das Teil, das auf dem Dichtungsring aufliegt?«, fragt Katie dazwischen.
»Armaturensitz«, antwortet ihr Vater.
»Vielleicht werde ich ja besser darin, Wasser zu zeichnen, wenn ich die Namen all der Einzelteile kenne.«
Im Verlauf der Jahre findet sie Gefallen daran, zu lernen, wie man Dinge repariert. Nur manches kann man nicht reparieren. Als sie schließlich so geschickt ist, dass sie niemanden mehr braucht, wird sie sich fragen, ob es von Geburt an ihr unausweichliches Schicksal war, allein auf Jacob’s Ladder zu leben.
JALOUSIEN
An jenem Vormittag hat Katie sechs Hähnchenbrüste gebraten. Sie hat sie einzeln in Plastiktüten versiegelt und im Gefrierschrank eingelagert.
Nun schneidet sie die sechste Hähnchenbrust würfelig, hackt Spargel und zerteilt mehrere rohe Pilze. Auf einem Papiertuch tauen tiefgefrorene Zuckererbsen auf. Sie verfrachtet alles in eine Schüssel, bevor sie Olivenöl und Gewürze hinzufügt. In einem Topf mit kochendem Wasser wird eine Tüte Butterreis mit Rosinen erhitzt.
Dunkelorangefarbenes Licht schillert draußen vor den Fenstern mit den Kreuzstäben.
Katie schenkt sich ein zweites Glas Wein ein, verschließt die Flasche, nimmt das Glas mit in die Diele, öffnet die Eingangstür und tritt nach draußen. Im Osten geht das dunkelsaphirblaue Firmament allmählich auf Schwärze zu. In der kurzen Zeit ihres Besuchs des Zwielichts dort hat sich der Himmel im Westen zu Blutorange verdunkelt.
Obwohl mit der Dämmerung auf dem Boden Windstille eingetreten ist, zerfranst ein Höhenwind die Wolken. Sie wirken nicht mehr wie ein Filigran, sondern wie eine dunkle Schliere irgendeiner unangenehmen organischen Substanz.
Es sind keine Hubschrauber in der Luft. Falls Boote den See befahren, haben sie keine Scheinwerfer eingeschaltet.
Ringrock erstrahlt in schillernder Pracht, ein extravagantes Lichterspiel. Noch nie zuvor hat Katie die Insel auch nur ein Zehntel so hell erleuchtet gesehen. Sie hätte nicht mal vermutet, dass es dort eine solch verschwenderische Fülle an Scheinwerfern geben könnte.
Verwirrt und leicht beunruhigt steht sie vor ihrer Tür. Man hat den Eindruck, als wären dort drüben sämtliche Lampen eingeschaltet worden, um jeden Winkel besser sehen zu können.
Durch Mutmaßungen wird sie nicht schlauer. Und obwohl sie wenig zu verlieren hat, ist für sie kostbar, was ihr geblieben ist. Das will sie nicht aufs Spiel setzen, indem sie sich Neugier hingibt. Die Regeln werden heutzutage in Amerika von Leuten aufgestellt, die Wissbegierde mit Aufdringlichkeit gleichsetzen. Neugierige werden als Störenfriede bezeichnet, für die man keinen Respekt und wenig Gnade kennt.
Katie kehrt in ihr Haus zurück und verriegelt die dicke Eichenholztür.
Sie geht von Zimmer zu Zimmer und lässt an allen Fenstern die Faltjalousien herunter. Dazu treibt sie nicht das Spektakel auf Ringrock an. Es entspricht ihrer Routine, die Nacht jeden Abend durch die Jalousien nach draußen zu verbannen.
In den mehr als zwei Jahren, die sie schon hier lebt, hat sich bisher niemand uneingeladen auf die Insel gewagt, zumindest nicht dass Katie wüsste. Sie hat noch nie ein Gesicht an einem Fenster gesehen. Bei ihren unzähligen ausgedehnten Spaziergängen über ihre mehr als 50 Hektar ist sie bislang nie auf fremde Fußabdrücke gestoßen.
Das Ritual der Jalousien ist wohl eher symbolischer als praktischer Natur. Unterbewusst schließt sie etwas anderes aus als die Aufmerksamkeit möglicher Eindringlinge. Was es sein könnte, muss sie erst noch herausfinden.
ABENDESSEN MIT DAPHNE
Die Küche umfasst eine Essecke mit einem Tisch und vier Stühlen. Die Möbel sind hübsch und robust. Joe Smith hat sie nach seiner Rückkehr aus dem Krieg angefertigt.
Hier nimmt Katie ihre Mahlzeiten ein, immer auf demselben Stuhl, der mit der Rückenlehne zur Wand steht und einen Blick auf den gesamten gemütlichen Raum bietet.
Joe hat nie geheiratet und sein ganzes Leben allein verbracht. Er hatte keine Verwendung für vier Stühle. Trotzdem hat er drei zusätzliche gebaut. Vielleicht ein Ausdruck von Hoffnung.
Manchmal fragt sich Katie, ob er womöglich vorhergesehen hat, dass sie ein Dreivierteljahrhundert später hier einziehen und alle vier Esszimmerstühle gebrauchen können würde.
Obwohl sie zum Abendessen oft Musik hört, greift sie bei dieser Gelegenheit auf keine ihrer CDs zurück. Ob Mozart oder Beethoven, sie würde nur versuchen, durch die Klänge hindurch auf nächtliche Geräusche von draußen zu lauschen.
Beim Abendessen liest sie immer. Wenn die linke Seite nach rechts klappen will, benutzt sie einen kleinen blaugrauen, am Ufer gefundenen Stein, um sie zu beschweren.
Obwohl sie alles von Dickens und Dostojewski schon mehr als einmal gelesen hat, wird sie es wieder lesen. Jane Austen, Balzac, Joseph Conrad. Die Selbstgefälligkeit und irrwitzige Intensität von James Joyce’ Vorurteilen kann sie nicht ausstehen. Ihre Abneigung gegen die Werke aller Nihilisten schränkt ihre Leseliste zusätzlich ein.
An diesem Abend hat sie sich für leichtere Kost entschieden, für eine von Daphne du Mauriers Novellen, »Die gespaltene Sekunde«. Die Autorin ist zwar in erster Linie eine Geschichtenerzählerin, dennoch besitzen ihre Werke mehr Tiefe, als ihnen Leute zugestehen, die für sich beanspruchen, Kunst zu definieren.
Du Maurier zeigt Mitgefühl für das Leid anderer, meidet aber Sentimentalität. Ihre Geschichten sind oft düster, driften jedoch nie ins Nihilistische ab. Sie weiß, dass wahres Mitgefühl edel und anspruchsvoll ist. Zärtlichkeit hingegen ist eine eitle Form von Mitleid, auf die Menschen zurückgreifen, die sich gut fühlen wollen, ohne etwas Unbequemes dafür tun zu müssen.
In den letzten Jahren ist diese Unterscheidung für Katie wichtig geworden.
Auf halbem Weg durch die etwa 50 Seiten der Novelle wird sie mit dem Essen fertig. Sie spielt gerade mit dem Gedanken an ein seltenes drittes Glas Wein, als die Stille von einem hohen Summen gestört wird, das wie ein gewaltiger Schwarm zorniger Wespen klingt. Es geht nicht von der Küche aus.
Ihr Blick fällt erst auf eine Jalousie, dann auf eine andere, bevor sie sich vom Stuhl erhebt, als das Summen anschwillt. Als sie in die Mitte des Raums tritt, stellt sie fest, dass der durch die Fenster dringende Laut auch durch den Schornstein herabhallt.
Lauschend steht sie da und analysiert erfolglos, bevor sie schnell zur Besteckschublade neben dem Kochfeld geht. Zusätzlich zu einigen Messern für kulinarische Zwecke enthält sie auch eine 9-Millimeter-Glock. Diese Pistole und eine weitere im Nachttisch neben dem Bett im Schlafzimmer sind für den Fall einer Krisensituation vorgesehen, die sich zu schnell entwickelt, um an die Waffen im Atelier zu gelangen. Abgesehen von Schießübungen und zum Reinigen holt Katie sie zum ersten Mal heraus.
Neben der Pistole befindet sich außerdem eine 45 Zentimeter lange Hochleistungstaschenlampe.
Auch sie wird der Schublade entnommen.
Als Katie die Eingangstür erreicht, ist das Geräusch noch lauter geworden. Ja, es ist ein Summen, allerdings begleitet von einem Kreischen so dünn wie Papier, aber so durchdringend wie ein Diamantbohrer.
Sie löst erst den oberen Riegel, dann den unteren und zögert nur einen Moment, bevor sie die Tür öffnet.
SUCHER
Katie bevorzugt es, die Pistole beidhändig zu halten. Allerdings ist der Mond noch nicht aufgegangen, und die verrückte Lichtshow auf Ringrock spielt sich über drei Kilometer entfernt ab. Ihre Insel liegt in nahezu vollständiger Dunkelheit, deshalb braucht sie die Taschenlampe.
Sie ist überzeugt davon, die Glock auch mit einer Hand effektiv bedienen zu können. Immerhin trainiert sie regelmäßig mit Gewichten für genug Muskelmasse, um den Rückstoß mühelos zu bewältigen, und den festen Griff ihrer Hände erhält sie durch Übungen mit einem harten Gummiball.
Niemand springt ihr entgegen. Ein Schwenk des Lichtstrahls offenbart, dass ihr auch niemand auflauert. Das Geschehen spielt sich über ihr ab.
Die leistungsstarke Taschenlampe erhellt einen Schwarm in Bewegung. Mechanisch und seltsam. Rädchen. Streben. Eine Anordnung von vier Rotoren. Stabilisatoren. Antennen. Möglicherweise Infrarotkameras zur Erfassung von Wärmesignaturen. Ganz sicher Befestigungen für Sensoren, die etwas anderes als visuelle Faktoren erkennen.
»Drohnen«, sagt sie, obwohl sie solche Modelle noch nie zuvor gesehen hat. Etwa sechs bis acht Meter über dem Haus bewegen sie sich langsam nach Nordosten. Trotz des Lichts der Taschenlampe lassen sich ihre Abmessungen schwer abschätzen, aber sie scheinen groß zu sein, mindestens anderthalb Meter im Durchmesser, vielleicht sogar zwei.
Sie fliegen wie in einer Phalanx, parallel zueinander. Auch als Katie den Strahl verengt, um die Leuchtkraft zu bündeln, fehlt der Taschenlampe die Reichweite, um zu bestätigen, was sie vermutet – nämlich dass die Fluggeräte eine durchgehende Reihe über die gesamte Breite der Insel bilden, mindestens 30 oder 40 davon. Das würde auch den Geräuschpegel erklären.
Auf dem Weg über das Gelände steigen sie zum Vermeiden der Bäume höher auf.
Unwillkürlich läuft Katie los, um den Drohnen zu folgen, denn sie wird vom plötzlichen Drang überwältigt, eine davon abzuschießen. Die Größe, die Komplexität und die schiere Anzahl der Fluggeräte scheinen den Beweis zu liefern, dass die Verantwortlichen auf Ringrock ein außergewöhnliches Projekt betreiben. Und offensichtlich hat jemand von ihren Leuten oder ein Eindringling etwas von enormer Bedeutung gestohlen. Etwas, an das man durch das Hacken ihrer Computer herankam. Man will den Dieb um jeden Preis aufspüren und glaubt offenbar, er könnte es bis nach Jacob’s Ladder geschafft haben, bis zu Katies Insel, ihrem Zuhause. Sie fühlt sich misshandelt. Man scheint sie einem Risiko ausgesetzt zu haben. Und wenn die Verantwortlichen wie so viele andere skrupellose, heimtückische Mistkerle sind, werden sie leugnen, was sie getan haben. Sie werden die Wahrheit mit allen Mitteln vertuschen. Wenn sie sich jedoch eine Drohne holen kann, hat sie einen Beweis.
Sie wünschte, sie hätte das Kaliber 12 mit dem Pistolengriff dabei. Eine Doppelladung Schrot würde eine Drohne sicher rasch zum Absturz bringen.
Als Katie die Phalanx überholt hat, lässt sie die Taschenlampe fallen und ergreift die Glock mit beiden Händen. Sie schiebt in annähernd gleichschenkeliger Haltung einen Fuß nach vorn, den anderen nach hinten und versteift die Arme. Wie alle Drohnen weist auch die vorderste keine Beleuchtung auf, trotzdem zeichnet sie sich als erkennbare graue Kontur vor dem schwarzen Himmel ab. Katie wartet, bis das Fluggerät sie passiert hat, bevor sie erst einen Schuss abfeuert, dann einen zweiten – einen dritten überlegt sie sich anders.
Die Chancen, dass die Regierung die Anlage auf Ringrock betreibt, entweder direkt durch das Militär oder in Zusammenarbeit mit einem Privatunternehmen oder einer Universität, liegen bei mindestens 50:50, wahrscheinlicher bei 80:20. Und bisher hat Katie vom Justizsystem in seiner gegenwärtigen Form keine Gerechtigkeit erfahren. Wenn sie eine sündteure Drohne der Regierung abschießt und dafür vor Gericht landet, besteht wenig Hoffnung zu triumphieren, zumal die Bundesbehörden bekanntermaßen die tiefsten Taschen auf dem Planeten besitzen. Sie könnte alles verlieren – ihre Insel und eine Zeit lang sogar ihre Freiheit.
Wenn es dazu käme, könnte sie ihr Versprechen nicht einhalten. Und das ist der einzige Grund, warum sie jeden Morgen aufsteht und sich durch den Tag kämpft. Das Versprechen bedeutet ihr alles.
Frustriert senkt sie die Pistole. Sie beobachtet, wie die präzise angeordneten Drohnen langsam nach Nordosten verschwinden. Mit jedem Meter Entfernung zeichnet sich weniger Grau ab, bis die Maschinen mit der Schwärze verschmelzen. Die Motoren und Rotoren dröhnen weiter durch die Nacht, mittlerweile nicht mehr sichtbar. Die Geräusche suchen die Wälder heim wie verzweifelte Geister, die nicht den Weg aus dieser Welt finden, obwohl ihre einstigen Körper längst verwest sind.
Vom dunklen Wasser geht Kälte aus. Die schwache Brise riecht nach Schlamm vom Strand, Kreosot vom Steg und etwas, das Katie nicht zu benennen vermag.
Sie hebt die Taschenlampe auf und kehrt zum Haus zurück. Auf halbem Weg bleibt sie stehen, dreht sich um und schwenkt den Lichtstrahl über das Gelände. Obwohl die Drohnen das Gebiet anscheinend abgesucht und nichts entdeckt haben, spürt Katie … eine Gegenwart. Dennoch scheint weit und breit niemand zu sein.
Südsüdwestlich schillert Ringrock nach wie vor hell erleuchtet wie ein abendlicher Vergnügungspark.
DER MYSTIKER
Katie wäscht den Teller vom Abendessen und die Küchenutensilien ab und verstaut alles.
Der insektenartige Chor der Drohnen ist nur noch schwach zu hören und dennoch beunruhigend. Ein entferntes Geräusch, das man im Traum für bloßen Tinnitus halten könnte, gleichsam eine Warnung, dass der Übergang zu einem Albtraum bevorsteht.
Die Speisekammertür steht offen. Katies Aufmerksamkeit richtet sich auf einen an der Innenseite befestigten Kalender. Ostern ist vorbei, Passah zu Ende. Die Quadrate mit Daten darin sagen ruhige Wochen voraus. Das aufregendste Ereignis in nächster Zeit ist der Vollmond in zwei Tagen.
Katie traut der erfreulichen Prognose nicht länger. Nach den ersten zwei Monaten auf der Insel hat sie zu glauben begonnen, sie könnte sich dem Zugriff des Bösen entzogen haben. Über zwei Jahre hat sie sich sicher gefühlt. Die Ereignisse an diesem Tag haben diese Zuversicht erschüttert. Sie schließt die Speisekammertür.
Was geschehen ist, hat für lange Zeit in ihr schlummernde Ängste wachgerüttelt. Schlimmer noch, sie nagen an ihr. Katie versucht immer, Zorn zu vermeiden, denn er reitet Einzelne in die Selbstzerstörung und ganze Nationen in den Ruin. Sie spielt mit dem Gedanken, ihr Handy für etwas anderes als eine Bestellnachricht an Hockenberry Marine Services zu verwenden. Zum Beispiel für einen Anruf beim Sheriff oder bei der Seeaufsicht. Nicht um sich zu beschweren. Katie will nicht zu viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Sie könnte sich als besorgte Bürgerin geben und beiläufig erwähnen, dass sie hoffe, bei all dem Tumult auf Ringrock – den Explosionen und dem Himmel voller Drohnen – sei niemand verletzt worden. Vielleicht erfährt sie dadurch etwas Beruhigendes, das es ihr ermöglicht, die Nacht durchzuschlafen.
Aber nein. Ein drittes Glas Wein, das sie sich selten gestattet, ist weniger riskant und wirkungsvoller als ein Telefonat.
Während sie sich den Cabernet einschenkt, fallen ihr Tanner Walshs Aufzeichnungen ein. Plötzlich erscheint ihr etwas relevant, das sie vor langer Zeit darin gehört hat.
Walsh hatte sich vom Großteil seiner Verwandtschaft entfremdet. Deshalb hinterließ er sein gesamtes Vermögen einer fragwürdigen Wohltätigkeitsorganisation, die Rechtsbeistand für bedürftige, mutmaßlich zu Unrecht der Misshandlung älterer Menschen beschuldigte Personen bereitstellte. In seinen Aufzeichnungen brachte er solchen Hass auf seine Eltern zum Ausdruck, dass er sich vielleicht gewünscht hatte, sie hätten lange genug gelebt, um auf ihn angewiesen zu sein. Dann hätte er die Gelegenheit erhalten, sie zu misshandeln. Katie hält es für durchaus möglich, dass sich sein Verständnis für ähnliche Fälle sogar auf Angeklagte erstreckt hat, denen man vorwarf, Familienstreitigkeiten nach Art von Lizzie Borden beigelegt zu haben.
Die Leiter der gemeinnützigen Stiftung interessierten sich vor allem für die Bankkonten ihres Wohltäters und die Erlöse aus dem Verkauf von Walshs Insel und Boot. Weniger scharf darauf waren sie, jemanden herzuschicken, der seine Kleidung und andere persönliche Gegenstände beseitigt hätte. Darunter befanden sich 106 einstündige Audiokassetten. Darauf hat Walsh alles Mögliche aufgezeichnet, von seinen ökologischen Beobachtungen auf der Insel bis hin zu Gedanken über Themen wie Reinkarnation, Poltergeister, Astralprojektion und spontane menschliche Selbstentzündung.
In den ersten Wochen hat sich Katie einige der Aufnahmen angehört, danach jedoch ist ihr Interesse geschwunden. Walsh war leichtgläubig wie ein Kind, allerdings ohne den Charme der Unschuld. Selbstherrlich. Eingebildet. Keine gute Gesellschaft, obwohl man ihn durch Umlegen eines Schalters zum Schweigen bringen kann.
Trotzdem hat sie die Bänder nicht entsorgt. Denn so töricht Walsh zu sein scheint, Katie ist bewegt von einer gewissen Verwundbarkeit unter seiner Großspurigkeit. Er war nicht weniger menschlich als sie. Mehr als hundert Stunden seiner Überzeugungen über den Sinn seines Lebens wegzuwerfen … würde sich zu sehr anfühlen, als spülte sie seine Existenz selbst in der Toilette runter. Für sie ist es ein empfindlicher Punkt, wie wenig Wert manche Menschen heutzutage dem Leben anderer beimessen.
Die Mikrokassetten sind in vier Schuhkartons in der obersten Ablage des Schranks in der Diele verwahrt. Katie holt sie zum Küchentisch.
Walsh hat jede Kassette thematisch beschriftet. Er hat sie in vier Kategorien eingeteilt und jeder einen eigenen Karton gewidmet. Mein Leben vor Jacob’s Ladder,Inselleben,Literatur und Übersinnliches.
Tanner Walsh war unter anderem Schriftsteller – und dabei vom Glück gesegnet. Sein Erstlingswerk namens Orchideen im Winter wurde vom Moderator einer Fernsehsendung für dessen medial aufgebauschten Buchclub ausgewählt. Drei Millionen gebundene Ausgaben wurden förmlich aus den Verkaufsregalen gerissen. Bei einer erbitterten Auktion wurden Filmrechte daran versteigert. Das Buch wurde in 40 Sprachen übersetzt. Angeblich hat ihm Orchideen insgesamt über 20 Millionen Dollar eingebracht.
Zwei Jahre lang verkehrte er mit Literaten und der Elite Hollywoods, gab auf Bühnen seine Meinung über alles von postmoderner Poesie bis hin zu Politik kund und besuchte schillernde Partys sowohl in den USA als auch in Europa. Dann kaufte er die Insel und gab die Absicht bekannt, sich ein Jahr lang ausschließlich seiner Kunst zu widmen. Auf dem ersten Band im Karton mit der Aufschrift Literatur referiert Walsh allein in dieser Küche für die Nachwelt über den großen amerikanischen Roman, der demnächst aus ihm hervorsprudeln wird. Es ist die einzige Aufnahme dieser Kategorie, die sich Katie in einem Zustand morbider Neugier von Anfang bis Ende anhören konnte.
Sein zweiter Roman hielt sich eine Woche in der Bestsellerliste, verkaufte sich 40.000 Mal und erhielt schlechte Kritiken. Sein dritter schaffte es nie auf die Liste, stagnierte bei 15.000 Exemplaren und wurde wüst verrissen. Sein vierter Roman fand keinen Verleger mehr.
Die ursprünglich als Einkehr eines Künstlers erworbene Insel wurde mit der Zeit zu seiner Zuflucht vor Spott und Demütigung. Nach der vernichtenden Aufnahme seines dritten Buchs verließ er sie kaum noch.
Das Band, an das sich Katie erinnert, befindet sich in dem Karton mit der Aufschrift Inselleben. Sie sieht die Kassetten durch, liest die Etiketten und wählt die mit dem Titel Beobachtungen des Sees aus.
Das Diktiergerät befindet sich im selben Karton, allerdings ohne Batterien. Sie holt zwei des Typs AA aus einer Küchenschublade. Das damit bestückte Gerät erweist sich als zuverlässig.
Katie lauscht, wie Walsh beschreibt, dass er ein Boot an Oak Haven Island vorbeifahren gesehen hat. Dabei schimpft er wüst über die nautischen Fähigkeiten des Steuermanns. Sie spult vor, horcht, spult zurück, hört etwas Pseudopoetisches über das Spiel des Morgenlichts auf dem Wasser des Sees, springt erneut vorwärts, wieder zurück, lauscht. So macht sie weiter, bis sie findet, woran sie sich erinnert.
Walshs Stimme klingt dabei nicht so aufgeblasen wie sonst manchmal. Tatsächlich schwingt darin der gehetzte Ton eines Mannes mit, der allmählich die Unzulänglichkeit seiner lange gehegten Sicht der Welt erkennt. »Ich frage mich, ob Jacob’s Ladder mich zum Mystiker gemacht hat. Reinkarnation, Bilokation, Besessenheit – ich sehe für all das eine Grundlage und Relevanz. Es muss an der Isolation liegen. Das ist zwar besser als der verkommene New Yorker Literatursumpf, trotzdem ist es Isolation. Der Geist will die Leere füllen, indem er über Dinge nachdenkt, die er davor als versponnen erachtet hat. Und wie seltsam ist es, von Wasser umgeben zu leben? Wie geflutet von der Ungerechtigkeit, die meine Hoffnungen und Ambitionen ertränkt hat. Letzte Nacht hatte ich einen Traum wie noch keinen anderen in meinem Leben. So lebendig. Fesselnd. Zutiefst verstörend. Ich habe davon geträumt, zu schlafwandeln. Wie ein Geist ging ich durch die dicke Eichenholztür und hinunter zum Steg, wo ich hinüber zu Ringrock geschaut habe. Die sanfte Beleuchtung, die dort sonst nachts schimmert, war erloschen. Die ferne Insel hat wie verlassen gewirkt. Nein, schlimmer als das. Im Traum hatte ich den Eindruck, ich müsste in der Unterwelt sein, das Wasser vor mir wäre der Styx, und Charon, der Fährmann, würde bald kommen, um mich ins Land immerwährender Finsternis zu bringen. Trotzdem hatte ich keine Angst. Irgendetwas hat beruhigend nach mir gerufen, aber nicht mit Worten. Wie soll ich es beschreiben? Ich habe mich gewollt gefühlt. Allerdings nicht so, wie uns der Tod mit seiner blutigen Sense und seinem knochigen Grinsen will. Eher … gebraucht. Nein, mehr als gebraucht – geschätzt. Im Traum trat ich vom Steg und konnte auf dem Wasser stehen. Dann ging ich nach Ringrock los wie Jesus Christus höchstpersönlich. Ich konnte das kühle Nass sanft wogend unter den nackten Füßen spüren, aber es hat mich getragen. Mit jedem Schritt hat sich in mir eine bebende Freude ausgebreitet, zugleich jedoch eine unterschwellige Angst, und ich sagte laut: ›Da drüben ist das Land der Toten. Und ich bin noch nicht bereit zu sterben.‹ Dann wusste ich, wiederum ohne Worte, dass auf Ringrock jemand für tot gehalten wurde, der es nicht war. Und wenn ich die etwa drei Kilometer über das Wasser zu der Insel liefe, würde ich dort etwas tun können, um ihm zu helfen. Etwas, das meinem Leben mehr Sinn als je zuvor verleihen würde. Aufgeregt ging ich schneller. Meine Freude wuchs – bis ich mich daran erinnerte, wie mein Vater mir als erst fünf Jahre altem Jungen das Schwimmen beibringen wollte, indem er mich vom Ufer in einen sehr tiefen Teich warf. Ich dachte daran zurück, wie er ins Wasser gekommen war, mich rausgezogen hatte, als ich fast ertrunken wäre, und mich dann erneut hineingeworfen hatte, wieder und wieder. Mein Traum von Ringrock wurde zum Albtraum über jenen Teich von damals und meinen Vater. Irgendwann bin ich panisch aufgewacht und habe mich in den Laken gewunden, als wären sie die Arme meines Vaters, dieses hasserfüllten, verfluchten Drecksacks.«
Walsh ist aufgebracht und klingt beinahe atemlos. Er nimmt sich einen Moment Zeit, um sich zu sammeln, bevor er fortfährt.
»Heute Morgen konnte ich meine Hausschuhe nicht finden. Wie seltsam, wenn die Pantoffeln nicht neben dem Bett stehen, wo sie sonst jeden Morgen sind. Ich konnte mich nicht erinnern, wo ich sie gelassen hatte. Nach dem Anziehen habe ich mir eine Kanne starken jamaikanischen Kaffee gebraut und damit meinen großen Lieblingskrug gefüllt, der Kaffee genauso gut warm hält wie Bier kalt. Ich wollte hinunter zum Wasser, mich dort auf den Liegestuhl setzen und die selige Beschaulichkeit des Sees meine Alpha-Wellen fördern lassen. Danach würde ich mich an die Arbeit an dem Buch machen, das beweisen würde, wie sehr sich die kurzsichtigen Kritiker in mir geirrt haben. An der Tür musste ich feststellen, dass sie nicht verriegelt war. Auch nach all den ereignislosen Jahren auf Jacob’s Ladder schließe ich die Tür ausnahmslos jede Nacht ab. Ich werde nicht vergesslich. So alt bin ich noch nicht. Und dennoch – erst die Pantoffeln, dann das Türschloss. Nicht unbedingt besorgt, aber verwirrt ging ich hinunter zum Steg – und, mein Gott, dort waren meine Pantoffeln. Seite an Seite, als wäre ich herausgestiegen. Als hätte ich tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, auf das Wasser zu treten. Ich ließ mich auf dem Stuhl nieder, trank meinen Kaffee und starrte abwechselnd auf die Pantoffeln, das Wasser und Ringrock. Dabei fragte ich mich, ob ein Teil meines Traums echt gewesen war. Hatte ich wirklich geschlafwandelt? Ich wurde immer beunruhigter. Eigentlich bin ich ein Mann unvergleichlicher Selbstbeherrschung, unerschütterlich wie ein Panzer. Niemand, der in einem Dämmerzustand durch die Gegend wandert. Nach einer Weile zog ich fahrig meine Schuhe und Socken aus, um meine Füße zu begutachten. Ich dusche immer vor dem Schlafengehen, um morgens schnell in die Gänge zu kommen, da die Muse eine anspruchsvolle Herrin sein kann. Deshalb hätten die Fußsohlen sauber sein müssen, waren aber stark verdreckt – als hätte ich tatsächlich im Tiefschlaf den Steg aufgesucht, meine Pantoffeln dort zurückgelassen und wäre barfuß ins Haus zurückgekehrt. Die Erkenntnis erschreckte mich zutiefst. Ich konnte den ganzen Tag nicht an meinem Roman arbeiten. Je länger ich darüber nachdenke, desto stärker gelange ich zur Überzeugung, dass dieses seltsame Erlebnis mehr als ein Traum, mehr als Schlafwandeln gewesen sein könnte. Mir scheint beinahe, ein Wesen aus einem höheren Reich hätte zu mir gesprochen und mich irgendwie für eine besondere Aufgabe auserwählt. Was mich nicht überraschen würde. Aber welche Aufgabe?«
Das Band endet. Das Diktiergerät schaltet sich automatisch ab.
Katie macht es wieder an und spult ein Stück vor den Beginn der Passage zurück, die sie sich gerade angehört hat. Walsh nennt in der Regel zuerst das Datum, an dem er seine Weisheit auf Band verewigt hat. So auch in diesem Fall. Die Aufnahme ist vier Monate vor Katies Kauf der Insel entstanden.
Wenn sie sich recht erinnert, ist Tanner Walsh in jenem Monat gestorben.
EINE NACHRICHT VON DEN TOTEN
Katie hat sich Tanner Walshs Bericht über das Schlafwandeln vor mehr als zwei Jahren zum ersten Mal angehört. Damals hat sie der Geschichte wenig Bedeutung beigemessen. Nur ein Mann, den der Absturz von Berühmtheit in Vergessenheit verbittert hatte, verstärkt durch die Jahre der Isolation. Vermutlich etwas verschroben und geschlagen mit einem Hang zur Selbstdarstellung. Nach den Ereignissen auf Ringrock und der Drohnenstaffel, die von dort gekommen sein muss, hallen seine Worte anders in ihr wider als zuvor.
Sie vermutet, dass es eine Folgeaufzeichnung geben muss. Bestimmt hat Walsh weiter über das Ereignis sinniert, durch das er sich für »eine besondere Aufgabe auserwählt« gehalten hat. Sie sieht die Kassetten durch, bis sie auf eine mit der Beschriftung Träume stößt.
Die Aufnahme ist zwei Tage nach der letzten auf der vorherigen Kassette angefertigt worden. Im Anschluss an eine ereignislose Nacht hatte Walsh in der nächsten erneut den Traum, von jemandem nach Ringrock gerufen zu werden, der »dort für tot gehalten wurde, es aber nicht war«. Wie zuvor hat er geschlafwandelt, diesmal vom ersten Schritt an barfuß.
»In dem Traum schwebte ich plötzlich mitten in der Nacht über dem Haus. Dann flog ich über die Wälder, steuerte mit den Armen und geriet in einen Zustand der Verzückung wie in Träumen vom Fliegen, die viele Teenager erleben. Unnötig zu erwähnen, dass ich einen derart berauschenden Traum seit Jahrzehnten nicht mehr genossen hatte. Irgendwann stand ich dann gute zehn Meter über dem Haus in der Luft und schaute in Richtung Ringrock. Wie zuvor fühlte ich mich von jemandem auf jener Insel gebraucht und verstanden. Der Unbekannte schätzte meinen Wert wie noch niemand in meinem Leben. Wortlos rief er nach mir. Wenn ich ihm zu Hilfe käme, würde mir die Gabe des Fliegens dauerhaft gehören, und ich würde das Ansehen wiedererlangen, das mir eigentlich immer zugestanden hatte. Das wusste ich. Ich schwebte vor dem Haus zu Boden. Diese Macht war mir nur zur Veranschaulichung verliehen worden. Um sie mir zu verdienen, musste ich Ringrock aus eigener Kraft erreichen. Ich kann gar nicht ausdrücken, wie emotional der Traum war, wie erwünscht, geschätzt und geliebt ich mich gefühlt habe. Und dennoch … Dennoch fühlte ich mich unter der Euphorie, vermutlich auf der Ebene der Instinkte, zugleich bedroht. Nichtsdestotrotz stand ich da, erfüllt von einer intensiven Sehnsucht nach Ringrock – und als ich erwachte, stellte ich fest, dass ich mich nicht im Garten, sondern barfuß am Kieselstrand befand, wo Wasser über meine Zehen schwappte. Als mir klar wurde, dass ich mir das Fliegen eingebildet hatte, verpuffte meine Ekstase. Angst überwältigte mich. Besäße ich nicht einen so glasklaren, messerscharfen Verstand, würde ich vielleicht an meiner geistigen Gesundheit zweifeln. Aber wenn hier etwas absonderlich ist, dann bin es nicht ich. Sondern Ringrock. Einheimische haben mir erzählt, dort sei eine Anlage der Umweltschutzbehörde untergebracht, die ein Jahr vor meinem Kauf von Jacob’s Ladder fertiggestellt wurde. Vielleicht. Aber wenn ich online in öffentlichen Aufzeichnungen darüber recherchiere, scheint es keine solche Anlage auf Ringrock zu geben. Irgendetwas stimmt nicht. Es wäre wohl nicht verkehrt, so viel wie möglich über den Ort in Erfahrung zu bringen. Sobald ich diese Aufnahme beende, werde ich aufs Festland zur Bezirksverwaltung reisen und nachsehen, was man dort an Aufzeichnungen über diese mysteriöse Insel hat. Ich habe das Gefühl, mich hat irgendeine außergewöhnliche Macht als Schriftsteller mit hinlänglichem Talent auserwählt, um aus diesem Material ein Buch von einzigartiger Bedeutung zu erschaffen.«
Als die Aufnahme endet, schaltet Katie das kleine Gerät aus. Eine lange Weile starrt sie darauf. Schließlich schaut sie erst zu einem Küchenfenster mit heruntergelassener Jalousie, dann zum anderen. Sie nippt an ihrem Wein.