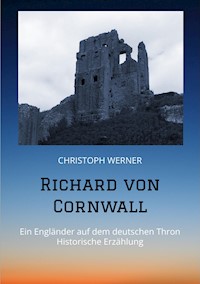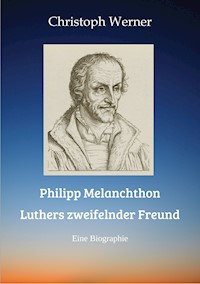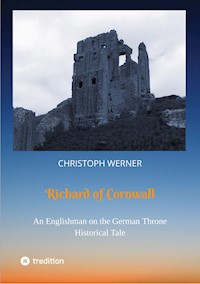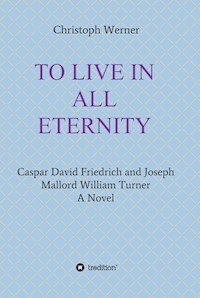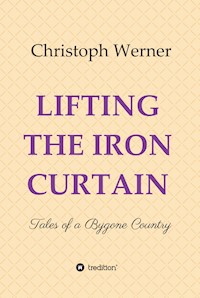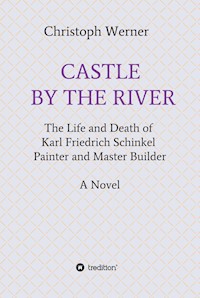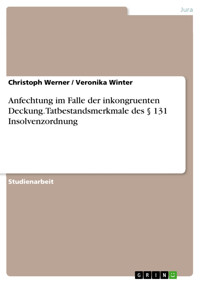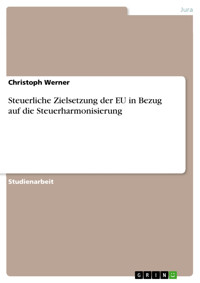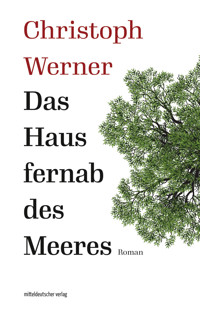
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mitteldeutscher Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Bei einem Segeltörn verliert Paul seinen Zwillingsbruder; Rosas Familie wird nach dem Versuch, über die Ostsee in den Westen zu fliehen, auseinandergerissen; Hagen hat am Ende des Zweiten Weltkriegs nur sein eigenes Leben retten können. Der Zufall bringt die drei im „Haus fernab des Meeres“ zusammen. Was sie verbindet, sind die Verluste, die sie erlitten haben. Aber kann aus gleichem Unglück wirklich Freundschaft entstehen, wie das Sprichwort sagt? Oder bringt Unglück immer nur eines hervor: Unglück? Christoph Werner erzählt mit ruhigem Ton eine große Geschichte von untergegangenen Ländern und scheiternder Liebe. Er zeigt, wie das Sprechen und das Schreiben beim Verarbeiten persönlicher Trauer helfen können. Am Ende dieses Wegs kann dann unvermittelt Trost stehen, die Heilung der seelischen Wunden besitzt aber ihren ganz eigenen Rhythmus …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 322
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christoph Werner wurde 1964 in Dessau geboren. Als Theaterregisseur hat er in allen Genres gearbeitet. Zahlreiche Preise auf einschlägigen Festivals, Tourneen durch Europa, Amerika und Asien dokumentieren seine Arbeit. Er war Intendant des Schauspielhauses in Halle (Saale) und des internationalen Festivals „Theater der Welt“. Seit 26 Jahren leitet er das vielfach preisgekrönte Puppentheater in Halle (Saale).
Seine Stücke erscheinen im Verlag Hartmann & Stauffacher, im Mitteldeutschen Verlag erschien seine Erzählung „Josefs Geschichte“, im Osburg Verlag der Roman „Marie Marne und das Tor zur Nacht“.
Christoph Werner ist verheiratet und hat drei Kinder.
1. Auflage
© 2023 mdv Mitteldeutscher Verlag GmbH, Halle (Saale)
www.mitteldeutscherverlag.de
Alle Rechte vorbehalten.
Gesamtherstellung: Mitteldeutscher Verlag, Halle (Saale)
Umschlagabbildung: © shutterstock.com – NikhomTreeVector
ISBN 978-3-96311-821-0
Inhalt
Prolog
Erster Teil
Zweiter Teil
Dritter Teil
Vierter Teil
Von Anfang bis Ende
Prolog
Wenig Wind, die Luft flirrt, das Wasser klatscht kraftlos an den Bootsrumpf, alles will uns täuschen, in Sicherheit wiegen, einlullen.
Wir segelten auf der Müritz von Rechlin nach Boek, etwa zweihundert Meter von der Uferkante entfernt. Ich saß am Heck, einen Arm lässig auf der Pinne und döste, Jonas, bäuchlings am Bug, war in seine Gedichte vertieft. Die Gewitterwolken am Horizont hatten wir natürlich bemerkt, aber sie waren weit weg und dazu noch in Lee. Also hatten wir die Segel oben, als die erste Böe uns traf. Sie war wie ein gezielter Schlag, der uns aus unserer Trägheit riss. Wir sprangen auf, reagierten schnell: Aussteuern, Großschot los – aber wir bekamen sofort Schlagseite. Vorschot los …, da schleifte der Großbaum schon fast durchs Wasser. Wir versuchten in den Wind zu steuern, aber der Wind drehte und drehte und dann kippten wir um. Sturmböen aus dem Nichts kommend, Blitze, Hagelschauer, Sicht bis zum nächsten Wellenkamm. Die „Henrietta“ trieb neben mir, richtete sich langsam auf – und sank! Ich hielt mich am Mast fest, solange es ging, dann musste ich kämpfen. Kein Laut, kein Gedanke an irgendjemanden oder -etwas, nur rasende Angst und der Wille zu überleben …
Erster Teil
I
In jenem Sommer war alles ungewiss, bis Rosa mir wieder begegnete. Zu der Zeit wohnte ich in einer schlecht isolierten Dachgeschosswohnung, die direkt neben einem Krankenhaus lag und deren Miete auch 1994 noch lächerlich niedrig war. Den ganzen Sommer hörte ich nachts die Sirenen der Rettungsfahrzeuge. Ihr fiebriges Heulen schnitt in meinen dünnen Schlaf und dehnte die Stunden. Nur mit einem Laken zugedeckt, wälzte ich mich auf meiner Isomatte, bis das Gezwitscher der Vögel einen neuen, endlosen Tag ankündigte, durch den ich trieb, unruhig, matt, planlos.
Morgens saß ich zwei, drei Stunden einfach in meinem Sessel und starrte aus dem Fenster hinab auf die Front des gegenüberliegenden Hauses, die frisch gestrichen worden war und in makellosem Weiß erstrahlte, sodass mir nach einigem Hinsehen die Augen wehtaten und ich helle Punkte sah, wenn ich danach den Blick abwendete. Ich stellte mir vor, dass ich nachts über die Straße gehen und einen Eimer schwarzer Farbe auf die Hauswand kippen würde. Später kam ich auf die Idee, die Farbe in kleine Gläser zu füllen und sie vielleicht über mehrere Tage und Nächte verteilt von meinem Fenster aus auf die andere Straßenseite zu werfen. Aber als ich mir das Ergebnis eine Weile lang vorgestellt hatte, begriff ich, dass die schwarzen Spritzer die Intensität des weißen Putzes wahrscheinlich nur verstärkt hätten. Der Kontrast war einfach zu groß. Ich probierte vor meinem inneren Auge andere Farben aus, aber immer mit dem gleichen Ergebnis: Die weiße Fläche war unantastbar. Sie strahlte mich an. Sie war von einer undurchdringlichen, makellosen Gleichgültigkeit, die mich lähmte. Ich saß da, unfähig mich zu bewegen, mich zu waschen, zu frühstücken, mich anzuziehen. Erst wenn die Glocken der nahen Pauluskirche zwölf schlugen, gelang es mir, mich loszureißen und aus dem Haus zu gehen.
Den ganzen Tag trieb ich mich im Stadtpark herum. Auf den Wiesen lagen die Mädchen und sonnten sich. Jungen spielten Fußball. Mit hochroten Köpfen rannten sie zwischen den Bäumen hin und her, die ihre Torpfosten waren, verfolgt von ausgelassenen Hunden, die die tollsten Sprünge vollführten. Auf den Wegen flanierten junge Mütter, die langsam ihre Kinderwagen vor sich herschoben, während die Kleinen tollpatschig neben ihnen her stolperten. Alte Männer hatten sich feuchte Tücher auf die Stirn gelegt und dösten im Schatten der Bäume oder spielten Boccia. Und dort, auf einer der Wiesen nahe dem Fluss, traf ich Rosa nach zwei Jahren wieder. Zunächst bemerkte ich sie nicht, als ich auf dem Weg Richtung Innenstadt lief und sie mir von der Mitte der Wiese zuwinkte. Ich fühlte mich nicht gemeint, denn in der Zeit meines Fortseins hatte sich vieles verändert und ich hatte bisher niemanden getroffen, den ich von früher her kannte. Erst als sie beide Arme schwenkte, blieb ich stehen und sah zu ihr hinüber. Noch immer zögernd, beschirmte ich die Augen mit der Hand, da kam sie schon auf mich zugelaufen und fiel mir um den Hals. Sie hielt mich umklammert und sagte nach einer Weile: „Wo warst du denn die ganze Zeit?“ Es klang fast ein bisschen gekränkt, so als seien wir verabredet gewesen und ich hätte mich verspätet. Ihr Haar duftete so gut, dass ich beschloss, mein Gesicht für den Rest meines Lebens darin zu vergraben. Als sie sich von mir löste, sah ich sofort, dass irgendetwas sie verändert hatte. Sie war nicht einfach nur älter geworden, etwas war in ihr oder mit ihr vorgegangen. Als Rosa bemerkte, wie ich sie ansah, schaute sie kurz zu Boden. Dann gab sie mir einen Kuss auf die Wange und überschüttete mich mit Fragen: „Wieso hast du dich nie gemeldet? Seit wann bist du wieder da?“
Ich fing an zu erzählen, wohin es mich in den letzten zwei Jahren getrieben hatte, dabei versuchte ich, sie dadurch zu beeindrucken, dass ich selbst die aufregendsten Orte, an denen ich gewesen war, so beiläufig wie möglich erwähnte. Rosa tat mir den Gefallen und rief an den richtigen Stellen „Ah“ und „Oh“ oder „Das ist nicht wahr?“. Sie lachte und ich sah ihre kleinen Grübchen, sie riss ihre braunen Augen auf und schüttelte ungläubig den Kopf. Dann strich sie sich ihr herrliches, immer wirr zusammengestecktes Haar aus dem Gesicht und führte mich zu dem Platz, an dem ihre Sachen lagen. Dort setzten wir uns und rauchten und ich erzählte weiter. Es sprudelte aus mir heraus, ich konnte nichts dagegen tun, und während ich sprach, merkte ich plötzlich, dass ich traurig wurde. Ich musste sprechen, um nicht in Tränen auszubrechen. Das verwirrte mich. Was war auf einmal los mit mir? Wieso war mir nach Heulen zumute? Lag es an Rosa? Daran, dass ich sie wieder getroffen hatte? Oder an etwas anderem? Ich wusste es nicht, aber ich wollte auf keinen Fall, dass sie merkte, was mit mir los war, ehe ich selber eine Ahnung davon hatte. Und dann traf mich die Erkenntnis wie ein Schlag: Ich fühlte mich einsam. Das war es, kein Zweifel, ich fühlte mich mutterseelenallein, von allen verlassen, fremd in dieser Stadt, in die ich zurückgekehrt war, um mich endlich nicht mehr fremd zu fühlen. Deshalb starrte ich den halben Vormittag auf die weiße Wand, deshalb trieb ich mich stundenlang im Stadtpark herum, deshalb brachte ich nichts Richtiges zustande, hatte keine Ideen, konnte nicht schreiben. Es war eine klare und mächtige Erkenntnis. Gleichzeitig spürte ich ein unbändiges Verlangen, Rosa zu umarmen, mich mit ihr auf der Decke herumzuwälzen, sie zu streicheln, zu küssen, mit ihr zu ringen. Und um dieses Verlangen zu unterdrücken, redete ich noch schneller, bis ich sah, dass sie einen kurzen verstohlenen Blick auf ihre Armbanduhr warf.
„Und du? Was hast du gemacht?“, fragte ich, weil ich Angst hatte, dass sie gehen wollte. „Warst du die ganze Zeit hier?“
„Irgendwie schon“, sagte sie. „Ich bin deinem Beispiel gefolgt und habe mich ebenfalls exmatrikulieren lassen …“ Sie machte eine Pause und rauchte.
„Und dann?“, fragte ich.
„Habe ich mich an der Kunsthochschule hier beworben und studiere Bildhauerei.“
„Was? Das ist … das ist ja großartig“, stammelte ich. Sie lächelte und ich sah, dass sie es genoss, meine Überraschung zu sehen. Bildhauerei, ein Kunststudium, sie hatte getan, was ich nicht schaffte, sie war nicht fortgelaufen, nicht vor ihrer Vergangenheit, nicht vor ihrer Zukunft.
„Entschuldige, aber ich muss jetzt los.“
Der Satz versetzte mich in Panik: „Was?! Wohin musst du denn?“, rief ich lauter, als ich gewollt hatte. „Kann ich nicht mitkommen? Zuschauen, wie du bildhauerst oder so? Ich habe Zeit, mehr als mir lieb ist, bitte.“
Rosa sah mich nicht an, als sie antwortete: „Ich muss meine Tochter abholen.“
„Deine Tochter …?“ Das war es also, was sie so verändert hatte. Sie hatte ein Kind und wahrscheinlich auch einen Mann. Vielleicht war sie sogar verheiratet. Scheiße, verdammte! Wut sprang mich an, ich verspürte das dringende Bedürfnis zu fluchen.
„Bist du verheiratet?“, fragte ich.
Rosa lachte kurz auf. „Nein“, sagte sie, als sei es völlig abwegig, an so etwas überhaupt zu denken. „Ich wohne mit Marie in einer schönen Villa, und dort habe ich auch mein Atelier. Ich schreibe dir die Adresse auf. Hast du ein Telefon?“
Ich nickte.
„Dann schreib mir deine Nummer auf die Hand und ich rufe dich an. Ich bin genauso froh, dass wir uns wiedergetroffen haben, wie du, glaub mir.“ Sie hielt mir ihre Hand hin, ich schrieb meine Telefonnummer und meine Adresse darauf und dabei sah ich, dass sie immer noch an den Fingernägeln kaute. Dann gab sie mir einen flüchtigen Kuss auf die Wange und stürmte davon. Wahrscheinlich war sie viel länger geblieben, als sie gedurft hätte. Ich musste unbedingt herausfinden, wer der Vater ihres Kindes war.
II
Nachdem Rosa gegangen war, stürmte ich ziellos durch den Park. Eine leichte Panikattacke trieb mich an. Seit dem Tod meines Bruders überfiel mich manchmal das Gefühl, etwas tun zu müssen, ohne zu wissen was und wie und dann geriet ich in Panik. Damals, als ich klitschnass am Strand der Müritz entlanggelaufen war, auf der Suche nach Jonas, war das verständlich gewesen, aber jetzt? Was glaubte ich jetzt tun zu müssen?! Im Laufe der Jahre hatte ich mir diese Frage oft gestellt. Mein Atem beschleunigte sich, weil mir nichts einfiel. Denk nach, Paul, sei kein Idiot! Ich lief schneller, was nicht wirklich hilfreich war. Stopp! Es ging um Rosa! Na klar, ich hatte sie gerade wiedergefunden und jetzt war sie schon wieder fort. Ich hatte sie gehen lassen, statt mich an sie zu klammern. Warum war ich nicht vor ihr auf die Knie gefallen und hatte sie angebettelt, nicht fortzugehen? Warum war ich überhaupt von ihr fortgegangen? Warum war ich mit dem alten VW Derby, den ich mir 1992 gekauft hatte, Richtung Italien gefahren? Warum hatte ich an jeder Mautstation mit klopfendem Herzen meinen DDRAusweis gezeigt, war die Adriaküste runtergefahren, die Mittelmeerküste wieder rauf, dann die Côte d’Azur entlang, durch Frankreich, Belgien, Holland zurück nach Deutschland-West, hatte als Kellner in Hamburg gearbeitet, als Gemüsefahrer in Münster, als Zeitungsverkäufer in Frankfurt am Main und am Schluss als Filmvorführer in einem kleinen Programmkino in Berlin, das irgendwann pleiteging? Warum das alles, wenn ich jetzt wieder hier stand, und sich im Grunde nichts geändert hatte? Wenn ich genauso verloren, hilflos und einsam war wie nach dem Tod meines Bruders. Ein paar Panikattacken, ein paar Wutanfälle im Straßenverkehr, ein paar aufregende Begegnungen, lange Abende am Meer, viel Heimweh, zwanzig Kilo Kummerspeck und ein halb fertiges Manuskript, das war die Ausbeute der letzten zwei Jahre.
Am Seeräuberspielplatz sank ich ins Gras und schaute den Kindern zu. Die Sonne stand im Zenit. Eine dumpfe Mittagsruhe hatte sich im ganzen Park, ja in der ganzen Stadt ausgebreitet. Da waren zwei Jungs, die selbstvergessen im Sand spielten. Der eine füllte die Förmchen, gab sie dem anderen, der sie ausleerte, offensichtlich nach einem genau festgelegten Plan, denn er überlegte nie lange.
Das waren wir, Jonas und ich, irische Zwillinge, im gleichen Jahr geboren, er im Januar, ich im Dezember. Und tatsächlich waren wir oft für echte Zwillinge gehalten worden, weil meine Mutter es liebte, uns die gleichen Hosen und Pullover anzuziehen. Wenn es etwas gab, das ihr gefiel, kaufte sie es einfach zweimal. Darüber zu streiten, war uns die Sache nicht wert, nicht, solange wir Kinder waren. Ich musste lächeln, denn die beiden kleinen Kerle da auf dem Spielplatz vor mir hatten auch ähnliche Sachen an, obwohl das eher ein Zufall zu sein schien. Als wir so alt waren, hatten wir uns noch ein Zimmer geteilt, hatten täglich Fußball gespielt, später Tischtennis und Federball, wir schwammen und tauchten und fuhren Fahrrad. Alles, was ein Junge können musste, habe ich von meinem Bruder gelernt. Natürlich ist er ein Jahr eher in die Schule gekommen, hat ein Jahr vor mir den Moped Führerschein gemacht, konnte alles immer etwas früher als ich, aber doch nicht so viel früher, dass er schon vergessen hatte, wie es sich anfühlte, in die Schule zu kommen oder Fahrrad fahren zu lernen. Er war immer kurz vor mir, er zeigte mir, was mich erwartete. Durch ihn war mein Weg weniger unbestimmt. Er ging vor mir her, aber nur so weit, dass ich ihn immer im Blick behalten konnte.
Ja, wir haben uns gestritten und ja, meine Erinnerungen an ihn haben sich längst verklärt. Klar hat er mich manchmal überredet, irgendwelchen Blödsinn zu machen, den er selber sich nicht traute. Wahrscheinlich dachte er, ich würde das nicht merken, aber ich merkte es natürlich. Es hat mir Spaß gemacht, etwas zu tun, wofür ihm der Mut fehlte. Ich wusste, mir wurde eher verziehen als ihm. Ich war ja der Kleinere. Aber wann, wann war diese großartige Zeit vorbei? Diese goldenen Jahre, in denen wir so eng zusammen waren, niemanden brauchten, uns wortlos verstanden? Es waren die Gedichte, die Literatur, es war dieser Pfarrer, der Jonas plötzlich unter seine Fittiche nahm. „Man muss seinem Stern folgen“, hatte Jonas eines Tages gesagt, nachdem er diese Geschichte von Albert Camus gelesen hatte, in der sein Name vorkam: „Jonas oder der Künstler bei der Arbeit“. Plötzlich wollte er Schriftsteller werden und nicht mehr Tischtennis spielen. Ich verstand das nicht damals, dass er sich auf einmal dafür interessierte, für Gedichte. Und die Gedichte habe ich auch nicht verstanden, jedenfalls die meisten. Was ich verstand, war, dass wir bald jeder unseren eigenen Weg würden gehen müssen. Dass seiner so jäh und so früh endete, hat meinen so sehr verändert. Er soll in dem Sturm die Orientierung verloren haben und in die falsche Richtung geschwommen sein, das hat uns die Polizei gesagt. Aber warum? Warum? Er hat sie doch immer vorgegeben, die Richtung, in all den Jahren. Und dann, in einem Moment, in diesem einen Moment … ich musste mich zwingen, ruhig zu atmen.
Mein T-Shirt war verschwitzt, deshalb zog ich es aus. Da war er, mein gepolsterter Bauch. Seit Jonas’ Tod hatte ich deutlich sichtbar zugenommen. Ich trieb keinen Sport mehr, und wenn ich merkte, dass ich traurig wurde, dann briet ich Salami in brauner Butter und schwenkte gekochte Nudeln darin. Das war unser Belohnungsessen gewesen, wenn wir vom Fußballspielen kamen oder nass und halb erfroren vom Skifahren. Ohne Fußball oder Ski war es kein Belohnungsessen, sondern Teil eines Beruhigungsrituals, das ich meistens nachts vollzog und das nicht folgenlos blieb. Ich packte eine Hautfalte mit Daumen und Zeigefinger und drückte sie zusammen. Mein Gott, was war aus mir geworden? Früher hatte ich die Statur eines Marathonläufers gehabt, jetzt sah ich teigig aus. Obwohl sich die zwanzig Kilo auf meine 1,80 Meter verteilten, hatte ich manchmal den Eindruck, das meiste davon habe sich in meinem Gesicht angesammelt, denn wenn ich in den Spiegel schaute, sah es so aus, als ob mein Gesicht eingetaucht wäre in eine weiche Masse. Meine Augen drohten darin unterzugehen, ich ähnelte einem wohlgenährten Baby. Vielleicht stimmte das, vielleicht konnte ich durch den Tod meines Bruders nicht wachsen, blieb ich immer siebzehn Jahre alt, so alt wie ich war, als er starb. Das war wahrscheinlich Blödsinn, aber seitdem geriet ich leicht in Panik, wenn Unvorhergesehenes passierte. Dann rastete ich aus, ich wollte etwas kaputt machen, jemanden schlagen, rumschreien, meinen Kopf an die Wand hauen, damit ich diese Ohnmacht nicht spüren musste.
Bei meiner Mutter waren es Weinkrämpfe, die sie ohne jede Vorwarnung überfielen. Es konnte überall passieren. Anfangs hatte mein Vater sie dann immer in den Arm genommen, aber jetzt saß er einfach neben ihr und wartete, bis es vorbei war.
Ich ließ mich auf den Rücken fallen, streckte alle viere von mir und streichelte das Gras. Der Himmel war strahlend blau, kein einziges Wölkchen. Mein Atem ging wieder ruhig. Ich hätte ewig so liegen können. Müde war ich nicht, wütend auch nicht, die Attacke war vorbei und ich konnte ohne Angst meine Gedanken kreisen lassen.
Wann hatte ich meine Eltern das letzte Mal besucht? Das war ewig her und ich nahm mir vor, bald zu ihnen zu fahren. Vielleicht hatte eine meiner zahlreichen Tanten Geburtstag, oder ein Onkel, irgendein Familienfest war doch immer, das wäre ein Anlass, nach Hause zu fahren, ohne mit meinen Eltern allein sein und ihre Überfürsorglichkeit ertragen zu müssen. Wenn ich zurückdachte, bestand meine Kindheit und Jugend aus einer ununterbrochenen Abfolge von Familienfeiern. Immer hatte jemand Geburtstag, ging eine Cousine zur Erstkommunion, heiratete eine der zahlreichen Schwestern meines Vaters, wurde ein neuer Cousin getauft. Dazu kamen die christlichen Feste, Mariä Verkündigung, Weihnachten, Dreikönigsfest, Mariä Lichtmess, Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag, Ostern, Christi Himmelfahrt, Pfingsten, Fronleichnam, Mariä Himmelfahrt, Allerheiligen und so fort. Immer spielte ich in Sonntagskleidung mit meinem Bruder und meinen Cousins und Cousinen irgendwo, im Garten meiner einen Großeltern, in der Wohnung meiner anderen, auf der Straße vor unserem Haus oder im Hof irgendeines Onkels. Und immer kam der Moment, in dem meine Mutter schimpfte, weil wir uns dreckig gemacht hatten.
Die beiden kleinen Kerle vor mir auf dem Spielplatz fingen an, ihre so sorgsam platzierten Sandkuchen zu zertrampeln. Dabei lachten sie laut und gerieten in eine Art Zertrampelrausch, der erst endete, als nichts mehr von ihrem Werk zu sehen war. Dann rannten sie davon. Ich setzte mich auf und sah ihnen nach. Irgendwo aus der Stadt wehte der Wind Glockengeläut zu mir herüber und ich musste daran denken, wie wir als Messdiener manchmal in den Kirchturm gestiegen waren. Der Mutigste von uns hatte sich auf die größte Glocke gestellt, sich an den Griffen, die vom Gießen übriggeblieben waren, festgehalten, und die Glocke mit seinem Körpergewicht zum Schwingen gebracht. Wir anderen mussten den Mund weit aufmachen und warten, bis der Klöppel an den Glockenrand anschlug. Bong! Wieso erinnerte ich mich heute daran? Eine komische Wehmut hatte mich überfallen. Der Geruch von Weihrauch, das Orgelspiel am Ende der Messe, die dunkle Kirche, in die der Priester zur Osternacht rief: „Lumen Christi“, das Licht, das von Kerze zu Kerze sprang, während die Gemeinde antwortete: „Deo gratias.“ An all das musste ich plötzlich denken. Die Gespräche nach dem Hochamt vor dem Hauptportal, der Geruch der frisch gewaschenen Gewänder, die ich als Messdiener anziehen durfte und das Glücksgefühl nach jeder Beichte.
Ich merkte, dass ich bei diesen Gedanken anfing zu lächeln. Und doch, das alles war dahin, untergegangen mit der „Henrietta“, dem 20er-Jollenkreuzer meines Onkels Harald, unseres Lieblingsonkels, Oberarzt an der Charité, der ältere Bruder meiner Mutter. Ich habe ihn verehrt und geliebt, aber seit dem Unglück nicht mehr gesehen. Und seitdem bin ich in keine Kirche mehr gegangen. Ich ertrage diese ganze verlogene Scheiße nicht mehr, dieses Gesülze und diese verblödete Demut: „Wir bitten dich, erhöre uns.“ Die Religion soll uns vor dem Abgrund schützen, in den wir blicken, wenn wir über den Zufall nachdenken. Wir beten, wir flehen zu Gott und sagen, seine Wege seien unergründlich, weil wir es nicht ertragen, dass unser Leben vom Zufall regiert wird. Aber der Zufall ist überall, er ist launisch, einfallsreich, erbarmungslos – er ist allmächtig.
III
Ich fing an, mein Zimmer aufzuräumen und die Tapete von den Wänden zu reißen. Ich brauchte ein Liebesnest und keine Gefängniszelle. Am Abend wollte ich Rosa anrufen, aber sie kam mir zuvor.
„Paul, was machst du, schreibst du gerade?“
„Nein, ich sitze neben dem Telefon und warte, dass du anrufst.“ Sie lachte.
„Willst du kommen, wir grillen heute Abend.“
„Wer, wir?“
„Hagen, Elena und ich.“
„Wer ist Hagen und wer Elena?“
„Hagen ist der Mann, bei dem ich wohne, und Elena ist seine Haushälterin.“
Es gefiel mir nicht, dass sie ihn Hagen nannte. Herr Sowieso wäre mir lieber gewesen.
„Gut, ich komme. Wann?“
„Der Grill wird gleich angeheizt.“
„Also gleich.“
„Wenn du willst, ja.“
„Natürlich will ich.“
„Gut, also bis gleich.“
„Warte! Wo denn? Wo ist die Villa?“
Sie fing an, mir den Weg zu erklären, aber leider kann ich mir Straßennamen nicht merken und deshalb nützte es nichts, wenn sie sagte, an dieser oder dieser Straße musst du links abbiegen. Ich bat sie, mir die Adresse zu geben. Ich wollte selber auf der Karte nachschauen. Ich überlegte, was ich anziehen sollte, und entschied mich für Jeans und ein dunkelblaues T-Shirt.
Die Villa lag auf einem kleinen Hügel auf der anderen Seite des Flusses. Rings um das Gelände führte ein schmiedeeiserner Zaun, der aufwendig restauriert worden war. Vorne, an der Ecke des weitläufigen Grundstücks, stand ein alter Holzpavillon. Ich fuhr eine Weile herum, weil ich die Zufahrt nicht fand. Sie lag in einer kleinen Seitenstraße, das Tor stand offen, aber ich klingelte vorsichtshalber, weil ich nicht wusste, ob das Gelände von einem Hund bewacht wurde. Es gab keinen Hund. Rosa kam mir entgegen. Sie trug ein langes, goldgelbes Baumwollkleid und hohe Schuhe mit dicken Absätzen, wie sie in den Siebzigerjahren modern gewesen waren. Sie sah wirklich fabelhaft aus.
„Was ist? Warum kommst du nicht herein? Du bist doch sonst nicht so schüchtern.“
„Ich dachte, es gibt vielleicht einen Hund.“
„Nein, keinen Hund, du weißt doch, dass ich Hunde nicht leiden kann.“ Sie küsste mich flüchtig und schenkte mir ein Lächeln.
Das Gelände war noch schöner, als man es von der Straße aus sehen konnte. Ein großer, düsterer Park mit altem Baumbestand, von Efeu überwuchert und leicht hügelig. Auf einer kleinen Wiese vor dem Haus steckten hüfthohe Fackeln in der Erde, unter einem weißen Baldachin war ein großer Tisch festlich gedeckt, alles sehr romantisch. Vor dem qualmenden Grill stand ein Mann mit einer Grillzange. Er hatte volles, schlohweißes Haar, ein kantiges Gesicht mit dunklen, weit auseinanderliegenden Augen. Es war unmöglich, sein Alter zu schätzen, er konnte sechzig sein oder fünfundsiebzig, bei Männern wie ihm machte das keinen Unterschied. Als er mich sah, lächelte er. Es war das Lächeln eines Premierministers oder Präsidentschaftskandidaten. Um seine Augenwinkel bildeten sich tausend Fältchen und sein großer Mund wurde noch größer.
„Hagen“, er hielt mir seine lange, schlanke Hand hin. „Ich freue mich, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind.“ Seine Stimme klang wie summende Lkw-Reifen, kein Zweifel, er war der Mann, um den eine ganze Nation trauern konnte.
„Rosa hat mir von Ihnen erzählt“, säuselte er weiter, „und ich wollte Sie kennenlernen.“
Er wollte mich kennenlernen. Ich hatte keine Ahnung, was er damit meinte.
„Willst du sie sehen?“, fragte Rosa beiläufig.
„Wen?“
„Marie.“ Ich brauchte einen Moment, bis ich begriff, dass sie ihre Tochter meinte.
„Ja, klar, unbedingt. Sie entschuldigen uns“, sagte ich artig zu Hagen.
„Ja, ja, gehen Sie nur. Und sagen Sie Elena, sie kann die Steaks jetzt bringen.“
Rosa ging schnell vor mir her. Sie war aufgekratzt, das merkte ich, und als ich die Villa betrat, begriff ich warum. In der Empfangshalle hätte man Walzerturniere veranstalten können. Links führte eine Treppe mit schwarz gebeiztem, wuchtigem Holzgeländer zu den oberen Stockwerken, Säulenimitate ragten an den Wänden empor und links und rechts der Tür, die in den Garten hinaus ging, standen kindsgroße Skulpturen.
Unten unzählige Durchgangszimmer mit bodentiefen Fenstern, Parkettfußboden und Stuckdecken, die Türen zweiflügelig, mit kunstvollen Blendrahmen verziert. Alte Einbauschränke gekonnt kombiniert mit modernen Designermöbeln, wundervolle Jugendstillampen und eine Sitzgruppe aus Rattan, die südländisches Flair verbreitete. Es gab eine Bibliothek und eine Art Herrenzimmer mit Sesseln von Le Corbusier und einem riesigen offenen Kamin. Ich schaute in alle Räume, denn so etwas hatte ich bisher noch nirgendwo gesehen. Meine Bruchbude konnte mit diesem Märchenschloss nicht mithalten, egal, wie lange ich sie sanierte. Ich begriff, dass ich ein solches Haus niemals hätte herrichten können, selbst wenn ich das Geld dazu gehabt hätte. Mir fehlte die Erfahrung von Luxus, der Umgang damit. Wer war dieser Hagen, woher hatte er so viel Geld und einen so sicheren Geschmack? Und wieso ließ er Rosa hier wohnen? Dass sie sich ein solches Haus zur Miete leisten konnte, war doch unwahrscheinlich.
„Hast du im Lotto gewonnen? Wie sonst könntest du diesen Palast bezahlen?“
Rosa zuckte mit den Schultern und ich merkte, dass sich ihr Gesicht leicht rötete. Was hatte das zu bedeuten?
„Hagen ist mein Mäzen“, sagte sie, griff nach meiner Hand und zog mich weiter. In der Küche, die so groß war, dass man dort eine Fußballmannschaft hätte verköstigen können, stand eine kleine, runzlige Frau mit krummen, in Orthopädieschuhen steckenden Beinen. Auch ihr Alter war schwer zu schätzen. Sie konnte sechzig sein oder hundert.
„Das ist Paul“, sagte Rosa.
Die Alte hielt mir ihre knochige Lederhand hin.
„Ich bin Elena.“
„Sehr angenehm.“ Ich fand es komisch, dass sie sich mir mit ihrem Vornamen vorstellte, aber als ich Rosa daraufhin ansprach, antwortete sie, ich sei ein Snob und sie hatte recht. Wir stiegen die breite Treppe hinauf. Es gab drei Etagen. Unten wohnte Hagen, in der Mitte Elena und ganz oben unterm Dach Rosa und Marie. Sie hatten sich häuslich eingerichtet, mit Wickeltisch, Laufgitter und Babybett. Wie immer lagen Rosas Sachen überall herum, ohne dass das Zimmer unordentlich gewirkt hätte.
Marie war ein Goldkind. Sie hatte volle, blonde Haare, ein kleines Kinn und große blaue Augen. Letzteres sah ich nur auf den Fotos, die auf dem Tisch standen, denn natürlich schlief sie. Ich hätte mich gerne noch ein bisschen umgesehen, aber Rosa hatte Angst, dass wir Marie aufweckten. Wir gingen also wieder hinunter. Es roch schon nach gebratenem Fleisch, als wir in den Garten kamen.
„Mein Atelier zeige ich dir später, jetzt essen wir erst einmal“, flüsterte Rosa verschwörerisch und ich nickte ein paarmal und sagte: „Unbedingt.“
„Ihr könnt euch schon hinsetzen, die Steaks sind gleich fertig“, sagte Hagen. Es gab selbst gebackenes Brot, Salat und wunderbare Soßen, die in kleinen, weißen Schälchen herumgereicht wurden und die jeder ausgiebig lobte. Elena lächelte jedes Mal artig, aber ich war sicher, dass sie den ganzen Abend kein einziges Wort sagen würde, und ich behielt recht. Zuerst unterhielten wir uns über das Essen. Hagen schlug vor, es das nächste Mal mit Fisch zu versuchen, und ich erzählte, wo ich zuletzt welchen gegessen hatte. Darüber kamen wir aufs Reisen, aber ich hatte keine Lust, schon wieder von meinen Fahrten zu erzählen. Ich wollte irgendetwas über diesen Hagen in Erfahrung bringen, aber er blieb die meiste Zeit stumm. Rosa dagegen war ganz wild darauf, Anekdoten aus unserer gemeinsamen Studienzeit zu erzählen, und sie konnte sich an Einzelheiten erinnern, die ich längst vergessen hatte. Nach dem Essen verabschiedete sich Elena. Rosa sagte, sie solle das Geschirr stehen lassen, aber natürlich kam das für Elena überhaupt nicht in Frage. Rosa protestierte, sie wollte höflich sein und merkte nicht, dass sie die alte Frau damit in Verlegenheit brachte.
„Lass sie nur“, sagte Hagen sanft und Rosa gehorchte. Ich zündete mir eine Zigarette an und schaute auf die Fackeln, deren Flammen im leichten Nachtwind hin und her schlugen. Es war schon dunkel geworden.
„Rosa hat mir erzählt, dass Sie Schriftsteller sind“, sagte Hagen, nachdem wir kurz geschwiegen hatten.
„Mein Bruder hat mir ein paar Seiten einer Geschichte hinterlassen“, sagte ich, „seit seinem Tod versuche ich, diese Geschichte zu Ende zu schreiben. Ich weiß nicht, ob man so jemanden einen Schriftsteller nennen sollte.“
„Ah“, sagte Hagen knapp. Keine Ahnung, warum ich ihm, kaum dass wir uns begrüßt hatten, von Jonas‘ Tod erzählte.
„Womit bestreiten Sie Ihren Lebensunterhalt?“, fragte Hagen nach einer längeren Pause. Ich wunderte mich, dass er sich so direkt danach erkundigte, versuchte aber, mir nichts anmerken zu lassen.
„Ich hatte noch ein paar Reserven, aber die sind nun aufgebraucht, ich muss mir ’nen Job suchen.“
Das war untertrieben. Mein Kontostand befand sich seit einiger Zeit konstant im Sollbereich und ich hatte Angst, sie könnten mir den so mühevoll erkämpften Dispokredit streichen.
„Und Sie, womit verdienen Sie Ihr Geld?“, fragte ich schnippisch.
„Vorwiegend Immobilien und Aktien“, sagte Hagen knapp.
„Und warum sind Sie in den Osten gezogen?“ Ich sah, dass Rosa anfing, unruhig auf ihrem Stuhl herumzurutschen, weil ich all diese Fragen stellte, aber er hatte schließlich damit angefangen.
„Das ist eine lange und komplizierte Geschichte.“ Er goss sein Glas voll, trank und schwieg. Ich hätte ihn gerne ermuntert weiterzusprechen, aber Rosa fing an, ihre Geschichten zu erzählen, und es schien sie nicht zu stören, dass ich die meisten davon schon kannte. Sie hatte Angst, ich könnte Hagen vielleicht zu nahetreten und gab sich viel Mühe, mich nicht mehr zu Wort kommen zu lassen. Und er saß dabei und genoss ihre Vorstellung. Er lächelte ihr zu, nickte von Zeit zu Zeit, machte kleine, intelligente Einwürfe, die sie ermutigen sollten, während sie die Beine übereinanderschlug, sich von ihm Feuer geben ließ und versuchte, geistreich zu sein. Es war wirklich widerlich. Er war der typische Kolonialist, der sich im Westen dumm und dämlich verdient hatte und jetzt hier den großen Gönner raushängen ließ. Wahrscheinlich kam er aus Hamburg. Er sprach zwar keinen norddeutschen Slang, aber er hatte diese vornehme Zurückhaltung. Schließlich hatte ich genug und verabschiedete mich. Hagen sagte, er würde sich freuen, wenn ich sie bald wieder besuchen käme, aber ich brummte nur kurz. Es war mir egal, wie viele Artigkeiten er mir zu sagen hatte. Ich würde mich nicht von ihm einwickeln lassen. Wieso ließ er Rosa hier wohnen? Wieso wollte er mich kennenlernen? Was sollte dieses ganze Theater? Etwas stimmte nicht mit ihm und ich würde herausfinden, was es war. Er sah mich einen Augenblick lang an, als ich ihm die Hand gab, und ich hielt seinem Blick stand. Rosa brachte mich zum Tor und küsste mich zum Abschied auf den Mund. „Sei nicht sauer“, flüsterte sie. „Du wirst alles verstehen, ich bin so froh, dass wir uns wiedergefunden haben.“ Ich drückte sie an mich, aber sie wollte es nicht richtig, also ließ ich sie wieder los und ging.
Auf der Fahrt nach Hause merkte ich, dass ich wirklich eifersüchtig auf diesen alten, geilen Bock war. Es lag nicht nur daran, dass er alles besaß, was ich gerne gehabt hätte, ich wusste auch, dass Rosa einen Vaterkomplex hatte. Vielleicht glaubte sie, dass er der Mann war, der ihr Glückskonto auffüllen konnte. Je länger ich darüber nachdachte, umso mehr war ich davon überzeugt, dass er schon damit angefangen hatte.
IV
Zwei Tage später klingelte es mitten in der Nacht an meiner Tür. Ich lag schon im Bett und wollte zuerst liegen bleiben, aber plötzlich wurde mir klar, dass das nur Rosa sein konnte. Sie sah furchtbar aus. Ihre Stirn war aufgeschrammt und ihr Gesicht tränenverschmiert. Sie weinte und brachte kein vernünftiges Wort heraus. Ich war so erschrocken, dass ich nicht einmal merkte, wie betrunken sie war. Ich dachte natürlich zuerst, dieser Hagen hätte endlich seinen Heiligenschein verloren, aber dann hörte ich, dass sie immerzu den Namen Johanna stammelte. Ich nahm sie in den Arm und wiegte sie hin und her und dabei summte ich, wie man summt, um ein Kind zu beruhigen. Es wirkte. Sie hörte auf, mir etwas erklären zu wollen, sondern weinte erst einmal. Ihr Hemd stank nach Bier. Als sie sich ein bisschen beruhigt hatte, fragte ich, ob sie vielleicht duschen wolle. Sie wollte natürlich nicht. Aber sie ging ins Bad, wusch sich das Gesicht und ich konnte sie davon überzeugen, ein Hemd von mir anzuziehen. Sie verlangte ein Bier, aber ich hatte nichts im Haus. Wir setzten uns auf den Fußboden, rauchten und sie erzählte wirres Zeug. Es ging, soweit ich es verstand, um ihre Mutter Johanna. Rosa hatte offenbar nach dem Fall der Mauer versucht, sie zu finden. Offenbar sollte eine Tante Regine helfen, etwas über Rosas Mutter in Erfahrung zu bringen. Dann hatte ich den Eindruck, Rosas Mutter sei tot, gestorben auf einer Insel, aber das konnte ich auch falsch verstanden haben. Irgendwann fiel auch Hagens Name, aber was der mit der ganzen Sache zu tun haben konnte, war nicht herauszufinden. Zwischendurch liefen Rosa immer wieder die Tränen und sie griff nach meiner Hand. „Verzeih mir“, sagte sie ein paarmal. „Du darfst mich nicht verlassen, versprich mir das.“
Ich versprach es ihr.
„Willst du mit mir schlafen“, fragte sie plötzlich. Ich war von der Frage so überrascht, dass ich einfach nur den Kopf schüttelte. Gleich darauf war mir klar, dass ich ihr das anders hätte beibringen müssen, aber es war schon zu spät.
„Ich weiß, ich sehe heute beschissen aus“, sagte sie gekränkt. „Ich werde nach Hause gehen.“ Ich wollte sie fahren, aber sie erlaubte es nicht, und es kostete mich einige Überredungskünste, bis sie mir gestattete, ihr ein Taxi zu bestellen. Ich brachte sie bis auf die Straße, und während wir auf das Taxi warteten, sagte ich: „Ich rufe dich an.“
„Ja, ja, wir rufen uns an, statt zu vögeln, rufen wir uns an. Das ist auch besser so.“ Wenn sie betrunken war, wurde sie oft ordinär, und eigentlich mochte ich das an ihr, aber ihre Aggressivität machte mir Angst. Es war manchmal eine Wut in ihr, wenn sie die Kraft dazu gehabt hätte, wäre sie im Stande gewesen, jemandem ein Bein oder einen Arm zu brechen, nur um ihn zu einer Reaktion zu zwingen, nur um zu sehen, dass er ein Mensch war.
Als die Rücklichter des Taxis hinter dem nächsten Eckhaus verschwunden waren, ging ich in meine Behausung zurück. An Schlaf war nicht zu denken. Ich trank ein Glas Wasser. Auf dem Fußboden sitzend, sah ich den alten Koffer, den meine Mutter mir bei meinem letzten Besuch aufgezwungen hatte. Er war schwer und als ich ihn öffnete, fand ich neben alten Winterschuhen, einem muffigen Bademantel, Büchern, Schulzeugnissen, Tischtennisschlägern und anderem Krempel auch ein Fotoalbum. Sollte ich es aufschlagen? Würde ich dann Nudeln in Butter schwenken müssen? Vorsichtig öffnete ich den Deckel und da war sie, Rosa. Sie saß zwischen zwei ehemaligen Kommilitonen und lachte in die Kamera. Auf einem anderen Foto saß sie auf meinem Schoß. Bilder aus einem anderen Leben. Ich blätterte durch das Album, es waren fast ausschließlich Fotos aus meiner Studienzeit. Nach dem Tod meines Bruders hatte ich ein Studium angefangen, Chemieanlagenbau. Es hätte auch Ufologie sein können, ich musste einfach irgendetwas tun. Also verschlug es mich hierher, in die Stadt am Fluss. Unsere Seminargruppe bestand aus fünfzehn jungen Männern und einer Frau: Rosa. Es dauerte zwei Wochen, dann waren wir alle auf die eine oder andere Art von ihr fasziniert. Wir kochten für sie, fuhren sie, wohin sie wollte, beschützten sie mehr als ihr lieb war und besuchten sie abwechselnd in ihrem Zimmer, um uns von ihr Mathematik erklären zu lassen, denn Rosa war ein Mathematikgenie. Mag sein, dass die meisten meiner Kommilitonen in ihr eher eine Schwester sahen, ich aber war sofort in sie verknallt. Das lag an dem, was Rosa mir, kurz nachdem wir uns kennengelernt hatten, erzählte. Es war die Geschichte ihres Unglücks, die uns beide sofort verband und die im Herbst 1977 in einer Eisdiele in Boltenhagen ihren Anfang genommen hatte: Rosa, sieben Jahre alt, wartete Eis essend mit ihrer Mutter, bis ihr Vater und ihre Tante Regine von irgendeinem Ausflug zurückkamen. Es wurde getuschelt und geschwiegen, draußen waberte kalter Nebel und komischerweise schienen sich Rosas Eltern darüber zu freuen. Als es dämmerte, fuhr die kleine Gemeinschaft mit dem Auto eine einsame Landstraße entlang, im Radio dudelte leise Musik, das Scheinwerferlicht reichte nicht weit, trotzdem fuhr ihr Vater schnell. Dann hielt er plötzlich und sagte, sie müssten aussteigen. Es ging durch einen kleinen Wald, der voller unbekannter Geräusche war. Rosa hielt die Hand ihrer Mutter fest umklammert, bis ihr Vater und ihre Tante stehen blieben, nasse Zweige aufhoben und so zwei Paddelboote freilegten. Mir stockte der Atem, als Rosa das erzählte. In den Booten lagen Rucksäcke. Alle zogen sich wetterfeste Kleidung an, dann hockten sie in den Dünen und warteten, bis die Grenzpatrouille am Strand vorbeigekommen war, danach rannten sie zur Ostsee. Rosa stieg mit ihrem Vater in das eine Boot, ihre Mutter mit ihrer Tante Regine in das zweite. Sie paddelten auf die Ostsee hinaus, rüber nach Fehmarn. Es war kalt und dämmrig und ihr Vater redete die ganze Zeit mit sich selbst. Möglicherweise sprach er sich Mut zu, aber das half nicht. Ihre Mutter und ihre Tante schafften es in den Westen, Rosa und ihr Vater nicht. Ein Boot der Grenztruppen tauchte plötzlich vor ihnen auf, ihr Vater kam ins Gefängnis, Rosa zu ihren Großeltern. Danach änderte sich alles. Das Leben, wie sie es kannte, verschwand von einem Tag auf den anderen – dieses Gefühl war mir vertraut.
Ihr Großvater, Kombinatsdirektor und Mitglied der SED, war jähzornig, fanatisch und streng. Dass seine Kinder, Rosas Vater und ihre Tante Regine, versucht hatten, aus der DDR zu fliehen, war eine Schande für ihn. Er rächte sich an Rosa und trieb sie ebenso aus dem Haus, wie er vorher seine Kinder aus dem Land getrieben hatte. Mit vierzehn lief sie das erste Mal von ihren Großeltern weg, mit fünfzehn war sie das erste Mal schwanger. Ihr Großvater setzte sie vor die Tür. Rosa hatte nur ihre Unterwäsche an und musste sich von einer Nachbarin eine Jacke borgen, um zu ihrem Vater gehen zu können. Sie liebte ihn, aber er hatte nach der missglückten Flucht über die Ostsee, vor allem aber nach der zweijährigen Gefängnisstrafe nicht mehr die Kraft, sich gegen seinen Bonzenvater zu behaupten. Trotzdem sorgte er dafür, dass Rosa abtreiben konnte. Sie zog nach Leipzig, wohnte in einer WG und beendete irgendwie die EOS. Danach stellte sie Schmuck her und nähte Kleider, die sie zu verkaufen versuchte. Irgendwann kam ihr Vater und überredete sie zu studieren. Sie hatte eine Begabung für Mathematik und Chemie und deshalb kam er auf die grandiose Idee, sie solle es doch mal mit Anlagenbau versuchen. Wahrscheinlich wollte er einfach, dass ihr Leben in geregelte Bahnen kam, und Anlagenbau mag das Einzige gewesen sein, was sofort zu haben war. Es war die Studienrichtung für verzweifelte Eltern, die Angst hatten, ihre Kinder könnten auf die schiefe Bahn geraten. Von ihrer Mutter hatte Rosa nie wieder etwas gehört. Mag sein, dass sie versuchte, Kontakt mit ihrer Tochter aufzunehmen, aber der Bonzengroßvater war zu mächtig. Irgendwann musste Rosas Vater in die Scheidung einwilligen, mehr wusste sie nicht.