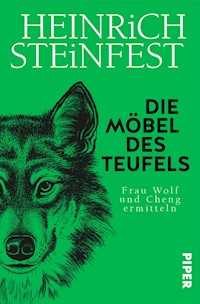6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
»Komm, Elias, setz dich dorthin. Ich werde versuchen, ein Feuer zu machen, dann können wir unsere Sachen trocknen, und es wird warm.« »Kannst du das? Feuer machen?« »Ja«, sagte Miriam. Es war ein gutes »Ja«, keine Lüge, sondern Optimismus, was mitunter das Gleiche ist, aber nicht sein muss. In diesem Moment jedenfalls nicht. Zwei kleine Halbwaisen, durchnässt und verfroren, auf der Suche nach Rettung: In einem abgeschiedenen, winterlichen Wald finden sie eine verlassene Hütte. Es mangelt an allem – kein Essen, kein Strom, keine Heizung, nur ein alter Ofen in der Ecke. Doch die 12-jährige Miriam weiß mit traumwandlerischer Sicherheit, was zu tun ist. Und als Elias krank wird, beginnt sie ihm eine ganz besondere Geschichte zu erzählen. Denn eines ist gewiss: Man kann nicht sterben, wenn man wissen möchte, wie es weitergeht ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 328
Ähnliche
Heinrich Steinfest
Das himmlische Kind
Roman
Knaur e-books
Über dieses Buch
Inhaltsübersicht
Der Tod eines heißgeliebten Menschen ist die
eigentliche Weihe für eine höhere Welt.
Man muß auf Erden etwas verlieren, damit man in
jenen Sphären etwas zu suchen habe.
Friedrich Hebbel an Charlotte Rousseau in Ansbach
1
Mama, was bedeutet Aquapet?«
Die Frage blieb ohne Antwort. Nicht ein Ton. Miriam sah hinüber zu ihrer Mutter, deren Gestalt im schräg ins Zimmer fallenden Sonnenlicht kaum auszumachen war. Wodurch ein Eindruck entstand, als löse sich der Körper in viele längliche Streifen auf, die ihrerseits zu kleinen Punkten zerfielen. Miriam mußte an den Beamstrahl denken, der die Leute auf dem Raumschiff Enterprise atomisierte, um sie an entfernte Orte zu transportieren. Als ihr Vater noch in diesem Haus gewohnt hatte, hatte sie mehrere Folgen der alten TV-Serie sehen dürfen. Scheinbar allein aus dem Grund, weil ihr Vater, als er selbst ein Kind gewesen war, ein großer Fan dieser Weltraumabenteuer gewesen war.
Miriam hingegen, die bereits im neuen, sogenannten 21. Jahrhundert auf die Welt gekommen und gerade zwölf geworden war, hatte lachen müssen über die komischen Menschen auf diesem Schiff, welche auffällig viel und lange miteinander diskutierten, ja sich stritten, aber offensichtlich, weil sie daran Gefallen fanden. Weil es ihnen Freude bereitete, im Vorfeld eines Unternehmens sich besserwisserisch zu geben und die Dinge zu debattieren. Da waren ein Kapitän, ein Arzt und ein Mann mit spitzen Ohren. Die drei verkörperten die Grundzustände menschlichen Daseins, auch wenn der mit den Ohren nur zur Hälfte Mensch war, was aber ebenfalls einem menschlichen Grundzustand entsprach, vielleicht sogar seinen ausgeprägtesten darstellte. Dieser Mr. Spock hatte eine gewisse Ähnlichkeit mit ihrem Vater, nicht der Ohren wegen, sondern weil er so gebildet redete und seiner Umwelt mit einer freundlichen Verachtung begegnete. – Stimmt, »freundlich« und »Verachtung« stellten einen Gegensatz dar. Aber war ihr Vater nicht genau das: ein lebender Gegensatz?
Die Streitigkeiten zwischen ihrer Mutter und ihrem Vater hatten nie jene glückliche Wendung wie auf diesem Raumschiff genommen, sondern waren stets ohne Einsicht und Erbarmen gewesen. Dabei hatten ihre Eltern sich selten angeschrien, eher war es ein Flüstern gewesen, ein zusammengequetschtes, gepreßtes Fauchen. Vielleicht um sie, Miriam, und ihren kleinen Bruder zu schonen, vielleicht auch wegen der Nachbarn. Nicht, daß Miriam sich schreiende Eltern gewünscht hätte, aber deren Flüsterei hatte sich als giftig erwiesen. Da hatten die beiden noch so sehr die Hände vor die Lippen halten können. Das Gift hatte sich ausgebreitet, hatte gleich schwebenden Tropfen in der Luft gestanden, und selbst für einen Menschen von Miriams Größe war es anstrengend gewesen, um diese Tropfen einen Bogen zu machen.
Vor einem halben Jahr war dann ihr Vater ausgezogen. Er hatte sich die Zeit genommen, mit Miriam, jetzt, wo sie quasi »ein großes Mädchen« war, lange und ausführlich über seine Gründe zu sprechen und wie sehr dies insgesamt das Beste für die ganze Familie sei. Weil dann eben Frieden einkehren würde.
Der Frieden, der dann aber einkehrte, verstärkte nur die Giftigkeit. Die Tropfen, in denen sich die ganze Wohnung auf eine unheimliche, stark verzerrte Weise spiegelte, standen fortan noch enger als zuvor. Es war eine tiefe Traurigkeit, die ihre Mutter umfangen hielt. Ja, ein Teil der giftigen Tropfen waren wohl Tränen. Statt diese Tränen zu weinen, hatte ihre Mutter selbige in den Raum gestellt, in der Luft abgelegt, dort, wo sie aber niemals trockneten.
Es war in diesen Monaten sehr schwer geworden, die Mutter etwas zu fragen. Sie war abwesend und in der Folge auch abweisend. Allerdings nicht in einem genervten Sinn. Sie sagte also weder »Laß mich in Frieden, Miriam!« noch »Ich habe jetzt wirklich keine Zeit für diesen Unfug«. Nein, sie blieb auf eine Frage hin einfach die Antwort schuldig, schaute an Miriam vorbei oder durch sie hindurch. Manchmal war sie zärtlich wie früher, nahm Miriam in den Arm, berührte sie an der Wange oder gab ihr einen Kuß. Aber man kann sagen: Ein solcher Kuß, eine solche Berührung hafteten nicht. Sie fielen augenblicklich von Miriam herunter wie alte Aufkleber, die man nirgends mehr anbringen konnte, weil sich auf der Klebefläche zu viel Staub gesammelt hatte. An Miriam selbst konnte es nicht liegen, ihre Haut war glatt und trocken, und sie war willig, einen solchen Kuß bei sich zu lassen. Doch die Küsse hielten nicht. Als sei ihre Mutter kein echter Mensch, sondern ein Gespenst. Kein böser Geist, das nicht, aber eben bloß eine Andeutung von etwas Gewesenem, blaß und skizzenhaft, gleich einem Pastell, aus dem die meiste Farbe verschwunden und nur noch ein vager Umriß geblieben war.
»Mama, Aquapet, was heißt das? – Aqua ist Wasser, das weiß ich, aber Pet, ich weiß nicht, was Pet bedeutet.«
In einer ihrer alten Spielzeugschachteln hatte Miriam ein vielleicht zehn Zentimeter hohes Objekt entdeckt, eine durchsichtige, mit abgestandenem, gelblichem Wasser gefüllte Säule, die auf einem blauen Plastiksockel thronte. Der Sockel verfügte rechts und links über zwei kleine gelbe Knöpfe, der eine mit einem fünfzackigen Stern, der andere mit einem Herz. In der Mitte war ein abstraktes Symbol angebracht, darunter ein kleines Loch, welches wohl als Mikrophon diente. In der gefluteten Säule schwebte, vom Boden her an zwei kaum sichtbare Fäden gebunden, eine kleine, geschlechtslose, ballonförmige Figur in Rosa. Sie verfügte über aufgemalte Augen und einen aufgemalten Mund, blaue, dreizackige Öhrchen, über eine Spirale von der Art eine Sahnehäubchens auf der Stirn sowie über schlaff herunterhängende Arme und Beine. Auf der Unterseite des Sockels befand sich eine kreisförmige Anordnung von sechs Löchern, die als Lautsprecherausgang dienten, zudem ein verschraubtes Batteriefach, darauf eine Aufschrift: Segatoys 2003, Made in China.
2003 also. Sie selbst war 2000 auf die Welt gekommen. Als man ihr dieses Spielzeug geschenkt hatte, da war sie etwa fünf gewesen. Vieles aus dieser Zeit war ihr wieder entfallen. Es wunderte sie, wenn man ihr mitunter ein anderes Kind vorstellte und behauptete, mit ihm wäre Miriam damals so gerne zusammengewesen. Die Gesichter waren ihr so fremd wie die Geschichten, die man zu diesen Gesichtern erzählte. Woran sie sich allerdings erinnern konnte, war der Tag, an dem sie mit ihrem Vater auf dem großen Stadtfest gewesen war. Sie meinte jetzt noch den gleichermaßen bestimmten und sicheren wie sanften Druck seiner Hand zu spüren. Eine Hand, die damals anders gewesen war, nicht bloß größer, weil ja die ihre kleiner gewesen war, sondern auch fester. Gut, ihre eigene Hand war in den vergangenen Jahren erstens gewachsen und zweitens kräftiger geworden, sodaß es sie nicht zu verwundern brauchte, wenn sich die Dinge, eben nicht zuletzt die Körperteile der Eltern, schwächer anfühlten. Aber ihr kam vor, als hätte der Griff ihres Vaters seither noch etwas anderes eingebüßt als bloße Muskelkraft, etwas, das man vielleicht die Seele einer Hand nennen konnte. Miriam stellte sich vor, jeder Körperteil besitze seine eigene Seele und daß die Seele in ihres Vaters Händen eben verschwunden war. Rechts wie links. Wohin auch immer.
Jedenfalls war es an diesem Tag geschehen, daß Miriam bei einer Tombola das Aquapet gewonnen hatte. Drückte man auf einen der Knöpfe, begann die schwimmende Figur hin und her zu wackeln und diverse Geräusche von sich zu geben. Es entließ ein Piepsen und Fiepen und Pfeifen. Auch war dieses elektronische Vögelchen in der Lage, den Donauwalzer zu zwitschern. Ausschalten konnte man es nicht, weshalb es vorkam, daß es selbst dann noch etwas zum besten gab, wenn man sich bereits von ihm abgewandt hatte. Als rufe es einem hinterher oder führe Selbstgespräche. Dies aber nur kurz. So sehr es nach Aufmerksamkeit und Fütterung verlangte, war es dennoch weniger lästig als konventionelle Haustiere oder familiäre Gefährten.
Damals, als alles an diesem Ding noch rein und hell gewesen war, hatte Miriam es für passend gefunden, es im Badezimmer unterzubringen. Immerhin handelte es sich um ein »Wassertier«. Während des Zähneputzens hatte Miriam es sich dann zur Angewohnheit gemacht, an den Knöpfen herumzudrücken und den vergnügten, aber doch recht eintönigen Bewegungen und Äußerungen des Geschöpfs zu folgen. Ein Geschöpf, das aber nie einen Namen erhalten hatte. Ein Umstand, der Miriam im nachhinein wunderte. Jedes ihrer Stofftiere hatte einen erhalten, sogar die Pflanzen ihrer Mutter. Warum dieses kleine Wasserwesen nicht? Oder hatte sie den Namen nur vergessen, wie den der Kinder, denen sie zu dieser Zeit auf Spielplätzen und Geburtstagsfesten begegnet war?
Miriam hielt das Objekt in die Höhe und gegen das Licht und betrachtete es von allen Seiten. Das einst so klare Wasser, das im Zuge innerer Verdunstung auf Scheitelhöhe des Aquapets herabgesunken war, besaß nun den Farbton von Urin. (Allerdings würde Miriam bald feststellen, daß gar nicht die Flüssigkeit diesen Eindruck verschuldete, sondern der gelbgraue Film, der sich an der Innenwand gebildet hatte.)
Auf den Begriff des Aquapets war sie im Internet gestoßen. Miriam hatte vor einiger Zeit einen Internetführerschein gemacht und durfte sich in der Bücherei als auch zu Hause in die ozeanischen Gefilde des Weltwissens begeben. Unter strengen Auflagen, versteht sich, obgleich ihre Mutter längst nicht mehr über die Konzentration verfügte, Auflagen zu überwachen. Aber Miriam gehörte ohnehin zu den Kindern, die sich selbst kontrollierten, die wußten oder ahnten, was für sie gut war und was nicht und die mit geradezu zensorischem Eifer sich Dingen verweigerten, die ihrem Alter oder ihrem Temperament nicht entsprachen. Und genau das war ja der Grund, daß Miriam diversen Hinweisen, es handle sich bei Aquapets um phallische Symbole, ebenso wenig nachging wie den geschmacklosen Kommentaren bezüglich der Möglichkeit, mit solchen Objekten frühzeitig eine Masturbation vorzunehmen. – Sie stoppte, sie kehrte um, sobald sie eine Gefahr witterte. Denn Miriam hatte begriffen, wie sehr menschliches Glück nicht nur darin bestand, etwas zu erfahren, sondern auch darin, etwas nicht zu erfahren. Zumindest nicht sofort.
Mit derlei selektivem Gespür hatte sie also herausgefunden, daß es sich bei dem Gegenstand, welcher da einige Monate lang zwischen ihren Zahnputzsachen gestanden hatte und dann im Zuge diverser häuslicher Umschichtungen in einen Karton und mit diesem in immer tiefere und dunklere Regionen des Kinderzimmers geraten war (in ferner Zeit werden Außerirdische diese Kinderzimmer freilegen und für reichbestückte Grabkammern halten), um eine Spezies namens »Aquapet« handelte. Und darum wollte sie nun wissen, wie Pet zu übersetzen sei.
Den Begriff in die Suchmaschine fügend, war sie als erstes auf die Pet Shop Boys gestoßen und postwendend auf die deutsche Übersetzung: Jungs aus der Zoohandlung. Pet Shop konnte somit nur Tierladen heißen. Und gleich darauf fand Miriam in Zusammenhang mit der Bezeichnung »Aquapets« die Formulierung »virtuelle Haustiere«. Nun, sie wußte, was virtuell bedeutete. Eine virtuelle Welt war schließlich genau die, in die sie dank des Computers ihrer Mutter eintreten konnte. Und wieder austreten.
Aber diese Figur hier, die da auf ihrem Tisch stand und in einer acht Jahre alten Lauge wie tot schwamm (denn noch hatte Miriam keinen der Knöpfe gedrückt), war doch eine gänzlich leibhaftige. Die äußere Hülle berührbar, warm vom Sonnenlicht, das darauf fiel, ohne aber eine optische Auflösung wie bei der Mutter zu bewirken. Ja, auf eine gewisse Weise mutete dieses Spielzeug realer und stofflicher an als der verlorene, nicht in Wasser, sondern in seine Traurigkeit eingeschlossene Mensch, der ihre Mutter war. Und würde wohl auch sehr viel kommunikativer sein, das Ding, wenn es einmal zu reden anfing.
Stimmt, das Aquapet war künstlich, ein Produkt. Aber war denn nicht alles ein Produkt? Und die Frage nur, ob es sich um ein beseeltes oder seelenloses handelte. Oder einst gehandelt hatte, wie etwa die Hände ihres Vaters.
Miriam dachte nach. Wahrscheinlich war im vorliegenden Fall mit »virtuell« gemeint, daß es sich hierbei nicht um ein richtiges Haustier handelte. Richtig im Sinne von fleischlich. Von gewachsen. Aus der Natur gewachsen oder von Gott erschaffen. Während ja das Gebilde in ihrer Hand von einer japanischen Firma entwickelt, von einer chinesischen produziert und von einer amerikanischen vertrieben worden war. Damit war freilich nicht geklärt, ob es eine Seele besaß oder nicht. Das war übrigens auch bei einem Käfer oder einer Spinne nicht eindeutig, obwohl diese keineswegs als virtuell galten, von Pflanzen ganz zu schweigen. Im Falle von Miriams Hund, der vor zwei Jahren gestorben war, ein Collie, der nie völlig gesund gewesen war, hatten ihre Eltern mehrfach betont, seine Seele sei in den Himmel gekommen. Sie, Miriam, hatte das gerne geglaubt, doch auf die Frage, ob dies ebenso für eine von ihr zertretene Fliege gelte, keine befriedigende Antwort erhalten. Das war möglicherweise überhaupt der Grund für die Entstehung des Internets. Es gab viel zu viele Fragen, als daß ein Erwachsener allein sämtliche Antworten hätte geben können. Über die Existenz von Seelen bei Insekten stand nun zwar auch im Netz nicht viel Befriedigendes, aber doch einiges, was die elterlichen Ausweichmanöver an Amüsement bei weitem überwog (»Ich denke, die Sache mit der Seele kann man nicht rausfinden, wenn man nicht zuerst mit einem Insekt geredet hat«).
Bevor nun Miriam daranging, das Aquapet durch ein Berühren der beiden Knöpfe dazu zu bringen, sich zu bewegen und Laute von sich zu geben, wollte sie es mit einem eigenen Namen ausstatten. Denn erst der Name verlieh den Dingen ein Leben. Das galt ja auch für sie selbst. Hätte sie nicht Miriam geheißen, wie hätte sie überhaupt wissen können, auf der Welt zu sein?
Der offizielle Kosename ihres Aquapets lautete Kiko. Wobei Miriam aus dem Netz erfuhr, daß die blaue Kiko-Figur (das Blau bezog sich auf die Farbe des Sockels) zusammen mit einem grünen und rosanen Modell die erste Generation dieser »interaktiven Wassertierchen« bildete. Wie so oft schienen die Nachfolgermodelle eher wie eine Karikatur der Urfassung, wirkten übertrieben und grotesk, lustiger als lustig, auch waren größere, recht unförmige Gehäuse entstanden. Die Gehäuse spielten eine wichtige Rolle. Denn im Falle eines Aquapets bildeten das glassturzartige Behältnis sowie der mit Elektronik gefüllte Sockel einen Teil des Ganzen, das zentrale Wesen nährend und schützend. Hier war das Haus untrennbar mit seinem Benutzer verbunden, ähnlich wie bei einer Schnecke.
Kiko also.
Nun, das war japanisch und es war weiblich. Doch Miriam empfand die Figur gar nicht als feminin, trotz der roten Lippen und großen Augen. Im Gegenteil, der spitz zulaufende Scheitel und die flossenartigen Ohren machten auf sie einen jungenhaften Eindruck: frech und draufgängerisch. – Keine Frage, jeder halbwegs aufgeschlossene Erwachsene hätte ihr nun erwidert, wie sehr auch Mädchen frech sein können, ja, frech sein sollen. Doch sie war da anderer Meinung. Das Frechsein erschien ihr als eine Männersache. Wenn Mädchen frech waren, dann nur, um sich nicht unterkriegen zu lassen. Aber es machte keinen Spaß, sich wie ein Bub aufzuführen. Wieso war sie ein Mädchen geworden, um dann Jungens nachzumachen? Schatz, zieh mal die schöne neue Hose an! Aber Hosen waren für sie das letzte. Vollkommen unbequem und praktisch nur, wenn man auf Bäume kletterte. Wohin sie nicht wollte. Bei Bäumen mochte sie die Blätter. Und die Blätter kamen ja von selbst. Dazu braucht man keine Hose anziehen.
Neuerdings mußte sie einen Selbstverteidigungskurs besuchen. Ihr Vater hatte es ihr lang und breit erklärt, wie sehr dies nötig sei und wie sehr ihr das später einmal helfen würde, sich Jungs vom Leib zu halten, wenn sie das wollte. Sie dachte jedoch an die Stricknadeln ihrer Großmutter und daß es damit eigentlich auch ganz gut funktionieren müßte. Ja, Miriam hatte mit dem Stricken angefangen, obgleich ihre Mutter wenig davon hielt. Mit dem Stricken schien es nämlich umgekehrt zu sein. Das war etwas, was Jungs lernen sollten, um sich zu beruhigen.
Wie auch immer, Miriam wollte diesem Wassertierchen einen Jungennamen geben. Ihr kleiner Bruder hieß übrigens Elias. Er war fünf, somit im gleichen Alter wie Miriam damals, als sie das Aquapet bekommen und im Badezimmer aufgestellt hatte. Wobei es ihr nun einige Gewissensbisse bereitete, das Spielzeug so lange vernachlässigt zu haben. Sie konnte nicht ausschließen, daß das rosane Figürchen bereits gestorben war, auch wenn seine Lebenszeit im Unterschied zu den Tamagotchis der 90er Jahre allein von den beiden Batterien abhing, die da gleich einem übergroßen, zweiteiligen Herzen im Sockel steckten. Doch vielleicht trug dieses Batterienfach längst ein Herz der Finsternis in sich. Vielleicht aber … Egal, ein Name mußte her.
Miriam sah sich um, als würde selbiger sogleich zwischen ihren Spielsachen hervorwandern, in der Form in die Luft geschriebener leuchtender Buchstaben. Man nannte das wohl Eingebung. Es gab Menschen, von denen behauptet wurde, sie hätten mathematische oder chemische Formeln, die Idee zu Erfindungen und sogar ganze Romane auf diese fremdbestimmte Weise zu Papier gebracht. Stellte sich die Frage, woher diese Eingebungen kamen und von wem. Miriam überlegte, inwieweit es sich dabei um Signale aus dem Jenseits handelte, Versuche der Toten, sich ins Leben der Lebenden zu mischen, Gutes oder Schlechtes zu bewirken, weniger aus einer Laune heraus, eher aus dem Drang, Einfluß auszuüben auf Dinge, auf die Einfluß zu nehmen sie während ihres Erdendaseins verabsäumt hatten.
Genau, Geister holten Versäumtes nach.
Um eine solche geistvolle Eingebung zu empfangen, mußte man gewissermaßen eine Türe in seinem Schädelinneren öffnen.
Miriam schloß ihre Augen. Sie sah ihn sofort, den Namen. Er prangte in dem gleichen, ein wenig fauligen Rosa, das auch die Kunststoffhaut des Aquapets bestimmte, von einem der Buchrücken in der Mitte ihres Kopfes: Dankward.
Dankward? Sollte das wirklich ein Name sein?
Als Miriam später wieder vor ihrem Computer saß und festgestellt hatte, daß es sich bei Dankward tatsächlich um einen alten deutschen, wohl ein wenig überholt zu nennenden Namen handelte, drängte es sie dennoch, eine kleine Korrektur vorzunehmen. Wenn man nämlich »Dankward« etwas rascher und kräftiger aussprach, so ergab sich das Folgende: Tankwart. Was ihr ungleich besser gefiel. Auch wegen der Vorstellung, ein Name bezeichne zugleich den Beruf oder die Eigenart seines Trägers. Ein Müller, der Müller hieß. Ein Ernst, der ernst war. Ein teuflischer Herr Teufel. Eine schöne Bella und so weiter. Ja, die ursprünglich mit einem Mädchennamen versehene kleine Kiko war jetzt ein Junge. Ein Junge, der Tankwart hieß und auch ein Tankwart war. Ein Tankwart der Gedanken und Phantasien. Ein wiedergefundener Freund.
Miriam versuchte nun, diesen Freund zum Leben zu erwecken, indem sie auf den Knopf mit dem Herzchen drückte. Natürlich stand das Herz für Liebe und Zuneigung. Aber nichts geschah. Offensichtlich galt für Tankwart das gleiche, was auch manchmal über Miriam gesagt wurde, nämlich »nicht immer auf Knopfdruck zu reagieren«. Zumindest nicht sofort.
Miriam bewies Geduld. Sie hob das Aquapet hoch und sprach in das kleine Loch am Grunde des Sockels. Fordernd, aber zärtlich fordernd. Doch noch immer blieb eine Reaktion aus. Gut möglich, daß Tankwart auf eine elektronische Weise beleidigt sein mochte. Oder geschwächt. Geschwächt von all den Jahren, die er im Dunkel einer vernachlässigten Spielzeugschachtel zugebracht hatte, zusammen mit anderen ausrangierten Objekten. Man war hier nicht bei Toy Story oder Pu der Bär, wo die Spielsachen auch unabhängig von den Menschen zu existieren verstanden. Nein, Tankwart schien beeinträchtigt vom Umstand fehlender Kommunikation als auch fehlender Nahrung, die er über die Taste mit dem Sternchen zugeteilt bekam. Das war nämlich sein Problem, eingeschlossen in die mit Wasser gefüllte Säule zwar einen hervorragenden Blick auf die Knöpfe zu haben, aber darauf angewiesen zu sein, daß jemand selbige auch drückte. Jemand, der bereit war, sich auf das »Spiel« einzulassen.
Na gut, Miriam war jetzt bereit. Sie bat um Verzeihung. Wobei ihr klar war, daß sie sich dann eigentlich bei einer ganzen Menge Zeug hätte entschuldigen müssen. Andererseits wurde ihr auch zum ersten Mal bewußt, wieso die Erwachsenen an alten Gegenständen, die sie in der Folge Antiquitäten nannten, einen solchen Gefallen fanden. Am Anfang war etwas neu, dann vergaß man es, um es, wenn es alt genug war, mit umso größerer Begeisterung wertzuschätzen. Vor allem, wenn es sich bei dem Gegenstand um den ersten seiner Art handelte.
Tankwart war der erste seiner Art. Umso mehr ein Grund, ihm Zeit zu geben. Er hatte wahrlich das Recht, ein wenig eingeschnappt zu sein.
Miriam polierte mit ihrem Rockzipfel seine transparente, im Inneren patinierte Hülle und stellte ihn auf einem Regal in ihrem Kinderzimmer ab, das sie zuvor vom Staub befreit hatte. Dann wechselte sie hinüber in die Küche, um nach einer Tafel Schokolade zu suchen. Sie hatte einfach Appetit. Stimmt schon, Schokolade mitten am Tag und ohne Nachfrage war eigentlich verboten, doch Miriam fand, die Gleichgültigkeit ihrer Mutter dürfe ruhig auch einen gewissen Nutzen haben. Zudem hielt sich die Schwere des Regelbruchs in Grenzen.
Sie war soeben dabei, ein Schrankfach zu öffnen, als sie mehrere Laute vernahm, die aus ihrem Kinderzimmer drangen: ein elektronisches Zirpen, eine Art von Ouvertüre in Form kurzer Töne, sodann ein verlangendes Fiepen. Sofort lief Miriam zurück in ihr Zimmer und drückte die Herztaste, was zu einer Folge dreier Klänge führte, die erneut mit einem flehenden Ton, einem animalischen Wimmern endeten. Es war unverkennbar zu hören: Hier beschwerte sich einer.
Miriam begriff, daß auch jemand, der Tankwart hieß, also gewissermaßen eine Tankstelle betrieb, eine Tankstelle der Töne und Klänge, Treibstoff benötigte. Von Liebe allein zu leben war eine doofe Behauptung.
Darum betätigte sie jetzt die kleine gelbe Sterntaste. Und in der Tat ergab sich ein Geräusch, das man leicht als ein mahlendes erkennen konnte, als ein Kauen, ein Geräusch von Zähnen, zwischen denen etwas Eßbares zerrieben wurde. Miriam wiederholte diesen Vorgang mehrmals, um Tankwart zu sättigen. Dazwischen sprach sie ihn auf eine vertraulichen Weise an, erklärte ihm, wie sie darauf gekommen war, ihm diesen bestimmten Namen zu geben.
Es war keineswegs so, daß Miriam nicht gewußt hätte, es hier mit einer im Grunde recht simplen und billigen Apparatur zu tun zu haben, die auf Knopfdruck sowie auf akustische Reize reagierte, und ganz sicher nicht mit einer Persönlichkeit, die den Sinn einer bestimmten Namensgebung begriff. Andererseits war sie noch immer in jene kindliche Welt verstrickt, in der die Vorstellung herrschte, so gut wie alles könne zum Leben erweckt werden, weil in so gut wie allem dieses Leben potentiell steckte. Jedes Ding in der Welt unterstand einer möglichen Golemisierung. Ja, Miriam meinte, daß die Frage, ob etwas lebte oder nicht, in erster Linie von einem selbst abhing. Und daß es vor allem keine Zufälle gab. Wenn dieses Aquapet nach so vielen Jahren erneut ihre Aufmerksamkeit erregte, dann wohl, um geliebt und gepflegt und auf solche Weise erweckt zu werden.
Keine Frage, Pädagogen empfahlen hierfür eher echte Tiere oder wenigstens Spielzeug aus echtem Holz, doch blieb dies für Kinder bedeutungslos, weil sie ja einer Bestimmung erlagen. Und die Bestimmung konnte genauso zu einem echten Tier wie zu einem völlig unechten Plastikteil führen. Entscheidend war, es richtig zu machen. Und Miriam wollte es richtig machen. Nicht nur im Sinne der Erfinder, jener japanischen Spielzeugingenieure, denen zu verdanken war, daß Tankwart im Zuge seines Gepflegtwerdens eine Melodie von sich gab, bei der es sich eindeutig um den Beginn des Donauwalzers von Johann Strauss handelte, sondern eben auch in jenem magischen Zusammenhang, der darin gipfelte, daß ein einmal angesprochenes, mit einem Namen versehenes Objekt sich in etwas verwandeln konnte, was über die Idee der Erfinder weit hinausging. – Ich werde angesprochen, also bin ich.
Freilich wird nicht jedes Objekt erweckt, das erweckt werden möchte, so wertvoll oder hochentwickelt es auch sein mag. Etwa Miriams Klavier. An welches sie nun erinnert wurde, weil es an der Türe klingelte. Das mußte ihre Klavierlehrerin sein, die jeden Dienstag und Donnerstag erschien, eine freundliche, einfühlsame junge Frau mit kleinen, runden Augen und langen, dünnen Fingern, was in ihrem Fall besser war als umgekehrt. Sie war ein typischer Man-kann-nicht-alles-haben-Mensch. Bei dem Klavier wiederum handelte es sich zwar wie im Falle des Aquapets um einen Japaner, ein Instrument von Yamaha, doch hatte Miriam in all den Jahren kein Verhältnis entwickelt, das geeignet gewesen wäre, dem Gerät Leben einzuhauchen. Nicht, daß diese Musikstunden eine Qual dargestellt hätten oder Miriam untalentiert gewesen wäre. Aber zwischen Miriam und dem Klavier bestand einfach keine andere Beziehung als die quasi berufsmäßige. Zu spielen und gespielt zu werden.
Das Yamahapiano – so ungemein schwarz und glänzend und halb tot – erinnerte an einen dieser Wale, die im Zuge viraler Infektionen oder der Verlärmung der Weltmeere an den Stränden der Menschen gelandet waren, unser Mitgefühl erregten, aber in den seltensten Fällen auf Rettung hoffen durften.
»Ich würde gerne den Donauwalzer lernen«, sagte Miriam, die das von Tankwart gespielte Stück erkannt hatte, es selber aber nicht beherrschte.
»Gute Idee«, sagte die Klavierlehrerin und lächelte mit dem gesenkten Vorhang ihrer kleinen Augenlider.
2
Macht euch fertig, wir fahren aufs Land.«
Miriam hätte gerne gefragt, wohin aufs Land. Aber ihre Mutter war bereits wieder aus dem Türrahmen getreten. Das war ohnehin der maßgeblichste Eindruck, den diese Frau derzeit bot, so rasch zu entschwinden, wie sie aufgetaucht war, ohne jedoch rasant oder geschäftig zu wirken. Sie tat ja nicht wirklich etwas, zumindest nichts, was aufgefallen wäre oder etwas bewirkt hätte. Sie begab sich selten nach draußen, nahm kaum Termine wahr, verblieb im Haus, war dennoch so gut wie unsichtbar. Um die Ordnung in der Wohnung, um die Mahlzeiten und die Wäsche kümmerte sich eine Frau, die jetzt täglich kam. Die Hausaufgaben erledigte Miriam im Hort. Sie tat sich leicht in der Schule, ohne der Schule etwas abgewinnen zu können. Sie hörte oft, wie wichtig es sei, all diese Dinge zu lernen und daß es doch eigentlich Spaß mache, klug zu werden.
Nun hatte Miriam gegen die Klugheit an sich nichts einzuwenden, doch der eigentliche Zweck anvisierter Bildung schien vor allem darin zu bestehen, klüger als jemand anders zu sein. Sich zu unterscheiden. Abstand herzustellen. Ein markantes Selbst zu schaffen, ohne freilich zum Außenseiter zu werden. Mitten in der Mitte außerordentlich zu sein. – Wenn die Leute gewissen Idealen der Schönheit, der Macht oder eben der Intelligenz nacheiferten, dann nur in der Hoffnung, sich zusätzliche Unterscheidungsmerkmale anzueignen. Niemand wollte sich von einem Spiegel anhören müssen, genauso schön wie jemand anders zu sein. Derartige Spiegel waren verhaßt. Dann lieber einer, der einem versicherte, man sei die Häßlichste im ganzen Land.
Nicht, daß Miriam mit ihren zwölf Jahren davon träumte, in einem Einheitsbrei unterzugehen oder in einem Maoanzug durch die Gegend zu laufen, aber sie fand, es seien der Unterschiede, die einem die Natur mitgab, genug. Mitunter konnte man einen bestimmten Menschen von hinten erkennen, allein durch seine Art des Gehens oder auch nur Stehens. Selbst das Stehen hinterließ einen unverwechselbaren Fingerabdruck. Das Stehen und einiges mehr. Es wäre ihr ein leichtes gewesen, ihren Vater von anderen zu unterscheiden, allein dadurch, wie er seine Brille putzte. Als massiere er die Haut eines kleinen, jungen Tiers und versuche auf diese Weise, quälende Blähungen zum Verschwinden zu bringen. Die Zärtlichkeit seiner Bewegungen beim Brillenputzen war einmalig, und Miriam wurde bei diesem Anblick stets warm ums Herz (wenngleich eine Bitterkeit mitschwang, weil sie ja meinte, sie selbst könne die Seele in den Händen dieses Mannes nicht mehr spüren).
Die Einmaligkeiten in einem jeden Gesicht, einer jeden Geste oder Bewegung erschienen Miriam völlig ausreichend. Was war denn wichtiger? Die Form der Augen oder die Form und Marke der Brillengläser, die diesen Augen übergestülpt waren? Für Miriam zählte eher, wie einer einen Satz aussprach, als die Intelligenz seiner Worte. Was ja keineswegs bedeutete, sie hätte ein Faible für Blödheiten gehabt. Aber sie erlebte das meiste Gescheitsein als einen bloßen Gegenpol zum meisten Blödsein, ebenso radikal und ungemütlich. Eine Stimme aber konnte es in sich haben, eine gute Stimme konnte die Welt verwandeln.
Ihre Erfahrung war nun, daß umso blöder und umso gescheiter Leute waren, umso unangenehmer deren Stimmen wurden. Die schönsten Stimmen gab es hingegen bei den Mittelgescheiten (eine Gruppe, an deren äußerstem Spektrum die Mittelblöden standen). Eingedenk solcher Anschauung, ging Miriam höchst vorsichtig mit der Bildung und der eigenen Leichtigkeit beim Lernen um. Man kann sagen: Ihr war sehr daran gelegen, auch später mal eine schöne, eine gute Stimme zu haben. Und in der Tat war es Miriams prägnantester Zug, trotz all ihrer Talente und ihrer raschen Aufnahmefähigkeit ein in ganz neuer Bedeutung des Wortes konkurrenzloser Mensch zu sein. – Klar, viele hätten jetzt eingewandt, wie sehr sich das noch ändern werde, sobald die Kleine mal die Vorzüge begriff, die sich aus ihrer Intelligenz ergaben. Aber das waren eben jene Leute, die ihre eigene Stimme geopfert hatten und nun krächzend oder brummend, mit Piepslauten oder im Ton einer Schlagbohrmaschine durchs Leben schritten und trotz aller Bildung unfähig waren, einen Gott zu rühren.
»Komm!« rief Miriam zu ihrem Bruder hinüber. »Mama will wegfahren, wir sollen uns anziehen.«
Beide waren noch im Pyjama. Ein Samstag. Und vor der Tür der Winter. Winter ohne Schnee. Aber kalt und mit grauer Luft, trüb und kummervoll. Allerdings hatten die Morgennachrichten den ersten weißen Tag dieses Jahres angekündigt, zumindest für das Land draußen. Möglicherweise der Auslöser dafür, daß die Mutter einen Ausflug unternehmen wollte. Obgleich das kaum zu ihrer derzeitigen Verfassung paßte. Seit Vater ausgezogen war, hatte es keine einzige solche Unternehmung mehr gegeben, gerade so, als wären das Wandern und das Besichtigen nur zu viert möglich.
Nun, was auch immer der Grund für den Wandel der Mutter sein mochte, Miriam ging zum Schrank und holte für ihren Bruder die Schiunterwäsche aus dem Kasten, dazu weitere winterfeste Kleidung. Sie war es gewohnt, solche Aufgaben zu übernehmen. Darum auch hatte sie begonnen, täglich die Wetternachrichten zu hören, um zu wissen, welche Sachen sie ihrem Bruder morgens hinlegen sollte. Elias wurde dann von einer fremden Mutter abgeholt und zum Kindergarten gebracht.
So leicht sich Miriam in fast allem tat, so schwer fielen ihrem Bruder manche Dinge. Er war ein Stolperer, einer von diesen Menschen, die sich selbst im Weg zu stehen schienen, die auch ohne Behinderung sich behinderten. Weder war er zurückgeblieben noch eingeschränkt, sondern nur tendenziell ungeschickt und daraus resultierend ein bißchen langsam. Noch aber wurde er deswegen nicht gehänselt. Noch war nicht die Zeit gekommen, wo einer wie er im Tor stehen mußte, weil man dorthin gerne die Tolpatschigen schickte. Früher waren es immer die Dicken gewesen, aber es gab zwischenzeitlich so viele dicke Kinder, die konnte man nicht alle ins Tor stellen. Zudem hatte der Fußball auch die Dicken erreicht, die immer besser spielten. Nein, im Tor standen die mit den zwei linken Beinen. Das durften dann auch dünne Beine sein.
Miriam half ihrem Bruder, sich einzukleiden. Sie tat das gerne, weil sie es mochte, ihn zu berühren und darauf zu achten, daß er hübsch aussah und alles so war, wie es sein sollte. – Auch so etwas, was man Mädchen gerne vorwarf: ihre Fürsorglichkeit. Ihr Vermögen, Ordnung zu schaffen. Und mit Ordnung ist nicht nur die sichtbare gemeint. Sondern gleichwohl die Fähigkeit, unsichtbare Objekte zu ordnen. Auch wenn darüber allgemein nicht gerne gesprochen wird.
»Vergiß nicht dein Zebra«, erinnerte Miriam ihren Bruder.
Er nickte und nahm seinen kleinen Rucksack, den gleichen, den er trug, wenn er in den Kindergarten ging und in dem sich im Moment eine leere Trinkflasche befand, dazu einige Zeichenstifte und zwei zerlesene Pokémonhefte. Zudem mehrere glatte Steinchen sowie zugespitzte Äste, wie sie auch die Urmenschen verwendet haben mochten und deren Besitz ein Gefühl der Sicherheit versprach. Er stellte sich auf einen quadratischen Holzsessel und holte von einem der Regale ein Plastikzebra, das einst Miriam gehört hatte. Keine Frage, Elias besaß genügend eigene Spielsachen, noch dazu handelte es sich um ein dreibeiniges Zebra, dessen vorderer linker Lauf heruntergebrochen war und von einem mit Klebeband befestigten dünnen Stück Holz, dem Teil eines Eßstäbchens, ersetzt wurde. Das realistisch gestaltete Kunststoffzebra stammte aus der Kollektion sogenannter Schleich-Tiere. Es war Miriam, als sie viel kleiner gewesen und ausnahmsweise selbst einmal gestolpert war, aus der Hand geglitten und in einem hohen Bogen auf dem Gehweg gelandet. Dabei war das eine Bein abgebrochen und mußte wohl in ein nahes Gebüsch geraten sein. Und zwar unauffindbar. Miriam hatte noch Tage und Wochen später an dieser Stelle nach der verlustig gegangenen Gliedmaße gesucht, ohne Erfolg aber. Selbst Jahre danach geschah es, daß wenn sie am »Unfallort« vorbeikam, einen Blick in das Grün warf und nach einem schwarz und weiß gestreiften Fragment Ausschau hielt.
Das Ersatzbein hatte sie als Sechsjährige eigenhändig angefertigt, weil das Plastiktier dreibeinig nicht in der Lage gewesen war, aufrecht zu stehen und im Liegen einen doch recht bedauernswerten Anblick geboten hatte. Das auf diese Weise verarztete Zebra geriet dann irgendwann ins Kinderzimmer ihres Bruders und wurde – noch vor den weichen und anschmiegsamen Plüschtieren – zu seinem favorisierten Begleiter erkoren. Eine Entscheidung, die beide Elternteile bis heute ablehnten, da es ihnen vorkam, als würde Elias damit eine fremde »Behinderung« idealisieren und sich somit auch dem eigenen Schicksal ergeben, obgleich er ja nicht im eigentlichen Sinn gehandikapt war, nur eben ungeschickt, sich ständig wo anstieß, ständig mit blauen Flecken durch die Gegend lief, als erhalte er zu Hause Hiebe. »Schmeiß das Zebra weg, du kriegst eines mit vier Beinen«, hatte der Vater erklärt. Doch Elias war in diesem Punkt ungewöhnlich starrköpfig gewesen und hatte sich nicht abbringen lassen, sein »Sebra«, wie er es gerne aussprach, überall hin mitzunehmen. Und wurde dabei von Miriam unterstützt, die noch immer hoffte, eines Tages auf das verlorengegangene Bein zu stoßen.
Und darum also mußte das Sebra-Zebra unbedingt auf diesen Ausflug mit. Elias brachte es in dem vorderen Täschchen seines Rucksacks unter und ging dann zum Frühstück, welches die Haushaltshilfe den Kindern vorbereitet hatte. Die Mutter war zwar ebenfalls in der Küche, saß aber nicht am Tisch, sondern lehnte an einer Kante, eine Tasse Tee in der Hand, und starrte nach draußen. Miriam meinte im Augenwinkel ihrer Mutter eine Träne zu bemerken, keine von denen, die in der Luft hingen und niemals trocknen würden, sondern eine geweinte, eine, die auf der Haut bleiben und sich dort auflösen würde.
Miriam fragte: »Soll ich uns einen Proviant herrichten?«
Ohne ihren Blick vom Fenster zu nehmen, meinte die Mutter: »Nein, Schatz, nicht nötig, wir werden unterwegs im Restaurant essen.«
Miriam runzelte die Stirn. Sie mochte es gar nicht, ohne Verpflegung das Haus zu verlassen. Das war so eine Regel, sich eine Notsituation vorzustellen, etwa in eine U-Bahn eingesperrt zu sein und was man dann benötigte, Kekse und Brote, etwas zum Trinken, vielleicht ein Pflaster, ein gutes Buch oder Heft, eine Packung Gummibärchen für die Nerven, einen Glücksbringer, Stricksachen. Nun gut, mit der U-Bahn würde man diesmal nicht fahren, und sie wollte keinesfalls ihre Mutter hintergehen, indem sie nun heimlich ein paar Brote schmierte und in Elias’ Rucksack schmuggelte.
Plötzlich wandte die Mutter ihren Kopf Richtung ihrer Tochter und sagte: »Pet ist das englische Wort für Haustier.«
3
Holla! Geht’s noch später?
Miriam wußte doch längst, wie das Wort zu übersetzen war. Schließlich war sie gezwungen gewesen, im Internet nachzusehen. Es war bereits zwei Tage her, als sie sich nach der Bedeutung dieses fremden Wortes erkundigt hatte. Dennoch erfolgte die Antwort ihrer Mutter jetzt in einer Weise, als hätte Miriam soeben erst die Frage gestellt. Weil sie aber wußte, wie oft die Mutter seit Vaters Weggang in tiefe Löcher fiel, in denen die Zeit stockte, unterließ sie es, auf den beträchtlichen Abstand hinzuweisen, und sagte einfach: »Danke, Mama!«
Ohnehin tat es ihr gut, der Mutter danken zu können. Das war so selten in letzter Zeit geschehen. Miriam begann, sich auf den Ausflug zu freuen. Sie überlegte sogar, ihren Vater anzurufen und ihn zu bitten, mitzukommen. Für diesen einen Tag nur. Wenn der erste Schnee fiel. Nichts ist schöner als der erste Schnee. Ein Kleid aus geflockten Liebkosungen, das sich Kuß für Kuß auf die Erde legt, entweder rasch wieder vergeht oder aber ein dicker Kuß wird. – Doch Miriam ließ es bleiben. Es war ja nur ein Wunsch und der Wunsch an sich schöner als der Umstand, nicht erfüllt zu werden. Sie wußte, daß Vater nicht kommen würde, nicht, wenn die Mutter dabei war. Also beschloß sie, ihm hinterher davon zu berichten, daß es Mama jetzt bessergehe und man wieder Ausflüge mache, dorthin, wo die Luft so gut riecht und man auf eine schöne Weise hungrig wird und sich aufs Warme freuen kann.
Sie zog sich jetzt ebenfalls an, dicke Strümpfe zu ihrem obligaten Rock, dazu die schöne oilily-Jacke, mit der sie aussah wie ein buntgeflecktes Eskimomädchen. Die Wollhandschuhe hatte sie sich selbst gestrickt, keine geringe Leistung, umso mehr als sie bemüht gewesen war, das Muster der Jacke zu kopieren. Wie auch im Falle ihres Schals. Da nun gleichfalls der Rock, die Strümpfe und selbst noch die Schuhe einiges an Farbigkeit aufbieten konnten, empfand Miriam beim Blick in den Spiegel eine Verwandtschaft zu jenen Gemälden, die sie kürzlich bei einem Museumsbesuch mit ihrer Schulklasse gesehen hatte. Nicht die Deutschen, die man expressionistisch nannte, sondern die Franzosen, die Fauves, was laut der Museumspädagogin auf den Begriff »wilde Bestien« zurückging. Miriam hatte ziemlich toll gefunden, was diese Bestien auf die Leinwand gebracht hatten. Als schafften sie es, die Dinge in ein Licht zu stellen, das von diesen Dingen selbst erzeugt wurde. Jeder Gegenstand eine kleine Sonne.
Miriam als Gemälde einer ausstellungswürdigen klassischen Moderne?
Nun, sie war keineswegs uneitel, sie mit ihrem vollen Gesicht, den blauen Augen, die im lamellösen Schatten ihrer langen Wimpern standen, dem Mund aus zwei Lippen, die ihrerseits an selbstleuchtende, polierte Objekte erinnerten. Ganz ohne Lippenstift. Der kindliche Zug, diese gewisse rundliche Frische der frühen Jahre, war weniger aus ihrem Gesicht verschwunden, als daß er sich in etwas Vornehmes verwandelt hatte, etwas von der Art eines geschmackvoll eingerichteten Raums, wo jeder Gegenstand an der einzig richtigen Stelle steht. Doch auch Miriams Eitelkeit, die Freude, die sie empfand, sich selbst zu betrachten – also ein von einem berühmten Franzosen gemaltes »Eskimomädchen« zu sein –, kam ohne Vergleiche aus. Die Freude war eine ungeteilte. Miriam wollte hübsch sein, aber nicht hübscher als jemand anders, so, wie sie auch gerne sagte, sie wolle sehr alt werden, aber damit ja keineswegs meinte, älter als ihre Sitznachbarin oder älter als ihr Bruder.
Mit diesem nun saß sie im Flur und half ihm, sich die Schuhe anzuziehen. Die Mutter stand bereits draußen und zog an einer Zigarette. Wie fast alle Kinder fand Miriam es schlecht, daß ihre Mutter rauchte. Denn gleich, wie lange sie selbst, Miriam, leben würde, wollte sie vor allem, daß ihre Mutter alt wurde, steinalt.
Genau dieses Wort dachte sie und überlegte sodann: »Können Steine sterben?« Eine Frage, die in die Haben-Ameisen-eine-Seele-Kategorie gehörte.
Die beiden Kinder traten ins Freie. Ein Streifen von Licht fiel auf die Wiese vor dem Haus. Zum wiederholten Male sah es aus, als sei die große traurige Frau in einen Beamstrahl geraten. Als versuche jemand von weit oben so hartnäckig wie verzweifelt, sie rechtzeitig von diesem Planeten fortzuschaffen. Doch dann schloß sich die Lücke in der Wolkendecke, und das graue Band war wieder ungebrochen. Die Mutter stand noch immer da. Ein sterblicher Stein.
Als man im Auto saß, beide Kinder angeschnallt auf der Rückbank, fragte Miriam, wohin man fahren werde.
»Hinaus«, sagte die Mutter.
»Ja, schon. Aber wohin? Zu Oma?«
Statt zu antworten, erkundigte sich die Mutter: »Hast du Lust auf Musik?«
»Mhm! Sweetbox«, schlug Miriam vor.
»Natürlich.« Die Mutter nickte und griff nach einer CD