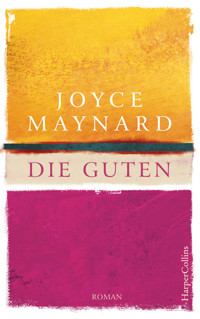12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diederichs
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte einer Außenseiterin auf dem Weg zu sich selbst
»Betrachten Sie die Liebe als einen Zustand der Gnade, nicht als Mittel zu irgendetwas, sondern (...) als etwas, das für sich steht.« (Gabriel García Márquez, Liebe in Zeiten der Cholera)
Nach einem Schicksalsschlag steht Irene am Tiefpunkt ihres Lebens. Spontan steigt sie in einen Bus ohne zu wissen, wohin er sie führt. Als sie schließlich in einem kleinen Dorf in Mittelamerika landet, quartiert sie sich in einem Hotel am Fuß eines Vulkans ein, wo sie sich zum ersten Mal nach einer langen Zeit zu Hause und geborgen fühlt. Es ist ein paradiesischer Ort, an dem die bunten, wunderschönen Vögel die Künstlerin Irene zum Malen inspirieren.
Durch unvorhergesehene Ereignisse wird ihr das Hotel übertragen. Anfangs noch skeptisch nimmt sie jedoch nach und nach die neue Aufgabe an. Es ist die Gemeinschaft im Hotel und auch dessen besondere Gäste, die ihr einen neuen Lebensinhalt geben. Doch wird sie jemals wieder glücklich sein? .
Der wunderschön und in schillernden Farben erzählte Roman berührt und lädt zum Staunen ein. Es ist ein hoffnungsfrohes Buch, das den Blick und die Liebe auf die kleinen und doch so wertvollen Dinge des Lebens richtet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 556
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Tauchen Sie ein in die magische Welt von La Llorona mit der New York Times-Bestsellerautorin Joyce Maynard!
Nach tragischen Ereignissen in ihrem Leben verschlägt es Irene nach La Llorona, wo sie sich in das geheimnisvolle Hotel am Fuße eines Vulkans einquartiert. Es erwartet sie eine bunte Welt, in der wunderschöne Vögel die Künstlerin in ihr inspirieren und in der mysteriöse Gäste Rätsel aufwerfen. Der Roman erzählt eine mitreißende Geschichte, die mit ihrer Wärme, Poesie, Fantasie und Liebe für großartige Unterhaltung sorgt.
Joyce Maynard war Reporterin bei der New York Times und arbeitet noch heute als freie Journalistin für verschiedene große Magazine. Ihre Kolumnen und Artikel erscheinen in zahlreichen US-Zeitschriften. Mit ihren Erinnerungen an die gemeinsame Zeit mit dem Schriftsteller J.D. Salinger schrieb sie einen internationalen Bestseller. Die Autorin ist Mutter dreier erwachsener Kinder und lebt in Kalifornien und Lake Atitlan, Guatemala.
Übersetzt aus dem Englischen von Judith Elze und Anne Emmert
Diederichs
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Copyright © 2023 Joyce Maynard
Der Originaltitel The Bird Hotel ist erschienen bei Arcade Publishing, New York. Herausgegeben nach Vereinbarung mit The Fielding Agency
Copyright © 2023 Diederichs Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Vera Baschlakow
Umschlag: zero-media.net, München
Umschlagmotiv: Sarah Jarrett / Arcangel Images; © Danil Nevsky / Stocksy United; FinePic®, München
Innenabbildung: © Ms.Moloko / stock.adobe.com
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN 978-3-641-30870-4V002
www.diederichs-verlag.de
Für Jenny Rein
Das Land, in dem die Geschichte spielt, mag zwar manchem mittelamerikanischen Schauplatz ähneln, ist jedoch eine Erfindung der Autorin. Ebenso der See, der Vulkan und das Hotel, die Bewohner des Ortes, das magische Heilkraut und die Glühwürmchen, die nur in einer einzigen Nacht im Jahr erscheinen. Viele der Vogelarten, die auf den folgenden Seiten beschrieben werden, gibt es in Wirklichkeit nicht. Vielleicht könnte man die Geschichte als Märchen bezeichnen, als Fantasie oder einfach als einen Traum. Doch der Teil über die Macht der Liebe und darüber, dass Menschen, die ihre Wirkung erfahren, Dinge vollbringen, die sonst unmöglich erscheinen, ist real und wahr.
Dos besos llevo en el alma, Llorona,
que no se apartan de mí,
Dos besos llevo en el alma, Llorona,
que no se apartan de mí,
El último de mi madre, Llorona,
y el primero que te di.
El último de mi madre, Llorona,
y el primero que te di.
Ich trage zwei Küsse in meiner Seele, Llorona,
die mich nie verlassen,
Ich trage zwei Küsse in meiner Seele, Llorona,
die mich nie verlassen,
Den letzten von meiner Mutter, Llorona,
und den ersten, den ich dir gab.
Den letzten von meiner Mutter, Llorona,
und den ersten, den ich dir gab.
La Llorona, die wehklagende Frau, ist ein traditionelles mexikanisches Volkslied über eine Mutter, die in Trauer um ihre toten Kinder auf Erden wandelt.
Er musste sie lehren, an die Liebe als einen Zustand der Gnade zu denken, der kein Mittel zu irgendeinem Zweck, sondern selbst Ursprung und Ziel war.
Gabriel García Márquez, Die Liebe in den Zeiten der Cholera
Was man über schwere Zeiten wissen muss
Ich war siebenundzwanzig Jahre alt, als ich beschloss, von der Golden Gate Bridge zu springen. Da war dieser eine Nachmittag. Bis dahin hatte ich ein tolles Leben gehabt. Eine halbe Stunde später wollte ich nur noch tot sein.
Ich nahm ein Taxi. Kurz nach Sonnenuntergang war ich bei der Brücke, die im Nebel aufstieg, in diesem wunderbaren Rot, das ich so geliebt hatte, als mir die Farben der Dinge noch etwas bedeuteten und Brücken dazu da waren, überquert zu werden. Als mir so vieles, das mir jetzt bedeutungslos vorkam, noch wichtig war.
Bevor ich also das letzte Mal meine Wohnung verließ, hatte ich mir einen Hundert-Dollar-Schein in die Hosentasche gestopft. Ich gab ihn dem Fahrer. Wozu noch auf das Wechselgeld warten?
Natürlich waren Touristen da. Verkehr stadteinwärts und stadtauswärts. Eltern mit Kinderwagen. Ich war auch mal eine von ihnen gewesen.
Ein Boot fuhr unter der Brücke durch. Von dort, wo ich stand und mich auf den Sprung vorbereitete, sah ich, wie es zwischen den Brückenpfeilern hindurchsteuerte, Männer schrubbten das Deck. Nichts ergab mehr einen Sinn.
Vage nahm ich wahr, dass mich ein älterer Mann beobachtete. Vielleicht wollte er mich aufhalten. Daher wartete ich einige Minuten, bis er weitergegangen war.
Nur schaffte ich ihn nicht, diesen letzten Schritt auf die Brüstung und in den Abgrund.
»Was man über schwere Zeiten wissen muss«, hatte Lenny in jener Woche gesagt, in der wir die Mieterhöhung im Briefkasten fanden, Arlo mit Kopfläusen aus der Kita nach Hause geschickt wurde, ich Drüsenfieber bekam und wir in der Wohnung einen Wasserrohrbruch hatten, der einen Stapel von Zeichnungen und damit sechs Monate meiner Arbeit zerstörte. »Wenn du unten angekommen bist, kann es nur noch besser werden.«
Als ich auf der Brücke stand und ins dunkel wirbelnde Wasser schaute, muss ich irgendetwas über mich verstanden haben. Auch wenn die Lage, in der ich mich befand, schrecklich war, konnte ein kleiner Teil von mir die Welt nicht loslassen. Die Trauer um meinen großen Verlust sollte mir wohl in Erinnerung rufen, dass das Leben kostbar war. Selbst meines. Selbst damals.
Ich trat von der Brüstung zurück.
Ich konnte es nicht tun. Aber nach Hause zurück konnte ich auch nicht. Ich hatte kein Zuhause mehr.
Und so landete ich schließlich im Hotel am Fuße des Vulkans.
1
1970. Fortan bist du Irene
Zwei Wochen vor meinem siebten Geburtstag hörten wir die Nachricht im Fernsehen. Meine Mutter war tot. Am nächsten Morgen sagte meine Großmutter, dass wir meinen Namen ändern würden.
Ich saß am Küchentisch – gelbes Resopal mit diamantförmigen Sprenkeln, eine Schachtel der allgegenwärtigen Marlboro Lights von meiner Großmutter, vor mir die Dose mit meinen Buntstiften aufgeklappt. Das Telefon klingelte andauernd, aber meine Großmutter ging nicht dran.
»Sollen sie doch alle zur Hölle fahren«, sagte sie. Sie klang wütend, aber nicht auf mich.
Komisch, woran man sich erinnert. Ich hielt meinen Stift ganz fest. Er war frisch gespitzt. Blau. Das Telefon klingelte weiter. Ich wollte den Hörer abnehmen, aber Grammy sagte Nein.
»Die Leute werden uns die Bude einrennen. Sie werden uns an den Pranger stellen. Es ist besser, wenn sie uns gar nicht erst damit in Verbindung bringen«, erklärte sie mir und griff nach einer Zigarette.
Was ist besser? Welcher Pranger und welche Verbindung? Was für Leute?
»Keiner darf erfahren, wer wir sind«, sagte Grammy. »Du kannst jetzt nicht mehr Joan sein.«
Ehrlich gesagt, hatte ich schon immer einen anderen Namen gewollt als den, den mir meine Mutter gegeben hatte. Sie hatte mich nach ihrer Lieblingssängerin genannt. (Baez, nicht Joni Mitchell, auch wenn sie beide mochte.) Ich bat sie immer, mich anders zu nennen. (Liesl, wegen einem der Kinder in The Sound of Music. Skipper, wegen Barbies kleiner Schwester. Tabitha aus Bewitched.)
»Kann ich Pamela heißen?«, fragte ich sie.
In der Schule gab es ein Mädchen, das so hieß und wunderschöne Haare hatte. Ich mochte ihren Pferdeschwanz.
So ginge das nicht, sagte Grammy. Meinen neuen Namen hatte sie schon ausgesucht. Irene.
Grammy hatte eine Freundin im Bridge-Klub, Alice, deren Enkelin so alt war wie ich. Ich hatte sie nur einmal getroffen. Irene. Sie war vor einer Weile gestorben (wahrscheinlich an Krebs, aber damals sprach niemand das Wort aus). Danach kam Alice nicht mehr zum Bridge-Klub.
Meine Großmutter sagte etwas, was ich nicht verstand: Man bräuchte ein Papier mit dem eigenen Namen drauf, wenn man zur Schule ging, um zu beweisen, dass es einen gab.
»Mich gibt es.«
»Ich kann’s dir nicht erklären, es ist zu kompliziert«, sagte sie. Wir müssten woanders hinziehen. Ich würde an eine andere Schule kommen. Sie würden mich ohne diese Papiere nicht in die erste Klasse aufnehmen. Sie hätte einen Plan, wie es gehen könnte. Sie hätte es in einer Folge von Colombo gesehen.
An jenem Nachmittag fuhren wir mit dem Bus zu einem großen Haus, in dem meine Großmutter eine Menge Formulare ausfüllte. Ich saß im Gang und malte. Als wir gingen, hatten wir meine neue Geburtsurkunde. »Es ist offiziell«, sagte sie. »Du bist jetzt Irene.«
Außerdem hatte ich einen neuen Geburtstag, denselben wie die tote Irene. Nun musste ich zwei Monate länger warten, bis ich sieben wurde. Das war nur eines von vielen Ereignissen, die mich damals verwirrten. »Frag nicht so viel«, sagte Grammy.
Auch meine Großmutter änderte ihren Namen: von Esther in Renata. Für mich blieb sie Grammy, das war also nicht weiter schwer. Bis ich im Kopf hatte, dass ich Irene und nicht mehr Joan war, dauerte es hingegen eine Weile. Ich übte gerade Schreibschrift. Mein »J« war schon ganz gut, und nun musste ich mit dem »I« wieder von vorn anfangen.
Ein Paket wurde geliefert. Darin waren Vinylschallplatten. Ich erkannte sie sofort. Sie waren von meiner Mutter. Auch die Handschrift auf dem Paket war ihre.
Ein paar Tage später kam die Umzugsfirma. Meine Großmutter hatte unsere ohnehin bescheidene Habe eingepackt. Nachdem sie die letzte Kiste herausgetragen hatten – meine Kullertränchenpuppe, ein paar Bücher, meine Chinaporzellantiersammlung, die Ukulele, die mir meine Mutter zum letzten Geburtstag geschenkt hatte und die ich nicht spielen konnte, die Buntstifte –, stand ich am Fenster und sah zu, wie die Männer den Wagen vollluden. Keiner hatte gesagt, wohin wir fuhren. Weg war das Einzige, was ich wusste.
»Siehst du den Mann mit dem Fotoapparat?«, fragte meine Großmutter und zeigte auf jemanden. »Deshalb müssen wir weg. Sie werden uns nie in Ruhe lassen.«
Wer?
»Die Paparazzi«, sagte sie. »Genau solche Leute haben Jackie Kennedy das Leben so schwer gemacht, dass sie am Ende diesen hässlichen alten Mann mit der Jacht geheiratet hat.«
Ich verstand gar nichts. Schon am Wochenende packten wir die Kisten in unserem neuen Zuhause aus, einer Einzimmerwohnung in Poughkeepsie im Bundesstaat New York, wo mein Onkel Mack, Grammys Bruder, lebte. Er nannte sie weiterhin Esther. Mich Irene zu nennen, fiel ihm dagegen nicht schwer, denn bis dahin hatte er mich erst zweimal gesehen. Am ersten Abend ließ er uns vom Chinesen Essen nach Hause kommen. Ich gab ihm den kleinen Zettel aus meinem Glückskeks zum Vorlesen.
»Die Nützlichkeit einer Tasse besteht in ihrer Leere.«
Auf dem Tisch lag ein Papierschirmchen. Auf zu, auf zu.
Grammy bekam Arbeit in einem Stoffladen. Da meine Mutter es im Jahr davor nicht zustande gebracht hatte, mich im Kindergarten anzumelden, schrieb mich Grammy in die erste Klasse der Clara-Barton-Grundschule ein. Danach fragte ich nur einmal nach meiner Mutter. Ich hatte das Gefühl, dass ich sie besser nicht erwähnte.
Ein Begräbnis hatte nicht stattgefunden. Keiner kam, um uns zu sagen, wie leid es ihm tat, was passiert war. Wenn Grammy überhaupt Fotos von meiner Mutter hatte, bewahrte sie sie irgendwo auf, wo ich sie nicht finden konnte. Da ich kein Bild von ihr besaß, malte ich selbst eines und legte es mir unters Kopfkissen. Mit rosigen Wangen, blauen Augen, Herzmund. Und langen Locken wie bei einer Prinzessin.
Wenn die Kinder in der Schule fragten, warum ich bei meiner Großmutter lebte und meine Mutter nie da war, sagte ich, sie wäre eine berühmte Sängerin, ich dürfte aber nicht sagen, wer genau. Sie wäre auf Tournee mit ihrer Band und würde für einen Auftritt bei Hootenanny proben.
»Die Sendung gibt’s nicht mehr«, sagte jemand. Ein Junge, der Richie hieß und immer herumstänkerte.
»Ich meinte die Johnny Cash Show«, verbesserte ich mich. »Die bring ich immer durcheinander.«
Nach einer Weile ließ die Fragerei nach, aber ab und zu wollten immer noch Kinder wissen, wann sie zurückkäme. Und würde ich nach Hollywood ziehen? Konnte ich ihnen ein Autogramm besorgen?
»Sie hat sich die Hand gebrochen«, sagte ich. Die linke, aber sie war ja Linkshänderin. Ich fand, das machte die Lüge überzeugender.
»Ich wette, deine Mutter ist gar nicht wirklich berühmt«, sagte Richie. »Ich wette, sie ist echt doof, genau wie die Oma aus Beverly Hillbillies.«
»Meine Mutter ist sehr schön«, erklärte ich. Immerhin das stimmte.
Meine Mutter hatte glänzendes schwarzes Haar bis über die Taille, das ich gern bürstete. Sie hatte lange, elegante Finger (mit schmutzigen Fingernägeln), und sie war so dünn, dass ich ihre Rippen nachzeichnen konnte, wenn wir auf einem der vielen Campingplätze, auf denen wir früher haltmachten, zusammen auf einer Luftmatratze lagen. Am besten erinnerte ich mich an ihre Stimme – einen reinen, klaren Sopran. Ihr Gehör war so gut (für die Musik hatte sie einen viel besseren Instinkt als für Männer), dass sie die komplexeste Melodie in Moll ohne die Hilfe einer Gitarre halten konnte – auch wenn es ihr nie schwerzufallen schien, einen attraktiven bärtigen Folksänger mit Gitarre zu finden, der sie begleitete.
Die Leute verglichen sie mit Joan Baez, aber ihr Freund Daniel – mit dem sie bis einen Monat vor dem Unfall die meiste Zeit meiner ersten sechs Lebensjahre (mit Unterbrechungen) zusammen war – sagte, sie wäre eher wie Joans kleine Schwester Mimi Fariña. Die hübschere mit der sanfteren Stimme.
Sie sang immer für mich, spät abends im Auto oder im Zelt, wenn wir zusammen im Schlafsack lagen. Sie kannte die ganzen alten englischen Balladen – Lieder über einen eifersüchtigen Mann, der die geliebte Frau in den Fluss wirft, weil sie ihn nicht heiraten will, über eine gutherzige Frau, die einem Edelmann versprochen ist, während sie sich für einen Bürgerlichen entscheidet, nur um schlussendlich zu erfahren, dass er der reichste Mann im ganzen Land ist.
Sie sang mich jeden Abend in den Schlaf. Die Lieder waren wie Gutenachtgeschichten.
»Twas in the merry month of May, when green buds all were swellin’/ Sweet William on his death bed lay, For love of Barbara Allen.« (Es war der schöne Monat Mai, wenn grüne Knospen schwellen / Süß William da im Sterben lag, er liebte Barbara Allen.)
»Kann man denn wirklich sterben, weil man jemanden zu sehr liebt?«, fragte ich sie.
»Nur, wenn man ein echter Romantiker ist«, antwortete sie.
»Bist du eine echte Romantikerin?«
»Ja.«
Manche der Lieder, die meine Mutter für mich sang, lullten mich aber nicht in den Schlaf, sondern hielten mich eher wach.
»I’m going away to leave you, love. I’m going away for a while. But I’ll return to you sometime. If I go ten thousand miles.« (Ich gehe fort, mein Lieb. Ich gehe fort ein Weilchen. Doch komm ich irgendwann zurück. Auch nach zehntausend Meilen.)
Der erste Teil über das Fortgehen beunruhigte mich. Zum Glück folgte dann, dass sie auf alle Fälle zurückkommen würde. »Es ist doch nur ein Lied«, sagte sie.
Eine dieser alten Balladen dagegen erschreckte mich zu Tode. Es war »Long Black Veil«, der lange schwarze Schleier. Dann lag ich mit der Giraffe im Arm da, die Daniel einmal auf einer Kirmes für mich ergattert hatte, als er fünf Luftballons hintereinander mit dem Pfeil traf. Und auch wenn ich meine Mutter hundert Mal das Lied hatte singen hören, fürchtete ich mich vor dem letzten Teil.
»Late at night when the north wind blows/ In a long black veil she cries o’er my bones.« (Nordwind, langer schwarzer Schleier / weint sie über meinem Grab.)
Eine seltsame Wahl für ein Gutenachtlied, aber so war meine Mutter.
»Hör auf!«, rief ich von meinem Bett oder einer Matratze aus, sobald sie zu dieser Stelle gelangte. Und wenn sie zu singen aufhörte, bat ich sie weiterzumachen, weil ich ihre Stimme liebte. Selbst wenn mir die Worte Albträume bescherten.
Meine Mutter wollte, dass ich sie Diana nannte. Sie käme sich alt vor, wenn ich Mom oder Mommy zu ihr sagte, wie eine Mutti im Fernsehen mit Bügeleisen in der Hand. Oder wie meine Großmutter, was noch schlimmer war.
Sie hatte ihren Uniabschluss in Berkeley gemacht. Und meinen Vater bei einem Sit-in gegen Vietnam im People’s Park kennengelernt. Natürlich wusste sie es damals noch nicht, aber als sie sich über die Bay Bridge auf den Rückweg machten, war Diana mit mir schwanger.
In jenem Herbst erhielt mein Vater seinen Einberufungsbescheid. Er hätte seinen Dienst etwa zum errechneten Geburtstermin beginnen müssen. Stattdessen ging er nach Kanada. Jeden Tag schrieb er Diana einen Brief, manchmal sogar zwei, in denen er sie bat nachzukommen, aber da war sie schon mit einem anderen zusammen – einem Banjospieler namens Phil, der sie an Pete Seeger erinnerte, aber sexyer war. Ich glaube, Diana liebte nicht so sehr meinen Vater, sondern vor allem den Liebeskummer – im Leben ebenso wie in Liedern. Dann trennten Phil und sie sich, und sie sang eine Menge traurige Songs. Aber das tat sie sowieso ständig.
An dem Tag, an dem sie die Wehen bekam, lernte sie Daniel kennen. Das war ihr Schema. Sie brauchte immer einen Mann an ihrer Seite und hatte nie Mühe, einen zu finden.
Daniel hatte sie im Kreißsaal als Hebamme betreut, damals ein ungewöhnlicher Job für einen Mann. Aber Daniel liebte Babys, und, wie er mir einmal sagte, er liebte es, Frauen bei der Geburt zu helfen. Er hatte Diana durch zweiunddreißig Stunden Wehen und sechs Stunden Presswehen begleitet. Sie erzählten immer, dass sie bereits verliebt waren, als ich geboren wurde.
In meiner Erinnerung an die »Daniel-Jahre«, wie ich sie nenne – mit häufigen Gastauftritten anderer Männer –, taucht vor allem die Musik auf, die wir damals hörten. Eine Platte, die Daniel für mich gekauft hatte, war von Burl Ives, der mir wie der ideale Großvater vorkam, und ein Album mit Kinderliedern von Woody Guthrie. Anders als Burl Ives klang Woody Guthrie immer ein bisschen verrückt, aber seine Lieder waren unglaublich lustig. Diana und Daniel mussten die Woody-Guthrie-Platte ein Dutzend Mal am Tag abspielen. In meinem Lieblingslied ging es um eine Autofahrt, begleitet von einer Menge komischer Geräusche, die man mit dem Mund machen musste. Eine meiner intensivsten Erinnerungen an Daniel ist, wie er mit geschürzten Lippen das Auspuffgeknatter eines sehr alten Autos nachmachte, und er klang genauso wie der kaputte Auspuff von unserem uralten Wagen. Ich dachte, jedes Auto würde solche Geräusche von sich geben.
Wir verbrachten eine Menge Zeit im Auto – in den vielen, die wir nacheinander hatten. Egal in welcher Schrottkarre wir unterwegs waren, meist gab es auf einem Highway unterwegs zu einer Friedensdemo, einem Konzert oder zurück nach Hause seinen Geist auf, wenn wir gerade ein Zuhause hatten, oder wenn wir keines hatten, auf dem Weg zum Motel, zum Campingplatz oder zur Wohnung eines Gitarre spielenden Freundes meiner Mutter. Diana und ich standen stundenlang am Straßenrand, während Daniel oder ein anderer Freund den Wagen reparierte. Die meisten von ihnen verschwimmen in meiner Erinnerung: lange Haare, komischer Geruch, Jeans, die durch den Dreck schliffen. Einer aber, Indigo, hob sich von den anderen ab. Er nannte mich Kid und kitzelte mich, obwohl ich ihm gesagt hatte, dass ich das hasste. Als wir einmal in einem Motel untergekommen waren, das einen Pool hatte, warf er mich ins Wasser.
»Joanie kann nicht schwimmen«, schrie Diana. Indigo lachte nur. Ich sank langsam auf den Grund des Pools. Ich machte den Mund auf. Keine Luft. Ich schlug mit den Armen um mich, aber es gab nichts, woran ich mich festhalten konnte.
Dann war Diana da. Sie war in ihrem Jeansrock in den Pool gesprungen und zog mich an die Wasseroberfläche. Ich hustete Wasser und rang nach Luft. Danach wagte ich mich in keinen Pool mehr.
Meine Mutter und ihre Freunde nahmen mich oft auf Konzerte mit. Ich erinnere mich vor allem an den Gestank der Dixie-Klos und dass ich mich fürchtete hineinzufallen, an den Geruch von Marihuana und Moschusöl und an das Gefühl von Wärme, wenn meine Mutter spät abends mit ihrem jeweiligen Freund zu mir ins Zelt kroch. Wenn sie meinten, dass ich schlief, flüsterten sie und lachten leise miteinander. Heute weiß ich, dass sie dann auch Sex hatten. Damals war es einfach die Hintergrundmusik meines Lebens, genau wie die alten Balladen oder Spirituals.
Häufig schimpften sie vor dem Zelt noch über eine knisternde Lautsprecheranlage. Am liebsten hatte ich die Abende, wenn Diana für mich sang, während im Schein unserer Benzinlampe die Motten über unseren Köpfen kreisten. Wenn sie und Daniel gerade ein Paar waren, saß er meist mit seiner Taschenlampe vorm Zelt und lernte für irgendeine Prüfung in der Hebammenfortbildung, rauchte einen Joint oder bearbeitete das Stück Holz, an dem er schnitzte, seit ich mich erinnern konnte. Es hatte keine für mich erkennbare Form, war aber so glatt, dass ich es mir gern an die Wange hielt. Ich stellte mir vor, dass es die Hand meiner Mutter war, die mich streichelte. Aber Diana war meist mit etwas anderem beschäftigt.
Eine Weile lebten wir zu dritt in San Francisco. Wir hatten sogar eine Wohnung mit einem Sofa und einem richtigen Bett für mich. Daniels Schwester schickte ihm einen Sauerteigstarter. Eine Zeit lang duftete unsere Wohnung nach Brot, und ich dachte wirklich, wir würden endlich nicht mehr weiterziehen. Aber als ich im Sommer 1969 sechs war, planten meine Mutter und Daniel eine Reise durchs Land, um an einem Musikfestival teilzunehmen: Woodstock. Wahrscheinlich ihre Idee, aber Daniel zog mit.
Sie packten alles, was wir besaßen, und das war nicht viel, ins Auto – in jenem Sommer war es ein silberner Renault. Ein paar Batik-T-Shirts und Bluejeans, meinen Malkasten, den ich überall dabeihatte, meine Giraffe, eine Patchworkdecke, die meine Großmutter für uns genäht hatte, und die geliebten Stiefel meiner Mutter mit dem Rosenmotiv an den Schäften sowie Daniels Bücher für die Hebammenschule. Im Kofferraum war eine Kiste mit Dianas kostbarer Schallplattensammlung verstaut. Wenn wir in heißen Gegenden wie Arizona unterwegs waren, hatte sie Angst, sie könnten schmelzen. Einmal kaufte sie eine Kühlbox und befüllte sie mit Eis, um die Platten zu schützen. Damals kam mir der Gedanke nicht, erst später fragte ich mich, ob Diana sich vielleicht um ihre Platten besser gekümmert hatte als um mich.
Meist zelteten wir, allerdings nicht in den Nationalparks, weil sie zu teuer waren. Eine Woche vor Beginn des Festivals fing der Wagen plötzlich an, Geräusche von sich zu geben wie die in dem Woody-Guthrie-Song, und so kamen wir nicht bis Woodstock. Stattdessen landeten wir bei einem Festival in einer Kleinstadt nahe der kanadischen Grenze, wo ein Mann, mit dem Diana tanzte, während er auf einem LSD-Trip war, ihr die Schlüssel zu seinem orangefarbenen VW-Käfer gab. Wir verließen das Konzert und fuhren fort, bevor er von seinem Trip herunterkam und es sich anders überlegte.
Drei Tage später hatten meine Mutter und Daniel – vielleicht weil sie mit dem Hare-Krishna-Typen getanzt hatte – auf einem Rastplatz in New Jersey wieder einmal einen Streit. Wie sich herausstellte, sollte es ihr letzter sein. An das, was folgte, habe ich nur eine vage Erinnerung. Diana und ich saßen vorn im Käfer, während Daniel seine Klamotten in seinen Seesack stopfte, ebenso ein paar von den Schallplattenalben, die meine Mutter nicht mehr wollte, weil sie sie an ihn erinnerten (Burl Ives war eine davon, Woody Guthrie eine weitere), und den Sauerteigstarter, den er in einem Einweckglas bei sich hatte. Als Letztes steckte Daniel das Stück Holz, an dem er immer schnitzte, in seine Tasche.
»Du bist ein tolles Kind«, sagte er, kurz bevor er den Rastplatz verließ. Ein paar Minuten später fuhren wir an ihm vorbei. Er stand am Rand des Highways und hielt den Daumen raus. Er sah aus, als würde er weinen, aber meine Mutter sagte, das wäre wahrscheinlich bloß eine Allergie. Auch mir war nach Weinen zumute. Von allen Menschen, die ich in jenen Jahren kennengelernt hatte, war Daniel der einzig Verlässliche gewesen.
An einer Tankstelle irgendwo in New York, wo sie wie immer nicht volltankte, fing Diana ein Gespräch mit einem Mann namens Charles an, der Mitglied einer Gruppe namens Weather Underground war. Der Name blieb bei mir hängen, weil mich die Vorstellung verwirrte: Wie konnte es unter der Erde Wetter geben? Ich stellte mir vor, dass unterirdisches Wetter mehr oder weniger gleich blieb.
Charlie lud uns ein, zu ihm und seinen Freunden in die Upper East Side in ein Haus in der East 84th Street zu ziehen, das den Eltern von einem von ihnen gehörte. Und schon fuhren wir über eine Brücke nach New York City.
Das Haus war aus Backstein, vorn auf der Treppe stand ein Topf mit Geranien, die aber offenbar schon länger keiner gegossen hatte. Charlie und seine Freunde spielten eine Menge Platten, deren Hüllen ich studierte, da ich keine Bücher hatte – Jefferson Airplane, Led Zeppelin, Cream. Meine Mutter hatte natürlich die meisten Alben noch in ihrer Kiste, aber die wollte nie einer hören. Songs wie »Silver Dagger« und »Wildwood Flower« passten nicht in das Haus der Eltern von Charlies Freund.
Schon damals war mir klar, dass Joan Baez und meiner Großmutter dieser Ort nicht gefallen hätte, und dass sie nicht gebilligt hätten, wie die Dinge dort liefen. Die Musik, die Charlie und seinen Freunden am besten gefiel, war anders: laut, mit viel Geschrei und Gitarren, die wie Menschen heulten. Wir aßen Unmengen Erdnussbutter und Schokopops, zum Abendessen gab es manchmal Eis, was großartig klingt – aber nicht war. Ein Mädchen, das einmal zu Besuch kam, die Stieftochter von Charlies Freund und ein paar Jahre älter als ich, hatte eine Barbiepuppe, die sie in einer besonderen Schachtel aufbewahrte. Ich kannte den Geschmack meiner Mutter gut genug, um sie nicht selbst um eine Barbie zu bitten, fand es aber toll, dass mir das Mädchen erlaubte, ihrer Puppe nacheinander alle ihre Kleider anzuziehen.
Auf dieser letzten gemeinsamen Reise übers Land hatte mir Daniel jeden Abend im Motelzimmer oder Zelt oder wo auch immer wir landeten ein Kapitel aus Wilbur und Charlotte vorgelesen. Als er uns verließ, hatte er das Buch mitgenommen, dabei waren wir noch nicht bis zu den drei letzten Kapiteln vorgestoßen. So erfuhr ich nie, wie es mit Fern, Wilbur und Charlotte ausging, und machte mir Sorgen um sie. Ich begriff nicht, warum die Freunde meiner Mutter Schweine so hassten. Wenn Wilbur ein typisches Schwein war, fand ich sie ziemlich toll.
Vieles von dem, worüber Charlie und seine Freunde sprachen, verstand ich nicht, außer dass der Vietnamkrieg eine große Rolle spielte – auch wenn ich nicht wusste, was das für ein Krieg war oder wo er stattfand. Ich wusste, dass sie im Keller an irgendwas bauten, für das sie einen Haufen Nägel brauchten. Einmal ging ich nach unten nachsehen, und alle wurden wütend, vor allem Charlie, der mich eine lästige Blage nannte.
Danach sagte mir meine Mutter, dass das Haus in der Upper East Side kein guter Ort für mich wäre, und brachte mich zu meiner Großmutter in die Wohnung in Queens. »Charlie ist nicht mein Typ«, sagte sie. »Ich gehe da weg.« Sie wollte sich nur ihre Platten holen und würde mich in ein paar Tagen abholen. Wir würden ein gemütliches Häuschen auf dem Land suchen und einen Garten anlegen. Sie würde jemanden finden, der mir beibringen konnte, Ukulele zu spielen (mit Sicherheit wäre es ein Mann gewesen). Sie hatte im Kopf, ein Album aufzunehmen. Ein Typ, der mal Buffy Sainte-Marie getroffen hatte, hatte ihr seine Karte gegeben.
2
Kein Hinweis auf Überlebende
Meine Großmutter machte uns gerade überbackene Käsesandwiches, als wir in den Nachrichten, die im Hintergrund liefen, von der Explosion hörten. Der Nachrichtensprecher redete die ganze Zeit über diesen Ort, den er als Weather- Underground-Haus in der East 84th bezeichnete. »Die komplette Zerstörung«, sagte er. Zwei Leute auf der Straße vor dem Haus waren getötet worden, als das Haus in die Luft flog. Einer davon ein Polizist außer Dienst, Vater von drei Töchtern und einem zehnjährigen Sohn.
Von dem Gebäude war nichts übrig geblieben, aber es wurde ein Foto gezeigt, wie es vorher ausgesehen hatte, und ich erkannte die Treppenstufen und die rote Tür. »Kein Hinweis auf Überlebende«, fügte der Nachrichtensprecher hinzu.
Ein Reporter stand auf der Straße zwischen den Trümmern und interviewte eine Passantin. »Ein Haufen Mörder«, sagte sie. »Ein Glück, dass wir die los sind!«
Nachdem meine Großmutter die Nachrichten ausgeschaltet und mich zu Bett gebracht hatte, konnte ich sie durch die Wand zwischen dem Wohnzimmer, in dem ich schlief, und ihrem Schlafzimmer hören. Es war das einzige Mal, dass ich Grammy weinen hörte.
Die Namen derer, die beim Bombenbau in dem Haus in die Luft geflogen waren, wurden erst am nächsten Tag veröffentlicht, doch da wussten wir es schon. Meine Großmutter sagte nichts darüber, aber als ich den Bericht im Radio hörte, konnte ich an nichts anderes denken als an Schokopops, die durch die Gegend schossen. Ich sah die Plattenhülle der Beatles mit den blutigen Puppen im Schoß vor mir und ein anderes Cover von King Crimson, von dem ich schon vor der Explosion Albträume gekriegt hatte: ein Männergesicht im Großformat, sodass man in die Nasenlöcher schauen konnte, die Augen weit geöffnet, als würde er schreien. Ich sah schwarze Vinylfetzen vor mir, auf der Straße vor dem Haus verstreut, und Dianas Stiefel mit den handgearbeiteten Rosen, die sie überallhin mitnahm, selbst dann, wenn wir sonst kaum etwas dabeihatten. (Zum Beispiel meine Glastiersammlung. Ich hatte sie in dem Haus gelassen, das explodiert war. Im Kopf stellte ich mir meine Tiere vor, jedes einzeln, wie es durch die Luft auf die Straße flog. Pferd. Affe. Maus. Einhorn. Ich hatte mich immer so gut um sie gekümmert.)
In Wahrheit war nichts Identifizierbares übrig geblieben, auch wenn ein TV-Reporter erwähnte, die Polizei hätte ein Stück von einem Finger gefunden. Als Grammy das hörte, schaltete sie den Fernseher aus.
»Wie konnte die Fingerkuppe von einer Hand abgehen?«, fragte ich meine Großmutter. »Was haben sie damit gemacht, als sie sie gefunden haben?«
In einer der Nachrichtensendungen, die in den Tagen nach der Explosion ausgestrahlt wurden, erschien ein Foto meiner Mutter aus ihrem Highschool-Jahrbuch auf dem Bildschirm. Im wahren Leben war sie viel schöner gewesen als auf dem Foto, das sie im Fernsehen zeigten. Ein Reporter hielt einer Frau ein Mikro hin, es war die Frau des getöteten Polizisten.
»Ich hoffe, sie schmort mit den anderen in der Hölle«, sagte die Frau.
Ungefähr zu dieser Zeit änderten wir unsere Namen in Renata und Irene.
Danach lebte ich bei meiner Großmutter – zuerst in Poughkeepsie, dann in North Carolina und Florida, danach wieder in Poughkeepsie und schließlich in Florida. Meinen Vater lernte ich nie kennen, aber ungefähr ein Jahr nach unserem ersten oder vielleicht zweiten Umzug machte meine Großmutter ihn ausfindig. Er sollte es erfahren für den Fall, dass er die Nachricht über meine Mutter nicht mitbekommen hatte. Sie nahm ihm das Versprechen ab, niemandem unsere neuen Namen mitzuteilen und auch niemandem zu sagen, wo wir waren.
Ray lebte zusammen mit seiner Frau, die kürzlich Zwillinge geboren hatte, auf einer Insel in British Columbia. Er sagte meiner Großmutter, ich könnte ihn besuchen, wenn wir in der Gegend wären.
»Ich werde immer daran denken, wie wir in jenem Sommer im Park saßen und die ganzen verrückten alten Lieder sangen«, schrieb er. »Über Diana kann man sagen, was man will, aber sie hatte eine wunderbare Stimme.«
Es musste in der dritten Klasse gewesen sein, da tauchte Daniel bei uns in Florida auf. Die Prüfung zu seiner Fortbildung hatte er anscheinend bestanden, denn er fuhr ein normal aussehendes Auto. Er arbeitete in einem Krankenhaus in Sarasota. Das Versprechen, unser Geheimnis zu wahren, hatte Ray offensichtlich gebrochen.
»Deine Mutter war die Liebe meines Lebens«, sagte Daniel zu mir. Er fing an zu weinen. Ich schätze, er war gekommen, um mich zu trösten, aber am Ende tröstete ich ihn. »Ich glaube nicht, dass sie irgendwen verletzen wollte«, sagte er. »Wahrscheinlich hat sie gar nicht kapiert, was die anderen da planten. Das Einzige, was sie wirklich interessierte, war das Singen.«
Und was ist mit mir, wollte ich ihn fragen.
»Diana hätte das sicher nicht gut gefunden, aber ich hab dir eine Puppe mitgebracht«, sagte er. Es war eine Barbie, und natürlich hatte er recht. Meine Mutter hätte mir nie eine erlaubt, nicht mal die schwarze.
Meine Oma und ich begleiteten Daniel zum Abschied zu seinem Auto. Er machte den Kofferraum auf. An der Art, wie er die Kiste aus dem Auto hob, konnte ich sehen, dass sie etwas sehr Kostbares enthielt, das ihm nicht leichtfiel herzugeben. Es war ein Stapel Vinylplatten – genau die, die meine Mutter ihm an dem Tag mitgegeben hatte, an dem wir ihn am Rastplatz zurückließen: Woody Guthrie, Burl Ives, das erste Joan-Baez-Album, sehr zerkratzt. Ich konnte noch alle Liedtexte auswendig: »Mary Hamilton«, »House of the Rising Sun«, »Wildwood Flower«. Die alten Songs, die wir immer im Auto zusammen gesungen hatten.
»Ich bin der Allererste, der dich je gesehen hat«, sagte Daniel, während er sich hinters Steuer setzte. »Ich hab die Nabelschnur durchschnitten.« Ich brauchte einen Moment, bis ich begriff. Er war damals im Kreißsaal die Hebamme gewesen. Der Job war ihm zugefallen.
»Ich wäre so gern dein Vater gewesen«, sagte er.
»Das wäre sicher gut gewesen«, erwiderte ich.
Mit Ausnahme von Daniel – und meinem Vater Ray, den meine Großmutter, ebenso wie mich, zur Geheimhaltung verpflichtet hatte – spürte uns nach der Explosion keiner aus unserem alten Leben auf. Dennoch lebte Grammy in der Angst, erkannt zu werden. All die Jahre verstand ich nicht, warum sie solchen Wirbel darum machte, aber es verging keine Woche, ohne dass sie mich an mein Versprechen erinnerte, nie jemandem zu erzählen, was passiert war oder wer wir vorher gewesen waren.
»Das ist unser Geheimnis«, sagte sie. »Wir nehmen es mit ins Grab.« Das brachte mich auf den Gedanken, tot zu sein, was mich wiederum an das Lied über den langen schwarzen Schleier denken ließ, der mich immer noch schaudern ließ.
Es mit ins Grab nehmen. Was bedeuteten diese Worte für eine Zehnjährige? Es war das Mantra meiner Kindheit. Niemand darf je wissen, wer du bist. Das musst du mir versprechen. Du wirst es mit ins Grab nehmen.
Ich hatte Albträume, was passieren würde, wenn jemand herausfand, wer wir waren.
Meine Großmutter hatte über die Jahre alle möglichen Jobs. Das Problem war, dass sie keine Sozialversicherungskarte hatte. Um angestellt zu werden, musste sie ihre jeweiligen Arbeitgeber zuerst persönlich kennen, oder sie machte Babysitting oder Ähnliches, wo ohnehin keiner danach fragte.
Ich war achtzehn und gerade mit der Highschool fertig, als meine Großmutter die Diagnose bekam. Lungenkrebs Stadium vier. Die Marlboros hatten sich gerächt.
In jenem Sommer kümmerte ich mich um sie. Noch in der Woche vor ihrem Tod im Hospiz nahm sie mir erneut das Versprechen ab, das Geheimnis über meine Mutter zu wahren.
»Ich hab es nie einer Menschenseele erzählt, Grammy«, sagte ich. »Aber selbst wenn ich es täte, würde es nichts mehr ausmachen.« Inzwischen wusste ich mehr über das, was passiert war und was Charlie und die anderen an jenem Tag im Keller dieses Reihenhauses in der Upper East Side gemacht hatten. Um meinen sechzehnten Geburtstag herum hatte mich die Neugier gepackt, und ich hatte einen ganzen Tag in der Bücherei über Weather Underground recherchiert. Bis dahin hatte ich wahrscheinlich nie wirklich wissen wollen, wie meine Mutter gestorben war, aber als ich die Berichte las, gingen mir die Bilder nicht mehr aus dem Kopf. Glassplitter überall auf der Straße. Die Fingerkuppe. Von einer Frau.
»Versprich es mir«, sagte Grammy. »Sag es nie jemandem. Es könnte dich in Schwierigkeiten bringen, die du dir gar nicht vorstellen kannst.«
Inzwischen bekam sie so viele Medikamente, dass die restlichen Worte nicht sehr viel Sinn ergaben; sie murmelte etwas über das FBI und irgendwelche neuen Testmöglichkeiten, nur auf der Basis von Speichel, einer Kaffeetasse oder einer Haarsträhne aus der Bürste, mit denen sie neuerdings Leute aufspüren konnten.
»Falls dich je irgendwer nach Diana Landers fragt«, flüsterte sie, »hast du noch nie von ihr gehört.«
3
Ein Mann von der Sonnenseite des Lebens
Ich brauchte nicht lange, um die Wohnung meiner Großmutter leer zu räumen, sie besaß ja kaum etwas. Sie hatte sich eine Feuerbestattung gewünscht, und ihre Asche sollte am Fuß der Unisphere von der New Yorker Weltausstellung 1964 verstreut werden, auf die sie mich als Baby mitgenommen hatte. Ihre Ersparnisse lagen nach Tilgung ihrer letzten Rechnungen bei gut tausendachthundert Dollar. Mein Erbe. Mit dem Geld zog ich nach San Francisco, mietete eine Einzimmerwohnung und kauft mir einen Plattenspieler.
Mit einem Geheimnis lebt es sich ganz anders, vor allem, wenn es sich um ein so großes handelt wie die Todesumstände deiner Mutter und du verhindern musst, dass die Leute dich mit deinem Geburtsnamen ansprechen.
Wenn du ein Geheimnis hast, ist es einfacher, niemandem zu nahezukommen, und genau so hielt ich es eine lange Zeit. In den Jahren in der Highschool und auch noch auf der Kunsthochschule hatte ich weder einen Freund noch eine enge Freundin. Außer in den Malkursen und bei meinem Kellnerjob in einem Diner im Mission District mied ich jede Gesellschaft.
Ich zeichnete die ganze Zeit. Ich hängte mir ein Bild von Tim Buckley an die Wand, zum einen, weil er so attraktiv war, aber auch, weil er jung und unter tragischen Umständen gestorben war, genau wie meine Mutter. Once I Was spielte ich so häufig ab, dass ich das Album nachkaufen musste. Wenn ich in eine besonders dramatische Stimmung kommen wollte, brauchte ich nur diesen Song aufzulegen.
Dann lernte ich Lenny kennen, einen Mann, den nicht der geringste Hauch von Tragik umgab. Müsste ich Lenny mit nur einer Liedzeile beschreiben, wäre es diese: He walked on the Sunny Side of the Street. Er stand wirklich auf der Sonnenseite des Lebens. Anders ausgedrückt: Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich mich in jemanden wie ihn verlieben würde – oder er sich in mich. Und doch passierte es.
Kurz nachdem ich die Kunsthochschule abgeschlossen hatte, durfte ich in San Francisco an einer Ausstellung in einer kleinen selbstverwalteten Galerie im Mission District teilnehmen. Für die Öffnungszeiten lösten wir Künstler uns ab und legten Cracker, die wir mit Käsecreme aus der Tube bestrichen hatten, auf Tellern nach, falls Besucher hereinkamen, was nicht sehr oft passierte.
Was die anderen in der Ausstellung zeigten, war vor allem abstrakte oder Konzeptkunst. Das Kunstwerk eines Typen war ein Stück Fleisch, das er in die Mitte des Raums gelegt hatte. Schon am zweiten Tag zog es die Fliegen an, und am vierten erfüllte der Gestank nach faulendem Fleisch die ganze Galerie. »Ich glaube, du musst das hier rausschaffen«, sagte ich zu ihm, als er kam, um für Crackernachschub zu sorgen. Kein Problem, sagte er. Er hatte schon frisches Fleisch dabei. Ein billigeres Stück.
Meine Arbeit hing in einer Ecke. Anders als die anderen, die ihre Kunst damals in der Galerie ausstellten, machte ich sehr realitätsgetreue Bleistiftzeichnungen, die von der Natur inspiriert waren. Schon als kleines Mädchen, noch bevor ich zu meiner Großmutter gezogen war, hatte mich das interessiert, auch wenn das Malen für mich erst nach dem Tod meiner Mutter zur Obsession geworden war. Wenn ich meine Stifte zur Hand nahm, verschwand für mich der Rest der Welt.
Über die Jahre hatte ich meine Tage phasenweise im Wald oder, wenn ich nicht in den Wald konnte, im Park verbracht. Ich skizzierte Pilze und Flechten oder hob ein vermoderndes Stück Holz auf, um die darunter wuselnde Insektengemeinschaft zu studieren und zu zeichnen. In dem Frühling, in dem meine Großmutter starb, war ich einige Wochen in die Sierra Nevada gefahren, wo ich wanderte, in meinem alten Zelt schlief und mein Skizzenbuch mit Zeichnungen von Wildblumen füllte, die ich dort vorfand. Mit genau diesem Skizzenbuch hatte ich mein Stipendium für die Kunsthochschule bekommen.
Zur Zeit der Ausstellung zeichnete ich vor allem Vögel. Die Bilder, die an jenem Tag an der Wand hingen, zeigten eine Papageienart, die sich in der Stadt niedergelassen hatte.
Man erzählte sich, dass Mitte der Achtzigerjahre zwei oder drei seltene, wunderschöne Papageien aus einem Geschäft für exotische Vögel in Südkalifornien ausgebüxt und Richtung Norden nach San Francisco geflogen seien, wo sie sich erstaunlich erfolgreich vermehrt hätten. Jedenfalls war schon bald überall auf den Bäumen des Telegraph Hill ein Schwarm farbenfroher Vögel zu sehen.
In einer Stadt, deren Vogelpopulation vor allem aus Tauben, Spatzen und Eichelhähern bestand, war das rot-blau-gelbe Gefieder der Papageien vom Telegraph Hill unübersehbar. Von meiner kleinen Wohnung in der Vallejo Street 1 aus beobachtete ich fasziniert, wenn ich mit meiner Tasse Kaffee in der Hand am Fenster stand, wie sie über die Filbert-Treppe Richtung Coit Tower hinabschossen. Die Fotos, die ich von diesen im grauen Nebel der Bay Area so unerwarteten exotischen Vögeln gemacht und an die Wand über meinem Zeichentisch geheftet hatte, waren die Grundlage für die Zeichnungen gewesen, die ich in der Galerie ausstellte – an dem Tag, an dem Lenny hereinkam.
Er schien etwa in meinem Alter zu sein, ein Mann von durchschnittlicher Größe und Statur. An seinem Äußeren war nichts Außergewöhnliches, außer dass er unglaublich freundliche Augen hatte. Er wirkte wie jemand, der sich in seiner Haut wohlfühlte. Das fiel mir wahrscheinlich auf, weil ich das von mir nicht hätte sagen können. Seine Jacke mit dem Logo der San Francisco Giants war so ramponiert, dass die meisten Leute sie längst weggeworfen hätten. Also war er entweder völlig pleite oder aber ein glühender Fan. Beides stimmte, Lenny mochte die Giants fast so sehr, wie er später mich liebte.
Er ging an den anderen Stücken der Ausstellung einfach vorbei – an der Skulptur eines riesigen Augapfels, über dem mit großen Buchstaben BIGBROTHER geschrieben stand, an dem Gemälde von einem jungen Mann, der sich eine Pistole an die Schläfe hält und, wie ich wusste (andere aber nicht), dem Künstler, der es gemalt hatte, sehr ähnelte. Er war beim Aktzeichnen im selben Kurs gewesen wie ich und litt an Depressionen. Als dieser Künstler mit dem Galeriedienst an der Reihe war, um Besucher einzulassen und ihnen Cracker zu reichen, sagte er ab. Er komme nicht aus dem Bett.
Bei Lenny wusste man sofort, dass er eine extrem positive Lebenseinstellung hatte. Das verfaulende Steak am Boden nahm er gar nicht zur Kenntnis. Er ging schnurstracks auf meine Zeichnungen mit den Papageien vom Telegraph Hill zu.
»Die sind toll«, bemerkte er, als er vor der Zeichnung eines Papageienpaares stand, das sich auf einem Zweig niedergelassen hatte. Einen Cracker hatte er im Mund, zwei weitere in der Hand, und er lächelte. Später erfuhr ich, dass er in der Hoffnung auf kostenlose Häppchen in die Galerie gekommen war. Was dann passierte, war für ihn ein Überraschungsbonus.
»Die hab ich gemalt«, sagte ich ihm.
»Meine Familie hatte einen Papagei, als ich klein war«, erwiderte er. »Jake. Ich brachte ihm bei, Sachen zu sagen wie: ›Beam me up, Scotty‹ oder ›Na los, mach mich glücklich‹.«
Das war typisch Lenny. Er war ein Mann, der seine Vorlieben – für einen Song, ein Bild oder einen Ort – an glückliche Erinnerungen aus einem bis dahin außerordentlich glücklichen Leben knüpfte. Nicht nur hatte er als Kind einen Papagei gehabt, er hatte auch zwei Schwestern (die eine älter, die andere jünger), die ihn vergötterten, und einen Hund – dazu Onkel, Tanten, Cousins und Cousinen, Freunde vom Sommercamp, zu dem er immer noch regelmäßig fuhr, und Eltern, die noch immer verheiratet waren und sich liebten. Bei seiner Bar-Mizwa hatte ihn seine Familie auf einem Stuhl herumgetragen und dazu gesungen. Er spielte in einem Bowlingteam und besaß sogar eigene Bowlingschuhe und ein Shirt, auf dessen Brusttasche sein Name gestickt war. Er war gerade Lehrer geworden und unterrichtete in einem sozialen Brennpunkt. Außerdem trainierte er an den Wochenenden Kids bei Mannschaftsspielen. Für jemanden wie mich hätte er ebenso gut vom Mars kommen können.
»Künstler bewundere ich echt«, sagte er. »Ich kann noch nicht mal eine gerade Linie zeichnen.«
»Du hast sicher jede Menge andere Talente«, entgegnete ich, »Sachen, die ich nie könnte.« Meine Antwort fiel zwar nicht besonders originell aus, aber für mich war es schon äußerst ungewöhnlich, überhaupt so viel zu einem Mann zu sagen – der zwar nicht übermäßig attraktiv war, aber nett aussah und ungefähr so alt war wie ich. Kaum waren die Worte raus, hatte ich Angst, sie könnten zweideutig geklungen haben, was er mir später bestätigte.
»Wie gut bist du im Baseball-Pitchen?«, fragte er mich.
»Rate mal.«
»Ich nehme dich zu einem Spiel mit«, sagte er. Einfach so.
»Wohin?«
»Du willst doch nicht sagen, dass du noch nie im Candlestick Park gewesen bist?«
»Dann sage ich das lieber nicht.«
Ab da waren wir ständig zusammen. Bei dem Spiel – meiner ersten Profisportveranstaltung überhaupt – erklärte er mir geduldig die Spielberichte und was ein Run Batted In oder ein Forced Error sind. Als irgendwann während eines späten Innings einer der Giants einen Schlag platzierte, der den Ball hoch über den Kopf des Pitchers sausen ließ, wandte ich mich ihm zu und sagte so etwas wie: »Echt toll!«
»Bei uns nennt sich das Pop Fly«, erklärte er mir. »Und das ist nichts Gutes.« Er sagte es freundlich. Dann küsste er mich auf den Mund. Es war ein toller Kuss. Am selben Abend liebten wir uns zum ersten Mal, in meiner Wohnung, weil Lenny einen Mitbewohner hatte. Für mich war es das allererste Mal überhaupt.
Ich war zweiundzwanzig Jahre alt und hatte seit einem halben Jahr meinen Kunsthochschulabschluss. Ich hatte einen Teilzeitjob als medizinische Zeichnerin, was bedeutete, dass auf dem Küchentisch in meiner Wohnung in der Vallejo Street immer Stifte, geordnet nach Farbfamilien, in Reih und Glied auslagen und Bilder von den medizinischen Organen sowie Zeichnungen des Fortpflanzungssystems, der Blut- und Lymphkreisläufe, des Verdauungssystems und Skeletts an der Wand hingen. Einige Jahre davor hatte ich während des Studiums neben meinen medizinischen Schaubildern eine Postkarte mit einem Gemälde von Chagall aufgehängt, das ich liebte – darauf ein Mann und eine Frau in einer kleinen Wohnung irgendwo in Russland, ein Kuchen auf dem Tisch und eine Schale mit etwas, das nach Beeren aussieht, vor dem Fenster eine ordentliche Reihe von Pfosten für einen Zaun vor einer Kirche, ein Sessel mit besticktem Kissen, ein einzelner Hocker.
Die Liebenden füllen den Raum ganz aus. Die Frau trägt ein schlichtes schwarzes Kleid mit einem weißen Kragen und schwarze Schuhe mit hohem Absatz an den unglaublich winzigen Füßen, sie hält einen Blumenstrauß in der Hand. Der Mann und die Frau küssen sich, und ihre Füße berühren den Boden nicht. Tatsächlich berühren sich nur ihre Lippen, auch wenn dies vonseiten des Mannes einer erstaunlichen akrobatischen Leistung bedarf: Um den Kuss zu ermöglichen, hat er den Kopf um hundertachtzig Grad gedreht, was anatomisch für einen Menschen unmöglich ist. Ganz zu schweigen vom Schwebeflug. Nur die Liebe konnte es zuwege bringen, dass zwei Menschen derart in der Luft schweben.
Die beiden Figuren auf dem Gemälde strahlen eine unglaubliche Zartheit und Unschuld, zugleich aber auch etwas Erotisches aus. Um vom Boden abzuheben, brauchen sich nur ihre Lippen zu berühren.
Am Tag nach unserem Baseball-Date schob mir Lenny eine Postkarte mit genau diesem Motiv unter der Tür durch. Darauf stand: Ich glaub, ich bin verliebt.
Als er mich am gleichen Abend – mit Rosen im Arm – zum Essen abholte, sah er aus wie dieser Typ aus Jeopardy!, der Lieblingsquizshow meiner Großmutter, als er den Rekordjackpot gewann. Hätten Sterbliche an jenem Tag fliegen können, wären wir zwei es gewesen. Vielleicht hätte ich da noch nicht gesagt, dass ich diesen Mann liebte, aber ich wusste, dass ich es bald tun würde. Lenny und ich, wir waren wie die beiden Leute auf dem Gemälde. Es war, als hätten wir die Liebe erfunden.
Er unterrichtete die zweite Klasse der Cesar-Chaves-Grundschule und liebte seine Schüler. Jeden Abend erzählte er mir beim Abendessen, was tagsüber in der Klasse alles passiert war, welche Schülerin schlecht drauf gewesen war, welcher Schüler endlich verstanden hatte, wie das Subtrahieren funktionierte. Ich lernte alle beim Namen kennen.
Er war von Anfang an ein Romantiker. In der kurzen Zeit bevor er bei mir einzog – und auch noch danach –, stand er nie ohne Blumen, einen Schokoladenriegel oder so alberne Geschenke wie ein Jo-Jo vor meiner Tür. Er schrieb Gedichte aus Büchern ab und las sie mir vor. Er liebte Songs wie »I Think I Love You«, »Feelings« und »You Light Up My Life«, weil sie genau ausdrückten, was er für mich empfand. Wenn wir unterwegs waren und im Autoradio ein Song lief, den er mochte, drehte er ihn voll auf und sang mit. Einmal brachte er ein Album von The Kinks mit. Darauf war ein Song, den er mir unbedingt vorspielen wollte, weil er ihn an uns erinnerte: »Waterloo Sunset«.
Für mich waren es allerdings nicht diese Momente mit Lenny, an die ich später am liebsten zurückdachte. Was mich berührte, waren die ganz gewöhnlichen Dinge, die für Lenny selbstverständlich waren: als ich eine Erkältung hatte und er losrannte, um mir Medikamente zu besorgen, als er mit einem Paar Schnürsenkel für mich nach Hause kam – nicht Rosen, sondern Schnürsenkeln –, weil er bemerkt hatte, dass meine so zerfranst waren, dass ich die Enden kaum noch durch die Löcher meiner Sneaker bekam. In San Francisco wurde es nie richtig kalt, aber an Regentagen heizte er das Auto für mich vor, und als ich einmal seinen Wagen für eine längere Fahrt zu einem Zahnarzttermin ausleihen wollte, kontrollierte er am Tag davor den Reifendruck. Ein andermal saß er an einem gemeinsamen Wochenende in Calistoga zwei Stunden neben mir am Poolrand des Hotels und versuchte, mir meine Angst vor dem Wasser zu nehmen. »Ich werde dich nie verlassen«, versprach er. Womöglich das Einzige, was er mir je sagte, das nicht stimmte.
Als wir später versuchten, ein Kind zu machen (entschieden hatten wir das bereits eine Woche nach unserer ersten Begegnung), pinnte er eine Tabelle an die Kühlschranktür, auf der wir jeden Morgen meine Temperatur eintrugen, um den Eisprung zu bestimmen, mit einem Kästchen neben jedem Tag, das ich ankreuzte, wenn ich meine Folsäure genommen hatte.
Wir stritten so gut wie nie. Allerdings fand er es nicht lustig, als ich einmal zum Spaß erwähnte, dass ich doch eigentlich Yankee-Fan sein sollte, da ich in Queens geboren wäre. »Daran arbeiten wir noch«, sagte er nur.
Unser buchstäblich einziger Konfliktpunkt betraf meinen Widerwillen, Lennys Familie kennenzulernen. Da er Jude war, stand Weihnachten nicht an, aber es gab viele andere Festtage: Thanksgiving, Lennys Geburtstag, den Geburtstag seiner Mutter, seiner Großmutter, seiner Tante, seines Onkels Miltie. Er war nicht gläubig, fastete aber an Yom Kippur zu Ehren seines Großvaters, der einige Jahre bevor wir uns kennenlernten gestorben war. Wie so ziemlich alle seiner vielen Verwandten hatte Lenny seinen Großvater sehr geliebt und wunderbare Erinnerungen an gemeinsame Besuche im Baseballstadion.
Einerseits mochte ich es, wenn Lenny Geschichten über seine glückliche Kindheit, sein glückliches Leben erzählte. Aber manchmal kam es mir auch so vor, als stünden die Geschichten von der Sonnenseite des Lebens – auf Lennys Seite – zwischen mir und dem Mann, den ich liebte. Es war, als ob wir unterschiedliche Sprachen sprächen, und abgesehen davon, dass wir verrückt nacheinander waren, kam er mir wie ein fremder Reisender auf Besuch von seinem Herkunftsland vor, und genauso musste es ihm mit mir ergehen. So viel wir gemeinsam hatten, gab es doch diese Kluft zwischen uns. Seine Lebenserfahrung gab ihm ein Gefühl von Hoffnung und Sicherheit, während ich überall Ärger vermutete und Verluste voraussah, bevor es überhaupt dazu kam.
Lennys Eltern lebten in El Cerrito, von der Stadt aus gesehen kurz hinter der Bay Bridge. In unserem ersten gemeinsamen Jahr ging er davon aus, dass ich ihn zum Sederabend zu seiner Familie begleiten würde. Ich dachte mir eine Ausrede aus – irgendeine Aufgabe, die ich für meinen Zeichenkurs zu erledigen hätte –, aber er durchschaute mich.
»In Familien fühle ich mich nicht wohl«, erklärte ich ihm.
Er hatte sich natürlich nach meiner Familie erkundigt. Ich hatte ihm nur das Nötigste erzählt – dass ich meinen Vater nie kennengelernt hatte, dass meine Mutter gestorben war, als ich noch sehr klein war, dass meine Großmutter mich aufgezogen hatte und mir seit ihrem Tod vier Jahre zuvor niemand mehr geblieben war.
Doch wie es seine Art war, wollte er mehr wissen: wie meine Mutter gestorben war, wie das für mich gewesen war. »Wir sollten ihr Grab besuchen«, sagte er. Er wollte ihr Todesdatum wissen, damit er an diesem Tag eine Kerze für sie anzünden konnte.
Ich konnte ihm nicht sagen, dass es kein Grab gab. Wo beerdigt man eine Fingerkuppe?
»Ich möchte nicht darüber reden«, sagte ich. »Es ist besser so.« Er war jetzt meine Familie, mehr brauchte ich nicht.
Und dann kam noch einer hinzu. Unser Sohn.
Kaum ein Jahr nachdem Lenny und ich zusammengefunden hatten, kam Arlo zur Welt. An dem Abend lief die World Series, das Baseballfinale zwischen den New Yorker Mets und den Bostoner Red Sox, sodass Lenny ausnahmsweise den Bostonern die Daumen drücken musste. Doch er hatte nichts anderes als unser Baby und mich im Sinn. Nicht einmal die Rallye der Mets, die einen Two-Run-Deficit im zehnten Inning in einen Sieg drehten und letztlich sogar die Meisterschaft gewannen, konnte Lenny in den dreiundzwanzig Stunden, bis Arlo es auf die Welt schaffte, auch nur eine Minute von meiner Seite locken. »Ist das wirklich wahr?«, sagte er, als die Krankenschwester mir unseren Sohn in die Arme legte. »Wir haben ein Baby gemacht.«
Ich bin Papa. Diese Worte, immer wieder.
Ich sagte gern, er sei der beste Vater und der beste Ehemann der Welt. Er brachte mir Kaffee ans Bett und kam ohne jeden Anlass mit seltsamen, komischen Geschenken nach Hause – einem Füllhalter, Socken in den Farben der Giants oder einer Glitzer-Tiara. Jeden Samstag ging er mit Arlo zu einem Eltern-Kind-Schwimmkurs ins Hallenbad – der einzige Vater in einem Pool voller Mütter, die ihre Babys hielten, während ich am Rand saß, noch immer in panischer Angst vor dem Wasser, seit ich als Kind fast ertrunken wäre. Wenn Arlo nachts weinte, sprang Lenny als Erster aus dem Bett und brachte ihn mir, und Lenny badete ihn und wechselte ihm die Windeln, sooft er konnte. Bis dahin hatte er seinen Unterricht geliebt, doch jetzt ging er nur ungern zur Arbeit. »Ich will nichts verpassen«, sagte er.
Die Sache mit Lennys Familie – vor allem mit seinen Eltern – war ein wunder Punkt. Inzwischen hatte ich gelegentlichen Besuchen von Rose und Ed zugestimmt, doch das entsprach nicht annähernd dem, was sie sich für ihr erstes Enkelkind erhofft hatten oder was Lenny sich für sie gewünscht hätte.
Wie bei der Lebenseinstellung ihres Sohnes nicht anders zu erwarten, waren Rose und Ed wunderbare Menschen. Mein Leben lang hatte ich mir gewünscht, Teil einer großen, liebevollen Familie zu sein, aber nun, da man mich in einer willkommen geheißen hatte, fühlte ich mich fehl am Platz. Wenn Lennys Familie zusammenkam, redeten alle pausenlos und laut, sie unterbrachen einander, jeder hatte eine andere Meinung und hielt mit seinen Gefühlen nicht hinterm Berg. Und es wurde viel gelacht.
Ich sagte bei solchen Besuchen nur wenig, aber das machte nichts, da rundherum so viel los war. Ich saß auf dem Sofa, stillte Arlo und nahm das Essen an, das mir unaufhörlich angeboten wurde. Manchmal hatte ich einen Skizzenblock dabei, um die anderen zu zeichnen. »Unser persönlicher Michelangelo«, nannte mich meine Schwiegermutter. (Sie redete von »unserer Familie«. Wenn schon nicht in meinen Augen, so war ich in ihren doch Teil dieses glücklichen Familienkreises.) Sie und mein Schwiegervater rahmten alle Zeichnungen, die ich in ihrem Haus angefertigt hatte. Sie hingen neben den Fotos von sämtlichen Verwandten, darunter auch von mir. Mein Foto hatte noch nie an irgendeiner Wand gehangen.
»Wann bekommt ihr denn nun das nächste?«, fragte mich Rose an dem Tag, an dem wir Arlos ersten Geburtstag feierten. An solche Fragen war ich nicht gewöhnt. Ich hatte schon früh gelernt, mir nicht in die Karten schauen zu lassen.
Auf der Heimfahrt von El Cerrito an jenem Tag war Lenny stiller als sonst.
»Sei meiner Mutter nicht böse«, sagte er. »So ist sie einfach. Sie liebt dich sehr.«
»Ich wusste nicht, was ich sagen sollte«, antwortete ich.
»Ich weiß, dass es schwer für dich ist«, bemerkte er. »Vielleicht kannst du mir ja eines Tages sagen, warum.«
Das konnte ich nicht. Ich hatte meiner Großmutter ein Versprechen gegeben.
Einige Wochen nach Arlos erstem Geburtstag heirateten wir auf dem Mount Tamalpais, in einer flippigen alten Wanderhütte ohne Strom, die sich West Point Inn nannte. Im Hauptraum der Lodge stand ein großes altes Klavier, an dem Lennys Schwester Rachel für uns spielte – Musicalsongs, amerikanische Unterhaltungsmusik, die Beatles –, begleitet von mehreren Familienmitgliedern mit Bongos und Tamburin und Lennys Onkel Miltie am Akkordeon. Lennys Mutter und Schwestern hatten Tage im Voraus gebacken. Samt Arlos Kinderhochstuhl zogen sie alles über die Feuerschneise den Berg hinauf. Arlo hatte damals gerade angefangen zu laufen. Er lief unablässig im Kreis herum und strahlte.
In den Wochen vor der Hochzeit hatte Lenny immer wieder nachgefragt, ob nicht noch jemand von meiner Seite dazu eingeladen werden sollte. Für Lenny war es unvorstellbar, dass ein Mensch, den er so liebenswert fand wie mich, niemanden hatte, der beim Ehegelübde dabei sein wollte.
An der Kunsthochschule hatte ich mit meinen Kommilitonen zwanglose Freundschaften gepflegt, mich aber auf nichts Tiefergehendes eingelassen. Ich konnte es meinem künftigen Mann nicht erklären, doch dieser alte Fluch – nicht sagen zu dürfen, wer ich wirklich war, und das Geheimnis wahren zu müssen – machte es mir unmöglich, außer Lenny jemanden an mich heranzulassen.
»Was ist mit Onkeln, Tanten, Cousins zweiten Grades?«, fragte er. »Da muss es doch irgendwen geben.«
In einem schwachen Augenblick hatte ich erwähnt, dass ich zumindest gehört hätte – auch wenn es fast zwanzig Jahre her war –, dass mein biologischer Vater auf einer sehr kleinen Insel in British Columbia lebe.
»Ich hab ihn überhaupt nie kennengelernt«, fügte ich hinzu. »Ich weiß nur, dass er Ray heißt und Vater von Zwillingen ist.«
Das genügte meinem Zukünftigen. Er machte Ray ausfindig. Ich war dabei, als er ihn anrief.
»Sie kennen mich nicht«, sagte Lenny, »aber ich liebe Ihre Tochter. Wir werden nächsten Monat im Marin County in Kalifornien heiraten. Wir würden uns unglaublich freuen, wenn Sie zur Hochzeit kämen.«
Jahre zuvor hatte die US-Regierung eine Amnestie für Wehrdienstverweigerer aus der Zeit des Vietnamkriegs angekündigt, die nach Kanada geflohen waren. Es bestand keine Gefahr für Ray, an der Grenze aufgegriffen zu werden, falls er zur Zeremonie kommen sollte. Aber dem Teil des Gesprächs, den ich mitbekam – Lennys Teil –, war deutlich zu entnehmen, dass mein biologischer Vater an meiner Hochzeit etwa so interessiert war wie an einer Steuerprüfung.
Die Stimme meines Zukünftigen gegenüber dem Mann, den er als seinen künftigen Schwiegervater bezeichnete, blieb freundlich, ohne den Hauch eines Vorwurfs oder dem Versuch, Schuldgefühle zu wecken.
»Ich weiß, es ist eine lange Reise«, sagte Lenny (mit einer Hand am Hörer, den anderen Arm um meine Schultern gelegt). »Ich würde auch gern den Flug bezahlen. Meine Eltern würden Sie unterbringen. Es würde Irene so viel bedeuten.«
Jahre zuvor hatte meine Großmutter Ray über meine Namensänderung informiert. Nicht dass er je die Gelegenheit gehabt hätte, mich mit meinem ursprünglichen Namen anzusprechen.
»Ich höre Sie«, sagte Lenny mit sehr leiser Stimme. Ich begriff, dass er seine Wut in Schach zu halten versuchte. »Ich verstehe. Vielleicht überlegen Sie es sich ja noch mal.«
Bevor das Gespräch endete, sagte er: »Sie haben eine wunderschöne Tochter, Ray. Sie würden sie lieben, wenn Sie sie kennenlernen würden.«
Aus Lennys Blick schloss ich, dass die Verbindung an dieser Stelle unterbrochen wurde.
4
Wie man seine Familie findet
Vermutlich zum ersten Mal in meinem Leben war ich glücklich. Doch war da auch immer das Geheimnis – die Angst, die mir meine Großmutter zusammen mit ihren Porzellanfiguren und ihrem Kochbuch für die perfekte Hausfrau hinterlassen hatte. Die Angst, dass eines Tages jemand herausfand, wessen Tochter ich war, und mich verfolgen könnte.
In jenem Winter lagen wir eines Abends zusammengerollt auf dem Sofa und sahen fern, nachdem wir Arlo ins Bett gebracht hatten. In einem Fernsehmagazin lief ein Beitrag über neue Technologien in der Kriminalistik. In der Episode ging es um einen Fall in England. Zwei junge Mädchen waren vergewaltigt und ermordet worden. Ein Junge in ihrem Dorf war der Tat beschuldigt, durch DNA-Analyse aber entlastet worden. Als die Polizei freiwillige Teststellen zur Blutabnahme bei allen Männern einrichtete, die in der Umgebung lebten, wurde durch ebendiese Analysemethode schließlich der wahre Täter identifiziert. Nur einer hatte die Blutabnahme verweigert, doch kam heraus, dass ein anderer Ansässiger, der sich dem Test nicht unterziehen wollte, seinen Freund überzeugt hatte, eine Blutprobe in seinem Namen abzugeben. Als die Polizei diese endlich erhielt, passte die DNA zu der des Vergewaltigers. Die Sendung, die Lenny und ich an jenem Abend schauten, berichtete über die Überführung des Mannes und seine Verurteilung zu lebenslänglicher Gefängnisstrafe.