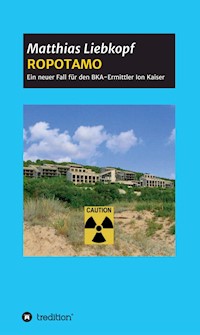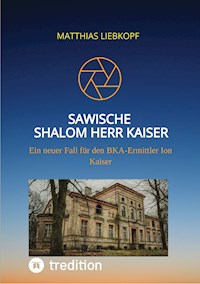3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein historischer Krimi mit Verbindung zum Deutschen Kaiserreich, über die vermeintliche Geschichte einer Pandemie und wie diese entstanden sein könnte. Verpackt in eine spannende Geschichte in der Kaiserzeit des alten Preußen, erzählt durch einen sympathischen, selbstkritischen Hauptdarsteller mit Machtkämpfen der Herrschenden, Lügen und Korruption sowie einer Prise Witz und leichter Frivolität.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 354
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Matthias Liebkopf
Das Imperium der Krähen
© 2024 Matthias Liebkopf
Umschlag, Illustration: Matthias Liebkopf
Lektorat, Korrektorat: Michaela Szemendera
Verlag & Druck: tredition GmbH,
Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Softcover
978-3-384-04653-6
Hardcover
978-3-384-04654-3
e-Book
978-3-384-04655-0
Inhalt
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Prolog
Der Anfang eines Traums
Beherrschung der eigenen Courage
Neue Wege im Beruf
Orients Anziehungskraft
Chirurg und merkwürdiger Arzt
Der Überfall
Mein Jesus
Der neue Kaiser
Alte Erinnerungen
Orients Überraschungen
Kairo unter der Besatzung
Falsche Wege
Medizinische Experimente und Geld-beschaffung
Im Land der Nubier
Deir Anbar Samaan
Der Tempel von Philae
Der Doppeltempel von Kom Ombo
Wüstenleben
Feuer des Todes
Neue Zeiten im Leben
Ein Abschied, zwei Reisen
Nilwasser
Wo bist Du?
Unruhige See
Jäger und Gejagte
Zu Hause oder nur eine Wohnung?
Sturmflut
Sorgen in Berlin
Diese Weibsbilder
Ein Traum, ein Albtraum
Das Ende des Lebens ist nur ein Anfang
Lebensdaten
Epilog
Das Imperium der Krähen
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Der Anfang eines Traums
Lebensdaten
Das Imperium der Krähen
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
Prolog
Nach meinem langen Leben, was mit biblischer Schuld behaftet ist, komme ich nun bald an das Ende meines Weges.
Wie vor vielen Jahren ist heute wieder der Silvesterabend. Ein neues Jahr deutet an, noch schlimmer als vergangene zu werden, da sich ein großer Krieg schon in Kürze, in greifbarer Nähe kommend, abzeichnet. Die Anzeichen dazu auf der politischen Bühne nehmen immer mehr Form und Gestalt an.
Sollte mich der Herrgott bald zu sich be-rufen, will ich vorher nunmehr Zeugnis über die damaligen, wundersamen und teilweise bestialischen Geschehnisse im Dreikaiserjahr 1888 in schriftlicher Form, in Demut den Opfern gegenüber, ablegen.
Möge mich die Geschichte durch nach-folgende Generationen, die durch mein Werk geschädigt wurden, nicht zu sehr strafen. Habe ich doch nur nach bestem Wissen und Gewissen und auf allerhöchsten Befehl ge-handelt.
Nun, da meine Hand zittrig diese Zeilen zu Papier bringt und mein Blick starr ins Berliner Grau des Winters fällt, denke ich an die letzten Jahrzehnte auch in Dankbarkeit zurück.
Das Gaslicht, was früher meine Schreib-arbeit begleitet hatte, schien dunkler zu werden, wie mein Augenlicht, was trüber und trüber wird.
Die stille Heiterkeit der wenigen Menschen in den Gassen von Berlin zum Jahreswechsel wirkt aufgesetzt, teilweise nach alter Zeit rufend. Die Angst vor der Zukunft hält die Menschen gefangen.
Willkommen Neues Jahr! Die Glocke der Georgenkirche schlug zwölf Mal. Möge es friedlich bleiben, du mir angstmachendes, unbekanntes Jahr 1914!
Ich blicke nochmals zurück und schreibe meine Memoiren.
Der Anfang eines Traums
Über Berlins Straßen legte sich dichter schleierhafter Dezembernebel in der Silvesternacht des Jahres 1887, während mein Blick immer wieder auf meine Taschenuhr gerichtet war.
Heller Glockenklang der Georgenkirche sollten in wenigen Minuten ein neues Jahr verkünden. Meine Taschenuhr schien präzise ihre Zeit anzuzeigen. Punkt 0:00 Uhr geschah es wie jedes Jahr. Die Glocken riefen die Christen an, das Neue Jahr im Deutschen Kaiserreich zu begrüßen.
Was bringt es?
Wo befindet man sich Ende des Jahres?
1887 ging als Jahr des Abschieds in meine Geschichte ein. Zu viele Familienmitglieder mussten den Weg zum lieben Herrgott antreten. Der Gottesacker war mein be-vorzugtes Gebiet zum Besuch geworden.
Meine Eltern starben fast zeitgleich vor ein paar Jahren, dann vor ein paar Monaten meine Tante, mein Onkel und vor acht Wochen meine Frau und mein ach so kleines Kind.
Alle zum Herrgott befohlen durch den schweren Choleraausbruch in Berlin. Ein rücksichtsloses Ding namens Schicksal verwehrte mir die Abberufung ins Paradies, ließ mich auf Erden die Qualen des Abschieds erleiden ohne Aussicht auf Heilung.
Mir blieb bloß zum Wanderer zwischen den Friedhöfen der Stadt zu werden, ohne meine eigene Person noch irgendwie wahrnehmen zu können. Ein wandelnder Körper ohne Kraft und ohne Aussicht auf etwas Glück.
Meine Person: Nun als Karl von Steinitz geboren, Sohn eines hochrangigen Offiziers der kaiserlichen Armee und einer bürger-lichen Frau aus der Berliner Mittelschicht blieb mir nach dem Tod der Eltern nur ihre Wohnung in einer gut situierten Gegend am Rande Berlins.
Die Haushälterin musste ich leider ent-lassen, ebenso den Kutscher meines Vaters. Die Zeiten wurden schlechter.
Auf den großbürgerlichen Lebensstandard meiner Eltern, den sie so liebten, werde ich wohl verzichten müssen. Mein Einkommen als Übersetzer brachte kaum den Lohn, um die Wohnung mit sieben Räumen weiter halten zu können. Erspartes war nur noch in kleinem Maße vorhanden, sehr begrenzt bei den hohen Kosten heutzutage, doch die Zeiten werden teurer und teurer.
Unmut machte sich in der Bevölkerung breit. Erste reaktionäre Gruppen bildeten sich und wurden vom Staat mit eiserner Hand ver-folgt.
Doch es gab auch eine andere Seite. Wohlsituierte Menschen, die ihren Wohl-stand den armen, schwer arbeitenden Tage-löhnern und Angestellten verdankten.
Erste Behausungen der wohl Begüterten wurden mit Elektrizität beliefert. Die Miete für Glühbirnen und Zählapparate im Jahr verschlingen Unsummen.
Bei dem stündlichen Verdienst durch meine spärlichen Dienstleistungen bei Über-setzungen verdiente ich nur Pfennige, eine ganze Reichsmark war selten. Nur ein wenig Mathematik sollte reichen, um meinen kompletten Finanzausfall in etwa zwei Jahren vorauszusagen. Doch man gewöhnt sich an einen gehobenen Lebensstil, obwohl auch meine Garderobe langsam zu wünschen übrig ließ.
Aus dem Fenster sah ich durch meine Straße laufend noch beschwingte Menschen, die mit Laternen und Kerzen das Neue Jahr begrüßten. Auch im Haus deutete eine erhöhte Lautstärke auf noch wache Mit-menschen hin, die ihre kleinen Feiern im Rahmen ihrer Familie praktizierten. Möge man am Vormittag davon nur noch wenige treffen.
Mein Wunsch auf Einsamkeit war hoch, Leute aus der Nachbarschaft treffen zu müssen, war mir ein Graus. Die ewigen Fragen nach meiner Gesundheit und ob ich alleine durch die Monate komme, machten mir zu schaffen. Der ewige Wunsch auf glückliche Zeiten im Neuen Jahr nehmen mir mehr und mehr die Lust auf eine Kommunikation mit anderen, unbekannten Mitmenschen.
Kurz vor dem Ende der ersten Stunde des Jahres sollte ich mich zu Bett begeben. Nur mein Wohnzimmer wurde noch beheizt. Im Schlafgemach wird mir Kälte in der Nacht nichts ausmachen.
Strikte Sparsamkeit sollte mir die Wohnung noch etwas erhalten. Sie war in die Jahre gekommen, schwere Tapeten lösten sich in unbeheizten Zimmern langsam von den Wänden.
Gaslicht muss einem Raum vorbehalten sein, dort, wo ich arbeitete. Denn meine Arbeit kann ich in den dunklen Monaten sonst nicht ausführen.
So etwas machte mir die Seele schwer, sah ich doch meine Eltern, meine Frau mit Kind noch beschwingt heiter durch die großen Räume der Wohnung ziehen. Nur ich blieb übrig, ein Alter von über vierzig Jahren hatte ich überschritten und somit die Lebenserwartung eines einfachen Arbeiters im Kaiserreich fast erreicht.
Arme Kreaturen aus der Arbeiterschicht werden schon meist in ihren dreißiger Jahren auf den Gottesacker befohlen. Zu schwer und schmutzig waren ihre Lebens-umstände.
Somit geht es mir eigentlich im Vergleich zu diesen armen Menschen noch gut, möge es im Jahre 1888 so bleiben! Dann sehen wir weiter.
Also begab ich mich in der ersten Stunde des Jahres zu Bett. Traditionsgemäß mit einem kleinen Glas gut abgelagertem Kognak noch aus Vaters Zeiten. Sparsam mit dem braunen Elixier werde ich sein, um mich noch Jahre an den Geschmack meines Vaters bei so einem guten Tropfen erinnern zu dürfen.
Die Augenlider werden schwer und der Schlaf legte sich bleiernd über meine ge-schundene Seele.
Das Pochen im Traum wurde heftig, als mich dieser Traum aus dem Schlaf riss. Das Pochen verstummte keineswegs und drang mehr und mehr in meine Ohren. An der Eingangstür zu meiner Wohnung begehrte jemand Einlass mit hoher Vehemenz. Schnell ein Griff zum Morgenmantel und trotz angelegter Bartbinde zur Schonung meiner Zierde auf der Oberlippe, öffnete ich die Haustür.
Ein Bote um diese nachtschlafende Zeit ist selten, meine Taschenuhr lag noch auf dem Nachttisch am Bett. Ohne Gruß und nur kurz nickend übergab mir ein Mann in blauer Botenuniform zwanglos ein recht großes Kuvert mit Wachssiegel und verschwand.
Das auf dem Papier hervorstechende Wap-pen machte meine kurze Nacht zunichte. Hellwach und mit zittrigen Fingern schloss ich die Tür, öffnete umständlich den Brief, nachdem ich ein Gaslicht entzündet hatte. Doch diesmal musste es ein hochgedrehtes Gaslicht sein. Es bewahrheitete sich meine Vermutung und eine Gänsehaut auf meinen Armen wollte nicht weichen. Das Wappen des Kaiserhauses prangte unübersehbar groß auf Kuvert und Brief.
Nach meiner Brille suchend las ich folgende Zeilen.
Durch allerhöchsten Befehl seiner Majestät, haben sich der Schreiber und Übersetzer Karl von Steinitz am folgenden Tag um die Uhr 8 im Kaiserlichen Schloss zu Berlin einzufinden, um dort weitere Befehle abzu-warten. Dieser Brief ist mitzubringen!
Staatskanzlei seiner Majestät Ein flaues Gefühl in der Magengrube ist meist die schleichende Angst vor etwas Un-gewissem. Ein zweites Glas meines Vaters Kognak wurde notwendig, um die Angst etwas zu mildern. Nie hatte man von Befehlen durch die Staatskanzlei gehört, einfache Bürger ins Schloss seiner Majestät berufen zu lassen. In Vaters Zeiten beim Militär in Kriegszeiten allemal, doch heut-zutage?
Beherrschung der eigenen Courage
Neujahr, ein wahrhaft mystischer Tag, einer seits jungfräulich, ohne eigene neue Geschichte des neuen Jahres und doch so vielschichtig durch alte Geschehnisse der Weltgeschichte.
So drängte meine Taschenuhr zur Eile, ein Spaziergang wird es nicht. Gut eine halbe Stunde mit Spazierstock. Eine Droschke um die frühe Zeit des Neujahrmorgens wird nicht zu besorgen sein, teuer ist sie allemal. Die zwei Groschen kann ich sparen.
Mein Körper bebte vor Anspannung und Neugier. Ruhe muss meine Devise sein, um nicht dumm und einfach zu erscheinen.
Der beste Gehrock aus der Kommode mei-nes Vaters, alt aber passend. Sollte es doch eigentlich der Stoff meiner letzten Ruhe auf dem Gottesacker neben meiner Frau zur Zierde meines Leichnams werden. Nun doch mit ihm hinein ins Tageslicht, in diesen frühen Morgen, die frische Luft in die Lungen ziehend, Schritt für Schritt zum Hohen-zollernschloss am Ende der Straße der Linden.
Meine Schritte ungewollt schwer und schwerer werdend, je näher mein Ziel zu kommen schien. Menschenleere in einer Stadt, die sonst so ungestüm laut und lebensfroh schien, trotz der grassierenden Armut, die all zu mehr an jeder Ecke zu finden ist.
Keine bettelnden Kinder und sich anbietende Dirnen in den Nebenwegen der Kaiserstadt. Vorbeieilende Dienstboten in geringer Zahl nahm ich kaum wahr.
Stumm schien der neue Mensch im Neuen Jahr zu bleiben, Stimmen fern meines Ohres gaben mir eine Art Zufriedenheit im Kopf. Ruhe und Einsamkeit sind gut für mich.
Menschenscheu trifft es, ungesellig ge-worden bin ich und Freude verschmähend. Der Tod hat es sich um mein Leben bequem gemacht, andere Mitmenschen bemerken es, meiden mich dadurch natürlich auch, doch es war mir egal geworden.
Zu viele Gedanken, zu lang der Weg zum Schloss. Lunge und Herz schienen sich im Kampf gegeneinander in meinem Leib zu duellieren. Beides schon arg angegriffen im alternden Korpus des Karl von Steinitz.
Schlossplatz Berlin mit der prunkvollen Residenz seiner Majestät ist immer zu einer Würdigung gut. Nur wenige Residenzen in der zivilisierten Welt werden solch eine Ausstrahlung besitzen. Macht entspringt aus der Angst vor Obrigkeit.
Dieses Bauwerk sagt, halt ihr Frevler! Hier ist von Gottes Gnaden seine Majestät, in stetigem Streben sein Volk zu leiten und das Deutsche Reich vor dem Feinde zu schützen, Tag und Nacht bemüht, die wahren Entscheidungen dafür zu treffen. Wer vermag solch Tun zu bewerten? Nur Gott allein.
Hinweg ihr Gedanken, Ruhe jetzt, steuerte ich doch auf den riesigen Eingangsbereich mit seinem Rundportal zu. Die stehende Wache bemerkte mich, gab mir zu verstehen, weiter laufen zu müssen, doch die Depesche aus der frühen Stunde änderte seine Meinung schnell.
Ein zweiter Angehöriger der Wache musterte meine Gestalt und winkte mich zu sich. „Großer Tag für Sie man, wa? Warten musste hier, der Dienstbereich holt Dir ab!“
Einfache Gemüter in Wachuniform, mir soll es recht sein!
Dienstbereich hieß hier ein Mann in blau-roter Ornatsuniform im Husarenstil. Ein Wink deutete mir an, mich vom Sitz im Vorraum zu erheben und ihm zu folgen.
„Guter Mann, Sie kennen das Hofzeremoniell bestimmt nicht?“
Mein Kopfschütteln sprach Bände, meine Gesichtfarbe auch!
„Also, am Hofe sind Audienzen eher sehr selten geworden, nur Sprechen, wenn man aufgefordert ist, Verbeugen beim in den Saloon eintreten und warten, was ihre Majestät Ihnen zuträgt. Angeredet wird nur mit „Eure Majestät“. Nach der Audienz, verbeugen und rückwärts entfernen. Noch Fragen?“
Mein Kopfschütteln entsprang nur meiner Nervosität.
Leere Gänge und Flure mit reich verzierten Decken, Wänden zogen an uns vorbei.
Hier hat schon elektrisches Licht Einzug gehalten, ein Luxus, den sich einfache Menschen wohl niemals leisten können werden.
In meinen Gedärmen rumorte es gewaltig, so eine Sache erlebt man nur einmal im Leben. Was tun, wenn ich hier falsch am Platze bin? Was tun, wenn ich nicht antworten kann? Zu oft war ich doch zurückhaltend und schüchtern, keine guten Eigenschaften in dieser neuen Zeit!
Die Tür zum Saloon, an der wir zum Stehen kam, schien über drei Meter hoch zu sein. Einmal Klopfgeräusch seines weiß behand-schuhten Zeigefingers klang zu leise, um vernommen worden zu sein, doch schwang die Pforte leise auf, gab den Blick frei in einen kleinen privaten Raum.
Ein Domestik in ebenso einer blauroten Ornatsuniform öffnete und bat mich hinein, nahm mir Spazierstock und Hut ab. Deutete sofort danach mit der flachen Hand, mich tief zu verbeugen.
Der Herzschlag schien mir die Augäpfel herausdrücken zu wollen. Saß doch dort am Schreibtisch die Spitze des Deutschen Reiches und Kaiser über uns alle Preußen.
Neue Wege im Beruf
War meine Verbeugung lange genug? Das Blut im Kopf mag sagen, es reicht. Langsam nahm ich die Umgebung wahr.
In der Ecke des Raumes mit elektrischem Licht hell beleuchtet stand der riesige goldfarbene Schreibtisch. Ein Mann mit prägnatem, weißen Wangenbart in Uniform schien Akten zu studieren und mit Feder abzuzeichnen. Von meiner Anwesenheit schien er keine Notiz zu nehmen.
Mein flehender Blick zum Diener in Uniform half nicht. Zeit des Wartens kann lang werden, ohne zu wissen, warum.
Die Feder wurde abgelegt, ein weiterer dienstbarer Mann nahm die Akten vom Schreibtisch und entfernte sich rückwärts hinter einen Wandvorsprung.
Eine ruhige alte, doch prägnante tiefe Stimme drang leise zu mir.
„Ist er der Sohn des Friedrich Karl von Steinitz?“
„Ja Eure Majestät!“
„Ist er auch ein Militär?“
„Nein, Eure Majestät!“
„Was ist Er?“
Damit schaute er vom Schreibtisch hoch und mich direkt an.
„Schreiber, Übersetzer, als Militär bin ich wegen einer ständigen Affektion meiner Lunge nicht tauglich, Eure Majestät.“
„Welche Sprachen spricht Er?“
„Latein, Arabisch, Persisch, Französisch, Griechisch, Türkisch, Englisch und etwas Afrikans.“
„Deutsch auch, wie mir scheint!“
Dabei lächelte der Kaiser milde. Ein kleiner Scherz, der es mir leichter machte, hier ruhig stehen bleiben zu können.
„Ja Eure Majestät, wie kann ich dienen?“
Der Mann hinter dem Wandvorsprung kam auf mich zu und übergab mir Akten, flüsterte mir kurz zu. „Durchlesen!“
Dem kam ich nach, wurde nicht klug daraus!
„Steinitz, Er hat es sich durchgelesen? Er ist ein gebildeter Mann, wie mir scheint!“
„Ja, Eure Majestät, nur bin ich nicht…“
Er unterbrach meine Gedanken, die mir lose über die Lippen kommen wollten.
„Ich bin ein alter Mann Steinitz, bald werde ich 91 Jahre alt, viel Zeit für ein einziges Leben. Sein Vater hat mir treulich gedient im Militärdienst im Orient, guter Mann. Nun ist es an Ihm, sich zu beweisen, um seinem Kaiser treu dienstlich zu sein. Lese er laut vor!“
Ich tat wie mir aufgetan.
„Nun, da es mit mir zu Ende geht, muss ich um Hilfe in der Sache im Orient erflehen. Mögen diese Zeilen seine Majestät in Berlin erreichen und mir Hilfe in Person von Karl von Steinitz zu senden. Mögen die Dinge nicht zu spät sein, um die anstehenden Dinge regeln zu können. FINIS EST OMNIS LABORIS. MORS PORTA VITAE AETERNAE“
Mein Blick ging zum Monarchen zurück.
„Was bedeutet es Steinitz?“
„Eure Majestät! Der Tod ist die Ruhe des Wanderers, er ist das Ende aller Mühsal. Der Tod ist die Pforte zum ewigen Leben.“
„Gut Steinitz, mein Latein ergab es auch.“ Dabei stand er langsam hinter dem Schreibtisch auf, der Diener kam hinzugeeilt, um den Kaiser Unterstützung zuteil werden zu lassen. Er winkte ab.
„Komm Er näher Steinitz.“
Dem kam ich nach und sah auf den Schreibtisch, auf dem eine Landkarte des Orients lag.
„Hör Er gut zu und gebe Er niemandem Auskunft über dieses, unsere Gespräch.“
„Jawohl, Eure Majestät!“
„Meiner Lebenszeit gehen die Tage aus. Mein Sohn, der Kronprinz Friedrich wird neuer Kaiser werden. Nur ist er leider ungesünder als ich. Seine Ärzte haben ihm ein bis zwei Jahre gegeben. Zu wenig, um dem Deutschen Reich ein hilfreicher Monarch sein zu können. Es gibt Be-drohungen aus allen Himmelsrichtungen. Nur ein starker Kaiser kann dieses Wirrwarr beherrschen. Sein Vater Steinitz hat mir im Orient treu gedient und meine Befehle ausgeführt. Nun ist Er an der Reihe. Wie im Brief vermerkt, ist Er per Namen angefordert worden. Nun denn!“
„Ich, Eure Majestät? Nicht mein Vater, der unlängst verstorben ist? Verzeihung Eure Majestät, ich sprach offen.“
„Gut Steinitz, spreche Er offen. Im Brief ist Er per Namen angefordert, nicht sein Vater! Er wird reisen! Nach Konstantinopel, ach man nennt es ja heute Stambul, um dort Nachforschungen anzustellen. Ein Arzt wird sich dort mit Ihm treffen und die Situation dort erklären.“
„Euer Majestät!“
„Steinitz, Er ist noch nicht im Bilde. Dieser Brief wurde von meinem in den Orient geschickten Gesandten verfasst. Dieser sollte mir etwas verschaffen, etwas, was meinem Sohn helfen wird, seine Krankheit zu besiegen, damit er einen Sieg gegen unsere Nachbarn erringen kann.
Es ist nur im Orient erhältlich und in kleinen Mengen gesundheitsbessernd, in großen Dosen wahrscheinlich nicht.
Versteht Er Steinitz? Es soll dem nächsten Kaiser helfen, zu Überleben in seinem Amt! Dieses Etwas nennt sich Mumijo, ein Medizinstück, um gesund und alt zu werden und bleiben.
Sein Vater Steinitz hatte es mir aus dem Orient gebracht. Zu wenig aber, um noch meinem Sohn Hilfe sein zu können. Mir hat es geholfen, meinem Sohn muss es noch helfen, seine Krankheit zu besiegen. Versteht Er! Schafft Er es nicht Steinitz, sehe ich dunkle Zeiten auf das Reich zukommen. Alle anderen nachdrängenden Thronerben sind zu schwach und nicht fähig zur Führung. Er wird sich schnellstmöglich auf die Reise begeben. Ab sofort ernenne ich ihn zum Geheimrat des Kaiserlichen Hauses. Meine Kanzlei wird sich um alles Weitere kümmern. Hat er Fragen?“
Fragen? Viele!
„Eure Majestät, wer fordert mich an? Wer kennt mich dort? Mir fehlen die Mittel, um mich einer langen Reise zu überantworten.“
„Ein Mann, bei dem Er als Kind aus und ein gegangen ist, Steinitz. Der Geheimrat Friedrich Blücher in Konstantinopel. Dieser war ein Freund Seines Vaters. Nun wurde er bestialisch ermordet. Der Arzt der Ihn dort treffen wird, hat die Leiche vom Geheimrat untersucht. Den Brief fand man in seiner Garderobe. Blücher hatte mir die Medizin besorgt, wollte zurückreisen, da geschah der Frevel.“
Geheimrat Blücher, natürlich kannte ich ihn. Dort war ich als Kind aufgewachsen, spielte, lernte und wurde größer, als mein Vater im Orient das Kaiserreich als Militärattaché vertrat.
Sprachen flogen mir nur so zu. Griechisch in Athen, Latein in Rom, Arabisch in Kairo. Eine schöne, unbeschwerte Kindheit, ohne zu ahnen, was mein Vater tat. Meine Mutter hielt mich fern allem Bösen.
Blücher wurde in Kairo und danach in Konstantinopel zu einer Art Ziehvater. Hoch intelligent, Geschichtsversessen und treu dem Kaiser ergeben. Ein Mann, der als Vorbild dienen konnte. Sein Tod betrübte mich ungemein.
„Steinitz, Er wird morgen fahren. Den Wunsch des Blücher werde ich nach-kommen. Die Ordonanz wird Ihm alles mitgeben. Beeile Er sich! Zeit ist wenig vorhanden! Die Ärzte meines Sohnes sprechen von einem Krebsgeschwür in seinem Hals, was nicht beseitigt werden kann. Ich zähle auf Ihn Steinitz!“
„Jawohl Eure Majestät, ich begebe mich unverzüglich nach Konstantinopel, aber wie erkenne ich den Arzt?“
„Er wird Ihn erkennen Steinitz! Geh Er mit Gott und Treue zu seinem Kaiser!“
„Eure Majestät!“
Dabei verbeugte ich mich tief und ging langsam rückwärts Richtung Tür, wo mich die Ordonanz übernahm.
„Puh!“
Dabei wischte ich mir mit dem Taschentuch den Schweiß von der Stirn.
„Herr von Steinitz, hier entlang bitte. Folgen Sie mir in die Schreibstube!“
So einen vollen Schreibraum hatte ich noch nicht gesehen. Voll mit Schreibtischen, an denen Männer Abschriften anfertigten und Akten bearbeiteten. An einem Schreibtisch kam ich zum Stehen. Ein Offizier schien hier Dienst zu tun.
„Ah, guten Tag Herr von Steinitz, laut dem Befehl seiner Majestät haben wir Ihren Pass und Ihre Berufung zum Geheimrat an-gefertigt. Die Fahrbelege ab dem Anhalter Bahnhof nach Prag werden Ihnen heute noch zugestellt. Ab dort werden Sie den Orientexpress nach Konstantinopel nehmen. Dort werden Sie die Passage über den Bosporus antreten und im Hotel Calypso eine Unterkunft haben. Dort wird man Sie kontaktieren und weitere Dinge besprechen. Seine Majestät möchte ständig in Kenntnis gesetzt werden, tägliche Depeschen Ihrerseits sind unumgänglich. Haben Sie alles verstanden?“
Nicken hilft, die eigene Inkompetenz zu überspielen.
Den neuen Reisepass unterschrieb ich noch vor Ort, ebenso die Ernennung zum Geheimrat. Dazu gab es Reisefahrscheine bis Konstantinopel in der ersten Klasse in den Dampfzügen. Eine zweite Unterschrift auf der Urkunde jagte mir ein Schauer über den Rücken. Der Kaiser hatte persönlich unterschrieben und mit Siegel beglaubigt. Eine kleine verschlossene Tasche aus Leder übergab er mir zuletzt.
„Viel Glück Herr Geheimrat, in der Tasche ist alles, was gebraucht wird!“
Damit wurde ich von der Ordonanz vor das Stadtschloss begleitet und mein Hut und Spazierstock übergeben.
Die Straßen auf dem Rückweg werden nun voller sein mit Menschen, denen ich eigentlich nicht begegnen möchte.
Ein Blick auf meine Taschenuhr verriet, es war fast 10.30 Uhr geworden. Als meine ersten Schritte aus dem Eingang den Weg fanden, wurde ich zurückgerufen.
„Herr von Steinitz, die Droschke wartet doch schon!“
Eine kaiserliche Droschke mit Wappen der Hohenzollern nahm mich auf und brachte mich im schnellen Trab zu meinem Wohnhaus. Den Menschen auf der Straße entging selten eine kaiserliche Droschke. Neugier trieb sie um!
Als das Fuhrwerk in meine Straße einbog, genoss ich zum ersten Mal die Situation. Flanierende Menschen blieben stehen, um einen Blick ins Innere der Kutsche zu erlangen. Als diese hielt und der Kutscher mir die Tür öffnete, taten mir die neu-gierigen Blicke gut. An den Fenstern meines Hauses sah ich Bewegung. Ein paar Groschen lehnte der Kutscher ab.
„Morgen um halb sieben der Uhr werde ich Herrn Geheimrat abholen und zum An-halterbahnhof fahren!“
Damit tippte er sich an den Hut und gab dem Pferd die Peitsche.
Den Weg in den Hof des Hauses genoss ich in vollen Zügen. Herren zogen den Hut und die Damen nickten huldvoll. Kaisers Wappen kann nutzvoll im armen Leben eines Schreibers sein.
Hauswirte haben die unangenehme Art des Geldgierigen an sich. Dieser schien die Droschke ebenso erspäht zu haben.
„Steinitz, was macht Ihr in solcher Kutsche? Gebe er mehr Acht auf des Vaters Wohnung, den Nachbarn missfällt das Aussehen der Fenster ihrer Wohnung!“
Diesmal möchte ich die Oberhand über diesen miesen Charakter behalten.
„Für Dich Hauswirt, Herr Geheimrat von Steinitz. Wage er nie wieder, solch lose Mundart mir gegenüber! Des Kaisers Wunsch ist meine Beförderung. Bin auf Reise ab dem Morgen. Kümmere Er sich um meine Wohnung, wenn ich die Befehle seiner Majestät erfülle.“
Die Groschen für den Kutscher warf ich dem Wirt zu, der mit offenem Mund dastand und nicht glauben konnte, was er hörte.
Die eigene Wohnung war der sicherere Zu-fluchtsort. Die Eingangstür schlug zu und mein Gang führte ins Schreibzimmer, wo etwas Wärme wartete.
Reise in den Orient. Wie lange war ich von diesem getrennt? Als Kind geliebt, dieses bunte Treiben in den Märkten, die Gerüche des Fremden und die Weite der Landschaft.
Die Ledertasche im Gehrock! Mit zittrigen Fingern nahm ich sie, öffnete den ledernen Bandwickel und erblickte den Inhalt. Viel Bargeld, unterschriebene Blankoschecks und ein Schreiben seiner Majestät, meinen Auftrag als Geheimrat ohne Blockade von Behörden im Ausland ausüben zu können. Eine Art diplomatischer Auftrag.
Mir wurde noch nicht bewusst, was an diesem Neujahrstag geschehen war.
Was muss man für eine so weite Reise mit-nehmen? Als Kind übernahm meine Mutter die Planung und die Hausangestellte die Packung der Reisekoffer.
Eine Idee zur Reisegarderobe fehlte mir komplett. Viel besaß ich nicht mehr. Koffer sollten zu finden sein. Wurden auch, Schrankkoffer mit dem Militärwappen der Kaiserlichen Armee. Diesen kann ich un-möglich mitnehmen, die schiere Größe er- schlug mich fast.
Die Wahl fiel auf einen Handkoffer aus braunem Leder. Nur wenig Unterwäsche, Bartwichse, Rasierpinsel und Messer. Oberkleidung wird sich finden müssen. Nur mit leichtem Gepäck kann ich schnell reagieren.
Ob die Unruhe, die sich in meinen Gedanken breit macht, vergeht? Eine Reise in den Orient ist einfacher geworden in den letzten Jahren, doch immer noch ein Abenteuer. Das Osmanische Reich war keine an-genehme Reiseübung. Fremd blieben sie, die Türken. Ihre Sitten unzivilisiert und archaisch. Doch kluge Handelsmänner, die jedwede Sache besorgen können.
Mumijo werde man in den alten Handels-souks besorgen können, vielleicht, wenn es dort jemand kennt.
Mir war diese Bezeichnung einer Medizin völlig fremd. Nun wohl werde ich mich zu Bett begeben müssen, um ausgeruht dem Befehl des Kaisers folgen zu können.
Orients Anziehungskraft
Der Droschkenkutscher stand pünktlich vor dem Haus, kurz ließ ich ihn noch warten, um den Hausbewohnern zu geben, was sie wollten. Einen Blick auf die Dinge, um ihre Neugier befriedigen zu können. Am Rand der Straße nahm mir der Kutscher den braunen Koffer ab.
„Mehr haben Herr Geheimrat nicht zur Reise?“
„Nein Kutscher, fahr Er zu.“
Er gab der Peitsche einen Laut, als sich die Droschke ratternd in Bewegung setzte. Der Anhalterbahnhof war mir nur aus den Er-zählungen anderer Menschen bekannt. Ge-fahren ab dort, war ich noch nie.
In der monumentalen Erscheinung des Bahnhofes spiegelte sich die schiere Größe des Deutschen Reiches wider. Schon früh war hier ein Trubel, wie sonst mir nur zu einer Kirmes bekannt war.
Als die Droschke mit dem kaiserlichen Wappen vorfuhr, kamen schon eine Schar von Kofferträgern zugeeilt. Der Kutscher verjagte sie mit der Peitsche.
„Kommt Herr Geheimrat ab hier zurecht?“ Ich nickte, nahm meine ganze Kraft zusammen und übernahm den braunen Koffer vom Kutscher, der kurz seine Mütze zog.
Ab da tauchte man ein in die weite Welt der Reisenden. Der Bahnsteig war mir durch den Fahrschein bekannt. Bahnsteig A bis Prag. Uniformierte Bahnmitarbeiter kümmerten sich um Reisende. Mich sprach einer davon bald an.
„Wohin der Herr?“
Mit einem Monokel schaute er sich meinen Reisefahrschein an.
„Oh, werter Herr. Werde Sie persönlich zum Wagon bringen! Ist wohl wichtig die Reise?“
Das Wappen des Kaiserhauses zeigte natür-lich Wirkung.
Stumm blieb ich lieber und suchte in meinem Gehrock nach Kleingeld. Davon wird man immer etwas an Bedienstete los.
Der Wagon schien als Reisegefährt überaus geeignet zu sein. Solch nobles Gefährt hatte ich nie zuvor gesehen. Ein Saloonwagen mit aller Art von Luxus ausgestattet. Rote Sofas und Einzelsessel und kleine Vertikos, auf denen aller Art von Getränken standen.
Man schob mich in den Wagen, da ich den Betrieb mit meinem Staunen aufhielt.
Ein Einzelsitz wurde mir zugewiesen, als ein Schaffner vor mich trat.
„Den Fahrabschnitt, werter Herr, bittschön!“ Wieder verfehlte das Kaiserliche Wappen seine Wirkung nicht.
„Eine angenehme Reise der Herr! Mögen Sie schon etwas bekommen? Die Abfahrt wird pünktlich sein. Prag auch pünktlich erreicht. Einen Gin derweil?“
Warum nicht? Solch Luxus hatte ich noch nicht erlebt, vom Vater nur gehört, der als Weltgewandter viel erlebt hatte.
Als sich die Dampflok schnaufend in Be-wegung setzte, wurde es im Wagon voller. Schicke Frauen, interessante Herrschaften nahmen Platz. Gespräche wurden geführt, als mich ein Mann ansprach.
„Zum Wohl der Herr!“
Ich prostete zurück. Er schien Gesprächs-bedarf zu haben.
„Na? Auch an die Moldau? Schönt dort diese Stadt. Deutsche Geschichte natürlich! Geschäftlich dort?“
„Nein, muss weiter nach Konstantinopel!“
„Was, zu den Mameluken? Wie schneidig! Würden mich keine zehn Pferde hinbe-kommen!“
Dann zog er weiter, ließ mich mit meinem Gin zurück. Ein Gespräch zu führen, war mir nicht willkommen zu dieser Zeit.
Nach Dresden hielten wir nur noch am Bahnhof Aussig, nahe der Elbe kurz vor Prag. Grenzen des Königreichs Sachsen verschoben sich immer wieder hin und her in dieser Gegend. Der Zug leerte sich vor dem endgültigen Halt der Tschechen-hauptstadt.
Die Reichsgrenze hinter mir zu lassen, lag etwas schwer auf meiner Seele, seit Kindertagen war eine Reise nicht mehr mög-lich gewesen.
Meinen Vater wurde eine Militäranlage in Berlin überantwortet, damit sahen wir als Familie den Orient nicht wieder. Im Jahre 1869 aber reiste Vater im Auftrag des Militärs noch einmal in die Gegend um Kairo. Fast zwölf Monate mussten wir alleine in Berlin bleiben.
Als er zu Hause seine Familie in die Arme schloss, kam er mir verändert vor, gealtert und müde. Seine Wutausbrüche nach dieser Zeit werden für immer eingebrannt in den Erinnerungen bleiben. Mutter hatte doch arg an ihnen gelitten, mich schützte sie so gut es ging. Was veränderte ihn dort im Orient so sehr. Nie fand ich es heraus.
Nun, da der Prager Bahnhof zum Ende der ersten Etappe meiner Reise in Sicht kam, hinterfragte ich zum ersten Mal die mir übertragene Aufgabe.
Als der Schaffner die Ankunft bekannt gab, stand meiner Weiterreise nichts im Wege. Der Orientexpress stand schon unter Dampf am benachbarten Bahnsteig. Belege über die Weiterfahrt wurden eifrig kontrolliert und mir ein Schlafwagenabteil zugewiesen. Noblesse im Abteil machte es einfach, sich heimisch zu fühlen, selbst ein Toiletten-schrank war mit integriert. Neben Bett, Tisch und Spiegel eine Art Abteilbar mit frischem Wasser und alkoholischen Ge-tränken. Nie sah ich Vergleichbares. Ein Ruck ging durch den Zug, als er sich in Bewegung setzte. Ein Klopfen an der Tür riss mich aus meinem Erstaunen und ein Mann trat herein.
„Herr von Steinitz? Wenn Sie etwas be-nötigen, klingeln Sie einfach. Der Abteil-kellner steht rund um die Uhr zur Ver-fügung. Frühstück ab 8 Uhr, Mittagessen ab 13 Uhr und Abendessen ab 19 Uhr im Saloonwagen. Haben Sie Fragen?“
„Wie lange wird die Fahrt dauern? Wo halten wir denn?“
„Das ist noch nicht entschieden mein Herr, im Balkan sind momentan große Schnee-massen. Wir werden ausweichen müssen, aber in sechs Tagen stehen Sie in Kon-stantinopel. Der Orient Express ist immer angekommen!“
Dabei fiel sein Blick auf einen Brief von mir aus dem Kaiserhaus. Schweigend ging er hinaus und sah kurz zurück zu mir. Die Briefe sollte ich aus der Öffentlichkeit heraushalten. Es verschreckt die Menschen.
Die nächsten Tage waren dem Nichtstun verschrieben. Städte, Orte und Gebirge durchquerte der Zug. Immer mal wieder wurde Kohle und Wasser für den Dampfkessel der Lokomotive nachgefüllt. Man kam sich beim Essen näher.
Unterschiedlichste Persönlichkeiten zog der Orient an. Kaufleute, Militärs, reiche allein-stehende Frauen mit Gouvernante. Viele bereisten die Gegend zum wiederholten Male. Einige wollten von Konstantinopel weiter in den tiefen Orient. Nach Bagdad, Kairo und Tripolitanien.
Wohlhabende Menschen lassen sich einfach treiben, wohl dem, wer es kann.
Meine Intension in Konstantinopel behielt ich für mich, doch der Schaffner musste sein Wissen mit einigen Reisenden geteilt haben.
Schon im serbischen Gebiet fahrend, traute sich ein junger Mann, mich anzusprechen.
„Sie halten sich abseits der Saloon-gesellschaft auf, mein Herr. Kommen Sie doch zu uns und trinken mit uns auf eine gute Reise. Sie sind im Auftrag des Deutschen Kaisers unterwegs, munkelt man. Es macht Sie unter den Gästen zu einem mysteriösen Zeitgenossen. Erzählen Sie, was macht so ein Mann wie Sie im Orient-express?“
Mein Kopfschütteln deutete er richtig, eine Antwort bekam er nicht.
„Der Kaiser ist nicht überall beliebt! Schon gar nicht im Türkengebiet. Hoffentlich wissen Sie das?“
Damit drehte er sich mürrisch weg. Auf der Hut sollte man immer und überall sein, diesen Rat meines Vaters sollte ich beherzigen.
So versuchte ich den Rest der Reise in meinem Abteil zu verweilen. Die Mahlzeiten nahm ich lieber alleine ein.
Zwei Tage später kam die Stadt Kon-stantinopel in Sicht. Eine Stadt auf zwei Kontinenten. Einzigartig auf dieser Welt. Schon die Einfahrt in den Hauptbahnhof Sirkeci war ein Spektakel.
Ein Gewusel von Menschen aus dem Orient und Okzident. Laut, bunt und stinkend. Es hatte sich seit meinen Kindertagen recht wenig hier verändert. Sofort kamen die alten Gefühle wieder hoch, hier kannte ich viele Straßen und Plätze. Zog mit Freunden spielend den ganzen Tag durch die Gassen. Willkommen in deiner alten Heimat, schien mir die Stadt lautstark zurufen zu wollen.
Vom Bahnhof zum Hotel stand noch die Überfahrt über den Bosporus vor mir. Hier heißt es aufpassen, Taschendiebe, übles Pack findet man hier häufig. Deren Blicken entgeht nichts.
Doch eine Hand am Koffer, die andere im Gehrock, als umklammere man eine Pistole, hielt die Bagage ab. Ein Trick, den mir der alte Blücher beibrachte, wirkungsvoll auf seine Weise.
Meine Kenntnisse der türkischen Sprache kamen mir zu Gute. Oft musste meine Stimme lautstark die merkwürdigen Ge-stalten von meinem braunen Koffer ver-scheuchen, die auf eine Schimpftirade in ihrer Sprache nicht vorbereitet waren.
Hotel Calypso, als koloniales Gut der Engländer hier nicht mehr wegzudenken, stand wie eh und je groß und pompös am Bosporusufer auf der asiatischen Seite der Metropole.
Der Boy in roter Uniform grüßte höflich als mein schneller Schritt den Weg in die Lobby fand. Hier stand eine Art Palast, hier logierten die Schönen und Reichen.
Weltreisende machten hier Halt in Richtung Kurdistan oder dem Weg in den tiefen Orient. Fand mich der Arzt hier? Die Lobby allein war vollgestopft mit Gästen aus aller Welt und hatte die schiere Größe des Hohenzollernschlosses in Berlin.
Der Concierge nahm kaum Notiz von mir, erst nachdem die Tischklingel unsanft von mir in Betrieb gesetzt wurde, unternahm er einen recht langsamen Versuch, mir gerecht zu werden.
„Geheimrat von Steinitz, ein Zimmer sollte für mich reserviert sein!“
„Oh, Herr von Steinitz, verzeihen Sie! Sie wurden uns erst für morgen angekündigt. Ihr Zimmer steht natürlich bereit für Sie!“
Damit winkte er einen Kofferboy heran. „Mohamed wird Sie auf Ihr Zimmer begleiten. Eine Nachricht wurde für Sie ab-gegeben.“
Damit überreichte er mir ein geschlossenes Kuvert.
Mohamed schien höchstens zehn Jahre alt zu sein, quälte sich mit meinem Koffer und machte große Augen, als ich ihm eine Reichsmark übergab.
„Danke Mohamed, ich brauche hier im Hotel jemanden, der mir etwas hilft, wenn es darauf ankommt.“
Er nickte eifrig.
„Gerne Efendim. Mohamed ist immer da!“
Schon mal ein Verbündeter in dieser riesigen Stadt.
Der Brief kam mir in den Sinn.
Chirurg und merkwürdiger Arzt
Im Brief standen nur wenige Worte.
Treffen uns morgen in der Hotellobby nach Ihrem Frühstück gegen 10 Uhr. Tragen Sie eine Tageszeitung gerollt in der linken Hand!
Nun denn, werden wir die erste Nacht seit langem im Orient verbringen. Alte Er-innerungen kamen in mir hoch. Bilder, Gerüche und Geräusche. Geräusche waren es, die einem die Nachtruhe hier beschwerlich machen. Die Rufe des Muezzins in später Stunde und früh noch zu nachtschlafender Zeit, hatte ich vergessen.
So trat ich schon früh den Weg zum Frühstücksraum an, in dem sich andere Europäer den wohl gedeckten Frühstücks-tischen widmeten.
Die Annehmlichkeiten im Hotel deckten sich mit denen in Berlin. Gaslicht in den Zimmern war weit verbreitet, nur die Wasch-gelegenheiten in Form einer Wasserschüssel muteten primitiv an. Was soll man machen, Abstriche bei Reisen in unzivilisierte Gegenden sind einzuplanen.
Laut meiner Taschenuhr hatte ich noch etwas Zeit, bestellte mir eine Tageszeitung an den Tisch und bekam den Londoner Daily Herald von vorgestern. Nun ja, man darf nicht wählerisch sein hierzulande. Zum Lesen war mir nicht zumute, da mir die englische Presse zu sehr gegen unser Kaiserreich hetzte. Zum Zusammenrollen als Erkennungszeichen reichte sie allemal.
Kurz vor 10 Uhr ließ ich den Frühstücksraum hinter mir, steuerte auf die Hotellobby zu und wartete. Menschen aller Couleur flanierten vorbei. Als meine Taschenuhr zehn Minuten nach 10 Uhr anzeigte, wurde mir etwas flau im Magen. Sollte man mich versetzt haben? Wohlmöglich stand ich nun hier im fremden Land alleine da!
Weitere Minuten vergingen als ein an-sehnliches Weibsbild im blauen Ausgehkleid auf mich zusteuerte.
„Herr von Steinitz?“
„Äh, nun ja Gnädigste, der bin ich, doch erwarte ich einen Arzt! Wer bitte schön sind Sie?“
„Ich bin der Arzt, Herr von Steinitz, mein Name ist Doktor Louise Bernard, ich sollte Sie hier aufsuchen!“
Nun war ich irritiert!
„Sie? Ich hatte einen Mann erwartet! Eine Frau als Arzt ist etwas ungewöhnlich!“
Sie machte aus ihrer Ablehnung gegen meine Person keinen Hehl.
„Herr von Steinitz, nur weil man im doch so aufgeklärten und modernen Deutschen Kaiserreich als Frau nicht Arzt und Chirurg werden kann, soll es doch in anderen Ländern schon möglich sein. So etwas nennt man außerhalb Ihres Landes Gleich-berechtigung!“
Eines muss man ihr lassen, sehr schlag-fertig!
„Frau Bernard, Sie sind Chirurg? Haben Sie die Leiche von Geheimrat Blücher unter-sucht? Es scheint mir als Frau doch sehr unwahrscheinlich, solche Dinge machen zu können.“
Sie schien die Gesichtsfarbe recht schnell ändern zu können.
„Also, Herr von Steinitz! Wenn ich mir so Ihr Erscheinungsbild anschaue, haben Sie schon bessere Zeiten gesehen. Die Hosen stoßen auf den Schuhen auf und fransen aus. Ihr Gehrock war vor etwa zehn Jahren mal modern, eine ganze Nummer zu groß scheint er auch zu sein. Sie haben zwar feine Manieren nach außen hin, weiche Hände, die grobe Arbeit nie kannten, doch Ihre besten Zeiten liegen weit hinter Ihnen. Nun, da nehme ich mal an, Sie wurden vom Kaiserhaus aus einer Schublade gezaubert, weil kein Anderer den miesen Teil der Arbeit hier im Orient übernehmen möchte. Finanziell scheinen Welten zwischen den Reisenden im Hotel und Ihnen zu liegen! Stimmt meine Vermutung?“
Touché! Sie hatte auf den ersten Blick meine Misere erkannt.
„Entschuldigen Sie Frau Bernard!“