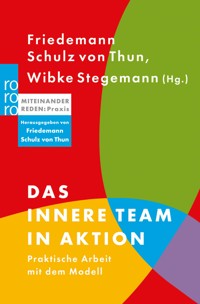
Das Innere Team in Aktion E-Book
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Das anregende Praxisbuch zur Arbeit mit dem Inneren Team Mit dem Inneren Team hat Friedemann Schulz von Thun in "Miteinander reden 3" ein prägnantes Modell geschaffen, um den Aufbau der Persönlichkeit, ihr Sprechen und Handeln besser zu verstehen. Die Beiträge in diesem Band demonstrieren, in wie vielen unterschiedlichen Bereichen und auf welche Weise dieses Modell wirkungsvoll eingesetzt werden kann. Der Bogen reicht von Training, Beratung und Mediation bis zu Paartherapie und Krankheitsbewältigung, zur Klärung verpönter Gefühle oder der Analyse von Wählermotiven.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 224
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Friedemann Schulz von Thun • Wibke Stegemann (Hg.)
Das Innere Team in Aktion
Praktische Arbeit mit dem Modell
Über dieses Buch
Das anregende Praxisbuch zur Arbeit mit dem Inneren Team
Mit dem Inneren Team hat Friedemann Schulz von Thun in "Miteinander reden 3" ein prägnantes Modell geschaffen, um den Aufbau der Persönlichkeit, ihr Sprechen und Handeln besser zu verstehen. Die Beiträge in diesem Band demonstrieren, in wie vielen unterschiedlichen Bereichen und auf welche Weise dieses Modell wirkungsvoll eingesetzt werden kann. Der Bogen reicht von Training, Beratung und Mediation bis zu Paartherapie und Krankheitsbewältigung, zur Klärung verpönter Gefühle oder der Analyse von Wählermotiven.
Vita
Friedemann Schulz von Thun (*1944) studierte in Hamburg Psychologie, Pädagogik und Philosophie und promovierte bei Reinhard Tausch und Inghard Langer über Verständlichkeit bei der Wissensvermittlung. Nach seiner Habilitation wurde er zum Professor für Pädagogische Psychologie in Hamburg berufen (1976 – 2009). Außerdem konzipierte er Kommunikationstrainings für Lehrer und Führungskräfte, später für Angehörige aller Berufsgruppen (1971 bis heute). Er ist Autor zahlreicher Bücher und Herausgeber der Reihe «Miteinander reden: Praxis». Für weitere Informationen siehe www.schulz-von-thun.de
Wibke Stegemann, Jahrgang 1971, Dipl.-Psych., als Kommunikationstrainerin, Konfliktmoderatorin und Coach in privatwirtschaftlichen Unternehmen und im Sozialbereich tätig, u.a. in Zusammenarbeit mit dem «Arbeitskreis Kommunikation und Klärungshilfe».
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Januar 2025
Copyright © 2004 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Redaktion Wolfgang Müller, Wibke Stegemann
Mit Ausnahme der gekennzeichneten Abbildungen stammen alle Zeichnungen im Text von den Autorinnen und Autoren.
Covergestaltung any.way, Walter Hellmann
ISBN 978-3-644-02258-4
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Friedemann Schulz von Thun
Einleitung
Zu meiner Freude hat das Modell vom Inneren Team und die zugehörige Methodik seit dem Erscheinen von «Miteinander reden 3» im Jahr 1998 bei Studierenden und Praktikern zu einer wahren Flut von Anwendungen und Erprobungen geführt. Studierende der Psychologie, Pädagogik, Soziologie und Politikwissenschaften haben in Hunderten von Hausarbeiten mit Vorliebe das Innere Team zur Grundlage einer Selbsterprobung gemacht, je zur Hälfte für private Selbstklärungen und für professionelle Probleme. Der Massenprofessor stöhnt zwar über die große Zahl, frohlockt dann aber doch über die anregende Ausbeute. Nicht selten deuten sich neue Erkenntnisse an. Eines darf man schon jetzt getrost feststellen: Das Modell kommt gut an, reizt zur Erprobung und erweist sich auch ohne Klärungshelfer/Berater als exzellentes Werkzeug der Selbstreflexion in verzwickten Situationen und schwierigen Lebenslagen, jedenfalls ein Stück weit, wie Birgit Leuker in einer Forschungsarbeit zum Thema herausfand (Leuker 2000).
In der Diplomprüfung sind angehende Psychologinnen und Psychologen herausgefordert, eine praktische Anwendung der erlernten Studieninhalte vorzustellen, zum Beispiel aus ihrem Praktikum. Auch hier ist das Innere Team, zusammen mit anderen kommunikationspsychologischen Modellen und Interventionen, ein beliebter Gegenstand kreativen Transfers. Zuweilen waren Wibke Stegemann (als Beisitzerin der Prüfungen) und ich überaus angetan von den (meist sehr gut visualisierten) Praxisbeispielen, sodass Wibke auf die Idee kam, einen kleinen Sammelband mit Beiträgen dieser Art zusammenzustellen und die Kandidaten einzuladen, ihren Beitrag nachträglich zu verschriftlichen, soweit das Innere Team tangiert war. Einige Beiträge sind auf diese Weise zustande gekommen, andere aufgrund dessen, dass ehemalige Studierende inzwischen erfahrene Praktiker sind und mit dem Inneren Team gearbeitet haben. So haben wir hier eine erfreuliche Koproduktion von Universitätsdozenten, erfahrenen Praktikern und frisch gebackenen Diplompsycholog(inn)en.
Worum geht es inhaltlich im Einzelnen? Wir beginnen mit Anwendungsbeispielen aus unserem ‹Heimspiel› Training, Beratung und Mediation. An Dagmar Ulrichs’ Beitrag ist zweierlei zu erkennen. Erstens: Das Modell eignet sich vorzüglich, um Fortbildungsthemen nahezu aller Art so zu behandeln, dass der individuell-persönliche Bezug zu einem Thema mit fast spielerischer Eleganz und nicht ohne (dosierten) Tiefgang ermutigt und ermöglicht werden kann. Zweitens: Die Lernenden (hier: Auszubildende) müssen nicht zur intellektuellen Elite gehören, um von dieser Methode zu profitieren – im Gegenteil: Die normal-menschliche und umgangssprachliche Gestalt des Modells erleichtert auch und gerade Menschen mit einfacher Schulbildung den Zugang. Dies gilt sogar, wie aus einer Forschungsarbeit von Evelyn Barth hervorgeht, für männliche jugendliche Straftäter – was ich als geradezu sensationell empfinde (Barth 2003).
Johannes Ruppel zeigt an einem Beispiel, wie ein Berater das Innere Team für sich selbst nutzen kann, wenn er mit gemischten Gedanken und Gefühlen darum ringt, einen Auftrag «abzunehmen, äh, anzulehnen». Die gründliche Selbstklärung ist hier (wie auch sonst) die Voraussetzung, mit der die gute Beratung für den Kunden steht und fällt.
Alexander Redlich unternimmt den viel versprechenden Versuch, das Innere Team für die Konfliktvermittlung zu nutzen. In seinem Praxisbeispiel ist eindrücklich zu studieren, wie bei der Entstehung zwischenmenschlicher Teufelskreise bestimmte Teammitglieder auf beiden Seiten unheilige, konflikteskalierende und lösungsverhindernde Allianzen bilden, jedenfalls wenn der Konfliktmoderator nicht gegensteuert.
Anne Papendorf eröffnet mit ihrem Beitrag die Perspektive, das Innere Team für Organisationsentwicklung und Change-Management zu nutzen. Menschen, die eine Veränderung aushalten und sogar mittragen und gestalten sollen/wollen, geraten keineswegs nur in eine euphorische Aufbruchstimmung. Im Gegenteil, wir haben mit inneren Oppositionsbewegungen zu rechnen, die durchaus heftigen aktiven oder passiven Widerstand organisieren. Will die Organisationsberaterin mit solchem Widerstand professionell umgehen, dann sollte sie die inneren Akteure genau und differenziert kennen lernen, um ihnen entgegenkommen zu können.
In drei weiteren Beiträgen stehen Paare im Blickpunkt. Wenn Liebe und Partnerschaft gelingen soll, dann kann es hilfreich sein, nicht nur zwei Menschen, sondern auch das Zusammenspiel zweier innerer ‹Mannschaften› ins Auge zu fassen. Katrin Klöpping eröffnet diese Reihe mit dem humorvoll-frechen Titel «Fremdgehen mit dem Inneren Team» und untersucht die Dynamik von Treue und Untreue, indem sie bei beiden Partnern zwischen einer ‹Vordermannschaft› (die in der Partnerschaft angesprochen und befriedigt wird) und einer ‹Hintermannschaft› (die eher übergangen und energetisch nicht herausgefordert wird, sodass sie sich sehnsuchtsvoll anderswohin wendet) unterscheidet. Diese Sichtweise hat den Vorteil, dass sie aussichtsreiche Möglichkeiten eröffnet, mit solchen heiklen Dynamiken kundig, unerschrocken und einfühlsam umzugehen – statt bloß mit der Moralkeule draufzuschlagen in der verqueren Hoffnung, dadurch die Liebe zu retten.
Aber auch bei anderen Themen können das Modell und die Methode des Inneren Teams dem Paar helfen, miteinander gut ins Gespräch zu kommen und den Kontakt vollständiger (statt einseitig und oberflächlich) zu machen. Constanze Bossemeyer demonstriert die von ihr und Annegret Lohse entwickelte Methode des ‹Team-Dialogs› an einem Beispiel aus der Praxis.
Paare wollen nicht nur miteinander reden. Karsten Schützmann wagt den Versuch, das Modell vom Inneren Team auf sexuelle Störungen in der Partnerschaft anzuwenden. Am Beispiel aus einer Sexualberatungsstelle wird erkennbar, wie das Zusammenspiel bzw. Nicht-Zusammenspiel verschiedener Teammitglieder auf beiden Seiten es verhindert, dass die Eheleute befriedigend zueinander finden. Es liegen noch längst nicht genügend empirische Belege vor, um zu ermessen, ob das Modell vom Inneren Team in der Sexualberatung eine große Zukunft haben wird. Aber Schützmanns Beispiel lässt den Optimismus zu, dass Beratung und Therapie von dem Modell erheblich profitieren können, weil das komplizierte Ineinandergreifen von innerseelischen und zwischenmenschlichen Dynamiken hier menschlich-einfühlsam und verständlich erfasst und dargelegt werden kann.
Wir betreten sodann das Anwendungsfeld Medizinpsychologie. Ob zum Beispiel eine Patientin die verordnete Medizin auch wirklich einnimmt oder nicht, das können wir zuweilen als Endresultat eines heftigen Ringens verschiedener Teammitglieder auffassen, wie Heike Aring-Waldmann an einem krisenhaften Beispiel zeigt. Sobald unsere Gesundheit in großer Gefahr ist, sind auch seelische Turbulenzen und Verknotungen zu erwarten – die Kenntnis des Inneren Teams kann uns als Helfer befähigen, die Compliance wiederherzustellen.
Ingo Heidrich und Michael Krüger beschreiben ein methodisches Vorgehen, wie das Innere Team in der Arbeit mit chronischen Schmerzpatienten in einer psychosomatischen Klinik eingesetzt wird. Hintergrund ist die Erkenntnis, dass das Erleiden von Schmerzen mitbedingt ist durch die Art und Weise, wie wir innerlich und äußerlich darauf reagieren und damit umgehen. Was diese subjektiven und ‹weichen› Faktoren betrifft, erlaubt das Innere Team eine differenzierte Individualdiagnose und eröffnet die Chance auf eine heilsame Veränderung.
Durch Heike Dierbachs Beitrag zum Inneren Team eines Schill-Wählers gelangen wir auf das Anwendungsfeld Politik. Jeder Wähler hat mehrere Seelen in seiner Brust. Der ‹Steuerzahler in mir› wüsste wahrscheinlich genau, für welche Partei er votieren würde, aber da ist auch noch ein umweltbewusster Öko, ein sozialer Gerechtigkeitsapostel, ein Pazifist vielleicht oder ein stolzer Nationalist – und alle wollen am Wahltag ihr Kreuz machen. Eine ‹differenzierte Individualdiagnose› wäre auch hier möglich und für die Schärfung des politischen Bewusstseins zuweilen sinnvoll. Heike Dierbach konzentriert sich auf den ‹Schill-Wähler› des Jahres 2001 in Hamburg und versucht sein Inneres Team zu rekonstruieren.
Den Abschluss bildet Dagmar Kumbier mit der psychologischen Analyse eines verpönten Gefühls: des Neides. Hier zeigt sich exemplarisch, was für unser Seelenleben überhaupt gilt: Gefühlsbegriffe (Neid, Genugtuung, Schadenfreude, Eifersucht …) sind noch sehr abstrakte Etiketten – so als ob ‹Rotwein› auf einer Flasche stünde. Die innere Konstellation, die dem Gefühl zugrunde liegt, kann von Mensch zu Mensch und von Kontext zu Kontext sehr unterschiedlich sein. Genau diese innere Konstellation bekommen wir aber durch das Modell und die Methode des Inneren Teams prägnant in den Blick. Was wir in den Blick bekommen, bekommen wir nicht unbedingt auch in den Griff, aber die Aussicht, mit der inneren Teamkonstellation etwas Konstruktives anzufangen, ist vorhanden, wie Dagmar Kumbier zeigen wird.
Wir vermuten, dass die Leserin, der Leser das Grundlagenbuch «Miteinander reden 3. Das Innere Team und situationsgerechte Kommunikation»(rororo Sachbuch 60545) bereits kennt. Für den Fall, dass dies nicht zutrifft, gebe ich im Folgenden eine kurze Einführung, die auch als Wiederauffrischung ohne langweilige Wiederholungen gelesen werden kann. Ansonsten hat die Reihenfolge der Beiträge keinen curricularen Aufbau, Sie mögen getrost Ihren Interessen folgen. Sollten Sie durch die Lektüre angeregt werden, eigene Anwendungsversuche in Ihrem Lebensumfeld zu erproben, dann wäre dies in unserem Sinne! Ein pluralistisches Verständnis vom Menschen kann uns helfen, mit uns selbst und den Dingen des Lebens besser zurechtzukommen.
Barth, Evelyn: Die Beratung von jugendlichen Straftätern mit dem Inneren Team. Unveröffentl. Diplomarbeit, Hamburg 2003
Leuker, Birgit: Regie führen im eigenen Theater. Zur selbständigen Anwendung des Modells vom Inneren Team im persönlichen Alltag. Unveröffentl. Diplomarbeit, Hamburg 2000
Schulz von Thun, Friedemann: Miteinander reden 1. Störungen und Klärungen, Reinbek 1981ff.
–, Miteinander reden 2. Stile, Werte und Persönlichkeitsentwicklung, Reinbek 1989
–, Miteinander reden 3. Das Innere Team und situationsgerechte Kommunikation, Reinbek 1998
(Alle drei Bände werden in den nachfolgenden Beiträgen jeweils mit MR 1, MR 2 und MR 3 abgekürzt.)
Friedemann Schulz von Thun
1Der Mensch als pluralistische Gesellschaft
Das Modell des Inneren Teams als Haltung und Methode
Wer angesichts einer Herausforderung oder einer Entscheidung, eines Menschen oder einer Aufgabe, einer Fliege an der Wand oder Gottes und der Welt in sich hineinhorcht, der wird in der Regel mehr als nur eine ‹Stimme› zu hören bekommen. Ich spreche von innerer Pluralität, um das Seelenleben des Menschen zu kennzeichnen. Er hat meist mehrere Seelen in der Brust. Dies ist sowohl eine Quelle großen Reichtums als auch häufig eine Not, mit der er fertig werden muss. Jedenfalls ist es normal und keine Störung, kein Hinweis auf Schizophrenie oder multiple Persönlichkeit.
Das Modell vom Inneren Team (s. ausführlich Schulz von Thun, MR 3) habe ich entworfen, um das menschliche Seelenleben in verständlicher Weise sichtbar und greifbar zu machen und um uns Methoden an die Hand zu geben, die aus der Not eine Tugend zu machen geeignet sind. Die Not: dass wir mit uns selbst oft keineswegs ‹ein Herz und eine Seele› sind, dass inneres Durcheinander und Gegeneinander herrschen, bis hin zur quälenden Zerrissenheit und Lähmung, bis hin zum inneren Bürgerkrieg. Die Tugend: dass wir die Vielzahl der inneren Stimmen nutzen können, um die Weisheit und Kraft, die in jeder Einzelstimme enthalten ist, zusammenzuführen. Anders ausgedrückt: dass es menschenmöglich und erlernbar ist, aus dem ‹zerstrittenen Haufen› ein Inneres Team zu machen – unter der Leitung eines Chefs, eines Oberhauptes, das einen guten Draht zu seinen Leuten hat und sich in der Kunst der kooperativen Führung versteht.
Ein kleines didaktisches Beispiel möge für die nachfolgenden Einführungen einen (im wörtlichen Sinn) ‹anschaulichen› Hintergrund bieten.
Eine junge Frau (Josefine) hat von ihrem neuen Freund einen Heiratsantrag erhalten. Was soll sie ihm antworten? Beim Modell des Inneren Teams gehen wir davon aus, dass es erstrebenswert ist, wenn wir in Übereinstimmung mit uns selbst kommunizieren, entscheiden, handeln würden. Wann aber bin ich ‹in Übereinstimmung mit mir selbst›? Darf ich darauf hoffen, dass mir dies eine innere Stimme verrät? In der Regel darf ich damit rechnen, dass sich gleich mehrere Stimmen zu der aufgeworfenen Frage zu Worte melden. Ferner muss ich damit rechnen, dass sich diese Stimmen keineswegs einig sind. Diese kleine Komplikation hat der liebe Gott eingebaut, und mit dem Modell des Inneren Teams heißen wir diese willkommen und nehmen die Herausforderung an!
Als Klärungshelfer würden wir die junge Frau fragen: «Was regt und rührt sich denn in dir, wenn du diesen Antrag erhältst? Gibt es eine Stimme, die sich gleich als Erste deutlich zu Worte meldet?»
Mit dieser Frage haben wir mit der Erhebung des Inneren Teams begonnen. Durch die Formulierung «Was regt und rührt sich in dir?» tragen wir der Erkenntnis Rechnung, dass sich manche inneren Antworten durchaus unsprachlich vernehmen lassen, zum Beispiel durch ein ungutes Gefühl in der Magengegend. Dann würden wir uns darauf konzentrieren, die Botschaft dieses unguten Magengefühles ‹spruchreif› werden zu lassen. Die zweite Konzentration zielt darauf ab, den inneren Urheber dieser Botschaft auszumachen: «Wer in dir reagiert mit diesem unguten Gefühl? Können wir diesem einen Namen geben?»
Als Ergebnis dieser dialogischen Erhebung, bei der wir uns als Hebamme betätigen, haben wir das erste Teammitglied zutage gefördert. Dieses Mitglied zeichnen wir als erste ‹Seele in die Brust›:
(Zeichnung: Dina Berghaan)
Zurück zu unserem Musterbeispiel.
Nehmen wir an, Josefine würde auf die Frage «Was regt und rührt sich in dir, wenn du diesen Antrag erhältst? Gibt es eine Stimme, die sich gleich als erste meldet?» zur Antwort geben:
Josefine (J): Eigenartigerweise will der große Jubel in meinem Herzen nicht so richtig ausbrechen, obwohl ich mich danach oft gesehnt habe! Aber schon: Er liebt mich, er will mich – das finde ich ganz toll! Aber gleichzeitig bin ich auch verwirrt und erschrocken: «Oh Gott, Hilfe!» – So ungefähr.
Klärungshelfer (KH): Klingt so, als gebe es mehrere Seelen in deiner Brust! Wollen wir mal schauen, wer da alles mitreden will?
J: Da schreien alle wild durcheinander!
KH: Oh, das ist ein zutiefst menschlicher Zustand: die ‹Unruhe des Herzens›! Und bei dir gibt es dafür immerhin einen würdigen Anlass! Vielleicht gelingt es uns, etwas Ordnung zu stiften. Also da ist zum einen jemand in dir, der jubilieren möchte und das ganz toll findet?
J: Ja, aber dieser Jemand wird sofort ausgebremst!
KH: Gut, dann wollen wir mal sehen, wer da jubelt und wer da bremst. Mit wem möchtest du anfangen?
J: Mit dem Bremser!
KH: Gut, von dem habe ich im Ohr, dass er «O Gott, Hilfe!» ruft. Magst du mal in die Haut von diesem Teil hineinschlüpfen und alles fühlen und alles aussprechen, was er so auf Lager hat? Kriegst du Kontakt zu diesem Hilferufer?
J: O ja, der sagt …
KH: Schlüpf mal hinein und sprich per ‹ich›!
J: Ich kriege Angst! Er will mich binden! Festbinden! (Sie unterbricht sich.) Ich meine, das ist natürlich Quatsch!
KH: Jetzt redet ein anderer Teil von dir dazwischen und will das nicht gelten lassen. Den müssen wir später auch noch hören. Aber kannst du ihn für einen Augenblick mal wegschicken, sodass wir zunächst den Bremser in Reinkultur zu Ende hören können?
J: Genau, also der Bremser kriegt Angst …
KH:Ich kriege Angst …
J: Ich kriege Angst, meine Freiheit zu verlieren und lebenslänglich eingesperrt zu sein!
KH: In den Käfig der Ehe!? – Ich male mal dieses Teammitglied hier hinein, mit einem Namen und einer Sprechblase. Kannst du seine Botschaft noch einmal in Kurzform zusammenfassen?
J: «Hilfe, er will mich festbinden!»
KH: Gut, und wie wollen wir diesen Teil nennen? Fällt dir ein passender Name ein?
J: Das ist der Bremser!
KH: Ja, er ist ein Bremser in Bezug auf die Jubilierende. Aber wir sollten einen Namen wählen, durch den sein eigenes Wesen, sein eigenes Anliegen zum Ausdruck kommt.
J: Wahrscheinlich die Bindungsängstliche in mir!?
KH: Das könnte sein! Lässt sich das Anliegen auch positiv ausdrücken? Wenn nicht, dann würde ich mal vorläufig ‹die Bindungsängstliche› schreiben.
J: Positiv würde ich sagen: die Freiheitsliebende. Ja, dass ich über mich selbst bestimme, das ist mir sehr wichtig!
KH: Das scheint mir gut zu passen: die Freiheitsliebende. (Malt das erste Teammitglied in das Brustbild, s. Abb. unten.)
Das erste Teammitglied ist geboren
(Zeichnung: Dina Barghaan)
Der dialogische Hebammenvorgang ist für das erste Teammitglied damit abgeschlossen. In genau derselben Weise werden nun die weiteren Stimmen erhoben, die sich zu der Frage «Wie reagiere ich auf den Heiratsantrag?» zu Worte melden. In diesem Fall betraten nach und nach die folgenden Mitglieder die Bühne:
das Jubilierende Herz, das sich unbändig freut («Er liebt mich, er will mich!»).
Eine Skeptische Beziehungsexpertin macht darauf aufmerksam, dass der Zeitpunkt für einen Heiratsantrag recht früh erscheint: «Wir kennen uns doch noch gar nicht richtig!»
Eine Emanzipierte Feministin sieht die Frau und die Liebe in der gesetzlichen Ehe nicht gut aufgehoben: «Heiraten ist spießig und für die wahre Liebe unnötig und hinderlich!»
Von der Emanzipierten Feministin verachtet, meldet sich sehr verschämt auch eine Anhängliche zu Wort, deren Botschaft Josefine in karikierender Übertreibung mit kleinmädchenhafter Stimme vorträgt: «Sei mein eeewiger Beschützer!»
Schließlich kommt auch noch eine schüchterne und leise Stimme hervor, die enttäuscht, verletzt und verlassen aus der vorigen großen Liebe zurückgelassen wurde («Es hat so wehgetan!») und die Angst davor hat, sich erneut einzulassen: das verletzte Gebrannte Kind.
Das vorläufige Schlussbild enthält also sechs Teammitglieder, die sich zunächst ungeordnet auf die Brustfläche verteilen. Alle haben, als Ergebnis der Erhebung, eine Botschaft (hier in Kurzform) und einen Namen.
Strukturbild 1. Ordnung: Teammitglieder, die sich auf den Heiratsantrag hin gemeldet haben (Zeichnung: Dina Barghaan)
Vom Klärungshelfer verlangt eine solche Erhebung drei Qualitäten: Empathie, allparteiliche Wertschätzung und Prägnanz. Empathie bedeutet, dass er sich einfühlen kann in die einzelnen Mitglieder. Ohne Einfühlungsvermögen erscheinen sie wie bestellt und nicht abgeholt. Allparteiliche Wertschätzung bedeutet, dass der Klärungshelfer jedes einzelne Mitglied zu würdigen weiß und sich nicht mit dem einen gegen den anderen verbündet. In dieser Gefahr ist nämlich die Frau selbst als Oberhaupt ihres Teams: dass sie einzelne ‹Mitarbeiter› nicht ausstehen kann oder sich ihrer schämt. Zum Beispiel die Art, wie sie die Anhängliche vorgestellt hat (selbstironisch abwertend), lässt darauf schließen, dass dieser Teil die Wertschätzung ihres Oberhauptes entbehren muss. Umso mehr bedarf er aller Wertschätzung dieser Welt durch den Klärungshelfer. – Prägnanz schließlich bedeutet, dass jedes innere Teammitglied in seinem Wesen treffsicher erfasst ist. Zum Beispiel wäre eine Botschaft wie «Ich freue mich, aber kann es nicht recht genießen!» nicht prägnant, weil darin noch zwei Seelen im Clinch sind.
Was wir in der Abbildung auf S. 21 erreicht haben, nenne ich Strukturbild 1. Ordnung: Es ist vollständig (vorläufig, weil immer noch Spätmelder hinzukommen können), aber noch ungeordnet additiv. In einem Strukturbild 2. Ordnung sind die Mitglieder so umgruppiert, dass die innere Gruppendynamik erkennbar wird: Wer steht wo mit wem zusammen gegen wen? Wie sind die Beziehungen zueinander? Wer macht sich vorne (an der Kontaktlinie) dick und breit, wer versteckt sich schüchtern und leise halb hinter dem Vorhang? Wer ist als innerer Außenseiter verbannt und gleichsam hinter Schloss und Riegel, wer bewacht dieses Gefängnis und passt auf, dass dieser Außenseiter nicht vordringt?
Diese knappen Hinweise mögen ausreichen, um die Aufgabe zu skizzieren, das Strukturbild 2. Ordnung zu entwerfen – wiederum im Dialog zwischen der Protagonistin und dem Klärungshelfer.
In unserem Beispiel war die Anhängliche ein wenig hinter Schloss und Riegel, weil sie einen ungeliebten Teil verkörpert. Besonders die Emanzipierte Feministin hat etwas dagegen, dass die Anhängliche zu stark wird. Sie ist die Wächterin, unterstützt durch die Freiheitsliebende, mit der sie eine starke Allianz bildet.
Strukturbild 2. Ordnung: Abbild der inneren Dynamik beim Thema ‹Heiratsantrag› (Zeichnung: Dina Barghaan)
(Zeichnung: Dina Barghaan)
Das verletzte Gebrannte Kind versteckt sich scheu hinter dem Vorhang, liefert aber ebenfalls Energie an die Allianz der Abwehrenden. Die große Gegenspielerin ist das Jubilierende Herz, das sich vernehmlich zu Worte meldet, aber nur von der Anhänglichen eine behinderte Unterstützung erfährt und daher derzeit ein wenig allein auf weiter Flur steht. Denn die Beziehungsexpertin ist ja derzeit auch noch skeptisch und steht der Abwehrallianz nahe.
Fassen wir zusammen: Worum handelt es sich beim Inneren Team, und welche Perspektiven verbinden sich mit diesem Modell? Vom ‹Inneren Team› sprechen wir in einem zweifachen Sinne. Zum einen ist das Modell gemeint, das die Pluralität des menschlichen Seelenlebens in Analogie zu einer Arbeitsgruppe zu fassen versucht. Es ist phänomenologisch (statt theoriegeleitet), indem es die inneren Wortmelder so aufnimmt, wie sie erscheinen (ohne sie in den Kontext einer Theorie von der Persönlichkeit des Menschen zu stellen, zum Beispiel Freuds Einteilung in Es, Ich und Über-Ich). Ein weiteres Merkmal dieses Konzeptes ist die Personalisierung: Seelische Kräfte, Regungen, Qualitäten, Lebensgeister, Gefühle, Introjekte etc. mit abgrenzbaren Anliegen werden als ‹Personen›, als ‹Botschafter im Kleinformat› aufgefasst, als Mitglieder eines größeren Teams, mit kognitiven, emotionalen und motivationalen Anteilen. Das heißt, sie haben Gedanken, Gefühle und Wünsche mit einheitlicher Ausrichtung. Ein weiteres unverzichtbares Konzeptmerkmal ist die Visualisierung, bei der die ‹Seelen› als personale Einheiten ‹in die Brust› gemalt werden. Dieses Vorgehen erlaubt die bei dieser Methode so wichtige Disidentifikation, das heißt das Heraustreten aus dem aufwühlenden Geschehen und der Blick von außen auf das ‹Getümmel›. Schließlich, aber nicht unverzichtbar, erlaubt dieses Konzept in der weiteren Beratungsarbeit die Inszenierung, das heißt die erlebnisaktivierende Aufführung des inneren Geschehens auf einer Bühne, entweder mit wechselnder Rollenbesetzung durch den Protagonisten selbst oder mit Rollenspielern aus der Seminargruppe.
Zum anderen sprechen wir vom ‹Inneren Team› auch im Sinne eines konkret erhobenen Teams. Die Abbildungen auf S. 21 und S. 23 enthalten das Innere Team der jungen Frau zum Thema «Wie reagiere ich auf den Heiratsantrag?» Hier ist allerdings zu bedenken, dass zum Zeitpunkt der Erhebung oft von einem Team im idealen Sinne (noch) nicht gesprochen werden kann. In der Regel finden wir den ‹zerstrittenen Haufen›, finden wir ein Durcheinander, ein Gegeneinander und ein Nebeneinander, oft auch ein partielles Miteinander von Untergruppen (Allianzen). Insofern ist mit dem Begriff ‹Inneres Team› eher die Verheißung angesprochen, welche die Arbeit mit diesem Modell enthält. Das konkret erhobene Innere Team ist durch zweierlei definiert: durch seine Besetzung (wer hat sich eingefunden, mit welcher Botschaft und welchem Namen?) und durch die Beziehungen der Mitglieder untereinander und zum Oberhaupt. Die Art und Weise, wie die Figuren miteinander umgehen (würdigend, verächtlich), ist für das ‹innere Betriebsklima› sehr entscheidend und für die weitere Beratungsarbeit ebenso bedeutsam wie die Begegnung der Inhalte ihrer Botschaften. Das ist ja auch in realen Teams der Fall: Wir begegnen uns immer zugleich auf der Inhalts- und auf der Beziehungsebene, und für die Teamentwicklung sind beide Ebenen und ihre Verschränkung erfolgsentscheidend.
Betrachten wir zum Abschluss dieser kleinen Einführung (oder Auffrischung für die Leser von «Miteinander reden 3») die Aspekte und Perspektiven, die sich mit dem Modell vom Inneren Team verbinden. Was lässt sich damit anfangen?
Aspekte und Perspektiven des Modells ‹Inneres Team›
Methode der Selbstklärung
Zum einen benutzen wir das Modell als Methode der Selbstklärung. Die dürfte aus dem Musterbeispiel sehr deutlich geworden sein. Selbstklärung ist die Voraussetzung für klare und kraftvolle Kommunikation und spielt in meiner Kommunikationspsychologie eine große Rolle, auch und nicht zuletzt als innere Voraussetzung für ‹stimmiges› Handeln. ‹Stimmigkeit› ist definiert als zweifache Übereinstimmung, sowohl mit mir selbst als auch mit dem Gehalt der Situation.
Zwar impliziert Selbstklärung noch keine Lösung. Im Gegenteil, die innere Uneinigkeit wird erst so richtig deutlich. Dennoch, bereits die Identifikation mit den einzelnen Wortmeldern sowie das anschließende Gewinnen eines Überblicks durch Betrachtung des Gesamtbildes und das Verstehen dessen, was dort vor sich geht, diese Arbeitsschritte führen häufig zu einer gewissen Klarheit und Beruhigung. Häufig berichten die Ratsuchenden: «Jetzt weiß ich, dass meine innere Uneindeutigkeit gute Gründe hat und völlig in Ordnung ist!» Oft gelingt es jetzt auch, die innere Pluralität als Ausweis differenzierter Menschlichkeit wertzuschätzen: «Gut, dass alle diese Lebensgeister in mir sind, denn jeder hat seine Weisheit und seine Kraft.» In vielen Fällen wird das Thema innerseelisch weiter bearbeitet, auch ohne Beratung von außen. Insofern ist die Selbstklärung mit dem Inneren Team nicht nur Vorbereitung für eine Lösungsfindung, sondern ein erster wichtiger Teil davon.
Methode zur Diagnose seelischer Störungen und Pluralitäten
Zweitens bietet der Ansatz mit dem Inneren Team eine ausgezeichnete Möglichkeit, seelische ‹Störungen› genau und individuell zu bestimmen. Diagnostische Etiketten wie ‹Depression›, ‹Prüfungsangst›, ‹Arbeitsstörung› sind sehr abstrakt und allgemein. Die Depression von Hans kann ein sehr anderes Gesicht haben als die Depression von Franz; erst im Bild des Inneren Teams tritt die individuelle Dynamik zutage. In einer Diplomarbeit zur Prüfungsangst hat Markus Gätje (2003) gezeigt, dass Prüfungsängste von Fall zu Fall sehr unterschiedlich konstelliert sind, je nachdem, welche Quälgeister und Druckmacher, Außenseiter und Stimmungsmacher die innere Bühne besetzen. Im Fall von Josefine haben wir eine recht prägnante Diagnose gewonnen, wodurch ihre Schwierigkeit, eindeutig zu reagieren, bedingt ist: Da ist zum einen ein innerer Konflikt zwischen den Autonomie- und den Bindungswünschen. Da ist zum zweiten eine Desintegration der Anhänglichen, die von der Freiheitsliebenden und der Emanzipierten Feministin hinter Schloss und Riegel gehalten wird. Da ist drittens noch eine alte Verletzung, die gut geschützt und gepflegt sein will. Und viertens erscheint eine kluge Bedenklichkeit, ob die Kürze der Bekanntschaft bereits eine so weit reichende Entscheidung erlaubt. Jedes einzelne Moment wäre ausreichend, eine klare und eindeutige Reaktion unmöglich zu machen, umso mehr alle vier zusammengenommen.
Eine solche Diagnose bildet die Ausgangsbasis für weitere Schritte der Beratung und Klärungshilfe.
Methode zur Lösung innerer Störungen und zur Nutzung innerer Pluralität
Das Modell vom Inneren Team enthält sodann reichhaltige Möglichkeiten, die identifizierte innere Pluralität für differenziertes und stimmiges Handeln zu nutzen, also die Chance, wirklich in Übereinstimmung mit sich selbst zu kommen. Einige Beispiele aus dem Ensemble der Interventionsmethoden, demonstriert an unserem Fallbeispiel:
Innere Ratsversammlung: Alle beteiligten Teammitglieder setzen sich unter Leitung des Oberhauptes um einen runden Tisch mit der Aufgabe, eine Reaktion auf den Heiratsantrag zu finden, zu erfinden, hinter der möglichst alle stehen können. Jeder wird angehört, sagt, was er auf dem Herzen hat und wie die Reaktion aussähe, wenn alles nur nach ihm (dem jeweiligen Mitglied) ginge. Sodann Dialog und Diskussion mit der Idee, aufeinander zuzugehen. (Zum genauen Vorgehen s. Schulz von Thun, MR 3, S. 90ff.)
In unserem Fallbeispiel könnte die Lösung zum Beispiel wie folgt aussehen: Das Jubilierende Herz





























