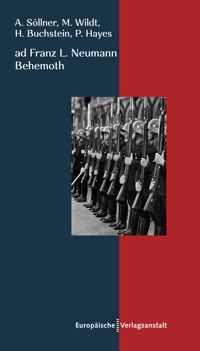10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CEP Europäische Verlagsanstalt
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Die aktuelle Asylpolitik birgt ein Zeichen der Hoffnung, nicht nur, weil sie den Kriegsflüchtlingen unter die Arme greift, sondern auch, weil sie der politischen Lähmung in Europa entgegenarbeitet." "Wir schaffen das!" – Der Satz der deutschen Kanzlerin aus dem Sommer 2015 ist sprichwörtlich geworden, aber die in ihm steckende Prognose wurde auch belächelt: Stand er für eine Selbstüberschätzung der Deutschen oder hat er eine Wendung der europäischen Asylpolitik in die Wege geleitet? Die Analyse der nationalen und globalen Entwicklungen auf dem Feld der Flüchtlingspolitik zeigt, dass politische Slogans nicht ausreichen. Es bedarf der Auseinandersetzung mit den rechtlichen und bürokratischen Realitäten, um zu verstehen, wie problematisch die Situation von Flüchtlingen nach wie vor ist. Alfons Söllner, der sein Forscherleben dem Erbe der Hitler-Flüchtlinge widmete, hat sich in den vergangenen 35 Jahren immer wieder mit der aktuellen Asyl- und Flüchtlingspolitik auseinandergesetzt. In den hier zusammengestellten Aufsätzen zeichnet Alfons Söllner ein differenziertes Bild von Geschichte und Gegenwart der Asylpolitik nach 1945, die Analyse der sie begleitenden wissenschaftlichen Diskussionen bekundet zugleich, wie sehr das Thema ihn persönlich berührt. Während die Texte vor der Jahrtausendwende noch vehement Kritik an der Aushöhlung des bundesdeutschen Asylrechts artikulieren, lassen die späteren Texte liberalere Tendenzen erkennen. Die großzügige Aufnahme der ukrainischen Flüchtlinge in Deutschland und Europa ist ein Zeichen der Hoffnung – und ein energischer Einspruch gegen den Krieg.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Alfons Söllner, geb. 1947, Studium der Politikwissenschaft, Philosophie und Literaturwissenschaft in Regensburg, München und Harvard, Promotion 1977 an der LMU München, Habilitation 1986 an der FU Berlin. Er ist Professor für politische Theorie und Ideengeschichte und lehrte bis 2012 an der Technischen Universität Chemnitz.
Publikationen u.a.: Deutsche Politikwissenschaftler in der Emigration, Opladen 1996; Fluchtpunkte. Studien zur politischen Ideengeschichte des 20. Jahrhunderts, Baden-Baden 2006; (Hrsg.) Deutsche Frankreich-Bücher aus der Zwischenkriegszeit, Baden-Baden 2011; (Hrsg. zus. mit Michael Wildt) Franz Neumann, Behemoth. Struktur und Praxis des Nationalsozialismus 1933–1944, Hamburg 2018; Political Scholar. Zur Intellektuellengeschichte des 20. Jahrhunderts, Hamburg 2018; ad Hannah Arendt. Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, Hamburg 2021.
Alfons Söllner
Das Jahrhundert der Flüchtlinge
Rückblicke auf die deutsche Asylpolitik
Europäische Verlagsanstalt
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
E-Book (EPUB)
© CEP Europäische Verlagsanstalt GmbH, Hamburg 2022
Coverabbildung: © picture alliance / dpa / Patrick Pleul
Covergestaltung: Christian Wöhrl, Hoisdorf
Alle Rechte vorbehalten.
EPUB: ISBN 978-3-86393-644-0
Auch als gedrucktes Buch erhältlich:
ISBN 978-3-86393-143-8
Informationen zu unserem Verlagsprogramm finden Sie im Internet unter www.europaeischeverlagsanstalt.de
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Inhalt
Einleitung
I. Zu früh! – Ich entsorge meine Asylbibliothek
II. Zu spät? Reorientierungsversuche nach dem „24. Februar“
Vorträge und Analysen aus vier Jahrzehnten
1. Asylpolitik in der Bundesrepublik Deutschland (1986)
2. Asylpolitik, Fremdenfeindschaft und die Krise der demokratischen Kultur in Deutschland (1994)
3. Der geistespolitische Ort des heutigen Asylrechts (1997)
4. Die unterschätzte Krise – Deutsche Flüchtlingspolitik 1992/93 und 2015/16 (2017)
5. Europäische Un/Glücksboten (2018)
6. „Massenankünfte von Geflüchteten überfordern bestehende Gesellschaftssysteme immer.“ Interview mit Birgit Glorius (2022)
Anmerkungen
Danksagung
Drucknachweise
Für meine Frau Nele,für unsere Kinder Sophie und Jonas
Einleitung
I. Zu früh! – Ich entsorge meine Asylbibliothek
Der Titel variiert einen Topos der Intellektuellenkultur. Während seine klassische Version dem Schreibenden nur noch einmal bestätigt, wie sehr ihm „seine“ Bücher ans Herz gewachsen sind, ja, dass ihre Ordnung oder die Neuordnung nach einem Umzug die emotionale Bindung an sie nur noch verstärkt, befinde ich mich auf dem gegenläufigen, einem abschüssigen Pfad: Ich möchte meine Asylbücher loswerden, und meine inständige Hoffnung erstreckt sich nur mehr darauf, dass sie nicht wirklich „entsorgt“ werden müssen, sondern einen gnädigen Abnehmer finden, der mit ihnen noch etwas anfangen kann. Meine Gefühle sind also wehmütiger Art, und ich frage mich, ob ich nicht etwas versäumt habe, da das Problemfeld von Vertreibung und Flucht doch keineswegs erledigt, vielmehr in periodischen Krisenzyklen wiedergekehrt ist, allerdings mit dem Unterschied, dass es inzwischen von einer mehr oder weniger etablierten Forschergemeinde beackert wird. Im Vergleich damit ist meine Bibliothek veraltet, deckt nur die Periode bis zur Jahrtausendwende ab, weshalb zu befürchten ist, dass sie von der „Berliner Stadtreinigung“ beerdigt werden könnte.
Als ich vor zehn Jahren mein Amtszimmer an der Technischen Universität Chemnitz zu räumen hatte, verschenkte ich die Hälfte meiner politikwissenschaftlichen Fachbücher an die verbleibenden AssistentInnen, einige Kisten mit ihnen moderten trotzdem noch eine ganze Weile im Institutsgang vor sich hin. Die Asylbücher hingegen hatte ich säuberlich zusammengestellt, in zwei Umzugskartons verpackt und nach Berlin geschafft, wo sie allerdings nicht im pensionierten Arbeitszimmer Platz fanden, sondern in den Keller verbannt wurden. Dort erhielten sie, zusammen mit schon den länger unbenutzten historischen Wälzern, „Gnadenasyl“ – immerhin in einem schön furnierten Holzregal, das wir aus dem Odenwälder Elternhaus meiner Frau mitbekommen hatten. Aber anders als bei der Pensionierung geplant, habe ich sie seitdem nicht mehr hervorgeholt. Selbst als ich mich 2015/16 durch die aktuelle Entwicklung noch einmal zu dem Thema gedrängt fühlte, habe ich den Aufsatz zur „unterschätzten Asylkrise“ ohne den Rückgriff auf die alten Bücher schreiben können; zu offensichtlich lag zu Tage, was vor sich ging, es bedurfte keiner „Recherche“.
Zwischendurch hatte ich meinem ehemaligen Chemnitzer Assistenten die Asylsammlung noch einmal angeboten, aber der hatte nur freundlich abgewunken: das Thema sei sicherlich wichtig, aber dem wissenschaftlichen Vorwärtskommen eben nicht förderlich. Mein lebenslanges Interesse dafür hatte also keine Nachahmung gefunden. Umso erfreuter war ich, dass eine junge Dresdner Kollegin, für deren Habilitationsschrift zu einer politischen Theorie des Flüchtlings ich vor einigen Jahren ein positives Gutachten geschrieben hatte, sich anerbot, meine Bücher zu übernehmen. Zwar habe sie ihren Vertrag mit der Universität gekündigt, weil sie dort keine Perspektive sehe, aber das von ihr kürzlich ins Leben gerufene Institut für angewandte Demokratieforschung kümmere sich selbstverständlich auch um die Integration von Geflüchteten und könne meine Bücher sehr gut gebrauchen. Mutig diese Frau, und ich erleichtert! Es bedarf also keiner „Entsorgung“ im wörtlichen Sinn, vielmehr kann ich mich auf etwas Positives besinnen und versuche mich zu erinnern, welchen Stellenwert die jeweils aktuelle Flüchtlingspolitik in meinem Wissenschaftlerleben eigentlich eingenommen hat.
Einen Hinweis zur Beantwortung dieser Frage entnehme ich der Spezialisierung der jetzt in Bananenkisten schlummernden und auf die Verschickung wartenden Asylbücher: ihre fachliche Ausrichtung ist primär juristischer, politischer und geschichtlicher Art, ihre zeitliche Konzentration liegt auf den 1970er bis 1990er Jahren. So naturwüchsig sich diese Abgrenzung bei der Sammlung der Bücher damals ergeben hat, so konsequent wiederholte sie sich bei ihrer Aufbewahrung und jetzt noch einmal bei ihrer Aussortierung. Darin aber versteckt sich – das merke ich jetzt – nichts weniger als ein verzwickter Konflikt, der mein ganzes Leben und Streben über drei oder vier Jahrzehnte hinweg mitbestimmt, wenn nicht gesteuert haben muss: das gleichzeitig bedrängende, aber auch vorwärtstreibende Gefühl, dass der einsinnigen Konzentration auf die Geschichte der Hitler-Flüchtlinge und davon noch einmal auf die emigrierten Politikwissenschaftler, die sich in meinen Publikationen so eindeutig manifestiert hat, etwas ganz Elementares fehlte, nämlich die Reflexion auf die eigene Gegenwart.
Bestand dieser Defekt auf der ganzen Linie – oder hat er sich erst im Zug meiner beruflichen Etablierung eingestellt, also nachdem eine ebenso ungewisse wie produktive Ausgangslage überwunden war und ich endlich auf der Chemnitzer Politikprofessur gelandet war? Die Frage führt über die Höhen und Tiefen eines Forscherlebens, das spektakulär begann und unspektakulär endete, das aber immerhin soviel Konsequenz bot, dass eine klare Sachorientierung erkennbar wurde, die jedenfalls von der Fachwelt als Leistung erkannt, ja anerkannt wurde. Die lag aber eben nicht in der aktuellen Asylpolitik, d. h. in den drängenden, bisweilen aufdringlichen rechtlichen, soziologischen und politischen Zeitfragen, über die niemand hinwegsehen konnte, sondern in der historischen Distanz. Ich forschte und schrieb über die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, und auch hier begegnete mir das „Jahrhundert der Flüchtlinge“, wie es notorisch genannt wurde, weniger als das große menschliche Drama, das es tatsächlich war, vielmehr interessierten mich seine akademischen Erscheinungsformen und deren längerfristige Folgen. „Deutsche Politikwissenschaftler in der Emigration“ – das stellt sich heute als ein wohlbegrenztes, aber auch irgendwie esoterisches Spezialgebiet der Ideengeschichte des 20. Jahrhunderts dar.
Aber gab es nicht auch Lebens- und Arbeitsphasen, die diesem Eindruck widersprechen? In der Tat gab es Ausbruchsversuche aus dem akademisch eingehegten Gelände, und sie ereigneten sich nicht zufällig in den Jahren, die ich in den ebenso notorischen wie selbstquälerischen Tagebuchnotizen aus dieser Zeit immer wieder als „meine Schattenkarriere“ bezeichnet habe. Sieht man sich nun aber diese Phasen unter dem Gesichtspunkt der Aktualität an, so erscheinen gerade sie unter den umgekehrten Vorzeichen: waren sie nicht eher meine Lichtjahre, standen also für einen politischen und intellektuellen Aufbruch? Und fügt man hinzu, was mir erst in der Erinnerung so richtig auffällt: dass ich nämlich – offenbar ohne zu wissen, welches Risiko darin steckte – die maßgeblichen Klippen meiner akademischen Qualifizierung mit „riskanten“ politischen Themen übersprungen habe, dann gerät der defätistische Ton meines Rückblicks ins Wanken.
Um es kurz und konkret zu machen: Es wäre gewiss nichts als eine romantische Überhöhung, in der Themenwahl meiner Münchner Dissertation zur Frühgeschichte der Frankfurter Schule einen politischen Widerstandsakt zu vermuten. Doch eine gewisse Risikobereitschaft wird man mir nicht absprechen, wenn ich behaupte, dass ich mich mit dem Buch Geschichte und Herrschaft (1979) eher außerhalb des Mainstreams bewegte, wie er von meinem Doktorvater, von Kurt Sontheimer, gerade in den „bleiernen Zeiten“ der späten 1970er Jahre vertreten wurde. Die Quittung dafür bestand in der definitiven Unmöglichkeit, mit solcher Qualifikation an der katholisch dominierten Ludwig-Maximilians-Universität auch nur einen temporären Job zu ergattern. So wie ich ins liberalere Berlin ausweichen musste, um eine berufliche Zukunft zu haben, erging es auch den anderen Mitdoktoranden in München, sofern sie ihre Interessen am „langen Sommer der Theorie“ (Philipp Welsch) aufgewärmt hatten.
Ganz ähnlich kann man vielleicht einen Hang zum politischen Eskapismus am Werke sehen, als ich mich Mitte der 1980er Jahre am Berliner Otto-Suhr-Institut nicht in den „normal science“-Betrieb der politikwissenschaftlichen Bereichsforschung einreihen wollte, sondern mit einer vergangenheitspolitischen Arbeit zu Peter Weiss die Habilitation anstrebte und mithilfe der immer noch zahlreich präsenten „Ex-68er“ auch absolvieren konnte. Aber wirklich aktuell-politisch entwickelte sich meine Arbeit erst mit dem Habilitationsvortrag, der sich die Rekonstruktion der bundesrepublikanischen Asylpolitik nach 1945 vornahm und aus dem breiten Stoff der Asylrechtsprechung die These herausdestillierte, dass die politische Praxis bei allem Wechsel der Regierungskonstellationen dem hohen Anspruch des Grundgesetzes durchgehend nicht gerecht geworden sei. Aus dem Umkreis dieser politisch-juristischen Themenstellung stammt das Gros der jetzt auf Abruf wartenden Asylbibliothek.
Aber die eigentliche asylpolitische Bewährungsprobe stand mir noch bevor; sie bestand in der Zuspitzung der Asyldebatte zu Anfang der 1990er Jahre und war in vertrackter Weise mit den Geburtswehen der deutsch-deutschen Wiedervereinigung verflochten. Was sich jetzt aufdrängte, war nicht nur eine große und erbitterte Debatte um den Erhalt oder die Abschaffung des weltberühmten Artikels 16.2 des Grundgesetzes, sondern eine regelrechte Gesellschaftskrise, deren Ausschläge zu tätlichen Angriffen auf die sogenannten „Asylanten“, ja zu Tötungsdelikten führte. In dieser Situation hatte ich das Glück (oder Unglück?), der Universität für eine Weile den Rücken zu kehren und alle Freiheiten eines Forschers am Hamburger Instituts für Sozialforschung genießen zu können, was zu einer ganzen Reihe von essayistischen Publikationen zur aktuellen Asylpolitik führte. Die Kehrseite war, dass die vorzügliche Bibliotheksausstattung mir die Eigenanschaffung der neuesten Fachliteratur ersparte. Aus dieser heiß umkämpften, aber auch luxuriösen Zeit stammen die Lücken in meiner Asylbibliothek.
Immerhin gab es einen Nachklang, der mir selber als höchst ambivalent in Erinnerung geblieben ist; denn einerseits war es natürlich ein erfreuliches Ereignis, dass ich Anfang 1994 den Ruf auf die Chemnitzer Professur für politische Theorie und Ideengeschichte erhielt; andererseits blieb es ein nachhaltig befremdliches Erlebnis, als ich die dort übliche feierliche Antrittsvorlesung mit dem Thema Asylpolitik und Fremdenfeindlichkeit in Deutschland bestritt, aber unter den Kollegen, den in der DDR sozialisierten Technik- und Naturwissenschaftlern zumal, nur Befremden auslöste. Vielleicht war dies einer der Gründe, weshalb ich das Asylthema später öffentlich nur noch einmal, nämlich anlässlich des zehnjährigen Gründungsjubiläums von „Pro Asyl“ aufgriff, aber ansonsten weder in der Lehre noch vor allem in der Forschung weiter vorantrieb. Muss ich mir also vorwerfen, dass ich mich, wie die bundesrepublikanische Öffentlichkeit im Übergang zur Ära Merkel insgesamt, in den bequemen Schlaf einer politischen Normalisierungsstimmung einlullen ließ?
Ganz verschlafen habe ich die aktuellen Veränderungen seit der Jahrtausendwende aber dann doch nicht; die betrafen weniger die Asylpolitik im engeren Sinn, in der sich die Ruhe vor dem Sturm einstellte, als vielmehr die gesamtgesellschaftliche Stimmungslage, in der sich, u. a. befördert durch das von der rot-grünen Koalition ratifizierte Zuwanderungsgesetz, endlich durchsetzte, was ohnehin längst Realität gewesen war: die Anerkennung der Bundesrepublik als moderne Einwanderungsgesellschaft. Den Beweis dafür habe ich in den ebenfalls entsorgungsbedürftigen Papierbergen aus Chemnitz gefunden: 2005 und 2006 habe ich unter dem Titel Migration und Asylpolitik eine Vorlesung und ein Hauptseminar angeboten, die mir deswegen so gut in Erinnerung geblieben sind, weil sie zu den am besten besuchten Veranstaltungen meiner gesamten Lehrtätigkeit gehörten: Das Asylthema war hier theoretisch eingebettet in ein weit gefasstes Konzept von Migration und europäischer Integration und wurde zum Stoff für eine ganze Reihe ungewöhnlich kluger Bachelor- und Magisterarbeiten: die Studierenden verstanden die Untergründe des Zeitgeistes offenbar besser als ihr theorie-versponnener Professor.
Dennoch, die asylpolitischen Ereignisse des Jahres 2015/16 kann man nur mit dem Begriff des „bösen Erwachens“ erfassen. Sie überraschten die intellektuelle wie die politische Szene gleichermaßen, und sie führten zu einer neuen Melange zwischen den beiden Polen; denn dieselbe Kanzlerin Merkel, die von uns Linksintellektuellen lange Zeit mit dem Schimpfwort des „politischen Aussitzens“ bedacht worden war, war es auch, die inmitten einer Flüchtlingskrise, die jetzt wirklich dramatisch war und von Anfang an europäische Verwerfungen zeigte, das berühmte „Wir schaffen das“ in die Welt setzte und damit neuen Wind in die Asyl- und Migrationspolitik brachte. Auch wenn mittlerweile offensichtlich ist, dass die damals gesetzten moralischen Standards weit davon entfernt sind, in den europäischen Mitgliedsstaaten konsensfähig zu sein, so glaube ich doch, dass die nach uns kommende Generation von Forschern und Lehrern daraus ein Quäntchen Optimismus schöpfen kann, was die Zukunft der Asylpolitik in Deutschland und Europa betrifft …
Auf der Autobahn nach Dresden überkommt mich ein seltenes Glücksgefühl: Zwar ist das Auto mit acht schweren Bücherkisten deutlich überladen und wir müssen vorsichtig fahren; denn es ist glatt. Aber ich spüre eine Last von mir abfallen, die anderswo, den jungen Leuten in Dresden z. B. noch von Nutzen sein wird. Wenn sie meine Asyl-Bücher abgeladen haben, werde ich ihnen hinterherrufen: „Nicht nur weil Ihr jünger, zahlreicher und mutiger seid als wir es gewesen sind, sondern auch weil das Flüchtlingsthema aus dieser Welt nicht mehr wegzudenken ist, müsst Ihr die Stafette jetzt übernehmen. Dafür wünsche ich Euch alles Gute!“ Nach Chemnitz weitergefahren, werden wir im Chemnitzer Hof absteigen, auch, um von da noch einmal versöhnlich auf das Hauptgebäude der Technischen Universität hinüberzuschauen, in der Villa Esche werden wir am Abend gut essen und am Morgen zufrieden wieder nach Hause fahren …
Diese nostalgischen Sätze habe ich Mitte Januar in mein Notizbuch geschrieben. Vier Wochen später, am 24. Februar, überschritten die russischen Truppen die ukrainische Grenze und lösten die vermutlich größte Massenflucht seit dem Zweiten Weltkrieg aus.
II. Zu spät? Reorientierungsversuche nach dem „24. Februar“
1. Wider die Resignation!
„Sie haben eine Weile nichts von mir gehört, weil mich der russische Überfall auf die Ukraine bedrückt, ja regelrecht gelähmt hat. Daher habe ich weder die Idee zur Wiederpublikation von Franz Neumanns Angst und Politik weiterverfolgt noch mich aufraffen können, an der allenthalben aufblühenden Flüchtlingshilfe mitzuwirken. Das praktische Engagement war ohnehin nie meine Stärke.
Jetzt aber könnte sich die Verdüsterung zumindest intellektuell heben: Schon vergangenen Herbst hatte ich, wie wenn ein böser Geist es mir zugeflüstert hätte, damit begonnen, meine verstreuten und vergessenen Aufsätze zur Asylpolitik zusammenzusuchen – und siehe da: sie erwiesen sich nicht nur als zahlreich, sondern zeigen jetzt eine Aktualität der seltsamsten Art. Reiht man sie nämlich aneinander, so möchte man an eine gewisse Umkehrung der Perspektive glauben: Während die Texte aus 1980/90er Jahren eine vehemente Kritik an der Asylverweigerung in Deutschland artikulieren, spricht aus den letzten Texten eine leise Zuversicht, so als würde man tatsächlich aus der Geschichte lernen.
Wäre es nicht ein probates Heilmittel gegen die grassierende Depression, diese Texte noch einmal zu publizieren und auf positive Entwicklungen hin zu untersuchen. Diese Neulektüre müsste das paradoxe Kunststück fertigbringen, einerseits einzugestehen, dass wir uns alle in einen zweifelhaften Pazifismus haben einnebeln lassen, zu dem nicht zuletzt eine fortgesetzt restriktive Asylpolitik gehörte, während es andererseits auf demselben Sektor doch auch Öffnungstendenzen gibt. Die gesamteuropäische Aufnahmebereitschaft für die Flüchtlinge aus der Ukraine ist ein Zeichen der Hoffnung.“
Diese E-Mail schicke ich am 27. März an meine Verlegerin. Die Antwort kommt prompt: sie und ihr Mann fänden die mitgeschickten Texte sehr interessant. Sie schlagen vor, eine Auswahl aus ihnen zu publizieren. Als ich den bunten Prospekt für das Herbstprogramm in der Hand halte, schlafe ich die folgenden Nächte sehr schlecht: Ist es überhaupt angebracht – und nicht vielmehr verwegen oder einfach nur eitel, meine alten, vergessenen Asyltexte noch einmal an die Öffentlichkeit zu zerren? Und da die Reflexion auf die aktuelle Entwicklung, die ja denkbar dramatisch verläuft, unabdingbarer Fixpunkt des rückwärtsgewandten Blicks sein muss – wie soll diese Aufgabe von einem 75-jährigen Pensionär bewältigt werden, der mit dem Älterwerden kämpft und in asylpolitischen Dingen die Flinte eigentlich schon ins Korn geworfen hat? Zu den nächtlichen Albträumen wegen der Zuspitzung des Ukrainekrieges gesellt sich die Angst, mich heillos überfordert zu haben – bis mir eines Morgens die rettende Idee kommt:
Ich würde gar nicht erst versuchen, an die Ambitionen der älteren Texte anzuknüpfen. d. h. die gegenwärtige Lage der Asylpolitik „wissenschaftlich“ zu analysieren, sondern mir den Luxus eines eher subjektiven Blicks auf das Asylproblem erlauben, um vielleicht gerade damit eine Art Spiegel für die Geschichte meiner Generation in die Hand zu bekommen; denn offensichtlich gehört das Thema von Flucht und Asyl irgendwie in die politische Grundausstattung der um und durch „1968“ Sozialisierten oder bildete für manche von ihnen sogar das Zentrum ihrer intellektuellen Verfasstheit.
Was mich selbst betrifft, ist dieser Zusammenhang offensichtlich: Tatsächlich gab es bei mir – und gibt es noch immer – eine geradezu manische Fixierung auf die Geschichte der Hitlerflüchtlinge, die unschwer als der stellvertretende Versuch zu erkennen ist, die Schuldgefühle gegenüber der unbewältigten Vergangenheit unserer Elterngeneration abzuarbeiten. Und analog dazu gehörte meine hochmoralische und gleichzeitig theoretisch ambitionierte Kritik an der restriktiven Asylpolitik in der Bundesrepublik in denselben Komplex, weshalb die großen Namen aus der Emigrantengeneration – in meinem Fall Hannah Arendt und Otto Kirchheimer – geradezu mantrahaft herbeizitiert wurden, um diese Kritik autoritativ abzusichern. Das zeigt sich in der Argumentationsweise und in der Rhetorik besonders der Aufsätze aus den frühen 1990er Jahren, als die Abschaffung des Asylartikels im Grundgesetz zu befürchten war: sie waren mehr politisch als analytisch gehalten, ihre Sprache war alarmistisch, normativ überdeterminiert, erging sich in beschwörenden Wiederholungen und der dazu passende juristische Diskurs schwenkte die Fahne der „Theorie“.
Aus heutiger Sicht ist wohl vor allem in diesem Punkt Entspannung angesagt. Ich werde daher die drei oder vier Texte aus der Sammlung heraushalten, die sich auf die zugespitzte Situation der Grundgesetzänderung, also die Jahre 1991 bis 1993 bezogen und meist in der Zeitschrift Mittelweg 36 erschienen waren.1 Das kann aber nicht heißen, dass die fortgesetzten Versuche, aus meinen historischen Recherchen zur Wissenschaftsemigration Schlussfolgerungen für die jeweils aktuelle Asyl- und Flüchtlingspolitik zu ziehen, gänzlich vergeblich waren. Sicherlich stand dahinter so etwas wie ein gedächtnispolitischer Denkzwang, Adornos Aufforderung zur „Aufarbeitung der Vergangenheit“ war eben der kategorische Imperativ meiner Generation. Aber der Wiedergutmachungsimpuls, das ewig schlechte Gewissen von uns Deutschen, die Nazizeit immer noch nicht hinreichend „aufgearbeitet“ zu haben, ist im Laufe der Zeit eher zum Hindernis für die Zukunftsgestaltung geworden. Heute geht es doch darum, sich mit ganz anderen Herausforderungen zu konfrontieren und daraus neue Hoffnung zu schöpfen. Trotzdem glaube ich, dass die von mir so verbissen betriebene Exil- und Emigrationsforschung zur Liberalisierung der politischen Kultur in Deutschland beigetragen hat, in der auch eine „andere“ Asyl- und Flüchtlingspolitik gedeihen kann. Die aktuelle Aufnahmebereitschaft der deutschen Gesellschaft gegenüber den Geflüchteten aus der Ukraine verstehe ich als Unterpfand dafür.
2. Der Zahlenschock
Die Aussicht auf die Wiederpublikation meiner alten Asylaufsätze ist begleitet von widerstrebenden Gefühlen: Ich spüre ein Nachlassen der Kräfte, das dem hypermoralischen Tenor von damals so ganz entgegengesetzt ist. Der auffahrende Gestus läuft ins Leere, der Kritiker findet seinen Gegner nicht mehr, der Anfang der 1990er Jahre in der ganzen Gesellschaft greifbar schien. Und während ich noch 2015/16 die Asylkrise als hochambivalenten Prozess darstellte – gibt es heute nicht die berechtigte Hoffnung auf einen ganz anderen Umgang mit der Situation? Darf man annehmen, dass die deutsche Gesellschaft als Ganze toleranter geworden ist? Jedenfalls zeigen sich bislang nirgends die hysterischen Abwehrreaktionen von früher! Beim Versuch, mit solchen, von starken Widersprüchen geprägten Fragen fertig zu werden, meldet sich ein Reflex zurück, mit dem ich mich schon damals vergeblich zu retten versucht habe: die Bannung des Schreckens durch die Statistik. Wenn der russische Überfall auf die Ukraine tatsächlich, wie ich immer wieder lese, die „größte Massenflucht seit dem Zweiten Weltkrieg“ ausgelöst hat – was heißt das in Zahlen?
Eine erste Information dazu finde ich nicht in den großen Medien, die dazu wenig berichten, sondern in einem Bericht der Fondation Robert Schuman, deren Informationsbrief ich regelmäßig zugeschickt bekomme, aber lange nicht mehr zu Rate gezogen habe. Dort lese ich am 19. April die folgenden Zahlen2: Bislang geflüchtet aus den östlichen Provinzen der Ukraine sind insgesamt mehr als 12 Millionen Menschen, davon sind ca. 7,1 Millionen interne Flüchtlinge, d. h. innerhalb der Ukraine geblieben, während ca. 4,6 Millionen externe Flüchtlinge sind, d. h. außer Landes gingen. Die letzteren verteilen sich folgendermaßen auf die angrenzenden europäischen Staaten: Polen 2,6 Millionen; Rumänien mehr als 700 000; Moldawien 413 000 (d. h. ca. 15 % der Bevölkerung); Ungarn 428 000; Slowakei 320 000.
Der regelmäßig informierende Mediendienst Integration stockt Mitte Mai diese schockierenden Zahlen folgendermaßen auf: Ukraine-interne Flüchtlinge 8 029 000, externe Flüchtlinge 6 312 255. Mit Berufung auf den UNHCR wird die Verteilung der Flüchtlinge folgendermaßen aufgelistet:
Anrainerstaaten: Polen: 3 396 792; Rumänien: 930 341; Russland: 863 086; Ungarn: 615 256; Moldawien: 463 435; Slowakei: 426 605; Belarus: 27 308. Nicht-Anrainerstaaten: Tschechien: 338 830; Italien: 113 230 – und Deutschland: 927 000. Wichtige Zusatzinformation für die Fluchtmigration insgesamt: 80-90 % der Geflüchteten sind Frauen und Kinder.
Am 23. Mai kommt dann der Quantensprung, der vor der Weltöffentlichkeit als Qualitätssprung dargestellt wird: Der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen verkündet, dass die sog. Weltflüchtlingspopulation die 100-Millionen-Grenze überschritten hat, was mehr als 1 % der Weltbevölkerung entspricht.3 Während es noch Ende 2021 weltweit „nur“ ca. 90 Millionen Flüchtlinge gab, kommt den Ukraine-Flüchtlingen die verzweifelte, aber hochsymbolische Ehre zu, diesen Quantensprung ausgelöst zu haben. Generalsekretär Grandi: „Es ist ein Rekord, der niemals hätte erreicht werden dürfen […] Das muss ein Weckruf sein.“ Er fügt aber auch hinzu, dass die internationale Reaktion auf die Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen, „überwältigend positiv“ ist. „Das Mitgefühl ist lebendig und wir brauchen eine ähnliche Mobilisierung für alle Krisen auf der Welt.“ Dieser positive Ausblick ist natürlich mehr Wunsch als Wirklichkeit; auch ist der Ukraine-Konflikt aus noch zu klärenden Gründen ein ganz besonderer Fall.
In der langfristigen Perspektive zeigt die Entwicklung der Weltflüchtlingspopulation, wie der Euphemismus heißt, tatsächlich eine schwindelerregende Steigerung. Ich kann das auch an meinen eigenen Texten nachvollziehen: 1986: 12 Millionen, 1992: 20 Millionen; 2016: 65 Millionen; 2020: 90 Millionen; und jetzt: mehr als 100 Millionen. Muss man vor diesen Zahlen nicht kapitulieren? Ist nicht heute noch „richtiger“ als vor 40 Jahren, was ich in meinem ersten Asylaufsatz in Anspielung auf Walter Benjamins Angelus novus so resümiert habe: „Es ist ein Missverhältnis, eine katastrophische Disproportion, die in der Beziehung zwischen Flüchtlingsbewegungen und Asylrecht zur Debatte steht.“ Sicherlich haben die KommentatorInnen vom FluchtforschungsBlog recht, wenn sie die Zahlen des Hochkommissars mit der Schlussfolgerung versehen, dass man vor der „Illusion der Transparenz“ auf der Hut sein müsse.4 Trotzdem, was die aktuelle Lage betrifft: Steht die gesamteuropäische Aufnahmebereitschaft gegenüber den Ukraine-Flüchtlingen nicht für eine profane Unterbrechung der Katastrophenlogik, die Benjamin bekanntlich nur von einem Messias erhoffte? Wie ist das möglich geworden?
3.A Window of Opportunity? Schlaglichter mit Schattenseite
Eigentlich mag ich solche „neudeutschen“ Formulierungen nicht, aber eine bessere Metapher fällt mir nicht ein, gerade weil sie doppelbödig ist: Wer das Fenster mit der Türe verwechselt, wird abstürzen! Trotzdem möchte in diesen Notizen dem Optimismus den Vortritt lassen und alles zusammentragen, was Angela Merkels „Wir schaffen das“ von 2015 noch einmal neues Leben einhauchen könnte. Vielleicht gilt heute mehr als damals, dass die Krise eine besondere Chance darstellt, festgefahrene Blockaden aus dem Weg zu räumen? An solchen zeitgeschichtlichen Bruchstellen wäre dann der kairos dingfest zu machen, der den Weg von „Migration as Challenge“ zu „Migration as Chance“, wie David Miliband ihn 2017 vorgezeichnet hat5, imaginierbar macht. Und die phantasievolle Vorwegnahme ist doch immer der erste Schritt, um einen neuen Weg zu betreten. Die aktuelle Situation macht diesen Umschlagspunkt sogar deswegen „vorstellbarer“ als vorher, weil sie vielleicht gar nicht als Krise wahrgenommen wird.
Ich werde also an erster Stelle von einer Erfahrung berichten, über die ich nicht ohne eine gewisse Scham sprechen kann und die dennoch die intensivste von allen war: Es ist gegen Mitte März, also in der Anfangsphase der Fluchtbewegung aus der Ukraine, dass ich Kontakt erhalte zu einer Flüchtlingshilfsgruppe in unserer Nachbarschaft, die von der evangelischen Pfarrerin ins Leben gerufen worden ist. Der dazugehörige Kantor, ein höchst vielseitiger Musiker, nimmt mich in die vom ihm eingerichtete „WhatsApp-Gruppe“ auf, die alsbald zum zentralen Kommunikationsmedium für die sich ständig vergrößernde und komplexer werdende Betreuung der Geflüchteten wird. In wechselnder Belegung der ca. 40 Feldbetten werden im Gemeindesaal über zwei Monate hinweg vorübergehend viele Familien und Einzelpersonen untergebracht.
In diesen Wochen werde ich Zeuge einer unglaublich spontanen und aufopferungsvollen, aber auch planvollen und nachhaltigen Flüchtlingshilfe. In der Hochzeit, also etwa Mitte April sind an dieser hochorganisierten „Willkommenskultur“, die neben dem Personentransport, der leiblichen Versorgung, der ärztlichen Hilfe auch Ämterbegleitung und viele weitere Tätigkeiten umfasst, ca. 100 Personen verschiedenster Profession und Konfession aktiv beteiligt. Mitte Mai wird die Unterkunft schließlich aufgelöst, weil von den zentralen Verteilungsstellen der Stadt Berlin nur noch Einrichtungen über 100 Betten angelaufen werden. Für mich am eindrucksvollsten ist, dass auf das „posting“ der vielen und immer neuen Aufgaben das passende Hilfsangebot jeweils so rasch erfolgt, dass es einem „Zögerer“ wie mir kaum möglich wird, auch einmal „zum Zuge zu kommen“. Und als ich – in einem nachträglichen Gespräch mit dem Kantor – genau diesen Punkt hervorhebe, kann er nur herzlich lachen, war er doch viele Wochen hindurch Tag und Nacht auf dem Posten gewesen, um die „Flüchtlingsunterkunft Lübars“ am Laufen zu halten, während das einzige Engagement, das ich „unpraktischer Intellektueller“ zustande brachte, auch meine negativste Erfahrung wurde.
Zusammen mit einem befreundeten Arzt hatte ich von der Pfarrerin den Auftrag übernommen, eine siebenköpfige ukrainische Familie aus dem Berliner Pfarrhaus in eine aufnahmebereite Gemeinde nahe Pritzwalk in Brandenburg zu transportieren. Keiner der noch jungen Eltern sprach auch nur ein Wort Deutsch oder Englisch, von den Kindern war das älteste 8 Jahre und das jüngste höchstens ein Jahr als, und so gab es auf der ganzen Fahrt nur mehr oder weniger hilflose Gesten, besser gesagt: zwischen uns herrschte sprechende Stummheit. Als wir im dörflichen Gemeindehaus ankamen, hatten die überaus bemühten Pfarrhelferinnen die sieben Betten bezogen, im Garten einen gastlichen Tisch mit Kaffee und Kuchen aufgestellt und versuchten mittels des deutsch-ukrainischen Übersetzungsprogramms auf dem Handy die Kommunikation in Gang zu bringen, während die Kinder sich bereits nach dem Sandkasten und den nebenan weidenden Schafen umsahen. Aber die Eltern wollten weder die Unterkunft besichtigen noch ein Stück Kuchen zu essen, sondern bestanden darauf, stante pede zurück nach Berlin gebracht zu werden, und zwar direkt zum Hauptbahnhof, um von dort, wie wir herausfanden, nach Budapest weiterzureisen, wo sie Verwandte vermuteten. Alle gut gemeinten Vermittlungsversuche halfen nichts, und so mussten wir die Familie ohne jedes Verständigungszeichen vor dem Hauptbahnhof absetzen, selbst unser Angebot, wenigstens noch den passenden Zug nach Ungarn ausfindig zu machen, wurde abgelehnt.
Von der Flüchtlingsabwehr zur „Willkommenskultur“? Kann man die aktuelle Situation mit diesem gedanklichen Kurzschluss in eine zeitgeschichtliche Perspektive bringen? Ist es überhaupt angebracht, diesen 2015 in Deutschland geprägten (und im Ausland bisweilen ironisierten) Begriff auch auf die Lage in anderen europäischen Ländern anzuwenden? Während man in Deutschland die damit gemeinte soziale und emotionale Öffnung gegenüber den Fremden eher als Leistung der liberalen Zivilgesellschaft verstehen möchte, ist die Hilfsbereitschaft in Polen wahrscheinlich eher Ausdruck eines traditionellen katholischen Milieus. Was geschieht mit der Hilfsbereitschaft, wenn die anfängliche Spontaneität sich verbraucht hat? In Deutschland wird man auf die Erfahrungen und Problemlösungen der Flüchtlingsbürokratie zurückgreifen können, die in Reaktion auf „2015“ reichlich ausgebaut wurde und jetzt rasch reaktiviert werden kann. Aber wird die Behandlung der Flüchtenden wieder primär aufenthaltsrechtlicher oder gar polizeilicher Art sein – oder wird man auf Teilhabe und Selbstorganisation setzen und die viel beschworene „Integration“ tatsächlich als psychische, soziale und berufliche Eingliederung verstehen? Wenn das die Lektion von „2015“ gewesen wäre, dann zeigte sich dem Blick zurück auf die 1990er Jahre nichts weniger als ein Unterschied ums Ganze!
Während ich das notiere, stoße ich in der Süddeutschen Zeitung auf einen Bericht, der meiner hoffnungsheischenden Analyse ins Gesicht schlägt: Der offenen Aufnahme der Ukraine-Flüchtlinge, von denen 80 bis 90 Prozent Frauen und Kinder (also eben keine „schwarzen jungen Männer“ aus dem Maghreb!) sind, steht eine ebenso offene rassistische Diskriminierung gegenüber: sie betrifft vor allem die ca. 400 000 Roma und Sinti, die in der Ukraine leben, oft keine Papiere haben, sozial unterprivilegiert und wenig gebildet sind. Ihre Ungleichbehandlung setzt sich auf der Flucht fort, ohne Papiere werden sie oft von den Grenzbeamten an der Auseise gehindert oder „gesondert“ behandelt, und auch innerhalb der EU bleibt ihr Schutz prekär. Hinzu kommt, dass die Roma sich oft in Großfamilien auf den Weg machen, was vollkommen ins traditionelle Vorurteil gegen die „Zigeuner“ passt. Der sächsische Flüchtlingsrat, der all das berichtet, fordert die Gleichbehandlung der Roma mit den ukrainischen Flüchtlingen. Ansonsten drohe in Deutschland, dass die Flüchtenden in zwei Klassen eingeteilt werden.6 Noch pessimistischer stimmt eine kritische Analyse im FluchtforschungsBlog, die behauptet, dass die asylpolitische „Bevorzugung“ der Ukraine-Flüchtlinge auf eine „Repolitisierung“ der Asylgewährung hinausläuft: „zurück in die Zeiten des Kalten Krieges!“, und das wiederum könne bedeuten, dass die allgemeine, die menschenrechtliche Basis des Asylrechts ausgehebelt wird.7
Und doch: Wenn man bedenkt, dass der russische Überfall auf die Ukraine seinerseits eine überfallartige Fluchtbewegung aus dem Donbass nach Mittel- und Osteuropa herein auslöste, dann kann man die positiven Reaktionen darauf nur aus einer generellen Bereitwilligkeit erklären. Es beginnt mit der raschen Liberalisierung der Einreise gleich zu Kriegsbeginn, mit der die Brüsseler Institutionen den Startschuss geben. Die sog. Massenzustrom-Richtlinie wird schon am 4. März, also eine Woche nach Kriegsbeginn in Kraft gesetzt wird: Ukrainische Staatsbürger dürfen sofort und ohne Visum einreisen, sie können sich 90 Tage frei bewegen, ohne sich polizeilich zu melden. Das „normale“ Asylverfahren ist ausgesetzt und durch einen automatischen, wenngleich „vorübergehenden Schutz“ ersetzt, der zunächst 90 Tage freie Bewegung im Schengenraum ermöglicht, danach aber bis zu drei Jahren verlängert werden kann. Daraus folgt in allen Mitgliedsstaaten ein umfassender rechtlicher Anspruch: auf Unterstützung bei Verpflegung und Unterbringung, auf Erwerbstätigkeit und Zugang zum Bildungssystem, auf medizinische Versorgung, Sprachunterricht und sogar Schulintegration.