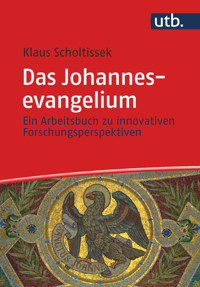
28,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: UTB GmbH
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Die Johannesforschung der letzten drei bis vier Jahrzehnte ist von weitreichenden Um- und Neuaufbrüchen geprägt. Herkömmliche Forschungspositionen, die über Jahrzehnte galten, werden nachhaltig infrage gestellt. Dieses Buch zum Johannesevangelium zeigt die wesentlichen Entwicklungslinien der jüngeren Johannesforschung auf, die sich von vielen älteren Annahmen getrennt hat. Das noch nicht ausgeschöpfte Potential dieser Textinterpretationen wird an exemplarischen Textauslegungen mit neuen Impulsen zum Weiterarbeiten veranschaulicht. Die Ausführungen sind sprachlich und didaktisch so gestaltet, dass Studierende, Theolog:innen sowie interessierte Einsteiger:innen schnelle Zugänge finden können zur Botschaft des Johannesevangeliums, die unversehens in den Bann zu schlagen weiß.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 902
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Klaus Scholtissek
Das Johannesevangelium
Ein Arbeitsbuch zu innovativen Forschungsperspektiven
Prof. Dr. Klaus Scholtissek ist Vorsitzender der Geschäftsführung der Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein GmbH (www.diakonie-wl.de) und apl. Professor für Neues Testament an der Theologischen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena.
Umschlagabbildung: Mosaico del Águila de San Juan. Interior de la Iglesia de San Manuel y San Benito de Madrid, Manuel Martín Vicente, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
DOI: https://doi.org/10.36198/9783838564098
© 2025 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
Einbandgestaltung: siegel konzeption | gestaltung
utb-Nr. 6409
ISBN 978-3-8252-6409-3 (Print)
ISBN 978-3-8463-6409-3 (ePub)
Inhalt
Vorwort
Die Johannesforschung der letzten drei bis vier Jahrzehnte ist von weitreichenden Um- und Neuaufbrüchen geprägt. Herkömmliche Forschungspositionen, die über Jahrzehnte galten, werden nachhaltig infrage gestellt: Das betrifft die teils überbordenden Schichtenmodelle und Quellentheorien, die die Entstehung des Johannesevangeliums erklären wollten. Das betrifft das vermeintliche Nichtverhältnis des Johannesevangeliums zu den synoptischen Evangelien und die vielfach angenommenen soziologischen, religionsgeschichtlichen und/oder theologischen Sonderrollen des Johannesevangeliums.
Eine weitreichende Neuauslegung des vierten Evangeliums wurde möglich durch eine neue Aufmerksamkeit für die johanneische Textwelt (Sprachwelt, Sinnwelt, Denkwelt). Dabei werden wichtige Etappen der jüngeren Johannesforschung erkennbar: der Aufweis der johanneischen Verschmelzung der vor- und der nachösterlichen Zeit im Rückblick auf das Leben Jesu, die Entdeckung der johanneischen Zusammenschau von gegenwärtigem und zukünftigem Heil, die vertiefte Beschäftigung mit der johanneischen Bildsprache und Ironie, die Beobachtung der erzählerischen Kompetenz und Raffinesse des Evangelisten – mit weitreichenden Folgen zum Beispiel bei den hochdifferenzierten Personenprofilen. Gleichzeitig werden in den letzten Jahrzehnten wichtige Themen des Johannesevangeliums, die in der früheren Forschung ausgeblendet wurden, ins Licht gestellt: die Schöpfungs- und Neuschöpfungsaussagen, die johanneische Ethik, die Aussagen des vierten Evangeliums zu Gemeinde, Diakonie, Taufe und Abendmahl, das Bild vom Menschen in seiner geschöpflichen Bedürftigkeit.
Die innovativen Forschungsansätze zeigen in ihrer Gesamtheit nachdrücklich, dass die sprachliche und gedankliche Kompetenz des vierten Evangelisten weithin unterschätzt wurde: Der Evangelist spricht und denkt nicht dualistisch, er simplifiziert nicht und er rezipiert zeitgenössische Ideen und Überzeugungen nicht unterkomplex. Im Gegenteil: Johannes erweist sich als souveräner und kreativer Erzähler, als philosophischPhilosophie, philosophisch und theologisch facettenreicher, multikulturell sprachfähiger Evangelist. Biblische, kultur- und geistesgeschichtliche Zeugnisse rezipiert er in innovativer Anverwandlung.
Ein Paradebeispiel für die geradezu geniale Kunst des Evangelisten ist der Johannesprolog: Der Prolog führt die Leserinnen und Leser in die johanneische Erzählwelt ein. Ihnen werden schon in den ersten achtzehn Versen die die ganze Schöpfung einschließende Reichweite und wesentliche Verschlüsselungen und Entschlüsselungen der johanneischen Text- und Denkwelt anvertraut. Schon im Prolog und dann im gesamten Evangelium reflektiert und durchleuchtet der Evangelist die anspruchsvolle Beziehung zwischen Gott, seiner Schöpfung, Jesus Christus und den Menschen, die sich ihm glaubend und liebend anvertrauen oder – und diese Alternative wird im Johannesevangelium vielfach durchbuchstabiert – ihn gerade nicht „nicht aufnehmen“ (vgl. Joh 1,11-13).
Die Fülle der wissenschaftlichen Veröffentlichungen zum Johannesevangelium hat in den letzten Jahrzehnten ein Maß erreicht, das geeignet ist, die Übersicht zu verlieren. In diesem Band werden ausgewählte Forschungsbeiträge vorgestellt und diskutiert. Diesem Band liegt eine langjährige eigene Beschäftigung mit dem Johannesevangelium zugrunde: Nach einer Monographie1 ist auch ein Sammelband2 zum Johannesevangelium erschienen. Diesen Sammelband eröffnet ein umfangreicher Forschungsbericht aus dem Jahr 2021, der als Grundlage für dieses Arbeitsbuch dient.3 Das vorliegende Arbeitsbuch greift auf diesen Forschungsbericht zurück und setzt neu an: mit wesentlichen Erweiterungen, mit vertiefenden Beispielauslegungen, mit sprachlichen und inhaltlichen Überarbeitungen und mit erheblichen Aktualisierungen.
Dieses Arbeitsbuch zeigt die wesentlichen Entwicklungslinien der jüngeren Johannesforschung auf, veranschaulicht diese exemplarisch und setzt eigene Impulse und Auslegungen zum Weiterarbeiten. Dabei wird das noch nicht ausgeschöpfte Potential der innovativen Forschungsperspektiven sichtbar.
Die Ausführungen sind so gestaltet, dass Studierende, interessierte Einsteiger, Theologinnen und Theologen Zugänge finden können zur Botschaft des Johannesevangeliums, die unversehens in den Bann zu schlagen weiß. Das Ziel dieses Bandes ist es, einen zuverlässigen Einstieg in die aufmerksame Lektüre und das Selbstverständnis des Johannesevangeliums zu ermöglichen. Dazu mag der Versuch beitragen, Fachbegriffe und Fremdwörter eingeschränkt zu verwenden, um das Verstehen zu erleichtern und gleichzeitig neu herauszufordern.
Die in diesem Arbeitsbuch zitierten Verse des Johannesevangeliums beruhen in der Regel auf eigener Übersetzung oder übernehmen die Lutherübersetzung 2017.
Der fachliche Austausch mit Ulrike Kaiser, Karl-Wilhelm Niebuhr, Manuel Vogel, Johannes Beck, Volker Rabens und Serhii Smahlo im Café NT genannten neutestamentlichen Labor an der Theologischen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena ist seit vielen Jahren Bereicherung und Freude.
Mein Dank gilt dem Verlag Narr Francke Attempto für die Aufnahme in das von ihm mitherausgegebene utb-Programm und dem Lektorat von Stefan Selbmann, dessen professionelle Begleitung den Weg bis zur Publikation gefördert, ermutigt und erleichtert hat.
Klaus Scholtissek, im Advent 2024
1Hinführung
Dieser Band stellt innovative Forschungsperspektiven zum JohannesevangeliumForschungsgeschichte (Johannesevangelium) vor, diskutiert sie und führt sie mit neuen Textbeobachtungen weiter. Dabei wird sich zeigen, dass deren exegetische und theologische Potentiale zwar zunehmend in den Blick rücken, aber noch keineswegs ausgeschöpft sind.1 Diese Perspektiven werden in unterschiedlicher Ausführlichkeit angesprochen, an Texten des Johannesevangeliums vorgestellt, geprüft und profiliert. Sie verdanken sich insbesondere einer erneuerten, methodisch und hermeneutisch aufmerksamen Zuwendung zur Sprachwelt des Johannesevangeliums (vgl. 4.1-11). Die ersten achtzehn Verse des Johannesevangeliums, der sogenannte PrologProlog (s. auchJohannesprolog), bieten sich in mehrfacher Hinsicht für eine exemplarische Tiefenbohrung in die Sprach- und Denkwelt sowie TheologieTheologie des vierten Evangeliums an (vgl. 3.1-3). Zuvor ist nach dem Ort des Johannesevangeliums im frühen ChristentumChristentum, frühes zu fragen – auch hier sind signifikante Neupositionierungen gegenüber der älteren Forschung aufzuzeigen und zu begründen (vgl. 2.1-4).
Die in 2-4 gewonnenen Beobachtungen und Erkenntnisse haben Folgen für die theologische Interpretation des vierten Evangeliums (vgl. 5.1-12). Die abschließende Zusammenfassung hält die wichtigsten Ergebnisse fest (6.1-3) und führt über zur Gegenwartsbedeutung des JohannesevangeliumsForschungsgeschichte (Johannesevangelium) (vgl. 7).
2Das Johannesevangelium im frühen ChristentumChristentum, frühes
Das Johannesevangelium wurde auf der Basis verschiedener Beobachtungen am Rand des neutestamentlichen Kanons verortet: Dazu wurden getrennt oder kombiniert soziologische, religionsgeschichtliche, sprachliche oder theologische Argumente angeführt. Viele dieser sich mit den einleitungswissenschaftlichen Fragestellungen wechselseitig beeinflussenden Thesen können mit guten Gründen als nicht stichhaltig bewertet werden – insbesondere dann, wenn sie zum dominierenden hermeneutischen Schlüssel der Johannesinterpretation auf- und ausgebaut werden.1 Diese Sicht ist in den folgenden Ausführungen näher zu erläutern.
2.1Interkulturelle Kompetenz statt religions- bzw. geistesgeschichtliche Randstellung
In verschiedenen Untersuchungen sind mit unterschiedlicher Intensität Einflüsse der GnosisGnosis1, des alexandrinischen Hellenismus, von zeitgenössischen philosophischenPhilosophie, philosophisch Schulen, des palästinensischen bzw. hellenistischen Judentums, von Philo von Alexandrien oder aus Qumran angeführt und – in Übernahme oder Widerspruch – zur Interpretation des Johannesevangeliums herangezogen worden.
Für die Zurückweisung des gnostischen Einflusses auf das Johannesevangelium bzw. einer maßgeblichen gnostischen Prägung des Johannesevangeliums kann exemplarisch auf die Studie von Titus Nagel verwiesen werden, die sich ausführlich der Rezeption des Johannesevangeliums im 2. Jahrhundert widmet.2 Heute kann die Diskussion zur Rezeptionsgeschichte des Johannesevangeliums auf die fortgeschrittene Edition der Nag-Hammadi-Texte zurückgreifen und auch methodisch bzw. hermeneutisch sehr differenziert arbeiten. Im Blick auf die wiederholt postulierte bzw. diskutierte Frage nach gnostischen Zügen im Johannesevangelium votiert Titus Nagel für die Gnostisierbarkeit johanneischer Begriffe und Texte, nicht aber für ihren tatsächlichen gnostischen Charakter.
Die Deutung des Johannesprologs bei Herakleon (Mitte des 2. Jahrhunderts n. Chr.) als Weg des Erlösers „von oben in eine ihm fremde Sphäre des Materiellen“ geschieht faktisch durch ein massives, sinnwidriges Umbiegen des johanneischen Textzeugnisses. TitusNagel betont: „Letztlich geht es dabei jedoch weniger um das Verstehen der joh. Intention als um die Deutung derselben im SinneSinne, Sinneswahrnehmung der Rezipienten“3. Auch in den Nag-Hammadi-Schriften wird oft die bewusst intendierte polemisch formulierte Gegenposition zu den johanneischen Aussagen erkennbar (vgl. das gnostische Insistieren auf der Verfügbarkeit des Heils entgegen dem eindeutigen ZeugnisZeuge, Zeugnis von Joh 3,8Joh3,8).
Im Ergebnis hält Titus Nagel fest: Wenn sich für das Johannesevangelium in der christlich-gnostischen Literatur eine umfangreiche Rezeptionsgeschichte aufweisen lässt, liegt dies nicht an einer möglichen Prägung oder Nähe des Johannesevangeliums zur GnosisGnosis, sondern daran, dass sich in diesem Schrifttum eine überwiegende Anzahl von Schriften mit auslegender Tendenz findet. Offensichtlich bestand in diesem Traditionsbereich ein starkes Interesse, das Johannesevangelium im eigenen Sinn ‚auszulegen‘ und damit als rechtfertigende Instanz zu vereinnahmen oder es polemisch zurückzuweisen.
Die Analysen von Titus Nagel zeigen darüber hinaus auf, dass das Johannesevangelium schon früh und breit im 2. Jahrhundert bekannt, rezipiert und verankert war:
(a) in Kleinasien durch Athenagoras von Athen, Apollinaris von Hierapolis, Melito von Sardes, ActJoh und EpJac im letzten Drittel des 2. Jh., durch EpAp in der Mitte des 2. Jh., durch Ignatius von Antiochien und Papias von Hierapolis ca. 110-120 n. Chr.;
(b) in Syrien durch Theophilus von Antiochien kurz vor 180 n. Chr., wahrscheinlich auch durch die nicht genau zu datierenden EvPhil und OdSal, eventuell auch durch PapEg 2, wahrscheinlich auch durch Ignatius von Antiochien;
(c) in Rom durch Herakleon (160-180 n. Chr.), die ptolemäische Prologexegese (ca. 150-200 n. Chr.), EpFlor, Tatian und Justin (um 150 n. Chr.);
(d) in Ägypten durch Herakleon (wenn sein Kommentar dort entstanden sein sollte), durch EpAp, PapEg 2; EpJac, EvVer, p52 (Mitte 2. Jh.).4
Die Datierung des Johannesevangeliums zum Ende des 1. Jahrhunderts und die Abfassung desselben in Kleinasien erhalten von diesen Zeugnissen her eine gewisse Plausibilität.
Aufgrund der heute vorliegenden, erheblich erschlosseneren und damit genaueren Quellenbasis zu den religionsgeschichtlichen Vergleichstexten und ihrer Entstehungszeit und aufgrund weiterer methodisch gebotener Differenzierungen zum religionsgeschichtlichen Vergleich geht es nicht mehr darum, genealogische Abhängigkeiten bzw. Einflüsse nachzuweisen oder zu bestreiten, sondern darum, „Analogien zu betrachten und nicht vorschnell genealogisch auszuwerten“5. Dies gilt zum Beispiel auch für die Versuche, Texte aus Qumran, die – anders als der Substanzdualismus der GnosisGnosis – einen biblisch beeinflussten ethischen DualismusDualismus vertreten, für die Auslegung des JohannesevangeliumsForschungsgeschichte (Johannesevangelium) heranzuziehen. Nicht Texte aus Qumran, sondern der „von der biblischen Tradition geprägte, jüdisch-palästinensische Hintergrund“6 ist für das Johannesevangelium insgesamt maßgeblich. Die oft missverstandenen dualistischen Sprachformen des Johannesevangeliums unterscheiden sich erheblich von dem in sich mehrschichtigen dualistischen Denken der Texte aus Qumran: Die dualistischen „Sprach- und Denkformen im Corpus Johanneum“7 sind bei JohannesJohannes (Evangelist) als Funktion der ChristologieChristologie, nicht aber der EschatologieEschatologie zu verstehenverstehen (s. auchwissen, erkennen).8 Auch eine mitunter angenommene Vorherbestimmungslehre (= PrädestinationPrädestination) im Johannesevangelium lässt sich nicht aus Qumran ableiten. Diese findet sich auch nicht im Johannesevangelium selbst.9 Das Johannesevangelium lässt sich nicht in einer unmittelbaren Auseinandersetzung mit oder Aufnahme bzw. Anverwandlung einer speziellen, in der zeitgenössischen Umwelt vertretenen Lehre verorten.
Das religions- und geistesgeschichtliche Umfeld des Johannesevangeliums ist geprägt von den Heiligen SchriftenHeilige Schrift(-en) Israels insbesondere der griechischen Übersetzung der Hebräischen Bibel (= Septuaginta), frühjüdischen Schriften und der hellenistischen Geisteswelt10. Es ist eine ungerechtfertigte Engführung, das Johannesevangelium in Abhängigkeit bzw. in Auseinandersetzung mit einem einzigen geschlossenen geistesgeschichtlichen Hintergrund erklären zu wollen. Das gilt auch für den Versuch von Troels Engbert-Pederson, das Johannesevangelium in eine erhebliche Nähe zur StoaStoa zu rücken.11
Philosophie, philosophischExemplarisch lässt sich dies auch an der johanneischen Sprache der Einwohnung (= ImmanenzImmanenz (reziprok) (s. auchbleiben)) veranschaulichen: Ein präziser religionsgeschichtlicher Vergleich führt gerade nicht zu einer unterkomplexen, ‚einfachen‘ Herleitung: EinwohnungsaussagenEinwohnungsaussagen (s. auch Immanenz) in der antiken Religions- und Philosophiegeschichte, in der biblischen, jüdischen und frühchristlichen Tradition sind trotz sprachlicher Parallelen in ihrem jeweiligen Kontext zu interpretieren und unterscheiden sich inhaltlich z.T. sehr weitreichend.12
Die angestrebte zeit- und sozialgeschichtliche Kontextualisierung des Johannesevangeliums kann nicht unterkomplex und einlinig auf eine zeit- und /oder religionsgeschichtliche Konstellation zurückgeführt werden. Weiterführend sind Spuren und Verbindungslinien zur jüdischen Diaspora Kleinasiens.13 In diesem Zusammenhang ist auch das Verhältnis der johanneischen GemeindenGemeinde (Ekklesiologie) zu ihren jüdischen Muttergemeinden genauer zu betrachten. Jörg Frey sieht im fiscus Iudaicus einen möglichen Katalysator für die sogenannte „Trennung der Wege“.14
Der fiscus Iudaicus wurde nach der Zerstörung des Jerusalemer Tempels im Jahre 70 n. Chr. als Iuppiter Capitolinus gewidmete Strafsteuer, die die jüdischen Gemeinden abzuführen hatten, eingeführt. Sie trat gewissermaßen an die Stelle der früheren Tempelsteuer, die die jüdischen Diasporagemeinden an die Muttergemeinde in Jerusalem zu zahlen verpflichtet waren. Die neue
„Steuer bedeutete nicht nur eine Erniedrigung des ganzen jüdischen Volkes, ja – in der Sicht mancher – einen Zwang zum indirekten Götzendienst. Sie bewirkte auch eine einschneidende Veränderung der rechtlichen Situation und, mit der Veränderung des Steuersystems, eine Veränderung der Wahrnehmung von JudenJuden („die Juden“ (s. auchAntijudaismus)) (und Christen) durch die römischen Behörden. … Dies machte Juden desto mehr ihre Sonderstellung in der römischen Gesellschaft bewusst, aber veränderte wohl auch den Umgang mit der Frage der Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zur Synagoge, und es ist anzunehmen, dass diese politischen Rahmenbedingungen schließlich auch wesentlich zur Separierung von Synagogengemeinden und Jesusanhängern beitrugen.“15
Jörg Frey fordert zu Recht eine fundierte, breite Berücksichtigung der alttestamentlichen, frühjüdischen und zeitgenössischen Quellen ein. Maßgebliche Bezugstexte sind alttestamentliche und frühjüdische Schriften „angesichts der Tatsache, dass das frühe ChristentumChristentum, frühes zunächst eine jüdische messianische Bewegung war, und dass die Entwicklung der frühjüdischen ChristologieChristologie und TheologieTheologie gänzlich auf der Grundlage (hellenistisch-)jüdischer Traditionen erfolgt ist.“16
Die Auslegung des Johannesprologs kann zeigen, dass der Evangelist über eine interkulturelle, im ursprünglichen Wortsinn ‚ökumenische‘ Kompetenz verfügt und diese kunstvoll komponierend einsetzt (vgl. 3.1-3).
Empfohlene Literatur
Kontexte des Johannesevangeliums. Das vierte Evangelium in religions- und traditionsgeschichtlicher Perspektive (WUNT 175), hg. v.J. Frey – U. Schnelle unter Mitarbeit von J. Schlegel, Tübingen 2004
Jörg Frey, Vom Ende zum Anfang – mein Weg mit dem Johannesevangelium, in: Ders., Vom Ende zum Anfang. Studien zum Johannesevangelium. Kleine Schriften IV (WUNT 492), hg. v. R. A. Bühner, Tübingen 2022, besonders 1-30
2.2Intensive TheologieTheologie statt Isolierung des Johannesevangeliums im Neuen Testament
Eine mögliche Rand- bzw. Sonderstellung des Johannesevangeliums in der zeitgenössischen Kultur- und Geistesgeschichte spiegelt sich forschungsgeschichtlich auch in der vermeintlichen Randlage des vierten Evangeliums im Blick auf die anderen Schriften des Neues Testaments wider. Diese Isolierung des Johannesevangeliums im Verhältnis zu den anderen neutestamentlichen Schriften, insbesondere zu den synoptischen EvangelienEvangelien, synoptische, ist jedoch durch viele neuere Forschungsbeiträge überholt und zurückzuweisen.1
Mit guten Gründen warnt Jörg Frey vor „vier ‚Torhütern‘, die einen angemessenen Zugang verstellen“2: den Ansätzen bei der Verfasserfrage, bei der LiterarkritikLiterarkritik, bei einer religionsgeschichtlichen bzw. religionspolitischen Vorentscheidung und bei einer einengenden Texttheorie. Positiv geht es um eine ideologiefreie Verbindung von literarischen, historischen bzw. zeitgeschichtlichen und theologischen Aussagen:
„Es ist vielmehr damit zu rechnen, dass das Johannesevangelium auch eine eigenständige und kreative theologische Leistung darstellt, eine innovative Reflexion über den Weg Jesu von Nazareth, und dass es darin seinen Leserinnen und Lesern in der Sache neu zu denken geben will.“3
Thomas Popp hat die Bezeichnung „theologische Intensität“ in die Johannesforschung eingeführt und dies am Beispiel von Joh 1,50-51Joh1,50-51 ausführlich nachgewiesen (vgl. hierzu auch 5.3.1).4 Das besondere Profil des vierten Evangeliums liegt demnach in RelationBeziehung (Relation) zu den anderen neutestamentlichen Zeugnissen nicht in einer wie auch immer gearteten zeit-, sozial- oder kulturgeschichtlichen Sonderstellung, sondern in einem genuin theologischen Nachdenken und Neusprechen der Jesus-Christus-Botschaft. Dabei darf dieses dezidiert theologische Interesse des vierten Evangelisten– bei aller Priorität5 – nicht vorschnell und unterkomplex gegen die geschichtliche Verankerung der johanneischen Jesusüberlieferung ausgespielt werden.6 Dieser Versuchung widerspricht der Evangelist nicht nur, aber in besonderer Weise durch die Aussage der FleischwerdungFleischwerdung (s. auch Inkarnation) des Wortes:
Joh 1,14Joh1,14
Und das Wort (ὁ λόγοςλόγος) ist Fleisch (σάρξσάρξ) geworden
und hat unter uns gewohnt (wörtlich: gezeltet).
Im Sinne des Evangelisten sind es sowohl der konkrete MenschMensch, Menschenbild (s. auchAnthropologie) Jesus von Nazareth und sein irdisch- geschichtliches Wirken in Wort und Tat7als auch deren vertiefte Auslegung im LichtLicht, Lichtmetaphorik des Osterglaubens und des Geistwirkens, das das theologische Nachdenken herausfordert, nährt, vorantreibt und rückbindet.8 Die Versuchung, Scheinalternativen aufzubauen, geschichtliche Wirklichkeit und theologische Deutung gegeneinander auszuspielen, wird im johanneischen Denken durch die geistgewirkte Erinnerung überwunden (vgl. hierzu auch 5.6).9Jörg Frey wendet sich in diesem Zusammenhang auch gegen „ahistorische“ bzw. „geschichtsvergessende“ Ansätze, die den „Geschichtsbezug des christlichen Glaubens, ja seine inkarnatorische Konkretheit“10 ausblenden. Gleichzeitig widerspricht er umgekehrt auch einem Ausspielen der „historischen Fokussierung“ gegen eine „theologische Interpretation der neutestamentlichen Texte“11, die die Texte aus sich selbst heraus einfordern.
Empfohlene Literatur
Johannesevangelium – Mitte oder Rand des Kanons?, Neue Standortbestimmungen (QD 203), hg. v. Th. Söding, Freiburg 2003
Thomas Popp, „Größeres als das wirst Du sehen …“ (Joh 1,50). Literarische Integrität und theologische Intensität im Johannesevangelium, in: Spurensuche zur Einleitung in das Neue Testament. Eine Festschrift im Dialog mit Udo Schnelle (FRLANT 271), hg. v. M. Labahn, Göttingen 2017, 349-372
2.3Die Aufnahme der synoptischen EvangelienEvangelien, synoptische im Johannesevangelium
Die unbestreitbaren Eigenheiten des Johannesevangeliums können anders und plausibler erklärt werden als durch eine Sonderstellung und/oder Isolation des vierten Evangeliums. Das Johannesevangelium steht mitnichten am Rande des neutestamentlichen Kanons. So setzt sich in der Forschung verstärkt die Annahme durch, dass das Johannesevangelium mindestens zwei (Markus und Lukas) der drei synoptischen EvangelienEvangelien, synoptische gekannt hat1, diese jedoch nicht ersetzen will. Jörg Frey plädiert für die Kenntnis des MarkusMarkusevangelium- und des LukasevangeliumsLukasevangelium2 – zumal andere, nichtsynoptische Quellenschriften (u. a. die sogenannte Zeichenquelle) jegliche Evidenz verloren haben.3
Für die erkennbare „Transformation der Wortüberlieferung“ beruft sich der Evangelist auf das Geistwirken:
„Die johanneische Darstellung läßt sich nur angemessen bewerten, wenn man das von ihr selbst genannte Erkenntnismedium theologisch ernst nimmt – die aufgrund der österlichen Geisterfahrung erfolgte Anamnesis des Christusgeschehens im Horizont der Schrift.“4
Stellvertretend für viele andere sei – neben der Passionserzählung5 – auf folgende Beispiele für die johanneische Anverwandlung synoptischer Prätexte hingewiesen:
Die Speisung der Fünftausend und Jesu Seewandel: Mk 6,30-52Mk6,30-52 und Joh 6,1-21Joh6,1-216
Die SalbungSalbung (Jesu in Bethanien) Jesu in Bethanien: Mk 14,3-9Mk14,3-9 und Joh 12,1-8Joh12,1-8
lukanische Erzählfiguren (Lk 16,19–31Lk16,19-31; 10,38–42Lk10,38-42; 7,36–50Lk7,36–50) als Prätexte johanneischer Soteriologie7
Joh 21Joh21 als „johanneisches Narrativ synoptischer Traditionen“.8
2.4Das Johannesevangelium, die drei JohannesbriefeJohannesbriefe (1-3 Joh) und die JohannesoffenbarungJohannesoffenbarung im frühen ChristentumChristentum, frühes
Die Verortung des JohannesevangeliumsForschungsgeschichte (Johannesevangelium) im frühen ChristentumChristentum, frühes ergibt sich überzeugend, wenn ernst genommen wird, dass der Evangelist die seinen GemeindenGemeinde (Ekklesiologie) vertraute Jesusüberlieferung der synoptischen EvangelienEvangelien, synoptische unter Aufnahme und Vertiefung der in ihnen angelegten Verkündigung neu zu interpretieren unternimmt.1 Dazu werden die konkrete Situation und die Erfahrungen der johanneischen Gemeinden, besonders der SynagogenausschlussSynagogenausschluss und der fiscus Iudaicus beigetragen haben. Die zeitgeschichtlich bedingten Entstehungsverhältnisse spiegeln sich in der johanneischen Literatur: dem Johannesevangelium, den drei Johannesbriefen sowie mit einer besonderen Prägung in der JohannesoffenbarungJohannesoffenbarung.2
Weitreichende Rückschlüsse von geschichtlich kaum mehr präzise zu greifenden Ereignissen wie dem SynagogenausschlussSynagogenausschluss der johanneischen GemeindeGemeinde (Ekklesiologie) auf die Entwicklung z. B. der johanneischen ChristologieChristologie, wie sie z. B. J. Louis Martyn und Martinus de Boer vortragen, sind hochspekulativ und zurückzuweisen.3
Die Reihenfolgen – und davon abgeleitet – Abhängigkeiten von JohannesevangeliumForschungsgeschichte (Johannesevangelium), Johannesbriefen und JohannesoffenbarungJohannesoffenbarung sind chronisch umstritten. Die Diskussionen hierzu werden durch verschiedene literarkritisch rekonstruierte Schichtenmodelle noch variantenreicher, aber nicht überzeugender. Eine Minderheitenposition vertritt die Priorität des 1. Johannesbriefes vor dem Johannesevangelium.4 Dieser Reihenfolge wird jedoch in der Mehrzahl der Forschungsbeiträge widersprochen.5
Das Johannesevangelium kann mit guten Gründen in der jüdischen Diaspora Kleinasiens, insbesondere in EphesusEphesus, angesiedelt werden.6 Dafür spricht auch die Analyse und Interpretation des Befundes zu den „Griechen“ in Joh 12,20-21Joh12,20-217 einerseits sowie spiegelbildlich hierzu zu „den JudenJuden („die Juden“ (s. auchAntijudaismus))“8 andererseits.
Joh 12,20-21Joh12,20-21
12,20Joh12,20
Es waren aber einige Griechen (Ἕλληνές τινεςἝλληνές τινες) unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest.
12,21Joh12,21
Die traten zu Philippus, der aus Betsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollen Jesus sehen.sehen
Die „Griechen“ dienendienen, Diener (s. auchDiakonie) dem Evangelisten als „Chiffre für die kleinasiatischen Adressaten des Evangeliums selbst“: „In den ‚Griechen‘, die den Irdischen nicht mehr zu Gesicht bekommen, aber dann zum Erhöhten hin ‚gezogen‘ werden, mußten die kleinasiatischen Hörer der johanneischen Schule, die Adressaten des Evangeliums sich selbst und ihren ‚ekklesiologischen Standort‘ erkennenerkennen (s. auchwissen).“9
Ist es möglich, Genaueres zur Person des Evangelisten zu sagen? Martin Hengel vertritt die These, dass der Evangelist ein später JüngerJünger, Jüngerinnen des geschichtlichen Jesus aus Jerusalemer Tagen gewesen sei, ein Augen- und Ohrenzeuge Jesu, der sein Evangelium in einem langen Reifungsprozess verfasst habe, und dessen Schüler seine schriftliche Hinterlassenschaft dann herausgegeben haben. Der Evangelist, der auch für die Abfassung von 1-3 Joh verantwortlich sei, wird mit dem „Presbyter“ JohannesJohannes (Evangelist) bei Papias (vgl. 2 Joh 12 Joh1; 3 Joh 13 Joh1) identifiziert. Mit dieser Position wendet er sich insbesondere gegen eine kollektiv und anonym gedeutete „johanneische Schule“.10
Für Jörg Frey ist das JohannesevangeliumForschungsgeschichte (Johannesevangelium) eine literarische und theologische EinheitEinheit, „eins sein“, das 21. Kapitel „ist … historisch und theologisch vom Grundbestand des Evangeliums nicht weit weg abzurücken“.11 Als Verfasser des Johannesevangelium sowie der drei JohannesbriefeJohannesbriefe (1-3 Joh) kommt für ihn der presbyterosPresbyteros aus 2 Joh 12 Joh1 und 3 Joh 13 Joh1 am ehesten in Betracht (vgl. auch den bei Papias genannten PresbyterosPresbyteros), „wenn man es überhaupt wagt, den johanneischen Autor mit einer anderwärts bekannten Person zu identifizieren“12.
Empfohlene Literatur
Jörg Frey, Das Johannesevangelium und seine Gemeinden im Kontext der jüdischen Diaspora Kleinasiens (2011), in: Ders., Vom Ende zum Anfang. Studien zum Johannesevangelium. Kleine Schriften IV (WUNT 492), hg. v. R. A. Bühner, Tübingen 2022, 797-828.
3Der JohannesprologJohannesprolog als TürTür bzw. Raum (Metaphorik) in die Sinnwelt des Johannesevangeliums
„Die noch ungeschriebenen, ums Geborenwerden ringenden Kapitel sollten sich im Keimbett der gewählten Anfangsworte schon erahnen lassen.“
Irene Valejo1
Der JohannesprologJohannesprolog ist ein anspruchsvoller Text. An seiner Auslegung scheiden sich die Geister, hier werden oftmals methodische und hermeneutische Vorentscheidungen getroffen, die die Auslegung des gesamten Evangeliums beeinflussen. Die Verse des Johannesprologs haben provoziert und provozieren weiter. Und sie stellen vor die Aufgabe, die steilen Aussagen dieses Prologs so zu verstehenverstehen (s. auchwissen, erkennen), wie sie der Verfasser zu verstehen gegeben hat. Der Evangelist JohannesJohannes (Evangelist) öffnet in den einleitenden Versen seines Evangeliums in genialer Weise die TürTür bzw. Raum (Metaphorik), durch die die Hörenden und Lesenden in das Haus des Evangeliums treten (zur johanneischen Türmetapher vgl. die Hirtenrede in Joh 10,1-18Joh10,1-18). Im Durchgang durch diese Tür erhalten die Hörenden und Lesenden die Zurüstung, die sie brauchen, um sich Gottes Kunde (vgl. das letzte Wort im PrologProlog (s. auchJohannesprolog): 1,18Joh1,18: „er hat Kunde gebracht“ [ἐξηγήσατο]),ἐξηγέομαι die seiner ganzen SchöpfungSchöpfung gilt (vgl. Joh 3,16Joh3,16), schrittweise und vertiefend als glaubende und liebende Kinder Gottes anzueignen. Diese These soll im Folgenden ausgeführt und begründet werden.
Die Deutung des Johannesprologs bezieht sich im Folgenden auf den vorliegenden, kanonischen Text in den Versen 1,1-18Joh1,1-18 (= synchrone Analyse und Interpretation). Damit wird eine traditionsgeschichtliche Entwicklung dieses Prologs nicht in Abrede gestellt (= diachrone Analyse und Interpretation). So rechnet ein Rekonstruktionsversuch mit einem vorjohanneischen Hymnus, der maßgeblich von frühjüdischer Weisheitstheologie geprägt ist. Methodisch ist es im ersten Schritt geboten, den Text in seinem vorliegenden Zusammenhang zu betrachten, zu analysieren und zu interpretieren. Erst auf dieser Grundlage ist nach Textsignalen zu fragen, die eine Wachstumsgeschichte plausibel machen (zur Gefahr von Zirkelargumentationen vgl. 4.1).
3.1Testbeobachtungen und Gedankengang
Joh 1,1Joh1,1
Im Anfang (ἐν ἀρχῇἀρχή) war das Wort,
und das Wort war bei Gott
und das Wort war Gott.
Joh 1,18Joh1,18
Niemand hat Gott je gesehen;
der einzig geborene Gott (der einzig geborene, der Gott ist) (μονογενὴς θεὸς),θεός
der an der Brust des Vaters ist, jener hat ausgelegt:
Der erste und der letzte Vers des Prologs bilden einen Rahmen: Sie sprechen von der Würde und Größe des „Wortes“ (λόγοςλόγος), das von allem Anfang an „bei Gott“ existiert, selbst „Gott ist“ und aus intimster BeziehungBeziehung (Relation) heraus „Kunde gebracht hat“. Das letzte Wort im Vers 18Joh1,18 „verkündigen / Kunde bringen / auslegen (ἐξηγήσατο)“ἐξηγέομαι weist den „Einziggeborenen“ als Gottes „Ausleger“, als Gottes „Exegeten“ aus: Die verbindliche und abschließende „Auslegung“ Gottes geschieht im sich anschließenden Hauptteil des Johannesevangeliums. Deshalb ist es sachgemäß, Vers 18 in den Übersetzungen mit einem Doppelpunkt enden zu lassen.1
Mit den ersten beiden Wörtern seines Evangeliums „Im Anfang …“ (ἐν ἀρχῇἀρχή) wiederholt der Evangelist die ersten beiden Wörter der Heiligen Schrift Israels in Gen 1,1Gen1,1 Septuaginta. Das ist kein Zufall, sondern signalisiert allen jüdischen bzw. gebildeten Adressaten, in welche Tradition sich der Evangelist bewusst stellt und welche kosmische (!) Reichweite sein Evangelium beansprucht. Dieses Anliegen greifen die schöpfungstheologischen Aussagen in Versen 2-3Joh1,2-3 ausführlich und vertiefend auf.
Der neben Gott neu eingeführte und ihm zugeordnete Akteur ist „das Wort“ (ὁ λόγοςλόγος). Diesem wird zugesprochen, dass es selbst „Gott“ ist (vgl. die WiederholungWiederholung(-en) dieser Zuschreibung in Vers 18). Sprachlich wird hier wie in Vers 18Joh1,18 der bestimmte Artikel „der (Gott)“ bewusst vermieden. Es geht im Vers 1Joh1,1 um Unterscheidung und Zuordnung von „Gott“ und „dem Wort“. Dabei wird die Göttlichkeit des „Wortes“ ausdrücklich betont und näher bestimmt. Diese Verhältnisbestimmung von „Gott“ und „Wort“ wird im ganzen Evangelium weiterverfolgt, vertieft und ausgeleuchtet.
Jan G. van der Watt diskutiert intensiv die grammatikalischen und syntaktischen Fragen, die sich zum Vers 1,1Joh1,1 stellen: Für die Annahme, hier handele es sich um ein Rätsel, kann er keine grammatikalischen oder syntaktischen Anhaltspunkte finden. Dafür verweist er auf eine bedeutende theologische und hermeneutische Schlussfolgerung:
„No final decision on the ‚correct‘ reading is really possible, as re-reading and re-thinking in light of the rest of the Gospel seems to be invited. At first reading, one is not supposed to understand fully what is going on, and is left guessing: but, as the Gospel unfolds, the meaning becomes more transparent.“2
Diese Beobachtungen zeigen, dass der Evangelist schon im und mit dem ersten Vers seines Evangeliums (!) seine Leser und Leserinnen zu einem Verstehensweg einlädt, der sich schrittweise in der rekursiven Lektüre des Prologs bzw. des ganzen Evangeliums erschließt (vgl. hierzu weiterführend 3.2; 3.3; 4.6).
Die Frage drängt sich auf: Bricht der Evangelist gleich im ersten Vers mit seiner biblischen Tradition, mit dem ersten grundlegenden Gebot des Dekalogs? Ist der MonotheismusMonotheismus aufgegeben? Schon im ersten Vers, dann in den weiteren Versen des Prologs und im gesamten Evangelium arbeitet der Evangelist daran zu zeigen, dass und wie seine steilen christologischen Aussagen den Monotheismus wahren (insbesondere durch die reziproken EinwohnungsaussagenEinwohnungsaussagen (s. auchImmanenz) zwischen Vater und Sohn3 (vgl. 5.5; 5.9). Dazu bezieht sich der Evangelist mit dem Begriff λόγοςλόγος sowohl auf die biblischen Aussagen über Gottes wirkmächtiges Schöpfer-Wort als auch auf die in frühjüdischen Schriften personifizierte Weisheit (vgl. bes. Sprüche 8Spr8).4 Gleichzeitig nimmt er bewusst Rekurs auf die in den zeitgenössischen philosophischenPhilosophie, philosophisch Schulen (bes. Seneca, Plutarch, Dion von Prusa, Epiktet) diskutierte Rolle des LogosLogos, logos. Der Evangelist schöpft aus seiner biblischen Tradition, in der er steht, und sucht zugleich das Gespräch mit den zeitgenössischen Philosophien auf der Höhe der ZeitZeit.5 Dies hat weitreichende Konsequenzen für die Auslegung des JohannesevangeliumsForschungsgeschichte (Johannesevangelium):
„Die philosophische Interpretation des Johannesevangeliums ist nicht nur eine Ergänzung der bisherigen Methoden und Fragestellungen, sondern sie verändert unsere Wahrnehmung der Texte: Sie sind nicht nur religiöse, sondern auch denkerische Leistungen, die Menschen damals wie heute unmittelbar ansprechen.“6
Mit dieser doppelten Dialogsituation steht der Evangelist wiederum in seiner biblischen Tradition, denn diesen Dialog führen die Autoren frühjüdischer Schriften der hellenistischen ZeitZeit seit Langem und in aller Ausführlichkeit (vgl. nur: Weisheit, Septuaginta, Philo). Dieser johanneische Diskurs, der mit der zentralen Verwendung des Stichwortes λόγοςλόγος im ersten Vers eröffnet wird, belegt die denkerische Kraft des Evangelisten und das hermeneutische Potential seiner Sprache und TheologieTheologie. Für die johanneische Intention ist es entscheidend, zu sehensehen und zu verfolgen, wie der Evangelist den polyvalenten Begriff λόγος beginnend in Vers 1Joh1,1 und dann schrittweise fortführend inhaltlich bestimmt und damit neu codiert.
Die für das Stichwort λόγοςλόγος angeführten interkulturellen Bezüge lassen sich analog auch für eine ganze Reihe weiterer zentraler johanneischer Leitwörter aufzeigen und vertiefen. Das gilt beispielsweise für die im PrologProlog (s. auchJohannesprolog) vorkommenden Begriffe: „Lebenleben, Leben“7, „Welt“, „LichtLicht, Lichtmetaphorik / FinsternisFinsternis“8, „ZeugeZeuge, Zeugnis, Zeugnis“, „WahrheitWahrheit“9, „HerrlichkeitHerrlichkeit (doxa)“10 und weitere Begriffe im Johannesevangelium: „GeistGeist (pneuma), Paraklet (parakletos)“11, „ZeichenZeichen“12, „FreimutFreimut (parresia), Offenheit“13.
Joh 1,2-3Joh1,2-3
1,2Joh1,2
Dieses war im Anfang (ἐν ἀρχῇἀρχή) bei Gott.
1,3Joh1,3
Alles ist durch dieses geschaffen worden (ἐγένετο),
und ohne dieses wurde nichts geschaffen (ἐγένετο),
was geschaffen worden ist (ὅ γέγονεν).
Dem göttlichen „Wort“ wird – in Weiterführung des poetisch-hymnischen Satzbaus aus Vers 1Joh1,1 – die Schöpfungsmittlerschaft zugeschrieben. Diese Aussage setzt die PräexistenzPräexistenz, präexistent des „Wortes“ vor der SchöpfungSchöpfung zwingend voraus (vgl. auch 5.1). Das schöpferische WerkWerk, wirken, das nur durch göttliche Kräfte möglich ist, wird ausdrücklich für das „Wort“ monopolisiert: Neben und an dem „Wort“ vorbei gibt es keine geschöpfliche Wirklichkeit. Ausnahmslos „alles (= alle Dinge)“ verdankt seine Existenz dem schöpferischen Wirken des „Wortes“. Dieses schöpferische Wirken des „Wortes“ widerspricht kategorisch jedem kosmologischen DualismusDualismus und fügt sich grundlegend ein in die biblische Schöpfungstheologie, die von dem einen und einheitlichen Schöpferwillen, dem sich die Schöpfung verdankt, ausgeht. In den Versen 2-3Joh1,2-3 wird der vielschichtige, polyvalente Begriff λόγοςλόγος in einem zweiten Schritt näher als göttlicher Schöpfungsmittler bestimmt.
Joh 1,4-5Joh1,4-5
1,4Joh1,4
In ihm war Leben,leben, Leben
und das Lebenleben, Leben war das LichtLicht, Lichtmetaphorik der Menschen.
1,5Joh1,5
Und das LichtLicht, Lichtmetaphorik scheint in der FinsternisFinsternis
und die FinsternisFinsternis hat es nicht erfasst (οὐ κατέλαβεν)καταλαμβάνω.
Joh 1,9-10Joh1,9-10
1,9Joh1,9
Es war das wahre Licht,Licht, Lichtmetaphorik
das alle Menschen erleuchtet,
kommend in die Welt.
1,10Joh1,10
Er war in der Welt
und die Welt wurde durch ihn geschaffen (ἐγένετο);
aber die Welt erkannte ihn nicht.
Die Verse 4-5Joh1,4-5 und 9-10Joh1,9-10, die die Verse 6-8Joh1,6-8 über die SendungSendung des Täufers als ZeugeZeuge, Zeugnis „des Wortes“ rahmen, bringen mit den Begriffen „Lebenleben, Leben“ sowie der Opposition „LichtLicht, Lichtmetaphorik“ und „FinsternisFinsternis“ zwei neue Motive ins ‚Spiel‘, die ebenfalls über ein hohes hermeneutisches Potential verfügen, weil sie zusätzlich zu den biblischen Bezügen viele archetypische bzw. kulturgeschichtliche Anknüpfungspunkte bieten. Über die Schöpfungsmittlerschaft im engeren SinneSinne, Sinneswahrnehmung hinausgehend werden in diesen Versen dem „Wort“ weitere Eigenschaften zugesprochen: Es trägt – absolut formuliert – „(das) Leben“ in sich. Damit ist ein soteriologischer Zentralbegriff angesprochen (vgl. Joh 10,10Joh10,10), der ökumenisch (im ursprünglichen Wortsinn: die ganze bewohnte Welt umfassend) Kulturen übergreifend und sie verbindend verstanden wird. Mit dem weiterführenden Hinweis, dass dieses Leben „das Licht der Menschen“ war und „alle Menschen erleuchtet“, wird das universale, in der ganzen SchöpfungSchöpfung gegenwärtige und heilstiftende Wirken des „Wortes“ ausgesagt.
Die Verse zur LichtLicht, Lichtmetaphorik-FinsternisFinsternis-MetaphorikMetaphorik14 bleiben – wie schon die Verse 1-3Joh1,1-3 zuvor – in gewisser Hinsicht rätselhaft: Wer oder was genau mit dem „Wort“ gemeint ist, wo und wie sich „das Lebenleben, Leben“ und „das Licht“ bzw. „die Finsternis“ in der Menschheitsgeschichte zeigen, das wird in den genannten Versen selbst nicht weiter präzisiert. Einen wichtigen Hinweis geben dann die folgenden Verse 6-8Joh1,6-8 zu JohannesJohannes (Evangelist), dem Täufer.
Zunächst einmal werden die Hörenden und Lesenden mit einer neuen, nämlich kritischen Botschaft konfrontiert, die in den weitgehend parallel gebauten Versen variierend und umschreibend festgehalten wird:
1,5Joh1,5 … und die FinsternisFinsternis hat es nicht erfasst15 (οὐ κατέλαβεν)καταλαμβάνω
und
1,10Joh1,10 … aber die Welt erkannte ihn nicht (αὐτὸν οὐκ ἔγνω)
Während Vers 5Joh1,5 offener formuliert, konkretisiert Vers 10Joh1,10, was gemeint ist. Verse 4-5Joh1,4-5 bleiben inbleiben (in)nerhalb der LichtLicht, Lichtmetaphorik-FinsternisFinsternis-MetaphorikMetaphorik, Verse 9-10Joh1,9-10 variieren die Aussage in Bezug auf „das Wort“, das von der „Welt“ (κόσμοςκόσμος) „nicht erkannt“ wurde, obwohl – die Lesenden bzw. Hörenden hatten es unmittelbar zuvor gehört bzw. gelesen – das „Wort“ „die Welt“ doch geschaffen und damit ins Lebenleben, Leben gerufen hat. In den Versen 4-5Joh1,4-5 noch verdeckt und in den Versen 9-10Joh1,9-10 klarer formuliert wird ein Konflikt, der in der LichtLicht, Lichtmetaphorik-FinsternisFinsternis-MetaphorikMetaphorikfür sich allein betrachtet noch dualistisch gedeutet werden könnte: Tatsächlich besteht der Konflikt darin, dass der Schöpfungsmittler von seiner eigenen SchöpfungSchöpfung „nicht erkannt“ wird. Damit bekommt der gerade nicht-dualistische Konflikt einen tragischen Grundzug, der schon in diesen Versen die im Evangelium wiederholt umschriebene und ausgeleuchtete Ablehnung Jesu präfiguriert.
Im Vers 1,11Joh1,11 wird die zweimalige Negation (in den Versen 5Joh1,5 und 10Joh1,10), das doppelte Scheitern, ein drittes Mal variierend und vertiefend aufgenommen:
Joh 1,11Joh1,11
Er kam in sein Eigen(-tum);
und die Eigenen nahmen ihn nicht auf (οἵ ἴδιοιἴδιος αὐτὸν οὐ παρέλαβονπαραλαμβάνω).
Der Evangelist entwickelt in dieser dreifach variierten Sinnlinie sein Programm: Im „nicht erfassenerfassen“ (Vers 5Joh1,5), im „nicht erkennenerkennen (s. auchwissen)“ (Vers 10Joh1,10) und im „nicht aufnehmenaufnehmen“ (Vers 11Joh1,11) wird in sich steigernder Konkretion der Widerstand bzw. das Nicht-zum-Ziel-Kommen der SendungSendung des „Wortes“ dramatisch vor Augen geführt. Diese Beobachtung, dass sich offenere Aussagen im Verlauf des Prologs schrittweise zu konkreteren Aussagen verdichten, lässt sich an vielen Stellen des JohannesprologsJohannesprolog beobachten. Das ist kein Zufall, sondern Absicht: Die sprachlich-stilistischen und semantischen Textbeobachtungen zeigen die Leserführung durch den Evangelisten auf und führen zu seiner theologischen Aussageabsicht.
Joh 1,11-13Joh1,11-13
1,11Joh1,11
Er kam in sein Eigen(-tum) (εἰς τὰ ἴδιαἴδιοςἴδιος ἦλθεν),
und die Eigenen (οἵ ἴδιοιἴδιοςἴδιος) nahmen ihn nicht auf (αὐτὸν οὐ παρέλαβονπαραλαμβάνω).παραλαμβάνω
1,12Joh1,12
Welche ihn aber (auf-)nahmen (ὅσοι δὲ ἔλαβονλαμβάνωλαμβάνω αὐτόν),
denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden (γενέσθαι),
denen, die an seinen Namen glauben,glauben
1,13Joh1,13
die nicht aus Blut
noch aus dem Willen des Fleisches
noch aus dem Willen eines Mannes,
sondern aus Gott gezeugtaus Gott gezeugt sein wurden (ἐκ θεοῦθεός ἐγεννήθησαν).
Die in Versen 4-5Joh1,4-5 anklingende und in Versen 9-10Joh1,9-10 konkreter beschriebene Konfliktsituation wird in den Versen 11-13Joh1,11-13 in zwei weiteren Bildsprachen, der FamilienmetaphorikFamilienmetaphorik und der Zeugungsmetaphorik, erneut aufgegriffen und vertieft: „Das Wort“ kommt „in sein Eigen(-tum)“, d. h. zu sich nach Hause, zu den „Eigenen (= Seinen)“, zu denen es von allem Anfang an gehört, weil es sie ins Lebenleben, Leben gerufen hat (vgl. 1,1-3Joh1,1-3). Gerade von den „Eigenen“ wird „das Wort“ jedoch „nicht aufgenommen“. Die schon angesprochene Tragik wird familienmetaphorisch variiert und zugespitzt.
Vielfach übersehen wird die RahmungRahmung (s. auchframe, Refraiming) bzw. der Spannungsbogen im Johannesevangelium durch die Wiederaufnahme von „in sein Eigen[-tum] (εἰς τὰ ἴδιαἴδιοςἴδιος) kommen“ und „aufnehmenaufnehmen (παραλαμβάνωπαραλαμβάνω]“ (bzw. „nicht aufnehmen“) aus Joh 1,11Joh1,11 in Joh 19,27Joh19,27 („und von jener Stunde an nahm [ἔλαβεν]λαμβάνω der JüngerJünger, Jüngerinnen sie in sein Eigen [εἰς τὰ ἴδιαἴδιος] auf“). Die Übersetzungen „Von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich“16, „und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich“17 und „von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich“18 verstellen den vom Evangelisten betonten Brückenschlag und die damit verbundene Aussageabsicht.19 In Joh 19,27Joh19,27 geht es dem Evangelisten um viel mehr als die Versorgung der Mutter Jesu nach dem Tod ihres Sohnes!
Die Zeugungsmetaphorik im Johannesevangelium (vgl. neben 1,12-13Joh1,12-13 besonders 3,1-12Joh3,1-12) hat Ursula Ulrike Kaiser in ihrer Monographie neu durchleuchtet:20
„Dass die ‚von oben‘ Gezeugten als solche auch Handelnde sind und sich in Entsprechung zu ihrem göttlichen Ursprung aktiv verhalten können (und sollen), wird aus dem Zusammenhang der Zeugungsmetaphorik in Joh 3,3-8Joh3,3-8 mit jener in Joh 1,13Joh1,13 und der dortigen Verbindung mit Joh 1,12Joh1,12 deutlich (…). Ihre ZeugungGeburt, Zeugung (Metaphorik) ‚von oben‘, ‚aus GeistGeist (pneuma), Paraklet (parakletos)‘ bzw. ‚aus Gott‘ können sie aber nicht selbst bewirken, sondern nur im Nachhinein erkennenerkennen (s. auchwissen).“21
Die fünf Verben „(nicht) erfassenerfassen“, „(nicht) erkennenerkennen (s. auchwissen)“ und „(nicht) aufnehmenaufnehmen“, „(nicht) glaubenglauben“ und „(nicht) aus Gott gezeugt seinaus Gott gezeugt sein“ gehören – in Verneinung wie in Bejahung – zur semantischen Achsesemantische Achse22 des JohannesevangeliumsForschungsgeschichte (Johannesevangelium).23 Der Evangelist JohannesJohannes (Evangelist) öffnet damit ein Fenster in das Keimbett seiner sprachlichen, semantischen und theologischen Arbeit: Die SendungSendung des „Wortes“ „in sein Eigen(-tum)“ führt zu positiven wie negativen Antworten bzw. Reaktionen mit dramatischen bzw. tragischen Zügen einerseits und überreich geschenkter GnadeGnade (vgl. 1,16Joh1,16) andererseits.
Verse 12-13Joh1,12-13 formulieren dann erstmals die gegenteilige, nämlich positive Möglichkeit, auf das Kommen des „Wortes“ „in sein Eigen(-tum)“ zu reagieren: die „Aufnahme“ des Wortes. Dieser Weg führt dazu, „Kinder Gottes zu werden“. Inhaltlich näher bestimmt bzw. variierend umschrieben wird die „Aufnahme“ des „Wortes“ als „an seinen Namen glaubenglauben“ und als „aus Gott gezeugt seinaus Gott gezeugt sein“. Damit wird ein fünftes Verb der semantischen Achsesemantische Achse auf der Positivseite zugeführt – neben „erfassenerfassen“, „erkennenerkennen (s. auchwissen)“, „aufnehmenaufnehmen“ und „aus Gott gezeugt sein“ auch „glauben“.
Das Verb „glaubenglauben“ avanciert im Verlauf des Evangeliums zu dem zentralen Leitbegriff für die Antwort des Menschen auf die SendungSendung des „Wortes“ in die von ihm ins Lebenleben, Leben gerufene SchöpfungSchöpfung. Dies wird überdeutlich in der bilanzierenden Schlusssentenz des Evangeliums:
Joh 20,30-31Joh20,30-31
20,30Joh20,30
Noch viele andere ZeichenZeichen hat Jesus vor seinen Jüngern getan,
die nicht geschrieben sind in diesem Buch.Buch
20,31Joh20,31
Diese aber sind geschrieben damit ihr glaubt,
dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes,
und damit ihr als Glaubende Lebenleben, Leben habt in seinem Namen.24
Zugleich – und dies ist bereits im PrologJohannesprologProlog (s. auchJohannesprolog) grundgelegt und wird im Hauptteil erheblich weiter entfaltet – wird die johanneische Interpretation von „glaubenglauben“ bleibend und wechselseitig von den im JohannesprologJohannesprolog zielsicher geclusterten Verben semantisch mitgeprägt. Der Evangelist zeigt sich hier und durchgehend im Johannesevangelium als Meister der sich wechselseitig auslotenden semantischen Sinndimensionen.
Verse 11-13Joh1,11-13 formulieren – zusammen mit den vorausgegangenen offeneren Varianten – eine semantische Sinnlinie bzw. Achse, die das ganze Johannesevangelium sprachlich und sachlich durchzieht. Der gesamte Konflikt und Prozess Jesu, der im Hauptteil des Johannesevangeliums vielfältig entfaltet wird, wird hier präfiguriert und vorausgreifend gedeutet. Dies lässt sich beispielsweise auch an der johanneischen Verwendung von „aufnehmenaufnehmen“ im gesamten Evangelium aufzeigen.25
Joh 1,14Joh1,14
Und das Wort wurde Fleisch und hat unter uns gewohnt,
und wir haben seine HerrlichkeitHerrlichkeit (doxa) gesehen,
eine HerrlichkeitHerrlichkeit (doxa) wie die des einziggezeugten (Sohnes) / des einzigen Sohnes (μονογεοῦς) vom Vater,
voller GnadeGnade und WahrheitWahrheit.
Joh 1,16-17Joh1,16-17
Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen (ἐλάβομεν)λαμβάνω GnadeGnade über Gnade.
Denn das GesetzGesetz (nomos) wurde durch MoseMoses gegeben,
die GnadeGnade und die WahrheitWahrheit sind durch Jesus Christus geschaffen worden (ἐγένετο).
In Vers 14Joh1,14 wird ein weiteres, sechstes Verb zur semantischen Achsesemantische Achse hinzutreten: „Wir haben seine HerrlichkeitHerrlichkeit (doxa)gesehen (ἐθεασάμεθαθεάομαιθεάομαι)“. Das „Sehen“ bzw. „Nicht-Sehen“ wird im Hauptteil des Johannesevangeliums umfangreich entfaltet, vielfach angereichert und wiederum mit neuen semantischen Bezügen und Kontexten – z. B. die Integration von Sinneswahrnehmungen insgesamt – verwoben (vgl. 4.5).
In den Versen 14Joh1,14 und 16-17Joh1,16-17 setzt der Evangelist in explizit theologischer und doxologischer Sprache die heilsgeschichtliche Konkretion dessen fort, was zuvor schon mehrfach metaphorisch umschrieben wurde: Vers 14Joh1,14 spricht expressis verbis von der FleischwerdungFleischwerdung (s. auchInkarnation) (= InkarnationInkarnation) des „Wortes“, das als „einziggezeugter Sohn“ des „Vaters“ identifiziert wird und dem göttliche HerrlichkeitHerrlichkeit (doxa) zugeschrieben wird. Vers 17Joh1,17 identifiziert diesen „einziggezeugten Sohn“ mit „Jesus Christus“. Die den ganzen JohannesprologJohannesprolog prägende schrittweise EntschlüsselungEntschlüsselung (Decodierung) der zunächst unbestimmteren Aussagen findet in den Versen 14-17Joh1,14-17 ihren Höhepunkt: Der göttliche LogosLogos, logos, der präexistentePräexistenz, präexistent Schöpfungsmittler, dem alle SchöpfungSchöpfung ihre Existenz, „LichtLicht, Lichtmetaphorik“ und „Lebenleben, Leben“ verdankt, wird „Fleisch“, also im Vollsinn MenschMensch, Menschenbild (s. auchAnthropologie) und mit dem Namen Jesus Christus als konkrete Person identifiziert.
In der Johannesforschung wird die Beobachtung, dass der Begriff λόγοςλόγος nach dem Vers 1,14Joh1,14 im gesamten Johannesevangelium nicht mehr für Jesus Christus verwendet wird, Fragen auf: Legen sich literarkritische Schlussfolgerungen nahe? Hier sei die folgende Erklärung vorgetragen: Das Sinnziel der ver- und entschlüsselnden Verwendung von λόγοςλόγος in den VV 1-13Joh1,1-13 ist mit Vers 1,14Joh1,14 erreicht: die Identifikation des λόγοςλόγος mit der Person Jesus Christus. Ab dem Vers 1,14Joh1,14 steht die auf diese Weise vorgestellte und eingeführte Person Jesus Christus im Fokus der johanneischen Erzählwelt. In ihm konkretisiert und personalisiert sich Gottes Heil für seine Geschöpfe und seine ganze SchöpfungSchöpfung.
Die SendungSendung Jesu Christi trifft einerseits auf tragische und folgenreiche Ablehnung, andererseits aber auch auf Aufnahme bzw. Glauben. Dieser Glaube führt in die Gemeinschaft der Kinder Gottes zum Gotteslob.
Charakteristisch für den JohannesprologJohannesprolog ist die durchgehend zugrundeliegende EinheitEinheit, „eins sein“ des Heils- und Offenbarungshandelns Gottes.26 Joh 1,17Joh1,17 ist nicht antithetisch zu interpretieren:
„Beide Sätze sind ohne ein aber nebeneinandergestellt, und die Passivformulierung wurde gegeben umschreibt hier, wie oft, ein Handeln Gottes. Die OffenbarungOffenbarung Gottes im GesetzGesetz (nomos) und in Jesus Christus werden einander zugeordnet und nicht entgegengesetzt.“27
Hier ist eine hartnäckige, antijüdische Auslegungstradition zu korrigieren (vgl. hierzu ausführlich auch die Ausführungen in 5.3).
Mit dem viermal verwendeten Begriff „GnadeGnade“ in V 14Joh1,14, V 16Joh1,16 („Gnade über Gnade“) und V 17Joh1,17 sowie dem passivum divinum in V 17aJoh1,17 („Denn das GesetzGesetz (nomos) wurde durch MoseMoses [von Gott] gegeben“) und der Fortsetzung in V 17bJoh1,17 („die Gnade und die WahrheitWahrheit sind durch Jesus Christus geschaffen worden“) akzentuiert der Evangelist die Prärogative, Ungeschuldetheit und Unverfügbarkeit der Heilszuwendung Gottes in Kontinuität zu seiner biblischen Tradition. Es ist in der Auslegungsgeschichte umstritten, ob und gfs. inwieweit mit der göttlichen Gnadenzuwendung die antwortende Reaktion des Menschen bereits im göttlichen Gnadenhandeln vorhergesehen und damit vorherbestimmt ist (= PrädestinationPrädestination), also losgelöst ist von einer freien Antwort der angesprochenen Menschen. Der PrologProlog (s. auchJohannesprolog) – so die hier vertretene Auffassung – verritt eine großartige In-Szene-Setzung des unverfügbaren und ungeschuldeten göttlichen Heilswillens und Heilsplans, aber keine vom Menschen losgelöste Vorherbestimmung in einem absoluten Sinn. Dann wäre in letzter Konsequenz die werbende Einladung des Evangelisten zum Glauben an Jesus Christus, zur NachfolgeNachfolge und zur Liebelieben, Liebe obsolet und geradezu selbstwidersprüchlich.
Joh 1,6-8Joh1,6-8
1,6Joh1,6
Es trat ein Mensch auf (ἐγένετο),
von Gott gesandt,
seinsein (in) Name (war) Johannes.Johannes (Evangelist)
1,7Joh1,7
Dieser kam zum Zeugnis,Zeuge, Zeugnis
um ZeugnisZeuge, Zeugnis zu geben für das Licht,Licht, Lichtmetaphorik
damit alle durch ihn zum Glauben kommen.
1,8Joh1,8
Jener war nicht das Licht,Licht, Lichtmetaphorik
sondern er sollte ZeugnisZeuge, Zeugnis geben für das Licht.Licht, Lichtmetaphorik
Joh 1,15Joh1,15
JohannesJohannes (Evangelist) gibt ZeugnisZeuge, Zeugnis für ihn und rief:
Dieser war es, von dem ich gesagt habe:
Der nach mir Kommende ist vor mir geschaffen worden (γἐγονεν),
denn er war eher als ich.
An zwei Stellen im JohannesprologJohannesprolog wird das ZeugnisZeuge, Zeugnis JohannesJohannes (Evangelist) des Täufers eingeführt und reflektiert. Mitunter werden diese Verse als sekundäre Erweiterungen bzw. nachträgliche Einschübe durch einen Redaktor klassifiziert. Diese Annahme wird mit verschiedensten literarkritischen Theorien zur Traditionsgeschichte des Johannesprologs und des gesamten Johannesevangeliums verbunden. Diese Diskussion kann hier nicht im Einzelnen geführt werden. Unabweisbar ist jedoch, dass die Verse 6-8Joh1,6-8 ebenso von der Licht-Metaphorik Licht, Lichtmetaphorik geprägt sind wie die diese Verse rahmenden Verse 4-5Joh1,4-5 und 9-10Joh1,9-10. Der Vers 15Joh1,15 ergänzt und bestätigt die zeitgeschichtliche Verortung des Kommens und der FleischwerdungFleischwerdung (s. auchInkarnation) des Wortes sowie die sich offenbarende Größe und HerrlichkeitHerrlichkeit (doxa) dessen, der von allem Anfang an die Seite Gottes gehört. Zur SendungSendung Jesu gehört von Beginn an das Zeugnis Johannes des Täufers, des Freundes des Bräutigams (vgl. ausführlich in Joh 1,19-51Joh1,19-51; 3,22-36Joh3,22-36), der nicht selbst „das Licht“ ist, sondern „Zeugnis gibt für das Licht“.
Das ZeugnisZeuge, Zeugnis-Motiv wiederum wird im Johannesevangelium durchgehend entfaltet. Es ist ein elementarer Bestandteil der juristischen BildweltBildwelt(-en) (s. auchMetaphorik) im Johannesevangelium und besitzt ebenfalls eine hohes kommunikatives und interkulturelles Potential. Gerade am Beispiel JohannesJohannes (Evangelist) des Täufers betont Ruben Zimmermann die kohärente narrative Strategie, die der Evangelist sowohl im PrologProlog (s. auchJohannesprolog) als auch im Hauptteil des Evangeliums verfolgt: Johannes der TäuferJohannes der Täufer wird als „Türöffner (gatekeeper)“ (vgl. Joh 10,3Joh10,3) und „FreundFreund, Freundschaft“ des „Bräutigams“ (Joh 3,29-30Joh3,29-30) vorgestellt.28Ruben Zimmermann zitiert Catrin H. Williams zustimmend:
„… John is characterized as a connecting link … between heavenly and earthly, the eternal and the historical, the old and the new.“29
„… he emerges at a point of transition – both spatialy (in the wilderness) and chronologically (on the first day) … His legacy as a character is that he fulfills a bridge-like role.“30
Am Beispiel Johannes des TäufersJohannes der Täufer, der seinen ZeugnisZeuge, Zeugnis-Auftrag vorbildlich erfüllt, veranschaulicht der Evangelist beginnend im PrologProlog (s. auchJohannesprolog) und weiter ausgeführt in Joh 1,19-51Joh1,19-51 und 3,22-26Joh3,22-26 zudem einen Auftrag, der für alle Glaubenden gilt: Alle Glaubende sollen hineinwachsen in ihre Aufgabe, mündige Zeugen für Jesus Christus zu sein bzw. zu werden (vgl. Joh 5Joh5; 9Joh9). So gesehen gehört das „Zeugnis geben“ der Glaubenden in der NachfolgeNachfolge dessen, der selbst „Zeuge“ ist und „Zeugnis ablegt“, mit hinein in die semantisch verketteten Verben der semantischen Achsesemantische Achse des Johannesevangeliums. Mit anderen Worten: „Zeugnis geben“ ist ein weiteres inhärentes Moment der „Aufnahme“ bzw. des „Glaubens“ an Jesus Christus (vgl. 5.10).
3.2VerschlüsselungVerschlüsselung (Codierung), EntschlüsselungEntschlüsselung (Decodierung) und NeuverschlüsselungNeuverschlüsselung (Neucodierung)
Die Textbeobachtungen zum Gedankengang in Joh 1,1-18Joh1,1-18 im vorausgehenden Kapitel zeigen sehr deutlich: Den Lesenden werden in diesen achtzehn Versen Prozesse der VerschlüsselungVerschlüsselung (Codierung) (= Codierung), der EntschlüsselungEntschlüsselung (Decodierung) (= Decodierung) und der NeuverschlüsselungNeuverschlüsselung (Neucodierung) (= Neucodierung) als literarische Stilmittel in theologischer Absicht anschaulich vor Augen geführt.
VerschlüsselungVerschlüsselung (Codierung)
JohannesJohannes (Evangelist) startet sein Evangelium mit einer VerschlüsselungVerschlüsselung (Codierung): Er weiß genau, von wem und über wen er in seinem Evangelium sprechen will. Dazu wählt er einen geistes- und kulturgeschichtlich vertrauten griechischen Begriff: logos. Bei aller Vieldeutigkeit dieses Begriffs für hellenistische und jüdische Leserinnen und Leser, philosophischePhilosophie, philosophisch und/oder weisheitstheologische Konnotationen sind diesem Begriff inhärent: Wer vom logos in einem emphatischen Sinn spricht, hat die großen philosophischen Grundsatzfragen im Blick.
Diese im ursprünglichen Sinn ökumenische Reichweite des Begriffs logos macht sich der Evangelist zu eigen: Die Adressaten seines Evangeliums sind zwar nach dem Ausschluss aus der Synagogengemeinschaft im doppelten SinneSinne, Sinneswahrnehmung eine Minderheit im Römischen Reich. Die Botschaft, die der Evangelist verkündet, hat jedoch eine erlösende Reichweite für die ganze bewohnte Welt (= die Oikumene).
EntschlüsselungEntschlüsselung (Decodierung)
Der JohannesprologJohannesprolog führt in seiner sprachlichen und stilistischen Leserführung einen schrittweisen Erkenntnisprozess vor Augen, der zum Zentrum des Evangeliums hinführt: der FleischwerdungFleischwerdung (s. auchInkarnation) des göttlichen LogosLogos, logos, der als Schöpfungsmittler und als Inkarnierter „Lebenleben, Leben“ und „LichtLicht, Lichtmetaphorik“ in der Gemeinschaft der Kinder Gottes denen schenkt, die ihn „aufnehmenaufnehmen“, d. h. an ihn glaubenglauben. Vom Vers 1 bis zum Vers 17Joh1,1-17 läuft eine schrittweise Entschleierung bzw. EntschlüsselungEntschlüsselung (Decodierung), wer dieser zunächst nicht näher bestimmte logos ist: Vers 17Joh1,17 identifiziert ihn mit Jesus Christus.
NeuverschlüsselungNeuverschlüsselung (Neucodierung)
Gleichzeitig mit dieser schrittweisen EntschlüsselungEntschlüsselung (Decodierung) (= Decodierung) nimmt der Evangelist auch eine schrittweise NeucodierungNeuverschlüsselung (Neucodierung) vor: Für jüdische Hörende und Lesende ebenso wie für philosophischPhilosophie, philosophisch gebildete Zeitgenossen wird mit dem Begriff logos jeweils eine Schlüsselkategorie und der mit dieser Schlüsselkategorie verbundene Verstehensrahmen (frameframe (s. auchRefraiming)) assoziiert. Der Evangelist greift dieses kulturelle Wissen auf und geht mit seiner Identifizierung des logos mit Jesus Christus über vorfindliche Konzepte hinaus: Das gilt (jeweils in unterschiedlicher Weise) für die frühjüdische Weisheitsspekulation ebenso wie für die verschiedenen Rollen des logos in der zeitgenössischen PhilosophiePhilosophie, philosophisch.
Daraus ergibt sich die Frage, ob die Hörer und Leser des Johannesprologs diesen Weg mitgehen können und wollen. Die Einladung dazu spricht der Evangelist in der von ihm gewählten Gestalt des Prologs unzweideutig aus. Gleichzeitig weiß er um die zurückliegende Zurückweisung und Ablehnung Jesu sowie die aktuelle Ausgrenzungserfahrung der Christen seiner eigenen GemeindeGemeinde (Ekklesiologie)(n), in der er lebt und für die er schreibt. Deshalb spricht der Evangelist in seinem PrologProlog (s. auchJohannesprolog) deutlich den Konflikt bzw. die Krisis an, die durch die ablehnende Reaktion eines Teils der „Seinen“ auf das Kommen des logos entsteht. Auch diese Konfliktsituation wird schrittweise durch variierende Metaphoriken (LichtLicht, Lichtmetaphorik-FinsternisFinsternis; FamilienmetaphorikFamilienmetaphorik, GerichtsmetaphorikGericht (Metaphorik) (s. auchkrisis)) hindurch entschlüsselt. Dem ZeugnisZeuge, Zeugnis des von Gott gesandten Täufers (VV 6-8Joh1,6-8.15Joh1,15) zum Trotz läuft das Kommen des logos auf einen Prozess zu, der Jesus gemacht wird, der aber in seiner ganzen Vordergründigkeit doch nur den Prozess in den Blick rückt, den Gottes eingeborener Sohn der „Welt“ macht, sofern sie ihn ablehnt.
Die Brücken zwischen PrologProlog (s. auchJohannesprolog) und Evangelium sind intensiver und zugleich vielfältiger als mitunter angenommen. Das gilt für Begriffe, Motive, Metaphern und Themen ebenso wie für sprachliche bzw. narrative Strategien des Evangelisten. Dies gilt für das hermeneutische Potential und die denkerische und sprachliche Kraft des Johannesevangeliums ebenso wie für die schrittweisen Entschlüsselungen und Neuverschlüsselungen von Leitwörtern vorwiegend (aber nicht nur) in christologischer Absicht.
3.3Lektüregewinn: Vom PrologProlog (s. auchJohannesprolog) zum Evangelium und zurück
Die aufmerksam Hörenden und Lesenden stehen mit dem Prolog in der offenen TürTür bzw. Raum (Metaphorik) zum Hauptteil des Evangeliums: Ihnen sind wichtige Akteure, ihre Rollen und ihr Geschick vor Augen geführt. Ihnen sind vertraute Deutekategorien in neuer Auslegung und Anwendung an die Hand gegeben. Sie werden in die Perspektive des allwissenden Erzählers eingeweiht und sie werden umworben, sich dem Gotteslob der „wir“-Gruppe, die sich in den Versen 14-18Joh1,14-18 zu Wort meldet, anzuschließen. Damit ist das JohannesevangeliumForschungsgeschichte (Johannesevangelium) aber keineswegs am Schluss, sondern immer noch am Anfang: Die hochgradig verdichteten Aussagen des Johannesprologs dringen auf weitere Erschließung, auf weitere Vertiefung, um so die Aneignung der Botschaft, die „Aufnahme“ Jesu im Glauben zu ermöglichen, auszuloten und zu sichern. Dafür schreibt der Evangelist das Lebenleben, Leben Jesu, wie er es aller Wahrscheinlichkeit nach aus (den) synoptischen EvangelienEvangelien, synoptische kannte, neu auf. Dazu zieht er die im Prolog vorhandenen Sinnlinien weiter aus, dazu verwendet und entfaltet er die Begriffe, Motive und metaphorischen Cluster des Prologs in zahlreichen Szenen und Sequenzen des Lebens Jesu.
Ausgehend von den „five divine initiatives“ in Joh 1,1-18Joh1,1-18 (the work of creation through the LogosLogos, logos in V. 3Joh1,3; the giving of the Law through MosesMoses in V. 17Joh1,17; the sending of John the Baptist in VV. 6-8Joh1,6-8.15Joh1,15; the coming of the light in V. 9Joh1,9; the incarnation of the LogosLogos, logos in V. 14Joh1,14; the birth of the children of God in VV.12-13Joh1,12-13) und ihren Wiederaufnahmen im JohannesevangeliumForschungsgeschichte (Johannesevangelium) zeigt R. Alan Culpepper auf, wie eng und wie vielfältig die theologischen Verbindungen sind zwischen PrologProlog (s. auchJohannesprolog) und Hauptteil des Johannesevangeliums.1 So betont er z. B., dass in den Aussagen über die SendungSendung des Täufers insbes. mit dem juristisch relevanten Zeugnismotiv bereits das Thema des Prozesses, den Jesus „der Welt“ macht und der Jesus gemacht wird, antizipiert wird. R. Alan Culpepper schlussfolgert zu Recht:
„Its [the Prologue] relationship to the themes and theology of the Gospel is such that it becomes increasingly clear that the Prologue provides readers of the Gospel with the theological framework that is needed to understand the significance of Jesus’ ministry, death, and resurrection as it is understood in the rest of the Gospel, and especially its images, ironies, misunderstandings, and interrelated themes.“2
„The theological themes and concepts introduced in the prologue und developed subsequently in the Gospel form the core of Johannine thought.“3
Für eine literarisch und theologisch kohärente Lektüre von PrologProlog (s. auchJohannesprolog) und Evangelium plädiert auch Christos Karakolis, der das LogosLogos, logos-Konzept des Evangelisten als dramatische IronieIronie interpretiert: „It is dramatically ironical that while on the one hand the implied readers know the real identity of Jesus as the LogosLogos, logos, and are in a position to understand the absolute authority and significance of his words, on the other hand the characters of the narrative are not able and/or willing to do so.“4 Weiterführend ist seine überzeugende Beobachtung, dass die ‚dramatische Ironie‘ Personen, die nicht oder noch nicht an Jesus glaubenglauben (z. B. NikodemusNikodemus), gerade nicht stigmatisiert, sondern im Gegenteil Sympathie für sie weckt!5
Die Textbeobachtungen 3.1-3.2 zeigen, wie stark die sprachlichen Stilmittel, die Leitmetaphern und die theologischen Intentionen des Evangelisten ineinander verschränkt sind, wie weit sie die gesamte Textgestalt der ersten achtzehn Verse des Johannesevangeliums imprägnieren und wie maßgeblich und ‚selbstbewusst‘ sie das verstehende, auf Aneignung zielende LesenLesen (vorausgreifend, zurückgreifend [= rekursiv]) des gesamten Evangeliums steuern.
In Kapitel 4 „Die Sprachwelt des JohannesevangeliumsForschungsgeschichte (Johannesevangelium) erkunden“ werden in elf Teilkapiteln eine Fülle von Beobachtungen zur Sprache und zur Text- bzw. Erzählwelt des Johannesevangeliums vorgestellt, die die hohe Kunst des Evangelisten aufzeigen, seine Botschaft, das Evangelium von Jesus Christus, in sein schriftliches Evangelium, sein „BuchBuch“ (Joh 20,30Joh20,30; 21,25Joh21,25), hineinzuschreiben. Viele dieser Beobachtungen zur Sprache sowie Text- und Erzählwelt des vierten Evangeliums werden im JohannesprologJohannesprolog grundgelegt, präfiguriert und kontextualisiert. Diese Verwobenheit des Prologs mit dem Hauptteil des Johannesevangeliums wurde oftmals unterschätzt und kann noch weiter vertiefend ausgelotet werden.
Charakteristisch für die in das ganze Johannesevangelium ausstrahlende Kohärenz des Johannesprologs ist die semantische Achsesemantische Achse, die in Joh 1,1-18Joh1,1-18 schrittweise entwickelt und in VV 11-14Joh1,11-14 explizit formuliert wird: Die SendungSendung Jesu erfährt „Nichtaufnahme“ und „Aufnahme“. Sie bewirkt gegensätzliche Reaktionen. Sie führt in eine Krisis mit einer ihr eigenen Dynamik, die im Hauptteil des Evangeliums in vielfältigen Konstellationen und Resonanzen inszeniert wird.
Die semantische Achsesemantische Achse





























