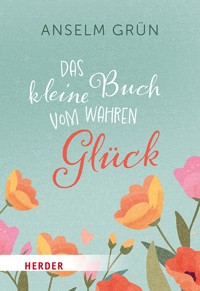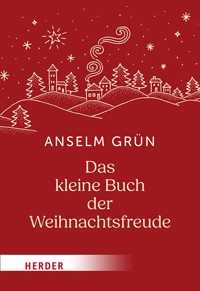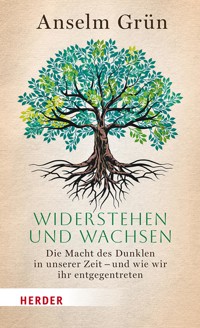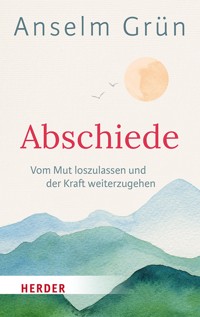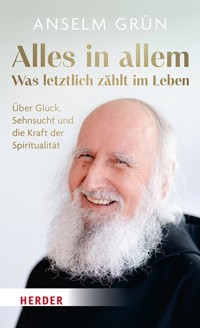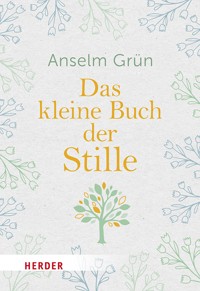
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Immer größer wird die Macht von Medien, die um unsere Aufmerksamkeit werben. Immer intensiver die Reize, die permanent versuchen, uns von uns selber abzulenken. Wie können wir innere Kräfte des Widerstehens stärken? Was hilft, innezuhalten, innere Ruhe einzuüben, Klarheit, inneren Frieden und neue Lebendigkeit zu finden? Es ist die Kraft der Stille. Anselm Grün gibt wertvolle und erprobte Impulse für die Suche nach dieser heilsamen inneren Kraft. Texte, die helfen, Stille als Geschenk zu erfahren, sie nicht nur wahrzunehmen, sondern sie immer wieder als Möglichkeit vertieften Lebens zu entdecken. Darum geht es: Mich in der Tiefe des eigenen Herzens verankern und so mich selber finden und offen werden für eine Wirklichkeit, die mich übersteigt und doch umfängt und trägt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 120
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anselm Grün
Das kleine Buch der Stille
Zur eigenen Mitte finden
Herausgegeben von Rudolf Walter
Ein einfach-leben-Buch
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2025
Hermann-Herder-Straße 4, 79104 Freiburg
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Bei Fragen zur Produktsicherheit wenden Sie sich an [email protected]
Umschlaggestaltung: Gestaltungssaal, Rohrdorf
Umschlagmotiv und Innen-Illustrationen: © mexrix / shutterstock, © Wanchana365 / shutterstock; © Rudzhan Nagiev / GettyImages
E-Book-Konvertierung: Newgen Publishing Europe
ISBN Print 978-3-451-03626-2
ISBN E-Book (EPUB) 978-3-451-83873-6
Inhalt
Einleitung
1 Sich Zeit nehmen – wie Innehalten geht
2 Atem holen – Leib und Seele verbinden
3 Orte der Stille suchen und finden
4 Schweigen lernen – ein Prozess
5 Stille aushalten – zur Ruhe kommen
6 Gemeinschaft erfahren – verbunden in der Tiefe
7 Auf dem Grund des Herzens – ganz bei mir, geborgen in Gott
Ausklang
Quellen
Über den Autor
Einleitung
„O komm, Gewalt der Stille“: Der Titel dieses Gedichts von Werner Bergengruen spricht uns auch in unserer aktuellen Lebenssituation an. Aus ihm spricht nicht nur eine Sehnsucht, sondern auch ein Wissen um die Kraft der Stille – und zudem die Hoffnung, dass sie ihre heilsame Kraft in einer Welt entfaltet, die immer lauter wird und uns krank macht. Da ist ja nicht nur der dröhnende Verkehrslärm, das nervende Klingeln allgegenwärtiger Handys oder der Geräuschpegel permanenter Hintergrundmusik, wie sie uns in Gaststätten und Kaufhäusern beschallt. Lärm begegnet uns auch in der Flut der Informationen, die ständig auf uns eindringen, in den Werbeimpulsen, die pausenlos auf unsere Aufmerksamkeit zielen und denen wir uns nicht so leicht entziehen können. Das hat Folgen auch in unserer Seele. Die französische Dichterin und Mystikerin Madeleine Delbrêl hat gesagt, dass alle Geräusche, die uns umgeben, viel weniger Lärm machen als wir selber, und gefolgert: „Der eigentliche Lärm ist der Widerhall der Dinge in uns.“
Der irische Schriftsteller C. S. Lewis erzählt in seinen Anweisungen an einen Unterteufel, wie der Oberteufel seinen Neffen das Teufelshandwerk lehrt: „Wir müssen die Menschen dazu bringen, dass sie möglichst viel Krach machen. Wir müssen also dafür sorgen, dass es immer lauter wird, bis das ganze Weltall ein einziger Höllenlärm wird.“ Lewis bezeichnet den Lärm, der uns umgibt, als „Höllenlärm“. Offensichtlich stellt er sich die Hölle als Lärm vor.
Gibt es auch eine himmlische Stille, die auch mehr ist als nur die Abwesenheit vom Lärm? Vor einiger Zeit lief mit großem Erfolg der Film Die große Stille von Philip Gröning. Gröning hat über drei Monate hinweg das Leben schweigender Kartäusermönche in der Grande Chartreuse, dem Mutterkloster dieses Ordens, begleitet. Am Ende der Vorführung, so erzählt ein Kinobesucher, klatschten die Zuschauer – ganz ungewöhnlich für einen Kinofilm – spontan Beifall. Was hat die Zuschauer da so fasziniert? Offensichtlich spürten sie die Tiefendimension dieser Lebensform und sehnten sich nach einer ähnlichen Erfahrung, auch wenn sie wussten, dass sie die Stille der Mönche in ihrer Alltagswelt niemals finden würden.
Dass sich bei vielen Menschen die Sehnsucht nach Stille immer wieder Bahn bricht, das erlebe ich bei den vielen Gästen, die bei uns für einige Tage im Gästehaus des Klosters wohnen und an unseren Gebetszeiten teilnehmen. Sie suchen einen Ort, an dem sie zur Ruhe kommen, an dem sie eintauchen können in eine Stille, die sie im Kloster erwartet.
Das deutsche Wort „Lärm“ kommt von „Alarm“, das wiederum auf den italienischen Ruf „Alle arme“ („An die Waffen“) zurückgeht. Der Lärm ist also eine Abwehrmaßnahme – aber gegen was? Offensichtlich empfinden manche Menschen die Stille als gefährlich. Denn da können sie der eigenen Wahrheit nicht ausweichen. Der Lärm schützt sie gegen die eigene Wahrheit. Die Wahrheit macht ihnen Angst. Sie leben also lieber in der Illusion weiter, dass alles in Ordnung sei. C. G. Jung schreibt: „Der Lärm ist willkommen, denn er übertönt die innere instinktive Warnung. Wer sich fürchtet, sucht laute Gesellschaft und tosenden Lärm, der die Dämonen verscheucht (…) Der Lärm schützt uns vor peinlichem Nachdenken, er zerstreut ängstliche Träume, er versichert uns, daß wir ja alle zusammen seien und ein solches Getöse veranlassen, daß niemand es wagt, uns anzugreifen“ (Briefe III, 125).
In der Stille lassen wir den Lärm als Schutzschild gegen die eigene Wahrheit los und stellen uns unserer Wahrheit. Wir lassen die Gedanken und Gefühle hochkommen, die wir am liebsten unterdrücken möchten: etwa den Gedanken, dass man am Leben vorbeilebt, dass das Leben so nicht stimmt, wie man es lebt. Oder es tauchen Schuldgefühle auf, die einen infrage stellen. Vielleicht kommen auch alte Verletzungen hoch oder Entscheidungen werden bewusst, deren Konsequenzen man lieber nicht wahrhaben möchte.
Wir unterscheiden Stille von Schweigen. Stille ist ein Zustand, Schweigen ist ein Weg. Stille ist einfach da. Der Wald ist still, eine Kirche ist still, die Bibliothek ist still. Man taucht in die vorgegebene Stille ein. Wenn man sich auf diese vorgegebene Stille einlässt, hat sie eine reinigende Kraft. Die alten Mönche verwenden da ein eindrückliches Bild. Sie beziehen sich, wenn sie über die Qualität der Stille nachdenken, auf den Wein, der stehen bleiben muss, damit das Trübe nach unten geht. Die Stille lässt uns das reine Sein erfahren. In der Stille sind wir verbunden mit allem, was ist: mit den Menschen, mit der Natur, mit Gott. In der Stille gibt es nicht die Missverständnisse, die Worte oft erzeugen können. Jenseits aller Argumente sind wir in der Tiefe unserer Seele eins mit allem. Wenn wir das reine Sein spüren und wenn Gott – so sagt es Thomas von Aquin – das reine Sein ist, ist Stille immer auch Gotteserfahrung.
Wer sich die Stille gönnt, der erfährt auch ihre heilende Wirkung. Er kommt zur Ruhe, wird offen für die Menschen, denen er begegnet, oder für die Aufgaben, die ihn erwarten. Es ist eine heilsame Stille, die wohltut, deren Kraft uns verwandelt, die uns aus der Unruhe zur Ruhe führt und die uns zum Wesentlichen hin öffnet. Diese Sehnsucht kommt in dem eingangs angesprochenen Gedicht von Werner Bergengruen (1892–1964) auf berührende Weise zum Ausdruck.
„Wir sind so sehr verraten,
von jedem Trost entblößt,
in all den schrillen Taten
ist nichts, das uns erlöst.
Wir sind des Fingerzeigens,
der plumpen Worte satt,
wir wolln den Klang des Schweigens,
der uns erschaffen hat.
Gewalt und Gier und Wille
der Lärmenden zerschellt.
O komm, Gewalt der Stille,
und wandle du die Welt.“
Auch wenn das Gedicht aus einer vergangenen Zeit stammt, so trifft es doch heute unsere tiefe Sehnsucht, dem oberflächlichen Lärm zu entkommen, in Berührung zu kommen mit dem Schweigen, aus dem wir entstanden sind. Sie öffnet uns auf Gott hin, das unbegreifliche Geheimnis, den Grund unserer Existenz.
Werner Bergengruen ist überzeugt, dass die Stille unsere laute Welt zu wandeln vermag – zu dieser wesentlichen Wirklichkeit hin. Wir würden heute lieber von der leisen Kraft der Stille sprechen und nicht von der Gewalt der Stille. Diese leise Kraft, die es nicht nötig hat, lautstark auf sich aufmerksam zu machen, spüren wir im Wachstum der Natur, in den Blumen und Bäumen, die einfach da sind. Wie aber können wir heute, in unserem Leben, dazu gelangen? Wie können wir selber diese Wirkung erfahren?
Stille verlangt auch nach Zeit, die wir uns lassen, um uns auf das Schauen, das Wahrnehmen einzulassen. Auch die Schönheit erleben in der Stille. Das kann in der Betrachtung einer Landschaft sein, aber auch, wenn wir bewusst ein Kunstwerk sehen. Wenn wir in ein Museum gehen, dann braucht es Konzentration, um sich vor ein Gemälde zu stellen und es einfach nur anzuschauen, es auf sich wirken zu lassen. Auch wer auf neue Gedanken kommen will, braucht Stille und benötigt Zeit. Ohne solches Innehalten in der Stille sind wir in Gefahr, nur zu wiederholen, was andere uns sagen. In der Stille wachsen neue Einsichten, da entstehen kreative Gedanken. Gehirnforscher sagen, dass wir diesen Zustand brauchen, damit sich das Gehirn regenerieren und neue Ideen entwickeln kann. Künstler brauchen die Stille, um schöpferisch sein zu können. Auch in der Wissenschaft ist es oft die Stille, in der ein kreativer Durchbruch der Erkenntnis geschieht. Werner Heisenberg erkannte in einer stillen Nacht auf Helgoland das Wesen der Quantenmechanik. Nicht das Lesen vieler Bücher also, sondern die Intuition, die in der Stille kam, hat diesen Erkenntnisfortschritt begründet.
Diese Erfahrung hat auch eine große religiöse Tradition. Die Bibel erzählt uns, dass Jesus sich immer wieder in die Stille zurückzog. Er brauchte offensichtlich diese Ungestörtheit, um sich dann wieder den Menschen zuwenden zu können, die ihn bedrängten und von ihm geheilt werden wollten oder die seine Worte hören wollten, die so anders waren als die Worte der Schriftgelehrten. Auch Buddha ging in die Stille. Die Wüstenmönche im 4. Jahrhundert zogen sich in die Einsamkeit der Wüste zurück. Für sie war die Stille mit Hoffnung verbunden. Und sie erfuhren: Die Stille öffnet für Gott.
Für Evagrius Ponticus besteht das Ziel des Betens darin, ganz still zu werden, frei zu werden von allen Gedanken. Nur wenn alle Gedanken über Gott schweigen, werden wir offen für Gott. Und ähnlich wie C. S. Lewis spricht er auch davon, dass der Teufel neidisch wird, wenn er einen Menschen beten sieht. Er stört den Mönch, indem er ihn an die verschiedensten Dinge des Alltags denken lässt. So kann der Mönch im Gebet nicht eins werden mit Gott. So sagt Evagrius: „Wache darüber, daß du dich während deines Gebetes an keine Vorstellungen hängst, sondern in tiefer Stille verharrst. So nur wird er, der sich der Unwissenden erbarmt, einen so unbedeutenden Menschen wie dich besuchen und dich mit der größten aller Gaben beschenken, dem Gebet“ (Evagrius, Über das Gebet 69). Das Gebet – so meint Evagrius – führt den Menschen in den heiligen Raum der Stille, der in jedem Menschen ist, der aber oft genug zugeschüttet ist von den täglichen Sorgen und Nöten. Evagrius nennt diesen heiligen Raum „Ort Gottes“. Es ist ein Zustand, der einem Saphir gleicht, klar und hell und rein. Evagrius nennt diesen Raum auch Jerusalem, Stadt des Friedens. Im Gebet und in der Kontemplation geht es darum, in diesen stillen Raum auf dem Grund unserer Seele zu gelangen, in den Raum der Stille, des Friedens und des Lichtes.
Vielen Menschen fällt das schwer. Denn eine Schuttschicht von Sorgen und Ängsten und Problemen hat sich über diesen Raum gelegt. Ein Weg, in diesen Raum zu gelangen, ist die Meditation. Ein anderer Weg ist einfach die Vorstellung: Unter all dem Schutt ist in mir dieser innere Raum. Allein die Vorstellung ist schon ein Schlüssel, der mir diesen Raum der Stille aufschließt. Und dann kann ich mir mitten im Trubel des Alltags vorstellen: Ich ziehe mich in den inneren Raum der Stille zurück. Dort hat der Lärm des Alltags keinen Zutritt. Dort kann ich aufatmen, allein sein mit mir, eins sein mit meinem innersten Selbst. Die Menschen mit ihren Erwartungen und Ansprüchen und ihren Meinungen über mich haben dort keinen Zutritt. Auch meine eigenen Selbstzweifel und Selbstbeschuldigungen können dort nicht eindringen. Auch die verletzenden Worte oder Blicke können in diesen inneren Raum der Stille nicht gelangen. Sie können nur meinen emotionalen Bereich berühren und mich dort kränken. Doch in den innersten Raum der Stille können sie nicht vordringen. In diesem Raum der Stille verstummt auch das Ego, das ständig auf sich aufmerksam machen möchte. Da bin ich ganz ich selber, frei von dem Druck, mich darstellen oder beweisen zu müssen. Und dort, wo das innere Licht – der Saphir – in mir leuchtet, bin ich rein und klar, frei von Schuldgefühlen und Selbstvorwürfen. Und ich bin verbunden mit Gott, mit der Natur und mit allen Menschen. Das ist eine heilsame Erfahrung der Stille.
Der Ort der Stille in mir ist also ein heiliger Raum, der der Macht der Welt entzogen ist. Das griechische Wort für „heilig“ ist „hagios“. Es bezeichnet einen abgetrennten und abgegrenzten Raum. Wir sprechen von „Maria im Rosenhag“. Mit „hagios“ hängen auch die deutschen Wörter „behagen“ und „behaglich“ zusammen. In dem inneren Raum der Stille, im heiligen Ort in mir fühle ich mich behaglich, geborgen, geschützt. Da bin ich ganz ich selbst, frei von allen Erwartungen, die ständig an mich gerichtet werden. Dort kann ich mich ausruhen und die Stille als innere Freiheit genießen. Die Stille macht also nicht einsam, sondern sie verbindet mich mit allem, was ist. Und sie schafft mir einen Ort der Geborgenheit, der „Behaglichkeit“, wie das griechische Wort „hagios“ es mir verheißt.
Wenn ich bei Kursen oder Vorträgen vom inneren Raum der Stille spreche, spüre ich in den Menschen eine Sehnsucht danach. Aber zugleich fragen sie, wie sie diese innere Stille finden können. Manche haben schon Erfahrung darin. Sie besuchen etwa zwischendurch eine Kirche, abseits vom Lärm der Straße, und spüren dort die Stille. Im Alltag genügt es dann, etwa mitten in einer hitzigen Sitzung oder mitten im Trubel, wenn ständig Kunden anrufen, oder mitten im Trubel des Supermarktes sich vorzustellen: Ich lasse mich ein auf die Realität um mich herum, aber in diesen inneren Raum der Stille vermag der Lärm von außen, die Unruhe von außen nicht vorzudringen. Dann kann ich mitten im Lärm der Welt doch die innere Stille erleben. Andere suchen in der Natur Orte auf, an denen es ganz still ist, einen ruhigen Wald, einen abgelegenen Feldweg, eine einsame Landschaft. Sie überlassen sich ganz dem Gehen oder kommen zur Ruhe, indem sie einfach stehen bleiben und schauen. Was sie zur Ruhe führt, ist die Vorstellung: Ich muss jetzt gar nichts erledigen, mir gar keine Gedanken machen, was nachher kommt. Ich bin einfach da. Wenn sie sich das bewusst machen, dann können sie die Stille genießen.
So wünsche ich den Leserinnen und Lesern, dass sie beim Lesen selber schon Stille und die darin erfahrbare Schönheit erleben, und dass sie für sich Wege finden, auch im Alltag dieser Welt Orte der Stille zu entdecken, und dass sie fähig werden, in die Stille einzutauchen. Und ich wünsche ihnen, dass sie dann diese positiven Erfahrungen machen, dass sie sich „behaglich“ fühlen in dem heiligen (hagios) Raum der Stille.
1 Sich Zeit nehmen – wie Innehalten geht
Wer ständig in Bewegung ist, der hindert seine Seele, ruhig zu werden.
S