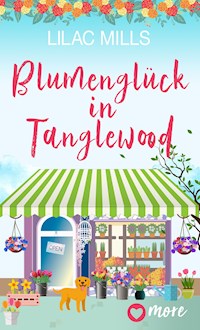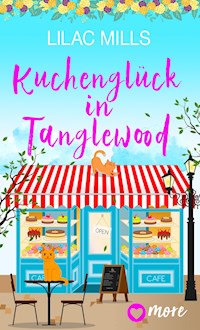8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Serens Großtante Nelly hasst es, in einem Pflegeheim zu leben, vor allem in der Weihnachtszeit. Als Seren erfährt, dass Nelly und die anderen Bewohner nicht in den Genuss kommen, in den Geschäften nach Geschenken zu stöbern, hat sie eine Idee: Wie wäre es, wenn sie die Geschenke zu den Bewohnern bringt? Kurzerhand baut Seren einen Eiswagen in einen Geschenkeladen um und reist durch Tinston.
Wird ihr kleiner Weihnachtsladen auf vier Rädern den Bewohnern die dringend benötigte Festtagsstimmung bringen? Und wer ist der gut aussehende Weihnachtsmann, auf den Seren immer wieder trifft?
Eine herzerwärmende und lustige Weihnachtsgeschichte für Fans von Rebecca Raisin und Sue Moorcroft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 448
Ähnliche
Liebe Leserin, lieber Leser,
Danke, dass Sie sich für einen Titel von »more – Immer mit Liebe« entschieden haben.
Unsere Bücher suchen wir mit sehr viel Liebe, Leidenschaft und Begeisterung aus und hoffen, dass sie Ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern und Freude im Herzen bringen.
Wir wünschen viel Vergnügen.
Ihr »more – Immer mit Liebe« –Team
Über das Buch
Serens Großtante Nelly hasst es, in einem Pflegeheim zu leben, vor allem in der Weihnachtszeit. Als Seren erfährt, dass Nelly und die anderen Bewohner nicht in den Genuss kommen, in den Geschäften nach Geschenken zu stöbern, hat sie eine Idee: Wie wäre es, wenn sie die Geschenke zu den Bewohnern bringt? Kurzerhand baut Seren einen Eiswagen in einen Geschenkeladen um und reist durch Tinston.
Wird ihr kleiner Weihnachtsladen auf vier Rädern den Bewohnern die dringend benötigte Festtagsstimmung bringen? Und wer ist der gut aussehende Weihnachtsmann, auf den Seren immer wieder trifft?
Eine herzerwärmende und lustige Weihnachtsgeschichte für Fans von Rebecca Raisin und Sue Moorcroft.
Über Lilac Mills
Lilac Mills lebt mit ihrem sehr geduldigen Ehemann und ihrem unglaublich süßen Hund auf einem walisischen Berg, wo sie Gemüse anbaut (wenn die Schnecken sie nicht erwischen), backt (schlecht) und es liebt, Dinge aus Glitzer und Kleber zu basteln (meistens eine Sauerei). Sie ist eine begeisterte Leserin, seit sie mit fünf Jahren ein Exemplar von Noddy Goes to Toytown in die Hände bekam, und sie hat einmal versucht, alles in ihrer örtlichen Bibliothek zu lesen, angefangen bei A und sich durch das Alphabet gearbeitet. Sie liebt lange, heiße Sommer- und kalte Wintertage, an denen sie sich vor den Kamin kuschelt. Aber egal wie das Wetter ist, schreibt sie oder denkt über das Schreiben nach, wobei sie immer an herzerwärmende Romantik und Happy Ends denkt.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Lilac Mills
Das kleine Geschenkemobil im Winterglück
Aus dem Amerikanischen von Dorothee Danzmann
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Grußwort
Informationen zum Buch
Newsletter
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Danksagung
Impressum
Für alle Weihnachtsmänner, wo sie auch sein mögen, weil sie den Zauber von Weihnachten am Leben erhalten.
Lilac Mills lebt mit ihrem sehr geduldigen Ehemann und ihrem unglaublich süßen Hund auf einem walisischen Berg, wo sie Gemüse anbaut (wenn die Schnecken sie nicht erwischen), backt (schlecht) und es liebt, Dinge aus Glitzer und Kleber zu basteln (meistens eine Sauerei). Sie ist eine begeisterte Leserin, seit sie mit fünf Jahren ein Exemplar von Noddy Goes to Toytown in die Hände bekam, und sie hat einmal versucht, alles in ihrer örtlichen Bibliothek zu lesen, angefangen bei A und sich durch das Alphabet gearbeitet. Sie liebt lange, heiße Sommer- und kalte Wintertage, an denen sie sich vor den Kamin kuschelt. Aber egal wie das Wetter ist, schreibt sie oder denkt über das Schreiben nach, wobei sie immer an herzerwärmende Romantik und Happy Ends denkt.
Kapitel 1
»Wir haben einen neuen Insassen«, berichtete Seren Fletchers Großtante ihrer Nichte, als diese sie im Fernsehzimmer des Pflegeheims gefunden hatte.
Seren beugte sich über die alte Dame und küsste sie auf die Wange. Ihre Großtante war mittlerweile schon dreiundneunzig Jahre alt, und ihr Gesicht zeigte jede Menge Falten, aber ihre Haut war nach wie vor weich und duftete nach dem Puder, den sie jeden Morgen auftrug – komme, was da wolle. Heute waren noch dazu ihre Lippen knallrot geschminkt, wie Seren jetzt bemerkte, nur war der Lippenstift leider in die zahlreichen Falten um ihren Mund herum gewandert, was ihr das Aussehen eines Vampirs mit unschönen Essgewohnheiten verlieh.
Großtante Nelly klopfte einladend auf den Stuhl neben sich, aber Seren schüttelte den Kopf.
»Sag nicht, du willst gleich wieder gehen!« Nelly verzog enttäuscht das Gesicht.
Seren schüttelte erneut den Kopf. »Ich kann bleiben, so lange du möchtest, aber der Fernseher ist so laut, man versteht ja sein eigenes Wort nicht. Können wir nicht irgendwohin, wo es ruhiger ist?«
»Was hast du gesagt?«, rief Nelly, weshalb Seren ihre Frage schon wiederholen wollte, als sie das vergnügte Glitzern in den Augen der alten Dame bemerkte.
»Scherzkeks!« Sie lachte und hielt der alten Dame den Arm hin, damit diese sich beim Aufstehen daran festhalten konnte.
Langsam und steif rutschte Nelly bis zur Stuhlkante vor, stützte sich mit den Händen ab und hievte sich hoch. Einen Moment schwankte sie beängstigend, doch dann griff sie nach dem dargebotenen Arm und hatte sich schnell wieder gefangen.
»Möchtest du deinen Rollator?« Seren war kurz zusammengezuckt, als sich die Hand ihrer Großtante um ihren Arm geschlossen hatte. Nelly mochte zerbrechlich wirken, doch der Griff der alten Dame war erstaunlich fest.
»Ja, ist wohl besser, ich nehme ihn mit. Wenn ich ihn hier stehen lasse, wird er doch nur geklaut.«
»Das glaube ich nicht …« Seren war überrascht. Bisher hatte sie noch nicht gehört, dass es im Heim Probleme mit Diebstahl gegeben hätte. Für ein Pflegeheim war es ein gutes Haus: modern und hell, mit einer schönen, gepflegten Gartenanlage und erfreulich viel Personal. Mehr noch, die Belegschaft hier tat wirklich alles, damit es den Heimbewohnern gut ging, und behandelte sie fürsorglich, einfühlsam und respektvoll, wie sie es auch verdienten. Nellys Bemerkung war daher ziemlich beunruhigend, und Seren nahm sich vor, einen der Angestellten darauf anzusprechen, bevor sie ging.
»Sind doch alles Diebe hier!« Nelly hatte beide Hände auf ihren Rollator gelegt und setzte sich langsam und methodisch in Gang: Rollator ein Stück weiterschieben, einen Fuß vorsetzen, den anderen folgen lassen und dann das Ganze wieder von vorne.
So kamen sie natürlich nur schleichend voran, aber Seren hatte es nicht eilig. Ihr Vater würde erst viel später von der Arbeit nach Hause kommen, und das Abendessen war bereits vorbereitet. Es würde ihr Lieblingsessen geben: Lammeintopf mit Klößen.
Tante Nellys Rollator kroch weiter über den Teppichboden im Flur, und es dauerte einige Zeit, bis die beiden Frauen den Aufenthaltsraum erreicht hatten. Hier ging es normalerweise eher ruhig zu, wobei auch das nicht garantiert war. Es hing davon ab, ob gerade ein Kartenspiel stattfand und wer dabei gewann oder schummelte. Da konnte es durchaus hoch hergehen.
Heute war der Raum glücklicherweise leer.
»Soll ich dir einen Tee holen?«, erkundigte sich Seren bei ihrer Tante, nachdem diese es sich gemütlich gemacht hatte. »Und dann erzählst du mir alles über den neuen Insassen – Himmel! Jetzt fange ich auch schon an! Bewohner natürlich. Du erzählst mir alles über euern neuen Bewohner.«
»Insasse trifft es schon. Man fühlt sich hier wie im Gefängnis, also kann man alle, die hier festsitzen, auch ruhig Insassen nennen.«
»So schlimm ist es doch wirklich nicht, Tantchen!«, protestierte Seren. »Ich hole uns jetzt erst mal einen Tee.«
»Er muss stark sein, denk dran. Komm mir bloß nicht mit dem Spülwasser, das dein Vater immer macht.«
Seren musste grinsen. Über die Qualität des von ihrem Vater servierten Tees ließ sich wirklich nicht streiten. Er hatte einfach kein Talent in dieser Richtung und riss den Teebeutel meist schon aus der Tasse, bevor das heiße Wasser überhaupt die Gelegenheit gehabt hatte, die Farbe zu ändern. Daher kochte Seren bei sich zu Hause den Tee, allein schon ihren Geschmacksnerven zuliebe.
»Hier, bitteschön, stark und schwarz wie Teer.« Seren stellte die Tasse für ihre Tante so auf einen Beistelltisch, dass diese sie mit ihren von Arthritis geplagten Händen leicht erreichen konnte, und nahm ihre eigene Tasse in beide Hände. Sie trank die heiße Flüssigkeit in kleinen Schlucken, während sie darauf wartete, dass ihre Tante mit den Neuigkeiten herausrückte.
Im Heim war eigentlich immer etwas los, und Nelly wusste meistens bestens Bescheid, denn egal wie oft sie sich darüber beschwerte, sich wie im Gefängnis zu fühlen, ließ sie sich doch voller Elan auf alles ein, was hier passierte.
»Heute ist ein neuer Typ aufgetaucht«, begann Nelly zu erzählen. »War zunächst nur auf einen Besuch hier, will aber Ende der Woche einziehen.«
»Und wie ist er so?«
»Jung. Fünfundachtzig, habe ich mir sagen lassen. Eine Tochter, ein Enkel, beide natürlich schon erwachsen. Hat noch all seine Haare und wohl auch seinen Verstand, aber das kann man in dem Alter ja noch erwarten.«
Seren musste sich ein Grinsen verkneifen. Von wegen jung! Ihre Tante war gerade einmal acht Jahre älter.
Nelly griff nach ihrer Tasse, um laut schlürfend einen Schluck Tee zu trinken. »Ich habe gehört, er hat Parkinson. Kann ich mir gut vorstellen, er geht schlechter als ich, und das will was heißen. Ich konnte ihn allerdings auch sprechen hören, und mit seiner Sprache scheint alles okay zu sein. Gott sei Dank. Schlimm genug, hier festzusitzen. Wenn man dann auch noch darum kämpfen müsste, verstanden zu werden – das wäre zu hart.« Nelly berichtete das alles nicht ohne eine gewisse Genugtuung, wie Selen bemerkte, die langsam Mitleid mit dem Mann bekam. Ihre Tante würde ihn erbarmungslos löchern, würde mit der Ausdauer und Geduld eines Bergmanns, der Kohle aus dem Felsen schlug, auch noch das letzte Fitzelchen an persönlichen Informationen aus ihm herausholen. Nelly liebte es, die Angelegenheiten anderer bis ins Detail zu kennen, und manch einer hätte sie vielleicht als eine Spur zu neugierig bezeichnet. Seren wusste jedoch, dass ihre Tante ein Herz aus Gold hatte und nicht einen Funken Boshaftigkeit im Leib.
»Ich wollte ihm eigentlich ein kleines Geschenk zum Einstand besorgen, nach dem Motto ›Willkommen im Knast‹, nur so als nette Geste, aber …« Nelly starrte mit versteinerter Miene in ihre Teetasse. Sie war wirklich nicht in bester Stimmung.
»Ich kann etwas für dich kaufen«, schlug Seren vor.
Nelly schüttelte den Kopf. »Das ist es ja gerade! Ich weiß nicht, was er mag, also weiß ich auch nicht, was ich für ihn besorgen könnte.«
»Pralinen? Süßigkeiten? Ein schönes Bier?«
»Pah, der übliche Kram! So was kauft man Leuten, wenn es einem eigentlich scheißegal ist und man zu faul ist, sich etwas einfallen zu lassen.«
»Tantchen!« Seren senkte die Stimme und sah sich nervös um, obwohl niemand außer ihnen im Zimmer war. »Scheißegal? So was kannst du doch nicht sagen!«
»Wieso denn nicht?«
»Vielleicht weil es nicht gerade damenhaft ist?«
Nelly schnaubte. »Wie alt bist du eigentlich?«
»Du weißt genau, wie alt ich bin.«
»Siebzig, ja? Oder doch erst fünfundsechzig? Wer dich so hört, käme nie auf die Idee, dass du erst achtundzwanzig bist. Damenhaft? Dass ich nicht lache. Damenhaft zu sein, ist schon seit Ewigkeiten nicht mehr in Mode. Genauso wie das Sitzen mit an den Knöcheln gekreuzten Beinen.«
»Dabei ist das eine prima Idee, wenn man einen kurzen Rock trägt«, meinte Seren.
Nelly kniff die Augen zusammen, und die Falten darum wurden so tief, dass ihre Pupillen kaum mehr zu sehen waren. »Du willst doch bloß das Thema wechseln. Lass es sein.«
»Was für ein Thema?«
»Geschenke kaufen.«
»Ach, das.«
»Genau das. Hast du noch irgendwelche anderen Vorschläge? Welche, bei denen man annehmen könnte, es interessiert dich wirklich?«
»Es interessiert mich wirklich!«, protestierte Seren. »Nur habe ich genauso wie du keinen blassen Schimmer, was diesem Mann gefallen könnte. Was hast du denn dem letzten neuen Mitbewohner geschenkt?«
»Blumen für die Beerdigung. Und es war eine Mitbewohnerin. Sie ist gleich in der ersten Woche hier gestorben.«
»Himmel! Ach, du meine Güte. Verstehe, das ist ja … schrecklich.«
»Nicht für sie. Herzinfarkt, im Schlaf. Hat nichts mitbekommen, die Glückliche. So will ich auch gehen. Und je eher, desto besser, wenn du mich fragst.«
»Na ja … wie wäre es mit einem hübschen Paar Pantoffeln? Seine Schuhgröße lässt sich doch bestimmt herausfinden.«
Seren wollte auf keinen Fall schon wieder hören, wie sehr ihre Tante sich danach sehnte zu gehen, und zwar nicht nur aus dem Pflegeheim. Nelly mochte einfach nicht mehr; ihrer Meinung nach hatte sie die ihr zugedachte Lebenszeit bereits erheblich überzogen und hätte schon längst in den Himmel zurückkehren sollen. Nicht, dass die alte Dame an den Himmel geglaubt hätte – oder an die Hölle. Sie wollte es einfach hinter sich haben. Sie war es leid, so alt und gebrechlich zu sein. Mit diesen Gedanken hielt sie sich nicht zurück, sie teilte sie gern und oft mit allen, die sie hören wollten, und bestimmt konnte sich auch der neue Mitbewohner auf einen Vortrag diesbezüglich gefasst machen. Seren beneidete den Mann nicht.
»Wie heißt er denn?«, erkundigte sie sich stattdessen.
»Edwin Soundso. Den Nachnamen habe ich gleich vergessen. So ist das im Alter: Ständig vergisst man etwas, und man hat seine Blase nicht mehr unter Kontrolle.«
»Es ist doch bestimmt schön, jemand Neues kennenzulernen, mit dem du dich unterhalten kannst.« Seren ignorierte die Anspielung auf Blasenprobleme und bemühte sich um ein Thema, das ihre Tante nicht gleich wieder auf die Palme brachte. Nelly war heute wirklich extrem schlecht gelaunt.
»Pantoffeln schenke ich ihm auf gar keinen Fall! Dafür sorgen schon die Verwandten, wenn man an einen Ort wie diesen hier verfrachtet wird. Es gibt neue Pantoffeln, einen neuen Morgenmantel und neue Schlafanzüge. Die denken wohl, hier geht es zu wie in einem verdammten Krankenhaus, und wir liegen den lieben langen Tag im Bett. Schön wär’s!«
»Du fändest es doch schrecklich, den ganzen Tag im Bett zu liegen.«
»Tagsüber fernsehen finde ich noch schrecklicher.«
»Was ist denn für heute Nachmittag geplant?« Seren versuchte es erneut mit einem Themenwechsel. Im Heim stand jeden Tag Beschäftigung auf dem Programm, und Seren wusste, dass ihre Tante von Zeit zu Zeit mitmachte.
»Ein Quiz.«
»Das ist doch schön.«
»Ist es nicht.«
Seren widerstand der Versuchung, die Augen zu verdrehen.
»Ich hätte auch gern etwas für Dorothy«, knurrte Nelly. »Sie hat nächste Woche Geburtstag. Und komm mir jetzt bloß nicht mit Pralinen!«, schnappte sie, noch bevor Seren etwas erwidern konnte. »Oder Duftwässerchen oder Taschentüchern! Den Schwachsinn kriegt sie von ihren Kindern mehr als genug. Von denen hat keiner auch nur einen Funken Fantasie. Grr!«
Hatte ihre Tante eben wirklich geknurrt?
»Wir könnten doch mal im Internet schauen«, schlug Seren vor.
Nelly holte einmal tief Luft, um sie dann vernehmlich wieder auszustoßen. »Ich möchte die Sachen sehen, nicht nur auf Fotos! Online-Shopping ist genauso blöd, wie aus einem Katalog zu bestellen. Wenn die Sachen da sind, sehen sie überhaupt nicht so aus wie auf den Bildern. Und wie soll man Qualität beurteilen, wenn man nichts anfassen kann?«
Es blieb also nur noch eine Möglichkeit. Seren sammelte sich kurz. »Und wenn ich mit dir einkaufen fahre?«
»Und kannst du mir auch sagen, wie das gehen soll? Beim letzten Mal musste dein Vater mitkommen, weil du mich nicht allein in deinen Wagen hieven oder später wieder herausholen konntest. Selbst mit seiner Hilfe hat es so lange gedauert, mich in den Rollstuhl zu setzen, dass die Geschäfte schon fast wieder geschlossen hatten. Und dein Vater hat sich so ungeschickt angestellt, dass ich hinterher zwei Wochen lang am Hintern blaue Flecken hatte. Danke für das Angebot, aber da verzichte ich doch lieber und bleibe, wo ich bin.«
Seren hatte den Ausflug nicht ganz so dramatisch in Erinnerung. Im Großen und Ganzen jedoch kam die Schilderung ihrer Tante den wahren Ereignissen schon ziemlich nahe.
Tante Nelly war nicht zufrieden gewesen, obwohl sich Serens Vater wirklich alle Mühe gegeben hatte, ihr ins Auto und später wieder herauszuhelfen – beides hatte sich als wirklich schwierig erwiesen. Und es hatte tatsächlich ziemlich lange gedauert, den geliehenen Rollstuhl über die Bürgersteige und in die diversen Läden zu manövrieren, wobei sich Nelly die ganze Zeit empört beschwert hatte.
Auch für ihre Tante war es bestimmt nicht einfach gewesen. In vielen Läden drängten sich Auslagen und Regale so dicht, dass selbst schlanke Menschen sich nur schwer dazwischen hindurchschlängeln konnten, von einer Zweiundneunzigjährigen in einem Rollstuhl ganz zu schweigen.
Dieser Shopping-Ausflug lag nun mehr als ein Jahr zurück. So lange hatte Seren gebraucht, um den Mut aufzubringen, einen zweiten vorzuschlagen, und als Großtante Nelly ihr Angebot rundheraus ablehnte, kannte ihre Erleichterung keine Grenzen.
Doch leider fiel ihr in puncto Geschenke nun nichts mehr ein. Entweder sie selbst besorgte etwas und es gefiel ihrer Tante – was unwahrscheinlich war. Bestimmt würde Seren das Geschenk in den Laden zurückbringen und sich das Geld erstatten lassen müssen. Oder Nelly musste eben doch im Internet etwas aussuchen.
»Wie läuft es bei der Arbeit?«, wollte ihre Großtante nun wissen. Seren verzog das Gesicht.
»Wie immer.«
»Du musst da raus.«
»Himmel, wie sich das anhört! Nur weil ich in einem Supermarkt arbeite, heißt das noch lange nicht, dass mein Job nichts taugt!«, wehrte sich Seren.
»Das habe ich auch gar nicht behauptet. Aber wenn dir die Arbeit so sehr missfällt, wie sie es meiner Meinung nach tut, musst du dir etwas anderes suchen.«
Seren zuckte die Achseln. »Da hast du wohl recht. Bloß weiß ich nicht, was ich sonst tun könnte.«
Nelly schnaubte. »Du hast doch was im Kopf, also benutz gefälligst deinen Grips! Das Leben ist viel zu kurz, um es an einen Job zu verschwenden, der dir zuwider ist. Such dir etwas, das dir Spaß macht, und dann los.«
Erneut musste Seren das Gesicht verziehen. Was Nelly empfahl, war leichter gesagt als getan. Sie war sich nicht sicher, was sie tun wollte oder was sie wirklich gern tat. Und das war im Grunde ziemlich traurig.
»Pass lieber auf«, warnte Nelly. »Wenn der Wind aus der falschen Richtung bläst, bleibt dein Gesicht so, wie du es im Moment verziehst. Was schade wäre, wo es doch eigentlich so hübsch ist.«
Plötzliche Geschäftigkeit, eilige, schlurfende Schritte und laute Stimmen ließen Nelly aufhorchen. Sie richtete sich auf und sah sich neugierig um. »Welchen Wochentag haben wir heute?«, wollte sie wissen.
»Mittwoch.«
»Hilf mir aus dem Stuhl, ich will nicht die Letzte sein! Sonst sind die Guten alle weg.«
Die Guten? Seren wunderte sich, fragte aber nicht nach, während sie ihrer Tante aus dem Sessel half und ihr den Rollator zurechtrückte.
»Den Rest schaffe ich allein, geh du ruhig nach Hause«, ordnete Nelly an. »Oder …?« Sie musterte ihre Großnichte abschätzend. »Oder du drängelst dich vor und hältst die Massen in Schach, bis ich zu dir aufschließen kann?«
»Das mache ich auf gar keinen Fall.«
»Dachte ich mir schon. Spielverderberin. Hast einfach keinen Mumm in den Knochen, Mädchen.«
Seren folgte ihrer Großtante langsam Richtung Haupteingang. Im Foyer angekommen, entdeckte sie den Grund für die Aufregung: Draußen auf dem Parkplatz stand der Bücherbus der örtlichen Bücherei. Die meisten Heimbewohner hätten die steile Treppe hoch in den Wagen nicht mehr bewältigen können, aber die Seiten des großen Fahrzeugs ließen sich nach oben hin öffnen, sodass sie eine Art Markise bildeten. Auf diese Weise kamen Reihen von Bücherregalen zum Vorschein, und durch die offene Tür konnte Seren weitere Bücher sehen, die sich innerhalb des Wagens befanden. Gerade reichte eine Bibliothekarin Bücherkartons an einen Pfleger weiter, der sie den Bewohnern bringen sollte, die das Haus nicht mehr verlassen konnten. Die meisten Heimbewohner traten jedoch hier draußen in der Kälte von einem Bein auf das andere und konnten es kaum erwarten, einen der neuesten Bestseller in die Hände zu bekommen.
»Bitte, haben Sie etwas Geduld«, bat der diensthabende Heimleiter. »Sie müssen nicht zu den Büchern gehen, die Bücher kommen zu Ihnen. Möchten Sie nicht lieber alle wieder hineingehen?« Er unterstrich seine kleine Rede durch verzweifelte Handbewegungen, die jedoch von sämtlichen Anwesenden geflissentlich ignoriert wurden.
»Herrscht hier immer so ein Gedränge, wenn der Bücherbus kommt?«, erkundigte sich Seren bei ihrer Tante, nachdem sie zugesehen hatte, wie sich die alte Dame unter Einsatz von Gehhilfe und Ellbogen resolut bis ganz nach vorn geschoben hatte. Sie mochte winzig sein, zerbrechlich und gebeugt, sie mochte so schmal und verletzlich wirken wie ein Vögelchen, aber in ihr steckte noch eine gehörige Menge Kraft.
»Für mich ist das der absolute Höhepunkt der Woche«, erklärte Nelly. »Ich kann mir die Bücher selbst aussuchen – wenn ich die Chance kriege, und mir die anderen nicht die besten vor der Nase wegschnappen.« Sie musterte ihre Mitbewohner mit misstrauischen Blicken. »Selbstsüchtige Bande! Eigentlich …« Ohne ihren Satz zu beenden, starrte sie Seren an. »Eigentlich könnten wir genau so etwas für Geschenke gebrauchen!«
Seren erwiderte ihren Blick ebenso unverwandt. In ihrem Kopf gingen gerade hektisch blinkend alle möglichen Glühbirnen an. »Denkst du gerade das, was ich auch denke?«, wollte sie wissen.
»Keine Ahnung, was du denkst, aber ich dachte gerade, es muss doch irgendeinen geschäftstüchtigen und einfallsreichen Menschen geben, der es schafft, Waren zu Leuten zu bringen, ohne dass diese dafür aus dem Haus gehen müssen. Und damit meine ich nicht den Lieferdienst von Amazon!« Nelly war vor lauter Aufregung ins Schwanken geraten, und Seren streckte rasch die Hand aus, um ihre Tante zu stützen, bis diese sich wieder gefangen hatte.
»Setz dich an dein Internet«, befahl ihre Tante, »und guck nach Leuten, die uns besuchen kommen. Es wird sich für sie lohnen.« Nelly wackelte mit ihren grauen Brauen und löste ihre rechte Hand kurz vom Rollator, um Daumen und Zeigefinger aneinander zu reiben. »Wenn du verstehst, was ich meine.«
»Ich werde sehen, was sich machen lässt«, versprach Seren. Bestimmt hatte ihre Großtante recht, und es gab da draußen jemanden, der einen solchen Service anbot. Sobald sie den entdeckt hatte, würde sie Himmel und Erde in Bewegung setzen und dafür sorgen, dass Nelly und die anderen Heimbewohner den so dringend benötigten Besuch bekamen.
***
Sie wurde nicht fündig. Es gab da draußen nichts, absolut gar nichts dergleichen, jedenfalls nicht in einer halbwegs akzeptablen Entfernung. Ungehalten klappte Seren ihren uralten Laptop zu und sackte auf ihrem Stuhl in sich zusammen.
»Was ist denn los, Sternchen?«, rief ihr Vater, der sich gerade im Fernsehen die Nachrichten ansah und dabei staunend und ein wenig angewidert den Kopf schüttelte. »Schau dir das mal an!«, fuhr er fort. »Da hat doch irgend so ein Volltrottel wirklich die große Eiche im Park mit abgetrennten Köpfen behängt!«
Seren schreckte hoch. »Mit echten?«
Die Kamera fuhr näher an die Köpfe heran, und Seren stellte erleichtert fest, dass es sich um Puppenköpfe handelte, nicht etwa um menschliche. Unheimlich sah das Ganze trotzdem aus.
»Blödsinn! Wir sind hier in Tinstone und nicht in London. Wahrscheinlich wegen Halloween. Sobald das vorbei ist und danach noch der Unsinn mit dem Feuerwerk am fünften November, hängen sie sofort die Weihnachtsdekoration auf. Im Supermarkt gibt es jetzt schon die schicken Pralinenschachteln von Roses und Quality Street.« Ihr Vater schüttelte missbilligend den Kopf.
»Du magst doch Weihnachten«, rief ihm Seren ins Gedächtnis.
»Aber nicht schon im Oktober!«
Seren wollte ihn gerade darauf hinweisen, dass vom Oktober nur noch wenige Tage übrig waren, ließ es dann aber sein. Sie selbst liebte Weihnachten zu jeder Jahreszeit, und wäre es nach ihr gegangen, würde die Weihnachtsdekoration das ganze Jahr über bleiben. Vielleicht nicht gerade der aufblasbare Weihnachtsmann im Vorgarten, aber ganz bestimmt der Baum und die blinkenden Lichterketten am Haus, ganz zu schweigen von den wunderschönen Girlanden und Kugeln drinnen. Seren flocht die Girlanden und den Kranz für die Haustür jedes Jahr selbst, und sie bastelte auch den Tischschmuck für den Esstisch, alles aus frischen Fichtenzweigen, Efeu, Ilex und Mistelzweigen. Wenn sie erst eine eigene Wohnung hatte …
»Was ist denn mit dir los? Du ziehst ja ein Gesicht wie ein zerknautschtes Suppenhuhn.«
Seren schreckte aus ihren Gedanken. Ihr Vater gluckste vergnügt vor sich hin.
»Tante Nelly«, seufzte sie.
»Was hat sie denn jetzt schon wieder verbrochen?« Ihr Vater verdrehte die Augen.
»Nichts. Sie möchte gern ein paar Geschenke kaufen, kann ja aber nicht einfach losziehen und draußen irgendetwas aussuchen.«
Serens Vater warf ihr einen entsetzten Blick zu.
»Keine Sorge!«, versicherte sie ihm hastig. »Sie will gar nicht shoppen gehen. Sie möchte, dass die Einkaufsmöglichkeiten zu ihr kommen.«
»Dafür wollen wir dankbar sein. Im Prinzip habe ich ja nichts dagegen, von Zeit zu Zeit mal mit ihr loszuziehen, aber als sie sagte, sie müsse auf die Toilette und ich solle mit, um ihr aus dem Rollstuhl zu helfen …« Die Erinnerung ließ ihren Vater erschaudern.
Seren biss sich auf die Lippen, um nicht loszulachen. »Aber du hast sie ja gar nicht aufs Klo begleitet, ich bin mitgegangen.«
»Die bloße Vorstellung hat mir gereicht. Sie ist schließlich eine Frau, da konnte ich sie schlecht mit auf die Männertoilette nehmen. Und wenn ich bei den Damen … Nicht auszudenken! Man hätte mich doch glatt verhaftet.«
Es hätte eine Behindertentoilette gegeben, für die sie sich allerdings erst einen Schlüssel hätten besorgen müssen, und so lange, hatte Serens Großtante erklärt, könne sie nicht warten.
Nelly war die Tante von Serens Vater, also die Schwester seiner Mutter. Von den insgesamt acht Geschwistern, die sie einmal gewesen waren, lebte nur noch sie, die Letzte ihrer Generation, und Seren war dankbar dafür, dass es sie gab. Wenn sie starb, blieben in der engeren Familie nur noch Seren und ihr Vater Patrick. Natürlich gab es auch noch Serens Mutter, doch diese lebte mit ihrem zweiten Mann auf der Isle of Man, und da Seren sie nur ein, zwei Mal im Jahr sah, zählte sie im Grunde nicht richtig dazu. Für Seren spielte ihre Mutter schon ziemlich lange keine große Rolle mehr. Seit ihrem fünfzehnten Lebensjahr waren Seren und Patrick ein eingeschworenes Team.
»Und online hast du nichts gefunden?«, erkundigte sich ihr Vater jetzt mit mitfühlendem Blick auf ihren Laptop. »Wie wäre es mit Parfüm oder Pantoffeln?«
»Damit darfst du Nelly gar nicht erst kommen. Ich habe es versucht, und sie hat mich dafür regelrecht in der Luft zerfetzt. Sie möchte selbst etwas aussuchen.«
»Im Heim gibt es einen Computer, den alle Bewohner benutzen können. Setz sie doch da dran.«
»Sie möchte sich die Dinge aber richtig anschauen können, sie möchte sie anfassen. Im Grunde hätte sie gern so etwas wie den Bücherbus, nur für Geschenke.«
»Das musst du mir erklären!« Da ihr Vater sie verständnislos anschaute, erzählte ihm Seren, worüber sie mit Tante Nelly gesprochen hatte.
»Und du hast im Internet niemanden gefunden, der so einen Service anbietet?«, hakte ihr Vater nach, nachdem sie ihm erklärt hatte, wieso die fahrende Bücherei dafür verantwortlich war, dass sie seit ihrer Heimkehr praktisch ununterbrochen am Laptop gesessen hatte.
»Es gibt schon ein oder zwei Angebote dieser Art, aber leider meilenweit entfernt. Genauer gesagt in Schottland.«
»Das nützt uns aber nichts, oder? Da musst du wohl noch einmal von vorne anfangen.«
»Ich muss es vor allem Tante Nelly beibringen«, stöhnte Seren. »Die wird nicht gerade begeistert sein.«
»Du könntest ein paar Sachen kaufen und ihr vorbeibringen. Vielleicht hast du Glück und ihr gefällt etwas davon.«
»Das wäre eine Idee. Ich behalte die Kassenbons, dann kann ich die Sachen notfalls zurückbringen und mir das Geld wiedergeben lassen. Das Problem ist nur, dass sie nicht weiß, was sie will.«
»Das geht uns doch allen so«, murmelte ihr Dad und drehte den Ton des Fernsehers wieder lauter, während Seren dasaß und sich wünschte, mehr für ihre Tante tun zu können.
»Es muss doch auch hier in der Gegend jemanden geben, der einen mobilen Geschenkeladen betreibt«, seufzte sie. »Es gibt bestimmt Bedarf dafür, und zwar nicht nur bei Bewohnern von Pflegeheimen. Genügend Menschen sind nicht mehr so mobil, und die würden sich sicher über einen Geschenkeladen freuen, der zu ihnen kommt.«
Sie sah ihren Vater an und hoffte auf Zustimmung, erntete aber lediglich weiteres Kopfschütteln.
Tja, sie hatte getan, was sie konnte. Nelly würde sich mit der Auswahl im Internet zufriedengeben müssen, oder aber mit den Geschenken, die Seren für sie aussuchte.
Kapitel 2
Mit einem schiefen Grinsen übergab Daniel seinem Freund Tobias die Schlüssel für seinen Pick-up. Sein Kumpel war ein absoluter Zauberkünstler, was Autos betraf. Er hatte sich vor einigen Jahren mit einer Werkstatt selbstständig gemacht, die auf den Umbau aller möglicher Fahrzeuge zu Wohnwagen und Wohnmobilen spezialisiert war. Er tat Daniel einen Gefallen, indem er sich den widerspenstigen Auspuff des Pick-ups ansah, und gleich noch einen, weil er ihm für die Zwischenzeit ein Auto lieh, damit sein Freund einen fahrbaren Untersatz hatte.
»Sag jetzt bitte nicht, dass es mich ein Vermögen kosten wird«, bat Daniel.
»Ich verspreche, die Kosten so niedrig wie möglich zu halten.« Tobias versenkte die Autoschlüssel in der Tasche seines Overalls und wandte seine Aufmerksamkeit wieder dem Campingbus zu, den er gerade generalüberholte.
»Danke. Ich wüsste wirklich nicht, was ich ohne dich tun würde.« Glücklicherweise brauchte Daniel den Pick-up im Moment nicht allzu dringend, denn für ihn wurde es, was die Arbeit betraf, allmählich ruhiger. Je näher Weihnachten rückte, desto weniger hatten die Leute ihre Gartenarbeit im Sinn. Das nervte zwar, ließ sich aber nicht ändern. Als selbstständiger Gärtner hatte Daniel in dieser Jahreszeit einfach weniger Arbeit als sonst. Nach dem Jahreswechsel änderte sich das erfahrungsgemäß sofort wieder, und es standen für Januar bereits zwei Aufträge in seinem Kalender, aber bis dahin musste er sich auf magere Zeiten einstellen. Ein paar kleinere Aufträge hier und da bis Mitte November, doch im Grunde war die Auftragslage jetzt schon ziemlich flau.
»Ich hoffe bloß, du findest nicht noch mehr, was ihm fehlt.« Daniel seufzte. Er konnte es sich so schon kaum leisten, Tobias zu bezahlen, obwohl der ihm einen überaus großzügigen Freundschaftsrabatt einräumte.
Tobias, der wusste, dass es seinem Freund in den Wintermonaten schwerfiel, den Kopf über Wasser zu halten, warf ihm einen mitfühlenden Blick zu.
»Hast du denn überhaupt Aufträge in Aussicht?«, erkundigte er sich.
»Nicht viele. Dafür habe ich diesen Winter Saisonarbeit übernommen«, erklärte Daniel unbedacht. »Hat allerdings nichts mit Gartenarbeit zu tun.«
»Ach ja? Was machst du denn?«
»Ich spiele den Weihnachtsmann.« Daniels Stimme war leise geworden, und er wünschte sich bereits, nichts gesagt zu haben. Der Job an sich war schon peinlich genug, da brauchte er nicht noch die blöden Sprüche von Tobias, mit denen er jetzt, wo sein Freund Bescheid wusste, unter Garantie zu rechnen hatte.
Da ging es auch schon los.
»Du als Weihnachtsmann?«, prustete Tobias. »Das muss ich mir ansehen! Darf ich auf deinem Schoß sitzen? Und auf welcher Liste stehe ich? Bei den artigen Kindern oder den unartigen?« Er nahm sich ein Stück des Isolationsmaterials vor, mit dem er gerade am Dach des Campingbusses arbeitete, und betrachtete es mit kritischem Blick und einem Grinsen auf den Lippen.
»Ach, halt doch die Klappe!« Daniel fragte sich, ob er Tobias seine Hilfe anbieten sollte oder hier doch nur im Weg stehen würde. Er arbeitete gern mit den Händen, hatte sich aber für Spaten und Kompost entschieden, nicht für Schraubenschlüssel und Maschinenöl.
»Mal im Ernst, Daniel, du machst das bestimmt prima. Du kannst doch gut mit Kindern.« Tobias bemerkte zu spät, was ihm da rausgerutscht war, und verzog das Gesicht. »Tut mir echt leid, Kumpel, ich habe nicht nachgedacht.«
»Kein Ding. Ist ja nun nicht so, als wäre ich Amelias richtiger Dad.« Daniel, der auf keinen Fall über seine gescheiterte Beziehung mit Amelias Mutter sprechen wollte, war froh, als Tobias’ Handy klingelte.
»T&M Umbauten, hallo?« Tobias klemmte sich das Handy zwischen Kinn und Schulter und versuchte, mit der freien Hand das Isoliermaterial festzuhalten. »Moment, ich stelle das Gespräch auf Lautsprecher.«
Daniel formte mit den Händen ein T und sah Tobias fragend an. Der nickte. Also würden sie zusammen noch eine Tasse Tee trinken, doch danach würde er gehen. Tobias hatte zu tun, und Daniel wollte seinem Freund nicht noch mehr Zeit stehlen, wo er sich doch schon so bereitwillig um den Pick-up kümmerte.
Tobias war ein prima Kumpel, aber ein kleiner Frauenheld und Playboy. Immer wieder hatte er eine neue Flamme am Start, und Daniel beneidete ihn um das Talent, sich scheinbar mühelos beim anderen Geschlecht beliebt zu machen. Daniel wünschte sich, mehr wie sein Freund zu sein, mit einer ähnlich lässigen Einstellung, aber bisher hatte sich an seiner eigenen, eher ernsthaften Haltung in Bezug auf Beziehungen noch nichts geändert, was wahrscheinlich auch so bleiben würde. Er nahm Beziehungen eben nicht so leicht wie Tobias, wobei man ja sehen konnte, was ihm das eingebracht hatte, dachte er düster: Gina.
Während Daniel hinüber zum Wasserkocher ging, hörte er halb zu, wie Tobias telefonierte, halb achtete er auf den Song von Ed Sheeran, der gerade im Radio gespielt wurde. In dem Lied ging es um den Tod und den Himmel, so gefühlvoll, dass ihm fast die Tränen kamen.
»Können Sie auch einen Van umbauen?«, erkundigte sich gerade eine Männerstimme über den Lautsprecher des Handys, und als Daniel sich zu Tobias umsah, bekam er gerade noch mit, wie der das Isoliermaterial aus der Hand legte und sich interessiert aufrichtete.
»Ja«, antwortete er. »Woran haben Sie denn gedacht?«
»Einen Eiswagen.«
»Soll ich einen Kleinbus wie einen Transit in einen Eiswagen umbauen? Oder haben Sie schon einen Eiswagen, der schick gemacht werden soll?«
»Ich überlege, für meine Tochter einen ausrangierten Eiswagen zu kaufen. Aber nicht, um damit weiterhin Eis zu verkaufen.«
»Sie möchten ihn also zu einem Campingbus ausbauen?«, fragte Tobias.
Daniel wusste, dass sein Freund schon an seltsameren Fahrzeugen herumgebastelt hatte, unter anderem an einem Feuerwehrauto. Im Grunde konnte jedes Fahrzeug zu einem Campingbus umgebaut werden, wenn man das nötige Geld hatte. Tobias steuerte Fantasie und Expertise bei und war wirklich gut in dem, was er tat. So ließen sich viele Projekte verwirklichen.
»Nein, eigentlich nicht«, antwortete der Anrufer.
»Was soll es denn dann werden, wenn ich fragen darf?« Tobias deutete mit dem Kinn auf ein Päckchen Kekse neben dem Wasserkocher und zog bittend die Brauen hoch.
»Ein mobiler Geschenkeladen.«
»Ach ja?« Tobias warf Daniel einen Blick zu und runzelte die Stirn. Wollte ihn da jemand auf den Arm nehmen?
»Meine Tochter hat eine Tante«, fuhr der Mann fort. »Na ja, sie ist eigentlich meine Tante, und sie lebt in einem Pflegeheim. Als dort neulich der Bücherbus vorbeikam, hatte sie eine Idee.«
»Ihre Tochter oder Ihre Tante?«
»Eigentlich hatte ich die Idee. Ich fange wohl lieber noch mal von vorne an, ja? Ich überlege, einen gebrauchten Eiswagen zu kaufen und ihn zu einem mobilen Laden umbauen zu lassen. Ginge das?«
»Na klar.«
»Okay! Wie viel würde das denn kosten?«
Daniel klemmte sich die Kekspackung unter den Arm, nahm die beiden Tassen mit dem Tee, der inzwischen fertig gezogen hatte, und ging hinüber zu Tobias.
Der bedankte sich mit einem stummen Nicken, bevor er sich wieder seinem Telefonat zuwandte. »Hängt ganz von den Arbeiten ab, die Sie wünschen.«
»Natürlich, verstehe. Aber Sie würden das auf jeden Fall hinkriegen?«
»Garantiert.«
»Okay, dann muss ich ihn nur noch kaufen.«
»Sobald Sie das Fahrzeug haben, bringen Sie es her. Dann unterhalten wir uns und beraten, wie es weitergehen soll.«
»Abgemacht! Danke und bis bald.«
Tobias steckte sich sein Handy in die Tasche. »Eins kann ich dir verraten«, sagte er zu Daniel. »Langweilig wird mein Job nie. Eigentlich ein bisschen so wie bei dir. Kein Auftrag ist wie der andere, und auch jeder Kunde ist anders.«
»Ich frage mich allerdings, ob du diesen Typen je zu Gesicht bekommst. Ihn und den Eiswagen, den er noch nicht mal gekauft hat.«
»Keine Ahnung! Aber weißt du, wen ich gern kennenlernen würde?«
»Wen denn?« Daniel trank schlürfend einen Schluck Tee.
»Den Weihnachtsmann! Ho, ho, ho.«
Daniel seufzte. Das würde er jetzt nicht mehr loswerden!
***
»Bist du das, Daniel?« Die Stimme von Daniels Mutter Linda drang so laut durch das Handy, dass er es mit schmerzverzerrtem Gesicht vom Ohr riss.
»Ja, Mum, ich bin’s.« Ganz kurz fragte sich Daniel besorgt, wieso seine Mutter a) seine Stimme nicht erkannte und b) glaubte, jemand anderes als er selbst könnte an sein Handy gehen.
»Gut, ich bin froh, dass ich dich erwische. Ich wollte dir erzählen, dass dein Großvater den Einzug gut überstanden hat. Er hat das schöne Zimmer bekommen, von dem ich dir erzählt hatte, das mit Blick auf den Garten. Er hat ausgepackt und freut sich darauf, sich an den Aktivitäten im Heim zu beteiligen.«
»Wunderbar. Ich springe auf dem Nachhauseweg kurz rein und sage ihm Guten Tag. Kann ich ihm etwas mitbringen? Braucht er noch irgendwas, hat er etwas vergessen?«
»Er braucht höchstens dich. Er wird sich so freuen, dich zu sehen.«
»Er hat mich doch gestern erst gesehen.«
»Ich habe Angst, er könnte glauben, wir vergessen ihn.«
»Mum, er ist gerade mal ein paar Stunden weg! Und es war seine Entscheidung, ins Heim zu ziehen.« Warum allerdings, das verstand Daniel immer noch nicht ganz. Die Parkinson-Erkrankung seines Großvaters war doch wirklich noch nicht so schlimm. Aber darum ging es ihm wohl: noch nicht. Es würde schlimmer werden, und niemand konnte sagen, wie schnell die Krankheit voranschreiten und welchen Verfall sie verursachen würde.
»Ich wollte nicht, dass er auszieht«, jammerte Daniels Mutter, und er konnte hören, dass sie den Tränen nahe war.
»Ich doch auch nicht. Wir hätten es geschafft.« Irgendwie hätten sie es bestimmt geschafft, auch wenn Daniel nicht hätte sagen können, wie genau.
»Ja, das hätten wir!« Linda schniefte. »Ich hätte frühzeitig in Rente gehen können, und es gibt die häusliche Pflege. Zusammen hätten wir das hinbekommen.«
»Ich hätte wieder nach Hause ziehen können …« Und genau an diesem Punkt war bei den Diskussionen das ganze Plädoyer gegen Grandpa Edwins Umzug in ein Heim in sich zusammengefallen.
Edwin hatte nichts davon hören wollen. So etwas habe er sich für das Leben seines Enkels nicht vorgestellt, hatte er entschieden erklärt und war von diesem Standpunkt auch nicht abgewichen. Es hatte hitzige Debatten darüber gegeben, wie wenig er davon halte, wenn Daniel seine Jugend daran »verschwenden« würde, einen alten Mann zu versorgen.
Wobei Edwin mit dieser Ansicht allein war, denn Daniel sah das ganz und gar nicht so. Er war inzwischen einunddreißig Jahre alt, seine Jugend schwand also so oder so schon dahin, wie er fand, und er hätte absolut nichts dagegen gehabt, seinem Großvater die Umsiedlung in ein Heim zu ersparen. Zurzeit ließ er ohnehin nicht gerade die Puppen tanzen, und es sah auch nicht so aus, als würde sich das in absehbarer Zukunft ändern.
Aber Edwin, bei klarem Verstand und wild entschlossen, hatte auf dem Umzug bestanden, und weder sein Enkel noch seine Tochter hatten ihn umstimmen oder in dieser Angelegenheit eine andere Entscheidung erzwingen können.
»Hallo?« Als die Stimme seiner Mutter erneut lautstark an sein Ohr drang, wurde Daniel klar, dass er wohl schon eine ganze Weile nichts mehr gesagt hatte.
»Ja, bin noch dran.«
»Hast du Lust, zum Abendessen vorbeizukommen? Ich habe einen leckeren Eintopf gekocht.«
»Wunderbar. Ich schaue bei Grandpa vorbei, und dann komme ich zu dir.«
Es entstand eine kurze Pause, bevor seine Mutter sagte: »Gina hat angerufen. Sei bitte nicht sauer. Sie sagt, sie kann dich auf dem Handy nicht erreichen.«
»Das liegt daran, dass ich ihre Nummer geblockt habe.« Angst legte sich wie ein Schraubstock um Daniels Burst. »Was wollte sie denn? Ist etwas mit Amelia?«
»Amelia geht es gut, soweit ich weiß. Aber Gina ist aufgebracht.«
Also versuchte sie jetzt, durch seine Mum an ihn heranzukommen? »Fies, echt fies, Gina«, murmelte Daniel, um dann lauter fortzufahren: »Und ob sie aufgebracht ist. Weil sie auf frischer Tat ertappt worden ist. Wenn ich an dem Abend nicht ausgegangen, sondern zu Hause geblieben wäre, wie ich es ihr gesagt hatte, dann hätte ich sie nie mit ihrem Ex erwischt.«
»Sie behauptet, da wäre nichts passiert.«
»Zungentango ist passiert!«
»Igitt!«, rief seine Mutter. »Erspar mir die Einzelheiten.« Sie schien kurz zu zögern. »Für Amelia ist es sicher nicht leicht«, sagte sie dann. »Erst bist du Teil ihres Lebens und dann auf einmal nicht mehr.«
»Ich weiß …« Daniel presste die Lippen aufeinander. Für ihn war es auch nicht leicht. Das Mädchen fehlte ihm sehr, und Daniel wusste, dass seine Mum nur helfen wollte, aber … »Ich kann nicht wegen Amelia mit Gina zusammenblieben. Es wäre etwas anderes, wenn sie meine Tochter wäre, aber so habe ich keinerlei Rechte. Ich bin einfach nur ein Typ, mit dem ihre Mutter geschlafen hat.«
»So einfach ist es nicht! Zwei Jahre – im Leben eines Kindes ist das eine lange Zeit.«
»Das stimmt. Und ich hätte mich auch nie so mit Gina eingelassen, wenn ich gewusst hätte, wozu sie in der Lage ist.«
»Das arme Kind muss völlig durcheinander sein. Ich wette, sie versteht gar nicht, warum du nicht mehr da bist.«
Damit hatte seine Mutter den Nagel auf den Kopf getroffen: Amelia verstand es wirklich nicht. Aber sie war nicht Daniels Tochter, und selbst wenn sie es wäre, Daniel hätte nicht gewusst, ob er auf Dauer mit einer Frau zusammen sein könnte, die sich als untreu erwiesen hatte. Die Kleine fehlte ihm unglaublich, sogar mehr als ihre Mutter, aber nach dem, was Gina getan hatte, konnte er sich unmöglich mit ihr versöhnen. Wer sagte ihm denn, dass sie es nicht wieder tun würde?
Nein, eine klare, sofortige Trennung war besser, als sich noch ein paar Monate lang mit der Entscheidung herumzuschleppen. Ihre Beziehung war zu Ende. Amelia hatte einen Vater, und das war nicht Daniel, auch wenn er es gern gewesen wäre.
Amelias leiblicher Vater war der Kerl, dessen Mandeln Gina in der Kneipe so intensiv mit der Zunge erkundet hatte. Und was hatte Daniel als Erstes gedacht, als er die beiden beim leidenschaftlichen Knutschen erwischt hatte? Ganz spontan hatte er sich für Amelia gefreut, weil es so aussah, als wären ihre Eltern wieder zusammen. Das allein sagte doch schon eine Menge über seine Beziehung zu Gina aus.
Wegen Amelia war Daniel dann zu Tode betrübt gewesen, als ihm durch die Gerüchteküche zu Ohren gekommen war, dass Carl gar kein Interesse daran hatte, wieder mit Gina zusammenzukommen. Aber das erklärte zumindest, warum Gina ihn jetzt wieder bedrängte und ihre Beziehung gerne wiederbeleben würde. Da hatte sie allerdings Pech. Er konnte weder vergeben noch vergessen.
***
Daniel drückte auf den Klingelknopf und wartete auf Einlass ins Pflegeheim. Er hatte keine Erfahrung mit solchen Einrichtungen und wusste nicht recht, worauf er sich einstellen sollte. Er war angenehm überrascht, wie neu und modern das Gebäude sich präsentierte und wie gepflegt die dazu gehörenden Gartenanlagen wirkten. Natürlich sah man vom Parkplatz aus nur die Vorderseite, aber laut seiner Mutter hatten die Bewohner Zugang zum Garten hinter dem Heim, der angeblich genauso schön war wie die Anlage vorne, wenn nicht sogar noch schöner.
Die Tür ging auf, nachdem er durch die Gegensprechanlage seinen Namen und den Grund seines Besuchs genannt hatte, und er trat ein. Halb hatte er damit gerechnet, dass es hier nach Kohl und Desinfektionsmitteln riechen würde, stattdessen streifte ihn der Duft eines Blumenstraußes auf dem Empfangstresen, und dann roch es noch ganz schwach nach Möbelpolitur und frisch gebrühtem Kaffee.
Daniel betrat den hellen, luftigen Eingangsbereich, der ihn eher an ein Hotelfoyer erinnerte, und erkundigte sich am Empfang nach dem Zimmer seines Großvaters.
»Edwin? Den finden Sie entweder im Spielezimmer oder in seinem Schlafzimmer«, erklärte ihm die Empfangsdame und wies in die entsprechende Richtung.
Immer noch mit einer gewissen Anspannung in den Gliedern, machte sich Daniel auf den Weg den Flur hinunter. Dabei fielen ihm die gerahmten Drucke an der Wand und der zweckdienliche Teppich unter seinen Sohlen auf. Er fühlte sich nach wie vor an ein Hotel erinnert. An eins der unteren Mittelklasse, eindeutig keine Billigabsteige und weit entfernt von der finsteren, krankenhausähnlichen Einrichtung, mit der er gerechnet hatte.
Lautes Lachen und erhobene Stimmen zogen ihn weiter. Im Vorübergehen warf er neugierige Blicke durch offene Türen, entdeckte einen Speisesaal, eine Teeküche und mehrere Schlafzimmer.
Im Spielezimmer fand er schließlich seinen Großvater. Edwin saß in einem Ohrensessel, einen Beistelltisch mit einem Becher darauf neben sich. Er sah zwei Herren bei einem ziemlich kompliziert wirkenden Spiel zu, bei dem Spielkarten und ein hölzernes Brett zum Einsatz kamen. Beide Männer hatten je einen Stapel Spielmarken aus Plastik vor sich liegen, und um sie herum hatte sich eine beträchtliche Zuschauermenge versammelt.
»Er schummelt!«, meldete sich gerade eine sehr alt wirkende Dame mit lauter Stimme, was eine erregte Diskussion auslöste, bei der oft und laut gelacht und manchmal auch mit einem Gehstock gestikuliert wurde.
Daniel nahm sich einen Moment Zeit, um seinen Großvater zu beobachten, der sich in dieser neuen Umgebung hoffentlich nicht allzu verloren und einsam fühlte. Doch Edwin schien sich bereits voll und ganz auf das Geschehen eingelassen zu haben. Gerade neigte er lächelnd den Kopf, als der rechts neben ihm sitzende Herr sich vorbeugte und etwas zu ihm sagte, dann nickte er.
Bahnte sich hier bereits eine neue Freundschaft an? Daniel mochte sich nur ungern einmischen, wollte sich andererseits aber auch dringend mit seinem Großvater unterhalten, denn er musste aus Edwins Mund hören, dass dieser den Umzug nicht bereute. Wobei im Moment ja alles noch sehr frisch und neu war, man würde abwarten müssen, wie Grandpa sich nach ein paar Monaten hier fühlte.
Edwin schien gespürt zu haben, dass er beobachtet wurde, denn er wandte den Kopf und blickte zur Tür. Als er Daniel dort stehen sah, zeichnete sich ein Leuchten auf seinem faltigen Gesicht ab, und er winkte seinen Enkel zu sich.
Daniel ging zu ihm und küsste ihn auf die stoppelige Wange. »Wie geht’s dir, Grandpa?«
»Bei deinem Anblick noch besser, mein Junge!« Edwin blickte in die Runde. »Das hier ist mein Enkel Daniel, Lindas Sohn. Linda ist die, die mich vorhin besucht hat.«
Daniel wurde von allen Seiten herzlich begrüßt. Man winkte und lächelte ihm zu, dann richteten alle ihre Aufmerksamkeit wieder auf das Spiel.
»Heute ist Endspiel«, erklärte Edwin. »Nächste Woche beginnt eine neue Runde. Ich habe mich bereits eingetragen, auch für das Scrabble-Turnier.«
»Und was wird hier gerade gespielt?«
»Cribbage. Kennst du das?«
Daniel schüttelte den Kopf.
»Hilf mir auf und wir gehen in die Küche. Ich könnte einen Tee gebrauchen.«
Daniel umfasste die Arme des alten Mannes, half ihm vorsichtig auf die Beine und sorgte noch so lange für Stabilität und Gleichgewicht, bis Edwins Rollator richtig stand.
»Hey, das ist meiner«, beschwerte sich eine laute Frauenstimme. »Schaff dir gefälligst selbst einen an!«
»Das ist doch seiner, du dumme alte Kuh!«, mischte sich eine andere Dame ein. »Achte nicht auf Nelly, Edwin, die sieht nur, was sie direkt vor der Nase hat. Ihr Rollator steht hinter ihrem Sessel.«
»Und was hat er dort zu suchen?« Nelly drehte unbeholfen den Kopf. »Kein Wunder, dass ich ihn nicht gesehen habe, habe schließlich hinten keine Augen im Kopf.«
»Ach, halt doch die Klappe!«
»Sag du mir nicht, was ich tun soll!« Nelly versuchte aufzustehen, woraufhin Daniel halb versucht war, der alten Dame zu Hilfe zu eilen. Doch Edwin war schon fast aus der Tür, also ging er ihm lieber nach.
»Kümmere dich nicht um die Bande da drinnen«, meinte sein Großvater. »Die sind alle harmlos. Ich habe mir sagen lassen, dass Nelly ziemlich streitsüchtig ist, aber sie hat ein Herz aus Gold. Sie hat mir zum Einzug eine Karte geschenkt: ›Willkommen im Knast‹. Selbst gebastelt und nicht gerade ein Kunstwerk, aber eine nette Geste, und das zählt schließlich. Holst du mir bitte eine Tasse Tee? Ich bin am Verdursten.«
Daniel sah sich in der Küche um, in der es einen Kühlschrank, eine Mikrowelle, einen Toaster und einen Automaten für Heißgetränke gab.
»Müsst ihr für den Tee bezahlen?«, fragte er mit Blick auf den Automaten, bei dem er nicht gleich erkannte, wo man dort Geld einwerfen sollte.
»Nein, bedien dich ruhig, ist alles im Preis inbegriffen.«
Daniel machte sich daraufhin an dem Getränkeautomaten zu schaffen. »Ist es denn hier wirklich wie im Gefängnis?«, kam er auf die Andeutung auf der Willkommenskarte zu sprechen. Er stand mit dem Rücken zu seinem Großvater, konnte allerdings dessen Spiegelbild leicht verzerrt im glänzenden rostfreien Edelstahl des Automaten erkennen.
»Himmel, nein! Es ist wunderbar.« Die Frage schien Edwin zu überraschen. »Ich weiß, ich habe meine Entscheidung getroffen, weil ich wirklich nicht glaube, dass deine Mum auf Dauer mit meinen gesundheitlichen Problemen fertiggeworden wäre, aber ein Masochist bin ich deswegen noch lange nicht. Ich wäre hier nicht eingezogen, wenn es so schlimm wäre. Bis jetzt finde ich alles ziemlich gut. Das Essen ist in Ordnung, mein Zimmer ist hübsch, die Leute, die hier arbeiten, sind freundlich und die anderen Bewohner eine nette Gruppe. Nelly hat mir zur Begrüßung auch noch ein Paar Pantoffeln geschenkt und sich gleich dafür entschuldigt. Das wäre ein so banales Geschenk und ich soll bloß nicht glauben, das wäre ihr scheißegal, aber sie hätte einfach nicht viele Optionen gehabt. Keine Ahnung, wie das gemeint war, irgendwie kommt sie mir ziemlich durchgeknallt vor. Aber es war wirklich nett von ihr, mir zum Einzug etwas zu schenken.« Er umfasste die Tasse, die Daniel ihm reichte, zur Sicherheit mit beiden Händen. »Danke, mein Junge.«
Daniel betrachtete die zitternden Finger seines Großvaters – war das Zittern seit ihrer letzten Begegnung schlimmer geworden? Er suchte immer wieder nach Zeichen des unausweichlichen Verfalls.
»Vielleicht ist sie dement«, fuhr Edwin fort. »Das arme Ding. So eine schreckliche Krankheit.« Er sah Daniel über den Rand seiner Tasse hinweg an. »Alt zu werden nervt, das kannst du mir glauben. Deswegen möchte ich auf keinen Fall, dass du mal so alt wirst wie ich und plötzlich feststellen musst, dass du dein Leben nicht so gelebt hast, wie du es wolltest. Was hast du mit dir angefangen, jetzt, wo ihr mich los seid?«
»In den paar Stunden, seit du weg bist?« Daniel lachte. »Ich habe den Pick-up in die Werkstatt gebracht – ich hatte dir doch erzählt, dass der Auspuff seltsame Geräusche von sich gibt. Und was Mum so getrieben hat, seit sie dir heute Morgen beim Umzug geholfen hat, weiß ich nicht.«
»Ich hatte ihr geraten, zum Friseur zu gehen oder zur Kosmetikerin, aber wie ich sie kenne, ist sie gleich wieder nach Hause gegangen und hat mein altes Zimmer geputzt.«
»Ja, so wird es wohl gewesen sein.« Daniel dachte voller Zuneigung an seine Mutter. Wahrscheinlich hatte sie beim Putzen bitterlich geweint, die Ärmste. Es war richtig, nach seinem Besuch hier bei ihr vorbeizuschauen, dann war sie wenigstens nicht ganz allein. Er hätte sie auch ohne die Einladung zum Abendessen besucht, um nachzusehen, wie sie mit der neuen Situation fertigwurde. Grandpa hatte schließlich einige Jahre bei ihr gewohnt, daher würde es seltsam sein, wenn er nicht mehr da war.
Daniel verbrachte noch eine gute Stunde bei seinem Großvater und unterhielt sich mit ihm. Er versicherte dem alten Herrn, dessen baldigen Geburtstag nicht zu vergessen, und hörte sich geduldig an, dass Edwin weder Luftballons noch Torte oder irgendeinen anderen Firlefanz wollte. Bei alldem merkte er, dass sein Großvater im Grunde nur eins im Sinn hatte: Er wollte seinem Enkel vermitteln, wie richtig es gewesen war, in das Pflegeheim zu ziehen, und dass er seine Entscheidung nicht bereute. Zwar habe er erst zwei Mal hier gegessen, aber es habe ihm beide Male gut geschmeckt, berichtete Edwin. Er zeigte Daniel voller Stolz sein Zimmer, die Gemeinschaftsbereiche des Heims und die Gartenanlagen und erzählte ihm, was er bisher über die anderen Bewohner erfahren hatte.
Daniel musste zugeben, dass sein Großvater allem Anschein nach mit seinem selbst gewählten Los zufrieden war. Trotzdem erklärte Edwin geduldig noch einmal, was er seiner Tochter und seinem Enkel schon oft beizubringen versucht hatte: Jetzt, wo er sich rund um die Uhr betreut fühlte und nicht zu befürchten brauchte, seine zunehmende Abhängigkeit von anderen könnte Lindas und Daniels Lebensqualität beeinträchtigen, hatte er das Gefühl, mit seiner Krankheit viel besser umgehen und sich eher mit ihr abfinden zu können. Und er beharrte trotz Daniels Protesten weiterhin darauf, es könne für einen jungen Mann kein Leben sein, sich um einen alten Knaben wie ihn zu kümmern. Gleiches galt seiner Meinung nach für seine Tochter.
»Linda kann noch ein bisschen länger arbeiten, wenn ihr der Sinn danach steht. Oder sie kann in Rente gehen und ihren Ruhestand genießen, weil sie sich nicht mehr die ganze Zeit um mich kümmern muss. Und du, junger Mann, kannst dir die richtige Freundin suchen. Eine, die dich von ganzem Herzen liebt und sich dir gegenüber anständig verhält. Denn das hast du verdient.«
»Alles klar, Grandpa.« Daniel lächelte, obwohl ihm nicht danach war. Soweit es ihn betraf, hatte er erst einmal genug von Frauen. Besonders von solchen, deren Kinder unter einer zerbrochenen Beziehung leiden würden.
Kapitel 3
Halloween kam und ging, und Seren räumte gerade Schachteln mit Knallbonbons in die Regale des Supermarkts, als sie ihren Namen hörte. »Seren! Mummy, Mummy, da ist Seren!« Sie drehte sich gerade noch rechtzeitig um, um die kleine Gestalt aufzufangen, die sich ihr in die Arme warf. Der Kopf der Fünfjährigen erwischte sie voll in der Magengrube, und Seren wäre unter dem Ansturm fast umgefallen.
»Uff!«, stöhnte sie, nach Atem ringend.
»Freya!« Nicole, Serens beste Freundin, die ihrer Tochter nachgelaufen war, verdrehte die Augen. »Tut mir echt leid, sie ist mir entwischt.«
»Schon in Ordnung.« Seren hockte sich hin und umarmte das kleine Mädchen. »Allerdings hat sie wirklich einen ziemlich harten Kopf.« Ganz hatte sich Serens Atem nach dem Schlag in die Magengrube noch nicht wieder erholt. »Bist du denn ein braves Mädchen gewesen?«, erkundigte sie sich bei ihrer Patentochter, als sie wieder normal reden konnte.
Freya nickte vehement. »Ich war das bravste Mädchen der Welt.«
Seren kicherte. »Das höre ich gern. Dann hast du dir ja einen Kuss verdient.« Sie drückte der Kleinen einen Schmatzer auf die Wange.
»Igitt!« Freya wischte sich mit dem Ärmel das Gesicht ab.
»Für Küsse ist sie zu alt, findet sie«, erklärte Nicole. »Und auch dafür, auf der Straße meine Hand zu halten.«