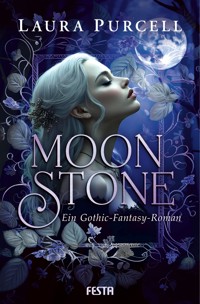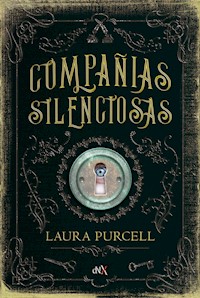5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Festa Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Als ihre gemeinnützige Arbeit Dorothea Truelove zum Oakgate-Gefängnis führt, freut sie sich über die Gelegenheit, die Theorie der Phrenologie zu erforschen. Kann die Form des Schädels eines Menschen ein Licht auf seine dunkelsten Wesenszüge werfen? Doch als Dorothea die junge Schneiderin Ruth Butterham trifft, stellt sie sich ganz andere Fragen: Ist es möglich, mit Nadel und Faden zu töten? Denn Ruth schreibt ihre Verbrechen einer übernatürlichen Kraft zu, die ihren Stichen innewohnt. Die Geschichte, die sie über ihre tödlichen Kreationen zu erzählen hat – von Bitterkeit und Verrat, von Tod und Kleidern – wird Dorotheas Glauben an die Wissenschaft erschüttern. Ist Ruth verrückt? Nur ein Opfer? Oder eine eiskalte Mörderin? Geheimnisvoll und quälend intensiv. Der neue viktorianische Thriller von Laura Purcell schildert, wie beängstigend es war, in dieser Zeit zu leben. Dem auf Goodreads: »Laura Purcell ist jetzt meine Queen der Gothic Fiction.« Guardian: »Ein eindrucksvolles Porträt einer Gesellschaft, die Frauen bestraft, die es wagen, gegen soziale Normen zu verstoßen … und ein großartiger Thriller mit angemessen melodramatischen Schnörkeln.« Mail on Sunday: »Purcells Geschichte fängt das eingezwängte Leben viktorianischer Frauen auf brillante Weise ein, während sie Aberglaube und Wissenschaft gegenüberstellt.« Anna Mazzola: »Mehr makabre Pracht von Laura Purcell, mühevoll zusammengenäht wie eine der schrecklichen Kreationen der Schneiderin Ruth. Das Korsett wird dich wie ein Schraubstock zerquetschen. Brillant.« ES Thomson: »Mit der Gabe einer geborenen Erzählerin hat Laura Purcell eine Geschichte geschrieben, die so verschlungen und makellos ist wie Ruths Nadelstiche. Das Korsett erinnert an Sarah Waters und Margaret Atwood, ist aber einzigartig und unverkennbar Laura Purcell.« Stacey Halls: »Eine meisterhafte Schriftstellerin. Ihre fabelhaften Schauergeschichten sind so gekonnt aufgebaut, dass man sie nicht mehr aus dem Kopf bekommt, selbst wenn man es wollte.« Mit farbigem Vor- und Nachsatzpapier. Die Hälfte der ersten Auflage erscheint mit einem Buchschnitt aus Goldfolie und wird zuerst verkauft, danach sind Exemplare mit einem blauen Farbschnitt lieferbar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 539
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Aus dem Englischen von Eva Brunner
Impressum
Die englische Originalausgabe The Corset
erschien 2018 im Verlag Raven Books.
Copyright © 2018 by Laura Purcell
Copyright © dieser Ausgabe 2021 by Festa Verlag, Leipzig
Lektorat: Bernhard Kempen
Alle Rechte vorbehalten
eISBN 978-3-86552-941-1
www.Festa-Verlag.de
Für Steph
O Männer, denen Gott
Weib, Mutter, Schwestern gegeben:
Nicht Linnen ist’s, was ihr verschleißt –
Nein, warmes Menschenleben!
Stich! Stich! Stich!
Das ist der Armut Fluch:
Mit doppeltem Faden näh’ ich Hemd,
Ja, Hemd und Leichentuch!
Doch was red’ ich nur vom Tod,
Dem Knochenmanne! – Ha!
Kaum fürcht’ ich seine Schreckgestalt,
Sie gleicht meiner eignen ja!
Aus: »Das Lied vom Hemde«
Thomas Hood (1799–1845)
Übersetzung von Ferdinand Freiligrath (1810–1876)
1
Dorothea
Meine geheiligte Mutter lehrte mich die sieben Werke leiblicher Barmherzigkeit: Hungrige speisen, Durstigen zu trinken geben, Nackte bekleiden, Reisende beherbergen, Kranke trösten, Gefangene besuchen und Tote begraben. Das meiste davon hatten wir gemeinsam getan, als sie noch lebte. Dann beerdigten Papa und ich sie, sodass ein weiterer Punkt auf der Liste abgearbeitet war.
Eine einzige gute Tat blieb mir versagt: Gefangene zu besuchen. Eine Dame meines Standes hat reichlich Gelegenheit, andere zu speisen und zu bekleiden, aber wem kann sie im Gefängnis einen Besuch abstatten? Wer ihrer vornehmen Bekannten ist jemals in Haft?
Ich habe diese Schwierigkeit meinem Vater gegenüber einmal beim Frühstück erwähnt. Meine Worte hingen in der Luft wie der Dampf aus unserem Tee; heiß, unangenehm. Ich sehe immer noch vor mir, wie Papa die grauen Augen über der Zeitung zusammenkniff.
»Wohltätigkeit ist kein Wettstreit, Dorothea. Es muss nicht jede dieser ›Barmherzigkeiten‹ erfüllt werden.«
»Aber, Sir, Mama sagte …«
»Weißt du, deine Mutter war eine …« Er schaute auf seine Zeitung hinab und suchte nach dem Wort. »Sie hatte eine eigenartige Auffassung von Religion. Du darfst dir, was sie sagte, nicht zu Herzen nehmen.«
Wir schwiegen einen Moment lang und spürten ihre Abwesenheit auf dem leeren Stuhl am Tischende.
»Mama war eine Papistin«, sagte ich und starrte auf meinen Toast, den ich gerade mit Butter bestrich. »Dafür schäme ich mich nicht.«
Seine Wangen wurden puterrot.
»Du wirst mir nicht in Gefängnissen herumtollen«, blaffte er. »Vergiss deine Mutter – ich bin dein Vater. Und ich sage dir, du bist Protestantin. Das ist mein letztes Wort.«
Aber Papa hat eigentlich nie das letzte Wort.
Als ich volljährig wurde, erbte ich von Mama mein eigenes Geld, das ich ausgeben durfte, wie es mir beliebte. Papa konnte nichts dagegen tun, als ich beschloss, es für die Verbesserung von Gefängnissen aufzuwenden.
Gefängnisse faszinierten mich ebenso wie Mamas Katholizismus, weil es etwas Verbotenes war, etwas Gefährliches. Ich saß in den Vorständen von Frauengefängnissen, gründete Komitees, um den armen Wichten in Newgate zu helfen, und kaufte Flugblätter über die Wohltäterin Elizabeth Fry.
Ich kann nicht behaupten, dass mich diese Aktionen zu einem Liebling der Gesellschaft machten, aber ich habe für meinen Geschmack genug Freundinnen gewonnen: wohltätige alte Jungfern und Ehefrauen anglikanischer Pfarrer. Weitaus würdigere Menschen als die modischen jungen Damen, die sich Papa für mich wünschte.
»Wie willst du einen Ehemann finden«, sagte er, »wenn du dich immer in diesen elenden Gefängnissen herumtreibst?«
»Ich bin hübsch und habe eine üppige Mitgift von Mama«, erwiderte ich. »Wenn ein Mann so dumm ist, sich von ein paar mildtätigen Unternehmungen abschrecken zu lassen, hat er mich nicht verdient.«
So setzte ich mich wie immer durch.
Vor zwei Jahren nahm der wohltätige Frauenverein von Oakgate den Abriss des alten stinkenden Klotzes in Angriff, der hier in der Gegend für ein Zuchthaus herhalten musste, um ein neues Gefängnis zu bauen. Das war meine Gelegenheit! Als der Frauentrakt fertig war, legte der Verein fest, dass es wünschenswert wäre, wenn die Inhaftierten Besuch erhielten und durch erbauliche Gespräche motiviert würden. Selbstverständlich meldete ich mich freiwillig.
Bei meinen Besuchen habe ich viele Unglückliche gesehen. Verzweifelte, die ohne Freunde waren und sich nach Trost sehnten. Doch einer Verbrecherin wie ihr war ich noch nie begegnet.
An jenem Morgen fütterte ich gerade Wilkie, meinen Kanarienvogel, als die Nachricht der Oberin kam, die mich darüber informierte, dass wir wieder eine hätten. Ich wusste, dass sie die Schlimmste aller Verbrecherinnen meinte: eine Mörderin. Mein Blut begann zu summen. Ich bestellte die Kutsche und holte eilig Hut und Handschuhe.
Die Spannung trocknete mir den Mund aus, als ich mit der Kutsche in Richtung Gefängnis ratterte. Man weiß nie, was man von einer Mörderin zu erwarten hat. Als ich jung war, stellte ich mir vor, dass sie alle zwingende Gründe hätten, ihre Taten zu begehen: einen geraubten Liebhaber, Rache an einem Elternteil, Verrat, Erpressung. Das ist ein Trugschluss. Mord kann das seltsamste, das banalste Motiv haben – oder manchmal gar keins.
Ich erinnere mich an Mrs. Blackwood, die behauptete, sie hätte keines dieser armen lieben Kinder ertränkt, sondern sie wären gekommen und hätten es selbst getan, sie hätten sie immer gezwungen, ihnen beim Töten zuzuschauen. Dann gab es Miss Davies, die mir sagte, sie habe dem jungen Schwarzen nichts Böses gewollt und nie etwas gegen Schwarze gehabt, aber dass er eben sterben musste, um ein Opfer zu bringen. Am erschreckendsten von allen fand ich jedoch Mrs. Wren. Ja, sie hatte ihren Mann getötet. Hatte er sie geschlagen? Nein. Andere Frauen aufgesucht? O nein, niemals. Hatte er irgendetwas getan, um seinen Tod zu verdienen? Gewiss, der Rohling – er hatte ihre Kochkünste kritisiert. Nicht im Allgemeinen, nein, nur das eine Mal. Das genügte. Welche Frau würde so jemanden nicht töten, wollte sie wissen.
Nur die Phrenologie liefert eine Erklärung für das Verhaltensmuster dieser Frauen. Sie werden mit der Neigung zum Töten geboren. Es ist alles schon im Schädel vorgezeichnet. Wenn keine Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden oder sich die falschen Organe entzünden, geben sie sich dem Laster hin. Unsere Gesellschaft macht sich schuldig, diese unentbehrliche Wissenschaft zu vernachlässigen. Hätten wir die Köpfe dieser Frauen vermessen, als sie jung waren, hätten wir ihre Verbrechen durch sorgfältige Unterweisung und Konditionierung vermutlich verhindern können. Leider fürchte ich, dass die zerebrale Missbildung nun zu weit fortgeschritten ist. Und wenn wir ihren Charakter nicht ändern können, welche Hoffnung besteht dann für ihre Seelen?
Das Neue Gefängnis von Oakgate erschien am Horizont, der Stein strahlte weiß wie die Erlösung. Gerüste verkleideten den noch unvollendeten Männertrakt, worin aber die Umrisse und Lücken zu erkennen waren, in denen schließlich die Fenster schimmern würden. Auf der Seite der Frauen hatten sie die Form von Bullaugen, die das Gebäude wie einen großen Dampfer aussehen ließen. Setzlinge umringten die hohen eisernen Zäune. Emporgewachsen werden sie den Hofgang eines Tages in schattiges Grün hüllen. Das alles wirkt wie ein Ort der Hoffnung, wo vielleicht noch nicht alles verloren ist.
Die Pförtner öffneten die Torflügel, die weder quietschten noch knarrten, sondern mühelos auf den frischen Angeln glitten. Als ich aus der Kutsche stieg und meine Röcke richtete, nahm mich ein weiterer Pförtner in Empfang und trug meinen Namen in sein Hauptbuch ein. Dann kam eine unserer Wärterinnen, um mich durch die gekalkten Flure, die ich auswendig kenne, geradewegs zum Büro unserer Oberin zu führen.
Sie saß an ihrem Schreibtisch. Als ich eintrat, erhob sie sich mit einem Klirren, was meinen Blick auf ihren Ledergürtel um ihre Taille und die daran hängenden Schlüssel lenkte. Sie sahen nicht wie Instrumente zur Inhaftierung aus. Sie waren poliert und glänzten so funkelnagelneu wie das Gefängnis. In ihrem Büro roch es frisch nach Holz und Kalkfarbe.
»Miss Truelove. Wie pünktlich Sie sind.« Sie machte einen Knicks, und es klirrte erneut.
»Aber selbstverständlich, Frau Oberin. Ich bin begierig darauf, unseren neuen Häftling kennenzulernen.«
Ihr Gesichtsausdruck veränderte sich – ich bin mir nicht sicher, was es bedeutete, es war jedenfalls kein Lächeln.
Die Oberin ist eine jener undurchschaubaren Frauen, die so leicht in den Mechanismen einer Institution aufgehen: von unbestimmtem Alter, ohne besondere Merkmale, mit monotoner Stimme. Sogar der Schädel blieb unter einer gestärkten Kappe verborgen und wies keine erkennbaren Beulen auf. Wäre ich gezwungen, zu einer Schlussfolgerung zu gelangen, würde ich sagen, sie mag mich nicht – aber natürlich bietet sie mir keine Beweise, nichts Greifbares, um dies zu begründen.
»Ich muss Sie dringend bitten, Vorsicht walten zu lassen, Miss Truelove. Sie ist gefährlich.«
Ein Schauer jagte mir über den Rücken. »Mord, sagten Sie, nicht wahr?«
»Ja, in der Tat.«
»War es furchtbar blutig?«
»Nein.« Ihr Mund zog sich zusammen, doch ihre Stimme veränderte sich nicht. »Hinterhältig. Sie tötete die eigene Herrin. Langsam, nach und nach.«
Dann war es keine Affekthandlung. Ich sehnte mich danach zu erfahren, wie sie die Tat begangen hatte, aber ich zügelte meine Neugierde. Die Oberin ist nicht wie ich; sie fragt nicht nach dem Motiv und hofft nicht auf Veränderung. Ihr geht es nur darum sicherzustellen, dass die Frauen Nahrung und Kleidung erhalten – sie scheint nicht daran zu glauben, dass die Häftlinge eine Seele haben.
»Ein Dienstmädchen, nehme ich an? Wie alt ist sie?«
»Das ist das Schlimme daran. Sie ist erst 16.«
Ein Kind!
Ich war noch nie einem mordenden Kind begegnet. Das würde meiner Arbeit sehr zugutekommen – den zarten Schädel einzuschätzen und zu sehen, ob die kriminellen Organe bereits ausgewachsen waren.
»Ihr Name?«, fragte ich.
»Ruth Butterham.«
Ich mochte den Nachnamen mit dem Verschlusslaut: Er schien wie eine Faust in die Luft zu schlagen.
»Könnten Sie mich zu ihrer Zelle bringen?«
Die Oberin gehorchte schweigend.
Unsere Schritte knirschten auf den mit Sand bestreuten Fußböden, hielten schließlich vor einem Eisengitter an. Eine so große Tür, dachte ich, um ein Kind einzusperren. Die leere Emailletafel schwankte – Ruth war noch nicht lange genug hier, als dass Name und Strafmaß vermerkt worden wären.
Die Oberin öffnete die knarrende eiserne Beobachtungsklappe an der Tür. Ich hielt den Atem an, beugte mich vor und lugte hindurch.
Diesen ersten Blick auf sie werde ich niemals vergessen. Sie saß vollständig angekleidet neben dem Bett, mit einer Schlaufe aus geteertem Seil auf dem Schoß. Der Kopf war geneigt, die Schultern gebückt, sodass ich ihre Größe nicht ausmachen konnte, aber sie schien von durchschnittlicher Statur zu sein. Drahtiges schwarzes Haar fiel ihr über die Schläfen. Das Personal hatte es bis zum Kinn abgeschnitten. Das half, Ungeziefer fernzuhalten, und ließ sie wie eine Gefangene aussehen. Doch bei Ruth Butterham hatte es die gegenteilige Wirkung – sie schien mehr Haar als eine Unschuldige zu haben, denn es kräuselte sich und bildete eine dunkle Krone um den Kopf. Ich konnte die kriminellen Organe im Schädel darunter nicht in Augenschein nehmen. Vielleicht war das Mordzentrum über dem Ohr angeschwollen, aber das müsste ich mit den Händen abtasten.
Ich zweifelte nicht daran, dass sie mir ein solches Experiment erlauben würde. Mir bot sich ein Bild der Ruhe. Ihre Hände bewegten sich sanft, als sie an den Wergbüscheln zupften. Die Arme waren zwar muskulös, wirkten aber nicht bedrohlich. Der Bizeps war natürlich entwickelt wie bei jenen Menschen, die für ihr Brot arbeiten müssen.
»Sie wollen mit ihr sprechen, nehme ich an. Wir hatten hier keine Mörderin mehr, seit der Henker die Smith geholt hat.« Die Oberin rasselte mit den Schlüsseln, ohne meine Antwort abzuwarten, und öffnete die Tür.
Das Mädchen blickte auf, als ich eintrat. Dunkle, von kurzen Wimpern umrahmte Augen folgten meinen Bewegungen. Ihre Hände hielten inne. Das Seil wurde schlaff. Ich schluckte und spürte jede Sehne in meiner Kehle. Wie konnte sie das Ding halten, wenn sie doch wusste, dass ihr Leben mit einem Strick um den Hals enden könnte?
»Butterham, das ist Miss Truelove«, sagte die Oberin. Sie rümpfte die Nase, was Missbilligung bedeuten könnte. »Sie kommt dich besuchen.«
Ich setzte mich auf den einzigen Stuhl in der Zelle. Seine Beine waren ungleich lang; ich musste meine Röcke ausrichten.
Ruth schaute mir ins Gesicht. Nicht unverschämt, ganz und gar nicht, sondern neugierig. Ich muss eine leichte Enttäuschung eingestehen. Sie war unscheinbar, fast männlich, mit markantem Kiefer und zu weit auseinanderstehenden Augen. Die Nase war merkwürdig flach. Flache Nase, flacher Verstand, sagt man. Allerdings ist mir aufgefallen, dass die Schönen und Eleganten selten von mörderischen Gedanken geplagt werden.
»Ich kenne Sie nicht«, sagte sie.
»Noch nicht.« Ich versuchte zu lächeln, was mir recht albern vorkam. Sie sprach nicht mit einer Kinderstimme. Sie klang müde, harsch. Etwas in ihren Tiefen verursachte mir eine Gänsehaut. »Ich suche alle Frauen auf. Vor allem solche ohne Angehörige.«
»Das steht Ihnen frei, vermute ich, einer reichen Frau wie Ihnen.«
Sie begann wieder am Seil zu zupfen. Während sich ihre Hände bewegten, schweifte ihr Blick über den Becher, den Holzteller und die Bibel, die auf der Fensterbank angeordnet waren. Ich bemerkte, wie geschickt sie war, wie das ständige Wergzupfen ihre Nägel und die Linien in ihren Fingern schwarz verfärbt hatte.
»Vielleicht steht mir tatsächlich frei, zu kommen und zu gehen, wie ich möchte. Aber ich bin nicht zum Vergnügen hier. Ich komme deinetwegen. Um dich zu trösten.«
»Hm.«
Sie glaubte kein Wort. Vielleicht hat es in ihrem kurzen Leben keine Freundlichkeit gegeben.
»Ich werde draußen stehen«, sagte die Oberin. »Die Beobachtungsluke ist geöffnet. Mach keine Dummheiten, Butterham!«
Ruth ließ sich nicht zu einer Antwort herab.
Die Tür klappte zu, und ich war mit der jungen Mörderin allein.
Seltsamerweise habe ich noch nie eine Gefangene mit mehr Selbstbeherrschung besucht. Erwachsene Frauen wie Jenny Hill haben an meiner Schulter geschluchzt oder mich um Gnade angefleht. Sie nicht. Sie war kein weinendes Mädchen, kein Kind, das bemuttert werden musste. Je mehr sie am Seil zupfte, desto mehr sah es wie ein Büschel menschlicher Haare in ihrem Schoß aus.
Sie tötete sie langsam, nach und nach.
Ich schüttelte mich. Ich durfte keine voreiligen Schlüsse ziehen: Nicht jedes Schweigen ist unheimlich. Immerhin wirkte der Scheitel unterhalb ihres krausen Haares vergrößert – es mochte sein, dass ihr Organ für Würde zu sehr gewachsen war. Oder dass sie die Bedeutung des Wortes Trost nie kennengelernt hatte. Wie konnte ich erwarten, dass sie ihre Gedanken zum Himmel richtete und bereute, wenn ihr nie Mitgefühl zuteilgeworden war? Sie musste lernen, was es heißt, eine Freundin zu haben. Sie brauchte mich.
Ich räusperte mich. »Die Oberin nennt dich Butterham. So macht es das Personal hier, glaube ich. Aber ich möchte dich mit deinem Vornamen ansprechen. Du hast doch nichts dagegen, wenn ich dich Ruth nenne?«
Sie zuckte mit den Schultern. Ihre Schultermuskeln spannten sich unter dem Serge-Kittel. »Wie Sie möchten.«
»Weißt du, warum du hier bist, Ruth?«
»Ich bin eine Mörderin.« Ohne Stolz auf den Titel – auch nur wenig Beschämung. Ich wartete und war mir sicher, dass noch etwas kommen würde. Aber sie zupfte gelassen weiter, ohne eine verzweifelte Erklärung oder den Wahnsinn, den ich gewohnt war.
Es ließ mich erstarren.
»Und wen hast du getötet?«
Ihre Miene trübte sich. Sie flatterte mit den kurzen Wimpern. »Oh, ich nehme an – sehr viele Menschen, Miss.«
Darauf war ich nicht vorbereitet. Gab es noch andere, die von der Polizei nicht entdeckt worden waren?
Der verfluchte Seilstaub reizte meine Augen und erschwerte mir das Denken. Kannte Ruth die genauen Anschuldigungen, die gegen sie erhoben wurden, vielleicht gar nicht? Wir hatten Fälle, bei denen die Ungeheuerlichkeit der Tat bewirkt hatte, dass der Vorfall aus dem Gedächtnis der Gefangenen gelöscht worden war. Hatte sie die Erinnerung an die Tötung ihrer Herrin verdrängt? Hatte sie bloß den Wärtern nachgeplappert, als sie mir sagte, sie sei wegen Mordes inhaftiert? Ich beschloss mich vorsichtig heranzutasten.
»Tatsächlich? Und tut dir leid, was du getan hast?«
Zwei gelbe Zähne nagten an der Unterlippe. »Ja. Das heißt, es kommt darauf an, Miss.«
»Worauf?« Ich konnte den Anflug von Ungläubigkeit nicht vermeiden, der sich in dieses Wort einschlich. »Gibt es verschiedene Grade der Reue?«
»Manche hatte ich nicht vor zu töten. Zu Anfang, das war ein Unfall.« Ihre Stimme stockte, der erste Riss in ihrer Fassade. »Dann gab es andere … Ich wollte aufhören. Ich wollte aufhören, aber es war zu spät.« Ein Seufzer. »Diese tun mir leid. Aber …«
»Ja?«
»Es gab auch ein paar …« Das starke Kinn ragte hervor, nahm das Gesicht wieder in Besitz. »Ein paar habe ich gehasst.«
In meiner Zunge juckte es, die Oberin zurückzurufen. Wenn das, was Ruth sagte, die Wahrheit war, gab es mehr Morde, die man der Polizei mitteilen müsste. Aber wenn ich sie so früh in unserer Bekanntschaft »verpetzte«, wie es die Häftlinge nennen, könnte ich unmöglich ihr Vertrauen gewinnen. Meine Finger würden nie den Schädel berühren, und ich könnte nicht beweisen, was sie wirklich war.
»Also … du bereust nicht, die Menschen getötet zu haben, die du nicht mochtest?«, tadelte ich sie.
Ihre dunklen Augen nahmen mich ins Visier. »Was glauben Sie denn?«
Sie entnervte mich, und doch hatte ich einen kleinen Hoffnungsschimmer. Wie sie dem Hass freien Lauf gelassen hatte, war auf seine Art beruhigend; ein Beweis dafür, dass sie aus Leidenschaft gehandelt hatte und keine kaltblütige Mörderin war, wie ich zuerst gedacht hatte.
Ihre Finger arbeiteten von selbst weiter, während sie mich ansah: Sie kratzten und rissen. Geschickt, auf eine beängstigende Weise.
»Ich frage mich, warum man dich hiermit beschäftigt«, sagte ich schließlich. »Zupfen ist eine schmutzige Arbeit. Würdest du nicht lieber Hemden nähen oder Strümpfe stricken? Ich bin mir sicher, wenn ich bei der Oberin ein gutes Wort einlege, würde sie dich in die Nähstube lassen.«
Ein Zucken im Mundwinkel. Kein Grinsen, aber nahe dran. »Oh, die Oberin will mich in der Nähstube haben. Ich musste mich mit Händen und Füßen dagegen wehren, um hier drinzubleiben. Finden Sie es nicht seltsam? Sie sperren mich hier ein, durchsuchen jeden, der hereinkommt, weil er mir etwas geben könnte. Doch dann befiehlt mir die Oberin leichtfertig, ich soll in die Nähstube gehen!«
»Warum sollte sie das nicht tun? Findest du nicht, dass Nähen eine erbauliche Beschäftigung für Fleißige ist?«
Für einen Augenblick erhellte sich ihr Gesicht mit Belustigung. »Ach, Miss!«
»Was ist? Ich verstehe dich nicht.«
»In der Nähstube bin ich am gefährlichsten!«
Vielleicht war sie doch ein wenig verrückt. Ich beschloss, der Oberin erst von den anderen Morden zu erzählen, wenn ich mir ganz sicher war, dass sie stattgefunden hatten. Es wäre demütigend, wenn ich mich von den Wahnvorstellungen eines Häftlings ins Bockshorn jagen ließe und die Oberin hinter meinem Rücken kichern würde.
»Nähen ist nicht gefährlich. Zugegeben, es gibt ein kleines Risiko mit Näh- und Stecknadeln, aber man ist vorsichtig. Du wirst stets von einer Wärterin beaufsichtigt. Du kannst mit einer Nadel niemanden wirklich verletzen, Ruth.«
Sie warf ihren dunklen Schopf zurück. Ich bekam eine Gänsehaut, zitterte am ganzen Leib.
»Ach, wirklich nicht?«
2
Ruth
Wäre ich als Junge geboren worden, wäre das nie passiert. Ich hätte nie eine Nadel in der Hand gehabt, nie von der Macht erfahren, die ich besitze, und mein Leben hätte einen anderen Verlauf genommen. Ich hätte mich vermutlich in der Welt durchgesetzt und meine Mutter beschützt. Stattdessen teilte ich das Schicksal aller Mädchen, die arm sind: Ich war an meine Arbeit gebunden wie die Nadel an den Faden.
Man kann sein Leben in die Näharbeit legen; das ist den Menschen gar nicht bewusst. Man kann seine Nadel mit sämtlichen Gefühlen des menschlichen Herzens aufladen, und der Faden wird sie aufnehmen. Man kann voller Zärtlichkeit nähen, man kann sich aus der Panik zur Ruhe nähen, man kann hasserfüllt nähen. Im Zorn nähen hat mir nie etwas gebracht außer verknoteten Strängen und stümperhaften Nähten, aber man kann es tun. Besser man wartet auf den Hass. Auf einen langsamen, bemessenen Hass. Niemand bekommt davon etwas mit, außer dir und der Nadel, wenn er in deinen Fingerspitzen fiebert.
Manche halten Hass für eine verschwendete Regung, eine zerstörerische Kraft, mit der sich nichts Sinnvolles anfangen lässt. Das ist ein Irrtum. Ich habe die Wut gepackt, sie wie eine Waffe benutzt. Aber schauen Sie sich Ihr Gesicht an, Miss. Sie haben noch nie einen Ihrer Mitmenschen gehasst, nicht wahr?
Es braucht jemand Besonderes, um es zum ersten Mal zu empfinden. Eine Person, die man lieben würde, wenn sie einen ließe, deren Verachtung einen jedoch wie ein Kreppkleid im Regen schrumpfen lässt. Sie zeigt einem ein Spiegelbild, das sogar in den eigenen Augen schwach und verabscheuenswert wirkt. Ja, es braucht jemand mit einem besonderen Talent für Grausamkeit, um so viel Hass auszulösen.
Jemand wie Rosalind Oldacre.
Ein bildhübsches Mädchen. Lange, blonde Locken. Ihr Gang hatte so viel Selbstsicherheit und Reife. Sie war uns allen weit voraus. Natürlich war sie der Liebling der Lehrer. Ich könnte so vieles aufzählen, was sie mir in jenem Jahr antat, als ich mit zwölf auf Mrs. Howletts Mädcheninternat ging. Wirklich schlimm war nur eines.
Es geschah an einem Nachmittag im Frühherbst, als die Tage kürzer wurden. Nach Ertönen der Schulglocke strömten wir alle an die frische, kühle Luft.
Der Mond tänzelte bereits über den Wellen grauer Wolken. Auf dem Platz brannten die Feuerschalen. Ich huschte über das Kopfsteinpflaster und sah zu, wie die anderen Mädchen in die Seitenstraßen verschwanden.
Nach Hause gehen sollte der schönste Moment des Tages sein, aber für mich war es eine Zeit erhöhter Achtsamkeit, in der mich jedes Geräusch und jede plötzliche Bewegung erschrecken ließen. Es war die Zeit, in der ich oft rennen musste.
Es gab einen Durchgang gegenüber der Schule, am anderen Ende des Platzes. Wenn ich es schaffte, dort schnell genug hindurchzugelangen, war ich für den Rest des Abends in Sicherheit.
Manchmal war ich schnell genug.
Nicht an jenem Tag.
An jenem Tag war Rosalind bereits dort und lauerte im Schatten des Durchgangs. Stolpernd blieb ich neben einer Feuerschale stehen, als ich sie sah. Eine Haube verbarg ihre blonden Locken. Darunter wirkte ihr Gesichtsausdruck starr.
»Butterham.« Bis dahin hatte ich meinen Namen gemocht, aber aus ihren hagebuttenroten Lippen klang er peinlich und unpassend. Andere Mädchen, deren Gesichter in den Flammen der Feuerschale zu Schatten und Höhlungen verschwammen, waren ihr auf den Fersen gefolgt.
»Lass mich vorbei!«, bat ich.
»Du bist arm, Butterham. Du bist geboren, Befehlen Folge zu leisten, und nicht, sie Höhergestellten zu erteilen.« In der Dämmerung verstärkte sich ihr Aussehen, doch es war eine schreckliche Schönheit, die Angst machte.
»Lass mich vorbei!«
»Ich wüsste nicht, was dich aufhalten sollte.«
Ihre schlanke Gestalt füllte den Durchgang nicht aus. Ich könnte an ihr vorbeischlüpfen, aber hinter ihr waren andere, deren Augen in der Dämmerung wie die von Nagetieren leuchteten. Mädchen, die sich zum Spießrutenlauf eingefunden hatten. Durfte ich es wagen?
Ich warf mich nach vorn und versuchte hindurchzukommen, doch Rosalind erwischte mich mit ihren scharfen Fingern an der Taille. »Nicht schnell genug, nicht stark genug! Ich würde dich nicht einstellen. Wie willst du jemals dein Brot verdienen?«
Die Mädchen scharten sich um mich und pferchten mich ein. Etwas traf meine Nase, und der Schmerz perlte bis hinter die Kehle.
Rosalind hatte recht: Ich war damals nicht stark. Ich konnte weder plappernde Worte hervorbringen noch mich aus ihrem Griff befreien.
Die Hände zerrten an meinem Mieder. Der Stoff zerriss. »Du bist keine Dame, du solltest nicht solche Kleidung tragen! Du gehörst in die Gosse, Butterham. Du bist eine Ratte, ein Tier!«
Sie johlten. Kalte Luft strömte in meinen Kittel, als sie mein Korsett, mein Unterhemd entblößten.
»Schau dir das an«, lachte Rosalind einem Mädchen hinter ihr zu. »Enge Schnürung. Sie versucht modisch zu sein! Du wirst nie eine gute Silhouette bekommen, Butterham. Nicht mit diesen Korsettstäbchen.« Ihre Finger zwickten an meiner Taille, fest, sehr fest. »Billig. Woraus sind die, aus Rohr? Gänsefedern?«
Ich nahm all meinen Mut zusammen und spuckte ihr ins Gesicht.
Auf einmal ließ sie mich fallen. Meine Wange traf das Kopfsteinpflaster mit einem Knacken. Bevor ich wieder zu mir kam, flog mir ihr spitzer schwarzer Stiefel entgegen. Der Schmerz explodierte in meinen Rippen.
»Siehst du? Die stützen dich kaum.« Die Mädchen versammelten sich um sie, jedes wie ein böser Schatten. Reihenweise dunkle Füße. »Schilfrohr ist nutzlos in einem Korsett. Wie lange dauert es, bis die Stäbe brechen?«
Es dauerte länger, als man denken würde.
Die Straßen begaben sich bereits zur Abendruhe, als ich mich endlich aufraffte und nach Hause schleppte. Die Milchmädchen und die Obsthändler waren längst fort; an ihrer Stelle lagen Orangenschalen und Dunghaufen. Keine Jungen rannten herum, keine Räder klapperten. Einzig die Verkäufer von Kleidung aus zweiter Hand schlurften vorbei, auch der Pastetenmann – den ich zwar nicht sehen konnte, dessen reicher Fleischgeruch jedoch durch den Kohlenrauch drang.
Die Abfälle des Markttages lagen auf dem Kopfsteinpflaster, und ich, der Abschaum höchstpersönlich, stieg darüber hinweg. Verhasst, unerwünscht. Meine Füße trippelten über Pfützen, um Pferdemist herum, und jeder Schritt tat höllisch weh. Ein kalter Angstschweiß hatte mich von Kopf bis Fuß überzogen und Salzkristalle gebildet, die mich unter dem Hemd wund rieben.
Ich hatte einen Umhang – zu kurz für mich, aber dennoch brauchbar –, mit dem ich mein Mieder überdeckte. Ich wollte nicht, dass Ma die Fußtritte und die Rippen sah. Ohnehin konnte ich mein Humpeln nicht verbergen. Ich konnte das heftige Luftholen nicht vermeiden, jedes Mal wenn mir ein abgeknicktes Korsettstäbchen in die Haut stach. Und meine Haube zog ich an den kaputten Bändern hinter mir her.
Wenn ich nicht ungesehen ins Haus und nach oben gelangte, würde ich meinen Eltern alles erzählen müssen. Das wäre noch schmerzhafter als ein weiteres Mal verdroschen zu werden.
Unser Heim kauerte bescheiden in einer Reihe baugleicher Häuser in Flussnähe. Oben drei Zimmer, unten zwei und dahinter ein Abort. Manche hatten es schlimmer. Als ich die ramponierte, unlackierte Tür aufstieß und eintrat, war die Luft rein, aber kalt. Ma saß am Fenster und saugte die letzten Sonnenstrahlen auf.
Meine Ma war stets von einem Meer von Stoffen umgeben: billigem Leinen, Batist, Ballen von Musselin. Manchmal stellte ich mir vor, es würde ihr jede Farbe auslaugen, eine weitere graue Strähne im schwarzen Haar hinterlassen, noch ein Schatten in den blauen Augen.
Ich kroch auf die Treppe zu.
Sie hatte mich nicht hereinkommen hören. Ihr Blick war ganz auf die Nadel konzentriert. Ich beobachtete, wie sie den Faden ableckte und mit einer sanften Bewegung durch das winzige Loch zog.
Mein Fuß knarrte auf der unteren Stufe.
Ma erschrak. »Ruth?« Steif stand sie auf und starrte über das weiße Baumwollfeld zwischen uns. »Was ist nur mit deiner Haube passiert?«
War es zu spät zum Weglaufen? Ich stieg einen weiteren Schritt hinauf, aber sie wirbelte bereits durch das Leinen, stieß Haufen zur Seite, um zu mir zu gelangen.
»Nichts, es ist nichts«, sagte ich hastig.
»Das sieht mir nicht nach nichts aus! Deine Haube ist zerdrückt! Ich sagte doch, du sollst aufpassen. Wir können uns keine neue leisten.«
Warum lag ihr so viel an meiner Haube? Ich war es, die zusammengeflickt werden musste.
Sie packte den Saum meines Umhangs und zog mich zu sich. »Wie konntest du so fahrlässig sein? Ich habe nichts, um die Bänder zu ersetzen, ganz abgesehen von der Zeit … Nun wirst du sie so tragen müssen und dämlich aussehen. Vielleicht lehrt es dich, mit deinen Sachen sorgsam umzugehen.«
Das war zu viel. Zuerst die Schmerzen, und nun schimpfte Ma mich obendrein aus! Meine Augen juckten und brannten, als hätte ich mir sämtliche Nadeln von Mas Kissen durch die Pupillen gestoßen. »Ich werde nie hübsche Sachen haben. Nie!«
»Wie meinst du das, Ruth? Das war aus bester …«
»Nein!«, schrie ich. »Alles, was ich trage, alles an mir – ist hässlich!«
Eine kurze Pause.
»Hässlich!« Die Empörung einer Mutter in schrillem Ton. Aber ich war zu schnell für sie – ich sah es. Ich sah es in dem Moment, bevor sich ihr Gesichtsausdruck veränderte. Es stand in ihren geröteten, blutunterlaufenen Augen: Scham. Sie hatte es immer gewusst. »Wie kommst du nur auf so einen boshaften Gedanken?«
Meine Tränen schossen heraus. Damals weinte ich noch.
»O Ruth!« Sie nahm mich in den Arm. Die höllischen Korsettstäbchen kratzten wie Klauen an meinen Prellungen. Das und ihr vertrauter Duft nach Leinen und verblichenen Rosenblättern ließ mich noch mehr weinen. »Verzeih mir. Ich habe nicht nachgedacht … Waren es die anderen Mädchen? Haben die das getan?«
Natürlich wäre es Ma nie passiert: der zierlichen, eleganten Ma. Ich hatte sie enttäuscht. Mit meinen zu weit auseinanderstehenden Augen, meinem stumpfen Kinn.
Ich schluchzte.
»Meine arme Kleine.« Sie holte ihr Taschentuch hervor, das mit dem Monogramm in der Ecke, dem einzigen, das aus der alten Zeit übrig war, und tupfte mir das Gesicht ab. »Setz dich hin und weine dich aus. Ich hole dir etwas zum Abendbrot.« Sie strich mein Haar hinter die Ohren. »Keine Sorge, meine Ruth, ich flicke dir die Haube. Wir finden einen Weg.«
Sie führte mich zum Sessel mit den glänzenden Nähten und einem mottenzerfressenen Schonbezug: dem besten Sessel im Haus. Nicht dass es mir angenehm gewesen wäre, lädiert in einem kaputten Korsett dazusitzen. Sie legte das Taschentuch in meinen Schoß und verschwand in die Küche.
Töpfe rasselten. Ich versuchte wieder ruhig zu atmen, nahm das Taschentuch zur Hand und fuhr mit den Fingern über das Monogramm. Alte, freundliche Stiche, verschlissen und lose. J T. Jemima Trussell. Die Ma aus der Vergangenheit, bevor sie Pa getroffen hatte, bevor ihre Finger schuppig geworden waren. Ich schloss die Augen, rieb über die Buchstaben und betete, dass mich jemand in jene junge Dame verwandeln würde.
»Ich kann den Rand so zunähen, dass es wie neu aussieht«, rief sie aus der Küche. »Wir müssen die Bänder erneuern, aber ich werde bestimmt etwas in meinen Vorräten finden.« Es schepperte erneut. »Sie ist völlig zerdrückt. Wenn wir sie auseinanderziehen, kehrt die Form vielleicht wieder zurück.«
Was würde sie erst sagen, wenn sie den Zustand meines Kleides unter dem Umhang sah? Selbst die freundliche Ma hätte Mühe, das in einem angenehmen Licht zu sehen.
Sie kam mit einer Scheibe Brot und einem Stück Käse zurück, der auf dem Teller schwitzte. In der anderen Hand hielt sie eine Tasse. »Tee. Gleich wirst du dich besser fühlen.«
»Das können wir uns nicht leisten«, erwiderte ich auf der Stelle.
»Dieses eine Mal schon.« Sie nahm mir das Taschentuch aus der Hand und ersetzte es durch die heiße Tasse. Die Wärme biss in meine Handfläche, doch der Schmerz war wohltuend.
Wir tranken keinen hochwertigen Tee wie Sie, Miss. Die Krämer betrügen einen, wo sie nur können: Sie färben die Blätter, strecken sie mit Weizen. Dennoch war es für mich ein Genuss.
»Weißt du«, sagte Ma, während sie sich zu mir setzte, »dass es meine Schuld ist? Ich habe Pa überredet, dich auf eine Schule zu schicken, wo die Mädchen … bessergestellt sind. Junge Damen, wie ich früher eine war. Ich hätte wissen müssen, dass sie dich schikanieren würden.« Sie schürzte die Lippen, wie immer, wenn sie einen schwierigen Nadelstich in Angriff nahm. »Es tut mir leid, Ruth. Aber du darfst ihnen keine Beachtung schenken. Es sind dumme Gören, und es wird sie bald langweilen. Dann suchen sie sich ein neues Opfer.«
Ich nahm einen Schluck Tee und schloss meine schmerzenden Augen. »Sie hassen mich.«
»Sie hassen dich nicht. Ich weiß, wie das ist, ich erinnere mich an meine Schulzeit. Da gibt es immer kleine Streitereien. Die Loyalität der Mädchen ändert sich so schnell. Warte nur, bis sie deine hervorragende Näharbeit sehen! Wirst du dann nicht das beliebteste Mädchen sein?«
Ich antwortete nicht. Ich zog nur den Umhang fester um mich.
»Dann wollen wir uns mal um die Haube kümmern.«
Ich konnte das Abendbrot nicht zu mir nehmen. Ich saß da, starrte auf meinen Teller, während das Licht aus dem Raum glitt. Ich hatte ein mulmiges Gefühl, wenn ich ans Essen dachte, wenn ich an mich dachte. Würden auch diese grausam hochnäsigen Mädchen zum Abendessen Platz nehmen? Ich stellte mir Rosalind Oldacre an einem mit sauberem Leinen gedeckten Tisch vor, von ein paar Kerzenständern beleuchtet. Sie schob die glänzenden blonden Locken hinter die Ohren und schnitt einen Lachs auf, nahm kleine, feine Bissen zu sich. Wenn ich ihr nur so wehtun könnte wie sie mir. Wenn ich nur einen dieser Silberkerzenständer in die Hand nehmen und ihr in die weißen Zähne rammen könnte. Dann würde sie verstehen, wie es ist, von den Mädchen ausgelacht zu werden, und wie es sich anfühlt, wenn man sich seines Gesichts wegen schämen muss.
»Hör auf, Ma.« Ich stellte den Teller unberührt auf den Boden. Der Käse glänzte wie ein kleiner Mond. »Du gerätst in Verzug, wenn du an meiner Haube arbeitest.«
Ma schien einen plötzlichen Einfall zu haben. Sie lächelte mit dem Mund voller Stecknadeln. »Vielleicht kannst du mir etwas von der Metyard-Arbeit abnehmen.« Sie spuckte die Nadeln aus und steckte sie in die Armlehne ihres Stuhls. »Würde dir das gefallen?«
Sie war in Schatten gehüllt, sodass ich nicht sagen konnte, ob sie es ernst meinte. »Was ist, wenn ich einen Fehler mache?«
»Das wirst du nicht. Ich vertraue dir.«
Sie erhob sich und ging auf die andere Seite des Zimmers. Mein Magen verkrampfte sich. Die Metyard-Arbeit! Das heiligste Heiligtum, der edle Stoff, der nicht beschmutzt werden durfte. Ma musste ihn Mrs. Metyard im Voraus im Laden abkaufen. Sollte die Arbeit zu spät oder fehlerhaft sein, musste sie eine Buße bezahlen.
»Sieh es dir an! Eine so kunstvolle Stickerei, wie sie im Buche steht. Handschuhe für eine Braut.« Sie legte mir die schillernde Seide ehrfürchtig auf den Schoß, als wäre es ein schlafendes Kind. Weißer Kettfaden, blauer Schussfaden. Ein Schimmer floss den Schaft des Daumens hinunter. Wunderschön. Die Trägerin würde immer den Mondschein bei sich tragen. Ma hatte damit begonnen, an der linken Hand ein Muster aus orangefarbenen Blüten und Myrten mit silbernem Faden zu sticken. »Ich habe das Muster selbst entworfen, siehst du? Du musst es nur kopieren.«
Ich schluckte. Mein Mund war trocken. Ich wollte alles zerschmettern und zerstören, aber hier war ein anderer Weg für den Sturm, der in mir wütete: etwas erschaffen.
»Ich wasche mir erst die Hände«, krächzte ich.
Bisher durfte ich die Metyard-Arbeit nicht einmal anfassen. Ich wusste, dass sie ein Risiko einging, wenn sie mir etwas so Wichtiges anvertraute, nur damit ich mich besser fühlte. Wenn ich ablehnte oder einen Fehler beging, würde ich keine zweite Chance bekommen.
Auf dem Weg nach oben legte ich den Umhang ab und quälte mich aus den verschlissenen Kleidern. Unter Schmerzen schaffte ich es fluchend, ein frisches Unterhemd und ein Kleid anzuziehen – ein langärmeliges mit hohem Kragen, um meine Prellungen zu verbergen. Als ich zu Ma zurückkehrte, hatte sie eine Talgkerze entzündet.
»Seide kann beim Arbeiten schlüpfrig sein, Ruth. Der Silberfaden ist grob; er bleibt stecken, wenn du nicht vorsichtig bist.«
»Ich werde vorsichtig sein.«
Ich nahm die Handschuhe auf und machte mich daran, sie zu besticken. Eine Berührung – und schon fühlte ich die Feinheit des Gewebes, die Löcher, die ich machen würde. Wir waren uns vertraut, diese Handschuhe und ich.
Der Rauch der Kerze stach mir in die Augen, die schon vom Weinen wund waren. Der silberne Faden glitzerte heftig in der Flamme. Ich blinzelte, bis ich nur noch die Nadelspitze sehen konnte. Und dann bewegten sich meine Hände von selbst.
Während der Arbeit sammelten sich Tränen in meinen Augen. In Gedanken ging ich die Geschehnisse des Tages durch, die mir förmlich aufstießen: jede spöttische Bemerkung, jeder Tritt, jedes Ziehen an meinem Haar.
Ich dachte an die Braut, die diese Handschuhe tragen würde: ein Bild in Weiß mit einem Mann, der bereit war, ihr ewige Treue zu schwören. Was ich niemals erleben würde. Ich würde Handschuhe nähen, nach denen vielleicht jemand verlangen würde, aber er würde niemals mich wollen. Ich würde mit kaltem Geld in der Hand in einer Kurzwarenhandlung stehen, während hübsche Frauen meine Handschuhe anzogen und aus dem Laden ins Leben tänzelten.
Es gab nur drei Dinge, die ich mir für die Zukunft wünschte: ein Gesicht, für das ich mich nicht schämen musste; einen Ehemann, der mich liebte; die Fähigkeit, prächtige Kleider zu nähen und zu tragen. Es schien mir nicht viel verlangt. Aber schon mit zwölf Jahren lernte ich, dass diese Dinge unerreichbar waren. Für immer. Was sollte ich also mit meinem Leben anfangen?
»Ruth!«
Ich fuhr hoch, pikste mich. Unwillkürlich zog ich den verletzten Finger weg, denn der Stoff war mir wichtiger als meine Haut.
»Setz dich von der Kerze zurück, sie spritzt. Das würde Spuren auf der Seide hinterlassen.« Ma kam herüber und nahm die Handschuhe von der Flamme weg. Sie prüfte sie. Ihre Augen bewegten sich hinauf und hinunter, bis sie innehielten.
»Habe ich etwas falsch gemacht?«, sorgte ich mich. »Das tut mir leid, ich kann es wieder auftrennen und …«
»Ruth«, sagte sie.
»Bitte verzeih mir, Ma, ich …«
»Ruth, wie hast du das gemacht?«
Ihr Blick ruhte auf den Handschuhen. Meine Nadel hing noch am Faden, zwinkerte im Kerzenlicht.
Ich schüttelte den Krampf aus meiner Hand, beugte mich auf dem Stuhl vor und erwartete eine Rüge. Warum war ich in Gedanken abgeschweift? Ich hätte mich auf die Aufgabe konzentrieren sollen, ich hätte vorsichtig sein sollen.
»Wo hast du das gesehen?«
Zum ersten Mal seit über einer Stunde sah ich mir die silbernen Formen an, die ich genäht hatte. Ich blinzelte. Ich hatte Mas Muster nicht kopiert, sondern verbessert. Schmetterlinge schwebten über der orangefarbenen Blume. Die Myrte hatte nun sowohl Beeren als auch Blüten und Knospen. Wie ich die Drehung der Blätter, die langen Staubblätter, wiedergegeben hatte, ließ sie echt wirken.
Der linke Handschuh, den Ma begonnen hatte, musste überarbeitet werden. Neben meiner wirkte ihre Stickerei schmucklos.
»Hast du diese Zeichnung auf dem Nachhauseweg in einem Schaufenster gesehen?«
Ich zögerte. Vielleicht war es so. Ich erhoffte es mir. So etwas konnte ich doch unmöglich nähen, ohne überhaupt hinzuschauen! »Ja«, stotterte ich. »Ich habe es in einem Laden gesehen.«
Endlich nahm sie den Blick von den Handschuhen. Ihre Augen strahlten, wirkten nicht mehr abgekämpft und blutunterlaufen. »Das ist großartig, Ruth, wirklich großartig! Ich habe dir gesagt, dass du es kannst. Komm, lass es uns Pa zeigen!«
Sie zog mich an der Schulter hoch und zerrte mich aus dem Zimmer. Ich seufzte. Immer diese Versuche, Pa in unsere Frauenangelegenheiten einzubeziehen. Er lebte nicht in unserer Welt, sondern in einem Land aus Farben und Pinselstrichen. Manchmal dachte ich, er könnte nicht weiter sehen als bis zum Rand seiner Leinwand.
Früher einmal, hatte Ma gesagt, war er mit seinen Porträts recht erfolgreich gewesen. Modische Damen, die ihm Modell saßen, bewunderten den Funken, den er in ihren Augen entfachte, und wie er bei Kleidern die feinsten Details beachtete.
Heute bekam er keine Aufträge mehr.
Also stickte Ma im Akkord Blüten für Mrs. Metyard, um uns über Wasser zu halten. Pa benutzte immer diesen Ausdruck: überWasser. Und mir schien, als würde Pa tatsächlich dahintreiben – er behielt den Kopf über Wasser und malte seine Bilder. Unter ihm kämpfte sich Ma durch Schilf und Dreck.
Wir klopften an seine Tür und warteten auf sein lakonisches »Herein!«, bevor wir eintraten. Das Licht umfing uns wie eine Explosion. Pa hatte keine stinkenden, rauchenden Talgkerzen, sondern eine Öllampe im Glas.
Stapel von Leinwänden waren an die Wand gelehnt. Ein in Öl gemalter Spaniel in voller Länge sah mich mit seinen trübseligen Augen an. Ich bahnte mir einen Weg über die Holzdielen voller Farbflecken. Hinter der Staffelei in der Mitte des Raumes stand mein Vater: ein gut aussehender, zerzauster Mann in Hemdärmeln und einem Lederschurz. Seine Weste war immer gelbbraun, seine Krawatte immer lose.
Er lugte seitlich um seine Leinwand. »Ah! Kommt ihr, um Gute Nacht zu sagen? Ich dachte, ihr wärt längst im Bett.« Sein Schnurrbart wuchs gleichmäßig, nicht jedoch sein Kopfhaar. Von ihm hatte ich meine wilden, unbezähmbaren Locken geerbt. Bei Pa kräuselten sie sich auf der Höhe des Kinns. Selbst als wir uns noch Pomade leisten konnten, waren sie immer aus der Reihe getanzt.
»Ruth wollte dir etwas zeigen.« Ma redete stets in einem erzwungen jovialen Ton, wenn sie über mich sprach. »Sie hat heute Abend sehr hart gearbeitet.«
Unglücklich nahm ich die Handschuhe von Ma entgegen und schlurfte zu Pa hinüber. Vorsichtig hielt ich sie empor, weit weg von seinem glitschigen, gefährlichen Pinsel.
»Oh, hast du das gemacht, wirklich? Famos! Sehr hübsch!« Sein Blick kehrte zu seinem Gemälde zurück. Jetzt konnte ich sehen, dass es eine nächtliche Stadt war, wo sich die Gaslaternen im Fluss spiegelten. »Ich mag die … die Schmetterlinge.«
Ma räusperte sich. »Es ist mit vom Feinsten, was ich je gesehen habe. Erst recht von einem Mädchen in ihrem Alter.«
»Und erst wie lange – in der Mädchenschule?«
Ma kniff mich in die Schulter. Es tat weh, aber ich sagte nichts.
»Tatsächlich hatte Ruth heute einigen Ärger in der Schule.«
Ich errötete. Das war etwas zwischen Ma und mir. Pa sollte nicht davon erfahren.
»Ärger?«, fragte er geistesabwesend. »Welche Art von Ärger?«
»Einige Mädchen haben ihr böse Lügen in den Kopf gesetzt und sie aufgebracht. Sie haben sich über ihr Aussehen lustig gemacht. Ich vermute, deren Kleider sind viel prächtiger als das, was wir uns leisten können.«
»Dann hör mal zu, mein Mädchen.« Er richtete den Pinsel auf mich. Ich beugte mich über die Handschuhe, hielt sie beschützend an meine Brust. »Diese aufgeplusterten, ungezogenen Gören wissen nicht, wovon sie reden. Du hast so edle Qualitäten, die diese Mädchen niemals haben werden.«
»Zum Beispiel ein gutes Herz«, warf Ma ein.
Auch das hatte ich nicht, aber das durfte Ma nicht erfahren.
»Bring sie dazu, dich zu sehen, Ruth. Deinen Wert. Dieses Talent, das du mit der Nadel hast, ist eine Kunst. Und dein wahres Ich ist in dieser Kunst, verstehst du?« Er deutete wieder auf die Handschuhe und versprühte schwarze Tröpfchen. Ich trat hastig zurück; sie platschten neben meinen Füßen auf die Holzdielen. »Du bist die Schmetterlinge, die Blumen. In dir drin besitzt du alles, was den anderen Mädchen fehlt. Wenn sie das sehen, werden sie dich bewundern müssen.«
Ich ließ ihn reden, aber seine Worte widersprachen allem, was ich kannte. So lief es nicht. Wenn eine Schülerin bei einer anderen eine Eigenschaft ausmachte, die sie nicht hatte, riss sie sie in Stücke.
»Siehst du, Ruth? Diese Mädchen erzählen viel Quatsch. Morgen haben sie längst wieder alles vergessen. Gib Pa einen Kuss, und dann ist es Zeit für dich, zu Bett zu gehen. Du wirst jetzt bestimmt besser schlafen.«
Ich reichte Ma die Handschuhe und ging zu ihm. Er nahm mich in die Arme, war voller Farbflecken und roch nach Whisky. Seine braunen Augen musterten mich, und ich denke, es dämmerte ihm endlich, dass seine Haare meine Haare waren, sein Kinn mein Kinn war – dass er dieses Elend über mich gebracht hatte. Gesichtszüge, die bei einem Mann gut aussehen, tun es nicht so bei einer Frau. Es bekommt einem Mädchen nicht, das Ebenbild des Vaters zu sein.
»Hör zu«, flüsterte er, »meine Pistole ist im Schreibtisch eingeschlossen. Falls diese Xanthippen meinem Mädchen weiterhin Ärger bereiten, sag es mir, ja? Ich werde es ihnen zeigen!« Er blinzelte mir zu.
Zum ersten Mal an jenem Abend lächelte ich.
3
Dorothea
Als ich das Gefängnis verließ, nahm ich mir vor, mich mit den Einzelheiten von Ruth Butterhams Fall vertraut zu machen.
Tilda, meine Zofe, wartete unter Schals verborgen in der Kutsche, wo ich sie zurückgelassen hatte. »Können wir jetzt nach Hause fahren, Miss?«, fragte sie, als ich einstieg.
»Bald. Ich habe Graymarsh angewiesen, in der Stadt anzuhalten.«
»O nein, Miss.«
Ich schenkte ihr mein bestes Lächeln. »Es wird bald Frühling. Ich habe große Lust, mir den botanischen Garten anzusehen – du nicht auch?«
Tilda wusste genauso gut wie ich, dass unsere nächste Anlaufstelle nicht der botanische Garten wäre. Zuerst bogen wir in eine Straße mit Kopfsteinpflaster ein, wo der Smog die Farbe eines dunklen Cognacs angenommen hatte. Ganz in der Nähe verbreitete eine Polizeileuchte ein gespenstisch blaues Licht.
»Ich gehe da nicht gerne hinein«, murrte Tilda. »Es ist voller Säufer und Bösewichte.«
»Nur ganz kurz.«
Sie zog sich ihre vielen Tücher um die Schultern. »Sehen Sie sich die Nebelsuppe an! Wie soll ich da überhaupt die Tür finden?«
»Die blaue Lampe wird dein Schutzengel sein«, neckte ich sie, aber sie fand es nicht witzig. Sie warf mir einen recht frechen Blick zu, bevor sie hinaussprang und fluchend in den braunen Nebel trottete.
Die arme Tilda kann natürlich nichts dafür – es liegt an der Form ihres Kopfes. Wenn ich hinter ihr stehe, bemerke ich rechts an der Grundlinie des Scheitels eine klare Vorwölbung. Selbstvertrauen, Eigenliebe, alle egoistischen Gefühle. Sie ist nicht dafür geschaffen, anderen zu dienen.
Zehn Minuten später kehrte sie schnaufend in die Kutsche zurück. Ruß hing in ihrem Haar.
»Und?«
Umständlich setzte sie sich wieder hin, blies sich in die Hände und zog den heißen Ziegelstein an ihre Füße, bevor sie mich ansah.
»Zum botanischen Garten«, sagte sie schließlich. »Eine halbe Stunde.«
Ich zog meine Uhr hervor und schaute nach der Zeit. »Ausgezeichnet. Fahr los, Graymarsh!«
Knospen schmückten die Bäume, die am Rande des Parks wuchsen, wo wir nah am schwarzen Eisengitter anhielten. Hier war alles taufrisch ohne den Smog der Stadt. Gelbe Krokusse trieben ihre Köpfchen aus der Erde. Ich ließ das Fenster hinunter, um einzuatmen. Die Pflanzen. Das Leben.
»Ich werde mich am Kopf erkälten«, warnte Tilda.
»Bestimmt wirst du das Beste draus machen, Tilda.«
Junge Damen wagten sich wieder hinaus, auch wenn sie direkt ins Tropenhaus gingen. Kindermädchen würden erst in ein paar Wochen mit ihrer in Decken gewickelten wertvollen Fracht kommen. Ich sehnte mich danach, an Davids Arm selbst eine Runde zu gehen … Aber das durfte nicht sein. Noch nicht.
Als in der Ferne eine Uhr die Stunde schlug, erschien er am Ende der Straße: Eine große Gestalt, die durch den Hut noch größer wirkte, kam mir entgegen, die Hände hinter dem Rücken verschränkt. Der Himmel erhellte sich, die Luft wurde frischer.
Bei jedem Treffen erinnere ich mich an unsere erste Begegnung. An meine Erleichterung beim Anblick dieser Gestalt, die wieselflink dem hassenswerten Rohling hinterherrannte, der mir meinen Pompadour entrissen hatte. Ich glaube, ich liebte ihn von diesem Moment an; ich liebte ihn umso mehr, als er mir meinen Besitz zurückbrachte. Das kostbare Miniaturporträt von Mama war sicher im Innern der Tasche, und es fühlte sich an – ich weiß, das klingt überspannt –, als hätte er mir einen Teil von ihr zurückgebracht.
Ich kniff mir in die Wangen. »Tilda, meine Haube. Richte meine Haube.«
Als sie damit fertig war, hatte David uns fast schon erreicht. Ich hörte seine Stiefel auf dem Gehsteig, und kurz darauf erschien er am Fenster.
»Ich habe nicht viel Zeit«, sagte er als Erstes.
Die arme Seele wirkte erschöpft: Augenringe, derangierter Schnurrbart und Haar, das unter dem Hut hervorlugte. Ich schämte mich beinah für meinen gemächlichen Morgen.
»Wie überaus galant Sie sind, Constable«, scherzte ich. »Zum Glück brauchen wir nicht viel von Ihrer Zeit.«
»Es war viel los«, erklärte er, während er mit den Knöpfen an seinem blauen Gehrock spielte. »Ich konnte eben erst hinauskommen. Ich werde nicht vor heute Abend wieder auf Patrouille sein.«
»Verzeih mir die Störung. Es ist nur, dass ich heute eine neue Gefangene getroffen habe, ein Mädchen namens …«
»Ruth Butterham.« Er knöpfte seinen Rock auf, holte ein Päckchen hervor und schob es durchs Fenster. »Ich habe bereits Kopien erstellt. Ich wusste doch, dass du herkommen würdest, sobald man sie geschnappt hatte.«
Ich strahlte. Das Päckchen fühlte sich wohlig warm an, und ich drückte es an meine Brust. Es trug noch seinen Duft: Wolle und Zedernholz. »Du hast so ein gutes Herz!«
Er schüttelte den Kopf, konnte aber das Strahlen auf seinem Gesicht nicht verbergen. »Ich kann so nicht weitermachen, Dotty. Hinunter ins Archiv schleichen, Dinge herauskopieren, zu dir kommen. Man wird mich erwischen.«
»Dich doch nicht! Du bist zu klug für sie.«
»Es ist die Polizei.« Er zog den Rock wieder zusammen und machte die Knöpfe zu. »Es ist ihr Metier, Leute zu erwischen. Ich weiß, das ist für dich schwer zu verstehen, so wie du lebst, aber wer für sein Brot arbeiten muss, Dotty, sollte seine fünf Sinne beisammenhalten.«
Während sein Blick nach unten gerichtet war, nutzte ich die Gelegenheit, ihn zu bewundern.
So handelt ein echter Mann: Er arbeitet hart an vorderster Front, um die Welt zu verbessern. Wäre ich im starken Geschlecht geboren, stelle ich mir gern vor, dass ich es genauso tun würde. Und doch weiß ich, dass mein Vater, der den ganzen Tag auf seinem runden Allerwertesten sitzend die Zeitung liest und raucht, die Frechheit hätte, sich über David zu mokieren.
»Es ist das letzte Mal«, versprach ich.
»Das sagst du immer.«
Ich lachte. »Was soll ich denn sonst sagen?«
Er warf einen Blick auf Tilda, die so tat, als wäre sie ins Stricken vertieft. Doch ich konnte sehen, dass sie nicht konzentriert war, denn sie hatte drei Maschen fallen lassen.
»Weißt du was? Ich möchte, dass du ein Datum festlegst.«
Ein Korkenzieher durchbohrte meine Brust. »Das werde ich tun, das weißt du. Aber noch nicht jetzt.«
Es tat mir so leid zu sehen, wie sich seine Stirn verfinsterte, wie die Enttäuschung seine Augen trübte. »Das geht nun schon seit einem Jahr. Was hält uns noch auf? Ich könnte von der Arbeit freibekommen, um zu heiraten. Jones hat es erst letzte Woche getan. Und ich weiß, deinem Vater wird es nicht gefallen, aber er kann dich nicht davon abhalten. Du bist volljährig.«
Tildas Nadeln klapperten.
»Dennoch würde in der Gesellschaft schrecklicher Klatsch verbreitet werden. Ich fürchte, sogar deine Kollegen würden es missbilligen. Womöglich müssten wir von hier wegziehen, mein Liebster, und wie schaffen wir das, ohne vorher etwas anzusparen?«
»Ich glaube, du irrst dich. Wir könnten in Oakgate bleiben. Es macht einem Mann alle Ehre, wenn er mit einer Frau den eigenen Hausstand gründet. Meine Vorgesetzten nehmen einen Familienvorstand ernst, befördern ihn manchmal. Sie bezahlen mir bereits ein Pfund pro Woche, und mit deinem eigenen Geld …«
»Ich habe zwar Geld«, erklärte ich, »aber nur, solange ich lebe. Im Schriftsatz steht so eine Formalität … Wenn ich vor Papa sterbe, geht meine Rente an ihn, nicht an meine Angehörigen.«
»Na und?« Er blickte über seine Schulter, vergewisserte sich, dass niemand in der Nähe war. »Warum solltest du vor deinem Vater sterben?«
Ich war gezwungen, meinen Blick abzuwenden und auf Tildas Stricknadeln zu richten. »Verheiratete sterben viel häufiger als Junggesellinnen. Das ist ein Berufsrisiko.«
Tilda ließ eine weitere Masche fallen.
Plötzlich verstand er, was ich meinte, und errötete. »Ja, natürlich. Daran hatte ich nicht gedacht«, murmelte David. »Aber wer weiß, ob uns Gott überhaupt mit Kindern segnen würde?«
»Wir sollten darauf vorbereitet sein. Ich muss für diesen Fall Ersparnisse zurücklegen, um sicherzustellen, dass du und etwaige Kinder versorgt seid. Es ist, weil ich meine arme Mutter verloren habe, dass ich mir solche Sorgen mache. Verstehst du?«
Er nickte langsam. Was hat er doch für einen perfekt geformten Kopf unter dem Polizeizylinder! Alles in Proportion: das Subjektive und das Objektive. So einem Exemplar begegnet man nicht jeden Tag. Und schon gar nicht in Kombination mit einem hübschen Gesicht und einem großmütigen Herzen. Ich kann es mir nicht leisten, ihn zu verlieren. Einen wie ihn finde ich nie wieder.
»Ich verstehe, aber …« Er stieß einen Seufzer aus. »Es ist nicht leicht, so lange zu warten. Meine Mutter zu vertrösten, wenn sie meint, ich sollte mit der Tochter einer Freundin ausgehen. Manchmal befürchte ich, dass du mit mir spielst, Dotty. Mich zappeln lässt.«
Das tat weh. Wie ungeduldig das männliche Geschlecht doch ist! Soldaten und Seefahrer verlangen ihren Weibsleuten ab, dass sie Ewigkeiten auf sie warten, aber wenn es andersherum ist, ärgern sie sich.
»Auch ich mache mir Sorgen«, antwortete ich mit einem Zittern in der Stimme. »Ich mache mir Sorgen, dass du meiner überdrüssig wirst. Dass es dir am Ende zu kompliziert wird, eine Dame meines Standes zu heiraten, und dass du eine andere wählen wirst.«
Er verneinte die Möglichkeit nicht, aber er drückte kurz meine Hand, bevor er sich vom Fenster entfernte. »Ich muss wieder zurück.« Feuchte Luft floss herein – in der Kutsche war es deutlich kälter geworden. »Den Leuten wird auffallen, dass ich hier stehe.«
»Ich werde dich bald wieder aufsuchen«, versprach ich.
Er berührte den Hut in meine Richtung und nickte Tilda zu. »Bald«, wiederholte er. Dann war er fort.
Ich habe mich unter dem Vorwand, ich würde Briefe schreiben, in meiner Kammer eingeschlossen. Papa würde meine Lektüre nicht gutheißen. Es ist gewiss ein schockierender Lesestoff. Nach den grauenvollen Einzelheiten des Berichts des Leichenbeschauers musste ich mich hinlegen, um mich zu erholen.
Das Opfer – das einzige Opfer nach Ansicht der Polizei – war eine junge Frau, die Ruth über Jahre gekannt hatte. Ein hübsches Ding, verheiratet, noch nicht Mutter geworden. Die Leiche war in einem schrecklich ausgezehrten Zustand, doch innerlich unversehrt, als wäre sie auf übernatürliche Weise konserviert worden.
Ruth hatte im Haushalt eine Vertrauensstellung inne, wie ich erfahren habe, sie pflegte sogar die sterbenskranke Frau, die in ihrem Schoß ein Geheimnis barg, eine schwarze Schlange, die sich um ihre lebenswichtigen Organe schlang. Dass Bedienstete ihre Herrschaft umbringen, kommt vor. Ich lese es oft in der Zeitung und werde Tilda die nächsten paar Tage misstrauisch im Auge behalten. Aber das hier … Es wirkt so berechnend. Tagaus, tagein der Absicht zu töten um Haaresbreite entgegenzuarbeiten. Irgendwie wäre es beruhigender gewesen, wenn Ruth ihrer Herrin einfach ins Herz gestochen hätte.
Was mir zugegeben am meisten zu schaffen macht, ist die Erinnerung an Mama, die langsam dahinsiechte, wenn auch aus einem ganz anderen Grund. Ich erkenne in den Beschreibungen den Haarausfall wieder, das Flaumhaar am Körper. Ein grausamer Tod. Und die Vorstellung, dass jemand ihn vermutlich mit Absicht herbeigeführt hat … Jemand, der noch ein Kind war!
Warum?
Ich würde mich gern mit dem Gedanken trösten, dass Ruth unschuldig ist – dass ihre Herrin an einer ähnlichen Krankheit litt wie meine Mutter. Aber da liegt ihr Geständnis, das für mich herauskopiert wurde, vor mir. Ihre Worte im Gefängnis. Allein schon in der Luft um sie herum knisterte etwas Dunkles.
Mein Kanarienvogel Wilkie beginnt zu zwitschern. Ich stütze mich auf einen Ellbogen und schaue ihm beim Flattern zu. Sein Käfig ist viel hübscher als der von Ruth Butterham.
Was mag sie gerade tun? Grübeln? Mit den tödlichen Fingern am Werg nesteln?
Ich frage mich, ob solch ein Mädchen überhaupt gerettet werden kann. Gott sagt Ja. Selbst meine Mutter, die auf ähnliche Weise starb wie das Opfer, hätte es bejaht. Es ist meine Pflicht zu versuchen, Ruth zur Bußfertigkeit zu führen. Hinzu kommt, dass ich meine eigene phrenologische Theorie habe, bei der sie mir behilflich sein kann.
Seitdem Flugblätter in großen Mengen gedruckt werden und das Bürgertum sich damit beschäftigt, den Schädel zu studieren, sind die Moralisten empfindlich geworden.
Sie glauben, unsere Entdeckungen würden die Idee der persönlichen Verantwortung schmälern.
Wenn zum Beispiel jemand mit einer stark ausgeprägten heißen Gehirnzone geboren wird, ist er dann nicht von der Wiege an ein Bösewicht? Wie kann er dann für etwas zur Rechenschaft gezogen werden, wofür er nichts kann?
Mein Wunsch ist es aber, meinen Glauben mit dieser Wissenschaft zu verflechten. Ich glaube, der Schädel des Säuglings spiegelt beim Heranwachsen die Seele und wird durch allfällige Entscheidungen geformt. Wenn wir in der Lage sind, Laster frühzeitig zu erkennen und dem Kind einen anderen Weg zu weisen, kann sich sowohl die Kopfform als auch die Beschaffenheit des Geistes verändern.
Sollte ich Ruth läutern und dies beweisen können, würde mein Gewissen mehr Ruhe finden. Ich könnte meine Erkenntnisse sogar Mr. Combe von der Phrenologischen Gesellschaft zu Edinburgh mitteilen. Ich möchte dann Papas Gesicht sehen, wenn die Studien, die er belächelt hat, von einem Gelehrten bestätigt werden!
Ich erinnere mich an Ruths ungläubiges Gemurmel, als ich ihr sagte, ich würde das Gefängnis nicht zu meinem eigenen Vergnügen aufsuchen. Sie hatte recht, mir zu misstrauen. Meine Beweggründe sind nicht gänzlich selbstlos.
»Und«, erzähle ich Wilkie, »wenn ich vom Leben dieser Menschen fasziniert bin, wenn ich es aufregend finde, mit der Verderbtheit zu verkehren, was ist schon dabei? Ihnen ist nicht weniger geholfen.«
Er sieht mich an mit Äuglein, die wie nasse Kieselsteine glänzen, und beginnt zu singen.
Ich stehe vom Bett auf, gehe zum Frisiertisch hinüber und ordne mein Haar. »Ich werde Ruth Butterham weiterhin besuchen«, sage ich dem Mädchen im Spiegel. Auch wenn ich Ruth widerwärtig finde und die Erinnerungen an Mamas Tod schwer zu ertragen sind, muss die Frucht geerntet werden. Ich kann ihr die Erlösung bringen, und dafür kann sie mir … ihren Schädel geben.
»Schau mich nicht so an«, schimpfe ich mit Wilkies hüpfendem Spiegelbild, während ich die Kämmchen über den Ohren befestige. »Wenn ich diese Theorie beweisen kann, stell dir vor, wie viele Leben gerettet würden!«
Der Essensgong ertönt. Ein tiefes Zittern fährt durchs Haus. Ich bleibe einen Moment sitzen, spüre die Vibrationen unter der Haut. Wilkie hoppelt mit aufgeplusterten Federn zum Sandpapier auf dem Käfigboden.
Er hat Angst.
4
Ruth
Danach sprach ich mit Ma nicht mehr über die Schule. Sie war bereits müde, zerknittert wie ein altes Bettlaken. Ich wollte nicht, dass sie zerreißt. Also versteckte ich mein zerfetztes Kleid und mein gebrochenes Korsett und erzählte ihr nie von meinen Verletzungen. Jeden Morgen trottete ich mit meiner ramponierten Haube davon, und am Abend schlich ich nach Hause, während ich an meiner Kränkung erstickte. Als ich hereinkam, blickte sie mit getrübten, von der Arbeit erschöpften Augen auf und fragte mich, wie mein Tag gewesen war.
Ich log.
Die Wahrheit erzählte ich nur den Handschuhen.
Es gefiel mir, an den Handschuhen zu arbeiten, die kühle Seide in den Händen zu spüren, eine Nadel durch die festen Fäden zu stechen.
Doch eines Abends, ein paar Wochen später, als wir in der Dämmerung nähten, nahm Ma sie mir behutsam aus dem Schoß. Obwohl kein Sonnenlicht darauf fiel, glänzte der silberne Faden wie Tränen. »Sie sind ein Kunstwerk, Ruth. Zurre diesen Faden fest, dann werde ich sie zu Mrs. Metyard mitnehmen, wenn ich morgen hinübergehe. Die Braut wird demnächst danach fragen.«
Ich verspürte den Drang, sie wieder an mich zu reißen. Nur die Empfindlichkeit des Stoffs hielt mich davon ab. Es waren meine. Mein Werk, meine Arbeit. Die Vorstellung, dass eine andere Frau sie berührte, war mir zuwider. »Sie sind noch nicht fertig.«
»Doch, das sind sie. Die Handschuhe sind tadellos.« In ihrer Stimme lag eine Wärme, ein Stolz, wie ich es noch nie von ihr gehört hatte. »Ich kann es gar nicht abwarten, Mrs. Metyards Gesicht zu sehen, wenn ich sie ihr zeige. Gerechterweise sollte sie mir einen Shilling mehr für eine solche Arbeit geben.«
Ich war Mrs. Metyard nie begegnet, aber ich stellte mir eine imposante Frau mittleren Alters mit Silberblick vor. Wie ich mich danach sehnte, ihr das Geld ins Gesicht zurückzuschleudern! Um die Handschuhe an mich zu nehmen, um damit meine schwieligen Finger und eingerissenen Nägel zu verbergen und zu einer anderen Person zu werden.
Doch als Ma mir die Handschuhe wieder in den Schoß legte, erkannte ich, wie hoffnungslos das war. Ein Mädchen wie ich in geflickten und fleckigen Kleidern konnte niemals so hochwertige Handschuhe tragen. Es war, wie Rosalind Oldacre sagte: Ich war keine Dame. Für sie würde ich kaum mehr als ein Tier sein. Ich würde niemals bekommen, was ich mir wünschte.
Ma hockte auf der Kante des bequemen Sessels, die Hände verschränkt. Sorgenfalten zeigten sich auf ihrer Stirn. »Es hat … dir gefallen, an den Handschuhen zu arbeiten?«, fragte sie zögernd.
Ich zog sie näher an mich heran. »Ja.«
»Also würdest du es nicht ablehnen, mir bei weiteren Stickereien zu helfen?«
Gab es irgendeine Arbeit, die schöner war? Ich schloss die Augen, träumte von schwerer gefilzter Wolle, schimmerndem Taft, wie ein Regenbogen ausgebreiteter Baumwolle. Ein Mädchen konnte sich in solchen Farben verlieren. »Nein.«
»Das ist gut. Weil ich mir dachte, du könntest die Arbeit an meiner Seite erlernen. Als eine Art Lehrling. Nur dass es zu einigen … Änderungen kommen würde.« Ihre Stimme stockte wie ein verknoteter Faden. »Zum einen müsstest du aufhören, die Schule zu besuchen.«
Ich riss die Augen auf. Nach meinen Visionen von prächtigen Stoffen sah der Raum sehr kalt und sehr schwarz aus. »Warum?«
»Um dich ganz deiner Aufgabe zu widmen, um …«, setzte sie an, doch selbst Ma konnte nicht einfach mit diesem Gedanken herausplatzen. Sie atmete aus und legte die Hand an die Stirn. »Wenn ich ehrlich bin, geht es uns darum, dass du Geld verdienen solltest. Ganztägig. Wir können es uns nicht leisten, weiter die Schule zu bezahlen. Es tut mir so leid, Ruth. Ich wollte, dass du andere Möglichkeiten hast, dass du dir deinen Lebensweg selbst aussuchen kannst. Aber wenn du hier bist und während des Tages mit mir nähst, kann ich dir beibringen, was ich gelernt habe, als ich in deinem Alter war. Ich hatte Unterricht in Französisch, wie du weißt, und ein wenig in Geschichte. Ich werde dich nicht ohne Bildung heranwachsen lassen.«
Ich hätte erleichtert sein sollen, die Schule und die stichelnden Mädchen hinter mir zu lassen. Ich war