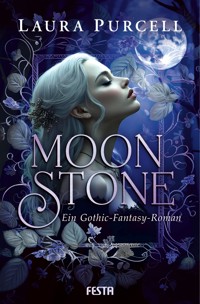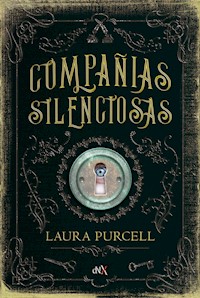5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Festa Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Böses geschieht im Dunkeln. Mitte des 19. Jahrhunderts hält die Fotografie in England Einzug, und die Scherenschnitt-Künstlerin Agnes kämpft verzweifelt darum, ihr Geschäft zu erhalten. Mit jedem Tag scheinen sich weniger Menschen für ihr besonderes Handwerk zu interessieren. Agnes sieht sich plötzlich mit Problemen konfrontiert, die sie immer mehr in die Dunkelheit ziehen. Doch in den Straßen von Bath lauert ein weiterer Schatten: ein heimtückischer Mörder, der es scheinbar auf ihre Kunden abgesehen hat. In ihrer Verzweiflung wendet sich Agnes an ein spirituelles Medium, die junge Pearl, die mit den Toten Kontakt aufnehmen soll. Die Wahrheit, die die beiden Frauen ans Licht bringen, wäre jedoch besser im Dunkeln geblieben … Das neue Meisterwerk der »Queen of Gothic Fiction«. Autorin der Bestseller Die stillen Gefährten und Das Korsett. Ein außergewöhnlicher Roman über das Schicksal und die Schatten, die wir mit uns herumtragen. Ruth Hogan: »Düster, süchtig machend und absolut fesselnd.« Horrified Magazine: »The Shape of Darkness bietet alle Elemente, die ihre Fans erwarten: Frauen in schwierigen Situationen, eine schleichende übernatürliche Bedrohung und eine finale, atemberaubende Wendung.« Mail on Sunday: »Purcell etabliert sich schnell als die Altmeisterin des Gothic Thrillers.« Publishers Weekly: »Fans von Gothic Fiction werden dieses Buch verschlingen.« Diese Ausgabe erscheint mit rotem Farbschnitt und goldfarbenem Leseband.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 450
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Aus dem Englischen von Eva Brunner
Impressum
Die englische Originalausgabe The Shape of Darkness
erschien 2021 im Verlag Raven Books.
Copyright © 2022 by Laura Purcell
Copyright © dieser Ausgabe 2022 by Festa Verlag GmbH, Leipzig
Lektorat: Bernhard Kempen
Alle Rechte vorbehalten
eISBN 978-3-98676-019-9
www.Festa-Verlag.de
Für Kevin
»… wir riefen gemeinsam einen seltsamen Schatten ins Leben, der keinem von uns gehörte, nur ein ungestaltetes, ungeformtes Ding … Die Ideen kreuzten sich wie die Linien zweier nasser Zeichnungen, die sich nach dem Übereinanderlegen schneiden, verwischen, auslöschen und unkenntlich werden.«
Elizabeth d’Espérance,
Shadow Land or Light from the Other Side
1
Es ist der Dreispitz, der sie zu ihm hinzieht: die Art, wie er aus einem Meer von Zylindern herausragt. Seine goldene Krempe endet tief in der Stirn und verleiht dem Gesicht darunter einen goldenen Glanz.
Er steht da und unterhält sich mit einem halben Dutzend anderer Herren unterhalb des verglühenden Herbstlaubfeuers in den Sydney Gardens, das den Spaziergängern wie ein Blutgerinnsel den Weg versperrt. Als er eine Hand ausstreckt, um seinem nächsten Begleiter etwas zu erklären, sieht es Agnes: die perfekte Pose für eine Ganzkörpersilhouette.
Sie greift in ihrem Pompadour nach der Schere, aber ihre Finger sind kalt und steif. Als sie die Griffe und das Schwarzpapier endlich zu fassen bekommt, um es durch die Hand gleiten zu lassen, hat sich der Mann bereits umgedreht und den Arm wieder seitlich angelegt.
Sie wird es aus dem Gedächtnis zuschneiden müssen.
Da sind das altvertraute Kribbeln im Bauch, die wirren Atemzüge in der Brust. Die Hoffnung will nicht sterben. Sie wird den dunkelblauen Mantel der Königlichen Marine niemals ohne den unerschütterlichen Glauben sehen können, dass er irgendwie, irgendwie …
Aber dieser Mann ist nicht Montague. Trotz ihres grauen Stars kann Agnes genug von seinen Gesichtszügen erkennen, um diese Fantasie zu verwerfen. Wenn John Montague noch am Leben ist – und sie hat keine Gewähr dafür –, dann wird er kein schlanker, aktiver Mann sein, der gern debattiert, sondern ein gestandener Seefahrer, der sogar älter ist als sie selbst. Die Jahrzehnte an Deck hätten seine Haut verwittern und ihn über seine Jahre hinaus altern lassen. Vielleicht hätte er einen Bauch unter der Weste oder humpelt aufgrund einer Schusswunde. Ihr ansehnlicher Lieutenant gehört der Vergangenheit an.
Sie schneidet die Umrisse seines Gesichts in glatten, kühnen Wellen aus und lässt das Papier zwischen der Daumenkuppe und dem Finger hindurchgleiten, der noch seinen Ring trägt.
Die Brise wird stärker.
Widerspenstig flattert das Papier. Es ist auf dem Spaziergang feucht geworden und bleibt nicht mehr so in Form, wie es sollte, aber Agnes macht beharrlich weiter.
Sobald sie über den Hals hinweg ist, wird die Arbeit leichter. Der Körper spricht eine andere Sprache. Die Schultern mit den Epauletten, die Rockschöße, die sich bis zu den Hosen und dem vorangestellten Fuß hinunterziehen, werden immer ganz flach geschnitten. Dieser Marineoffizier muss soeben zu Hause angekommen sein. Denn eigentlich darf er seine Uniform nicht im Heimaturlaub tragen. Es ist ein seltener Anblick, ein Geschenk; ein wenn auch flüchtiger Blick auf glücklichere Zeiten.
Der Wind bläst. Die Bäume werfen ihre goldenen und bronzenen Schätze auf die Männer, und ein frisches, braunes Eichenblatt setzt sich aufrecht in der Krempe des Dreispitzes fest. Es wäre ein schönes Detail, wenn Agnes diese Form nicht schon ausgeschnitten hätte.
Sie nimmt die letzte Wölbung in Angriff, was sie nicht überstürzen darf, auch wenn sich ihre Fingerknöchel zu verkrampfen beginnen. Und … da! Die Gestalt hebt sich triumphierend vom Hintergrund ab. Ein weiterer Windstoß reißt den schwarzen Papierabfall mit sich und schickt ihn wirbelnd in den bleifarbenen Himmel.
Agnes schaut missbilligend auf ihr Werk. Sie hat bei der Nase über- und beim Kinn untertrieben. Es geht um Nuancen, die man bei ihrer Kunst nur selten versteht: Ein Schatten, eine exakte Nachbildung des Schattens, den eine Person wirft, hat so gut wie gar keine Ähnlichkeit. Er muss verfeinert und übertrieben werden, damit die Menschen das Profil als ihr eigenes erkennen können. Aber nun fehlt ihr die Zeit, um Änderungen vorzunehmen. Die Herrengruppe verabschiedet sich. Die Wolken sammeln sich schnell hinter der Kalksteinfassade des alten Sydney Hotels.
Trotz ihres großen Geschicks kann Agnes nicht im Regen arbeiten. Es ist an der Zeit, nach Hause zurückzukehren.
Sie plagt sich dieser Tage ab, eine Folge des Unglücksfalls. Vielleicht liegt es aber auch am Alter. Die Straßen von Bath sind schwieriger zu begehen, wie es scheint, und die Sohlen ihrer Halbstiefel rutschen aus, wenn sie Kopfsteinpflaster unter den Füßen hat. Es sprießen die Regenschirme, die das Überqueren der Pulteney Bridge zu einer doppelten Tortur machen. Klamme Wollmäntel drücken gegen sie. Die Rinnsteine laufen im Regen schnell über und verbreiten den Geruch von Pferdemist und Abwässern.
So war das doch früher nicht?
Das Bath zu Agnes’ Kinderzeit war eine Stadt der Paläste. Natürlich kamen Leute zur Kur, doch damals saßen nicht alle krank im Rollstuhl; die feine Gesellschaft stellte sich tagsüber in der Trinkhalle zur Schau und tanzte nachts in den Sälen des Kurhauses. In irgendeinem der Palais aus weißem Stein wurden immer Theateraufführungen oder Konzerte dargeboten.
Jetzt haben Kohleablagerungen die Gebäude verfärbt und ihnen ein trauriges Aussehen verliehen. Der Dreck strömt in den Fluss und zum Himmel. Die Seele von Bath hat die Stadt verlassen, und ihr Körper verwest. Nur die Hügel von Somerset leuchten übernatürlich lebendig in der Ferne.
Eine Peitsche knallt durch die Luft. Agnes hält gerade noch rechtzeitig am Rande des Bürgersteigs an. Ein großer Wagen rumpelt mit quietschenden Rädern vorbei und bespritzt ihre Röcke.
Als sie den Kirchhof der Abtei erreicht, kratzt ihr Atem schmerzhaft in der Lunge. Es war wirklich töricht, bis zu den Sydney Gardens zu wandern. Es sind kaum zwei Jahre vergangen, seitdem eine Lungenentzündung sie fast das Leben gekostet hätte. Schon vor dem Fieber war sie nicht kräftig gewesen, doch als sie wieder klar denken konnte, bemerkte sie eine tiefgreifende Veränderung: Ihr Körper fühlte sich an wie der einer Fremden, der ihr nicht mehr wie früher gehorchen wollte.
Gehen Sie es langsam an, rät ihr Simon. Doch manchmal scheint es ihr, als hätte sie ihr ganzes Leben langsam angegangen: im gemächlichen Tempo eines Menuetts. Ein Päuschen im Ohrensessel vor dem Kamin, um ihrem Neffen Cedric aus Varney, der Vampir vorzulesen, würde ihr guttun. Die Krankheit mag sie gebrechlich gemacht haben, aber sie gibt sich noch lange nicht geschlagen.
Der Regen spritzt boshaft. Sie nimmt all ihre Kraft zusammen und geht über den Kirchhof und um das Abteigebäude herum.
Ihr Haus, dessen Mauern durch die Zeit und den Ruß dunkel geworden sind, liegt im Schatten der Abteikirche. Efeuberankte Säulen stützen einen Portikus über der Eingangstür. Elstern haben sich hier eingenistet, auch wenn sie derzeit nicht zu sehen sind. Den ganzen Tag über schnattern und gackern sie, stören sie bei der Arbeit, die sie wie andere auch verspotten und als ein Relikt einer längst vergangenen Zeit abtun.
Aber für Agnes sehen die schwarzen Scherenschnitte in ihren Fenstern so schön aus wie eh und je. Diese Konversationsstücke hat sie entworfen, um die Kunden zum Verweilen zu verführen: eine Damengruppe beim Tee, Pferde, die mit der Hundemeute jagen. Und dann gibt es die heiteren, in Zinnoberrot gemalten Ovale; es sind lebhafte Farbtupfer an diesem trüben Tag.
Sie ist nicht die Einzige, die ihre Arbeit mit Bewunderung betrachtet.
Als sie näher kommt, bemerkt sie zwei Männer, die vor dem Fenster ihres Salons stehen. Der eine schaut auf seine Taschenuhr und klopft dann an die Haustür. Seinem Auftreten nach zu urteilen, klopft er nicht zum ersten Mal.
Kann Mama das nicht hören? Und wo ist Cedric? Bei dem Wetter spielt er doch nicht etwa draußen?
Kopfschüttelnd eilt sie voran, entschlossen, die Besucher zu erreichen, bevor sie sich abwenden. Was für ein erbärmliches Bild einer Künstlerin sie abgibt – keuchend und klatschnass –, aber sie kann es sich nicht leisten, auch nur das geringste Geschäft zu verlieren.
Erst als sich die Wolken öffnen und einen dünnen Lichtstrahl durchlassen, bemerkt sie, dass der Mann, der an ihre Tür klopft, kein gewöhnlicher Besucher ist. Regen tröpfelt vom Portikus auf seinen hohen Kastorhut.
Der Zylinder eines Polizisten.
»Miss Darken! Wie Sie sehen, Sergeant, stehe ich zu meinem Wort. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass sie sich an einem Tag wie diesem nicht weit hinauswagen würde.«
Bevor Agnes sich besinnen kann, erkennt sie Simons Stimme, sieht Simons wässrig blaue Augen, die sie unter der durchnässten Hutkrempe vorwurfsvoll anschauen.
Sie wird von Simon und einem Polizeibeamten erwartet.
»Ich … musste etwas an die Luft«, erklärt sie. »Ich bin umgekehrt, als es zu regnen begann.« Sie klingt schuldbewusst wie ein ertapptes Kind.
»Miss Darken, ich bin Sergeant Redmayne.« Der Polizist hat ein Gesicht wie ein Granitblock, auf dem nicht die Spur eines Lächelns erkennbar ist. Als er den Kopf vorneigt, fällt Wasser von seinem Hut auf ihre Füße.
Agnes unterdrückt einen Seufzer. Die Manieren scheinen noch schneller zu verfallen als die Stadt selbst. »Und womit kann ich dienen, Sergeant?«
»Es ist etwas heikel, Miss. Darf ich hereinkommen?«
Simon räuspert sich und fummelt an seinem Kragen herum. Zweifellos denkt er das Gleiche wie Agnes: Der Anblick eines Polizisten könnte bei Mama wieder einen ihrer seltsamen Anfälle auslösen.
Die Augen des Sergeants nehmen sie noch aufmerksamer ins Visier, als sie zögert.
»Wenn es sein muss«, sagt sie widerwillig. »Bitte entschuldigen Sie die Unordnung. Ich habe heute früh gearbeitet. Ich habe nicht mit …«, sie deutet auf ihn, »Ihnen gerechnet.«
Sie kramt in ihrem Pompadour, holt einen Schlüsselbund hervor und steckt unbeholfen einen der Schlüssel ins Schloss. Sie hofft, dass der Sergeant weder das angelaufene Messing am Briefkasten noch den Kot der Elstern an den Türverkleidungen bemerkt. Vielleicht ist es ganz gut, dass er kein Klient ist.
Agnes führt sie herein. Es folgt keine Reaktion auf ihre Schritte oder das Zuschlagen der Tür hinter Simon, der als Letzter eintritt. Vorsichtig blickt sie in den Salon – eine kleine Kammer, die von einem Kamin und einer alten eichenen, keuchend tickenden Großvateruhr dominiert wird. Captain Darken hatte bis zu seinem Tod vehement behauptet, die Uhr sei aus dem Holz der HMS Victory gefertigt worden, was Agnes immer bezweifelt hat.
Eine Teetasse steht noch auf dem Beistelltisch, wie sie sie zurückgelassen hat. Der Bodensatz hat sich mit dem weißen Porzellan verbunden. Im Schlund des Kamins liegt nur noch Asche.
Zum Glück lässt sich Mama nicht blicken.
»Bitte sehr!«, lädt sie die Besucher ein und schämt sich für den Staub und die Pinsel, die im Raum herumliegen. Sogar die gerahmten Profile an der Wand scheinen ihre Gesichter abzuwenden, um sich ihr Durcheinander nicht ansehen zu müssen. »Dauert es lange? Soll ich Teewasser aufsetzen?«
»Das wird nicht nötig sein, Miss Darken.« Sergeant Redmayne lässt sich in den Ohrensessel fallen.
Agnes würde sich lieber umziehen, das Feuer anheizen und eine Stärkung zu sich nehmen, bevor sie sich anhört, was er zu sagen hat, aber das Verhalten des Sergeants ist so ernst, so bedrückend, dass ihr nichts anderes übrig bleibt, als sich zu setzen, die Haube abzunehmen und stumm auf seine Worte zu warten.
»Ich bin vorher schon einmal vorbeigekommen, aber Sie waren nicht da. Stattdessen traf ich hier Ihren Arzt an.« Er wirft Simon einen Blick zu, der einen schmächtigeren Mann umhauen würde. »Seltsamerweise tauchte er, gerade als ich für einen zweiten Versuch zurückkam, wieder auf.«
»Ein Zufall.« Simon lächelt, doch Agnes spürt, dass er nicht ganz unbeschwert ist. Er hat sich noch nicht hingesetzt.
»Wenn Sie das sagen, Doktor. Hören Sie, Miss, ich will nicht um den heißen Brei herumreden. Hatten Sie am letzten Samstag, dem 23., einen Mr. Boyle hier für ein Porträt?«
»Nicht ganz ein Porträt, Sergeant. Ich habe ein paar erste Skizzen gemacht. Er möchte die Umrisse für seine Frau auf Glas malen und mit bronzenen Details verzieren lassen. Als Erinnerungsstück zum Jahrestag ihrer Hochzeit, wenn ich mich recht entsinne.« Agnes zwirbelt die schlaffen Bänder an ihrer Haube. »Aber … woher wissen Sie davon?«
»Mr. Boyle hat den Termin in seinen Kalender eingetragen. Darken, 14 Uhr.«
»Ja, das war ungefähr die Zeit …«
Sie ist verwirrt. Was hat ein Polizist mit ihrer Arbeit zu tun? Sie versucht sich an diesen Mr. Boyle zu erinnern. Ein unauffälliger Mann, altmodisch. Kein ausgeprägtes Profil, abgesehen von den prallen Lippen. Die Art von Mann, die ihre Schwester Constance verächtlich als alten Kauz bezeichnet hätte.
»Ist Mr. Boyle in Schwierigkeiten?«
»Das kann man wohl sagen, Miss. Er ist tot.«
»Tot!«
Simon tritt vor. »Wirklich, Sergeant, das ist nicht die Art, einer Dame eine solche Nachricht zu überbringen …«
Doch Sergeant Redmayne redet unbeirrt weiter, seine Stimme ist so emotionslos wie sein Gesicht. »Ermordet, genauer gesagt. Wir haben die Leiche auf dem Gravel Walk gefunden, mit eingeschlagenem Kopf. Sieht aus, als wäre die Tat mit einem Holzhammer verübt worden. Ohne Zweifel wollte der Täter die Identifizierung seines Opfers so lange wie möglich hinauszögern.«
»Jetzt hören Sie mal …«, wendet Simon ein.
Agnes ist dankbar für seine voluminöse Anwesenheit und das Salz, das er ihr unter die Nase hält. Der Geruch wirkt wie eine Peitsche, die sie aufrecht hält.
»Wie widerwärtig«, keucht sie. »Wer könnte nur …?«
»Das ist es, was wir herausfinden wollen. Boyle hatte eine Verabredung zum Abendessen, nachdem er bei Ihnen war, um 19 Uhr. Dort ist er nie angekommen. Aber Sie können bestätigen, dass er hier war?«
Simon setzt sich endlich neben sie. Das Sofa gibt unter seinem Gewicht nach. Hilflos kippt ihr Körper in seine Richtung, sodass sie sich mit der Schulter an ihm abstützt wie bei einem Kartenhaus. Sie richtet sich auf.
»Ja«, antwortet sie zaghaft. »Unsere Sitzung hat nicht lange gedauert. Skizzieren geht sehr schnell, wissen Sie …« Der Gedanke, dass ihre Augen mit zu den letzten gehören, die Mr. Boyle lebend gesehen haben! Es ist gewiss ein tröstlicher Gedanke, dass sie die Linien seines Gesichts nachzeichnete, bevor sie verschwanden. Oder in sich zusammenfielen. Ein Holzhammer, hat der Polizist gesagt? »Wir haben länger über das gewünschte Produkt gesprochen. Ich nehme an, er verließ mich gegen … Viertel vor drei?«
Sergeant Redmayne nickt. Kein einziges Mal während des ganzen Gesprächs hat Agnes ihn blinzeln sehen. »Und wie wirkte er? Aufgewühlt? Besorgt?«
Agnes versucht, sich in Gedanken zurückzuversetzen. Ehrlich gesagt war Mr. Boyle die Sorte von Mann, die man schnell vergisst. Wäre sie wie in alten Tagen von Modellsitzenden überrannt worden, hätte sie sich wohl kaum an ihn erinnert. So wie es ist, hat sie ein Bild seines nach links geneigten Gesichts zum letzten Mal auf Papier gebannt. Keine Gesichtszüge, nur Bleistiftumrisse. Es verblasst bereits in ihrem Gedächtnis. Sie hatte ihm einen Schattenriss aus schwarzem Papier ausgeschnitten, um ihm zu zeigen, wie es aussehen würde, bevor er sich für die Farbe entschied.
»Oh«, haucht sie in einem absterbenden Ton. »O nein. Er hat mich nicht bezahlt.«
»Wie bitte?«
»Mr. Boyle wollte die Glasmalerei bei der Abholung bezahlen. Sie ist praktisch fertig. All die Arbeit!«
Der Sergeant schnalzt irritiert mit der Zunge. »Ich kann das nicht als das größere Übel betrachten, Miss. Manche würden sagen, er hat den höchsten Preis bezahlt.«
»Ich möchte nicht gefühllos klingen. Aber man kann Mitleid nicht essen. Ich kann mit Mitleid kein Haus über den Winter heizen. Ich wage zu behaupten, wenn das Polizeirevier Ihr wöchentliches Gehalt nicht bezahlen würde …«
Simons Ellbogen stupst sie an. Vielleicht ist sie unvernünftig.
Es ist der Schock.
Sie ist nicht sie selbst.
»Wenn wir noch mal zu der Frage zurückkehren könnten, wie Mr. Boyle an dem fraglichen Nachmittag wirkte?«
Die Elstern bewegen sich in ihrem Nest, ihre Füßchen klappern auf dem Dach.
»Er war … unauffällig. Soweit ich es als jemand, der ihn nicht kannte, beurteilen kann. Wir sprachen über seine Frau und den Auftrag, glaube ich. Mehr nicht … Er schien in bester Laune zu sein. O ja! Er machte einen Scherz über den Schattenriss meiner Schwester. Er wirkte also nicht im Geringsten beunruhigt.«
Sergeant Redmayne nickt wieder. »Verstehe. Nun, falls Ihnen noch etwas einfällt, Miss Darken, könnten Sie mich dann aufsuchen? Ich lasse Ihnen meinen Namen und meine Adresse da.«
Er zieht eine Visitenkarte aus der Tasche und schiebt sie mit dem Finger über den Beistelltisch.
»Ja. Ja, das werde ich.«
»Sie waren vermutlich die letzte Person, die Mr. Boyle lebend gesehen hat. Abgesehen vom Mörder natürlich. Ich möchte Sie bitten, in der Stadt zu bleiben.«
Sie stößt ein Lachen aus. »Wohin sollte ich denn gehen?«
Er zuckt mit den Schultern und steht auf, wobei er einen wässrigen Abdruck auf dem Ohrensessel hinterlässt. »Die Leute gehen an alle möglichen Orte, wenn die Polizei anfängt, Fragen zu stellen.«
Jetzt ist Simon an der Reihe aufzustehen. »Ich verbürge mich dafür, dass Miss Darken in Bath bleibt. Ihre Gesundheit ist derzeit nicht stabil genug, um eine Reise zu erlauben. Und nun«, er gestikuliert zur Tür, »haben wir der Dame für heute genug Kummer bereitet.« Die Großvateruhr surrt in Vorbereitung auf den Stundenschlag. »Ich würde Sie gern hinausbegleiten, Sergeant.«
Endlich setzen sie sich in Bewegung, schlurfen durch die Tür zum Flur, nehmen die lauten Stimmen und furchtbaren Nachrichten mit sich.
Agnes lässt sich in voller Länge auf das Sofa fallen. Erst jetzt, als ihre Zähne unkontrolliert klappern, bemerkt sie, wie kalt ihr ist. Sie sollte sich dieser elenden, feuchten Kleider entledigen, aber ihr fehlt die Energie. Alles an ihr fühlt sich schwer an.
Wenig später berührt Simons Hand sie leicht am Hinterkopf. »Vergeben Sie mir, Miss Darken. Ich hatte dem verfluchten Kerl gesagt, das alles würde Sie nur wieder krank machen. Nicht dass er auf mich gehört hätte. Diese neumodische Polizei gibt Emporkömmlingen wie ihm viel zu große Befugnisse.«
»Ich würde ihm seine Unverschämtheit verzeihen, wenn er mir nicht so eine schreckliche Nachricht überbracht hätte.« Sie hustet. »Armer Mr. Boyle! Mein erster Klient seit Monaten!«
»Still jetzt, still! Legen Sie sich hin! Ich hole Ihnen etwas zu trinken.«
»Wo ist Cedric? Mama? Sie darf nichts davon erfahren …«
»Nein.« Er hält inne. »Oben ist alles … ruhig.«
»Danke, Simon.«
Erschöpft schließt Agnes die Augen, aber die fehlende Sicht verstärkt nur ihre Schmerzen und ihr Unwohlsein. Das Brennen in ihrer Brust. Ein Dröhnen tief in ihren Augenhöhlen. Der Anblick des Polizisten hat den Unglücksfall mit einer Klarheit zurückgebracht, die sie nach all den Jahren nicht für möglich gehalten hätte.
Das Haus dehnt sich und platzt auf. Sie lässt das Gesicht in ein Kissen fallen und ignoriert alles um sich herum.
Als sie wieder zu sich kommt, ist ein Schal über sie drapiert. Flammen züngeln im Kamin. Auf dem Beistelltisch dampft eine frische Tasse Tee neben einem Stück Kuchen.
Simon sitzt da und beobachtet sie. Er hat seinen Mantel abgelegt und die Hemdsärmel über die breiten Arme hochgerollt. In der rechten Hand hält er ein Glas mit einer whiskyfarbenen Flüssigkeit. Möglicherweise Opiate.
»Zuerst den Tee«, weist er sie an. »Dann eine Dosis hiervon, damit Sie schlafen können.«
Der liebe Simon. Er hat sie bedient, als wäre er ein Hausangestellter – und sie kann ihm nicht einmal die Medikamente bezahlen.
»Wie geht es Mama? Cedric wartet bestimmt auf sein Abendbrot. Wir versuchen immer, es zusammen einzunehmen und eine Geschichte zu lesen …«
Simon holt tief Luft.
»Sie schlafen schon.«
Es fällt kein Licht durch die Papiersilhouetten an den Fensterscheiben; ihre Formen verschmelzen mit dem Schwarz der Nacht dahinter. Es ist viel später, als sie gedacht hätte.
»Ich halte Sie viel zu lange auf, Simon. Sie haben Besseres zu tun. Andere Patienten … Und wer füttert denn Ihren kleinen Hund?«
Ein dünnes Lächeln.
»Morpheus kommt auch ohne mich zurecht. Los, trinken Sie Ihren Tee. Erst wenn Sie sich beruhigt haben, werde ich mich verabschieden.«
Gehorsam greift sie nach der Tasse. Die Flüssigkeit ist zu heiß, aber sie zwingt sie hinunter.
»Simon, wenn die Nachricht von dem Mord nach draußen dringt … und das wird sie zweifellos …« Sie nimmt einen weiteren Schluck. »… befürchte ich, dass es mein Geschäft in Verruf bringen könnte.«
»Das besprechen wir später in Ruhe.«
Das ist wenig beruhigend. In ihrem Kopf wimmelt es von Fragen und Sorgen – es wäre eine Erleichterung, sie mit Simon zu besprechen, aber sie kennt ihn schon lange genug, um die undurchdringliche Arztmiene zu erkennen. Dieser Mann ist nicht mehr ihr Verbündeter, sondern »Dr. Carfax«, der Aufregung absolut verbietet.
Stattdessen schluckt sie den letzten Rest des Tees hinunter, schmeckt nichts als Hitze und nimmt einen Bissen vom trockenen Kuchen. Simon reicht ihr die Opiate, und sie trinkt sie als bitteres Dessert.
»Jetzt müssen Sie sofort ins Bett.« Er sieht aus, als könnte er selbst einen langen Schlaf gebrauchen. Im Licht des Feuers sind seine Augen blutunterlaufen. »Versprechen Sie es mir.«
»Das werde ich. Aber zuerst will ich Sie hinausbegleiten.«
Sie zündet eine Kerze an, und sie verlassen gemeinsam den Salon.
Als sie die Haustür öffnet, weht eine kühle Brise herein und zwingt sie, schützend eine Hand um die Flamme der Kerze zu legen. Der Regen hat aufgehört, geblieben ist nur sein metallischer Geruch. Die Straßenlaternen zeichnen schweflige Pfützen auf die Bürgersteige.
Es ist ein schrecklicher Gedanke, dass Simon sich allein hinauswagt, während ein Mörder frei herumläuft.
»Seien Sie vorsichtig, Simon. Gehen Sie schnell.«
Er verbeugt sich – eine richtige Verbeugung, ein Bein leicht hinter dem anderen. Selbst bei seinem Körperumfang hat er mehr Anmut als der Sergeant.
»Bis morgen, Miss Darken.«
Er setzt sich den Hut auf und dreht sich um. Agnes blickt ihm nach, wie er fortgeht, seine Gestalt hebt sich im Licht der Straßenlaternen ab.
Immer »Miss Darken«. Sie kennen sich seit der Kindheit; er ist wie ein Bruder für sie, und doch ist da diese Befangenheit zwischen ihnen.
Feuchte Luft schleicht um die Abteikirche und berührt ihre Wange. Als das Geräusch von Simons Schritten verhallt, schließt sie die Tür und verriegelt sie.
Die Wände atmen aus.
Leise steigt sie die Treppe hinauf. Sofort ins Bett, sagte Simon, aber aus Erfahrung weiß sie, dass sie mindestens zehn Minuten Zeit hat, bevor die Opiate wirken.
Sie muss nachsehen. Nur ein Mal.
Die Türen zu Mamas und Cedrics Schlafkammern sind verschlossen. Keiner der beiden gibt im Schlaf einen Laut von sich. Agnes vermeidet die knarrenden Dielen und geht vorsichtig über die Schwelle zu ihrem eigenen kalten Bett und betritt ihr Atelier.
Es ist der einzige Ort im Haus, an dem sich die Luft lebendig anfühlt. Selbst in der Nacht, im Schein ihrer flackernden Kerze, strahlt ihr Arbeitsplatz eine Art Glanz aus. Vielleicht ist es der Messingglanz der verschiedenen Geräte und Apparate, die sie im Laufe ihrer Arbeit erworben hat: unter anderem einen Physionotrace mit einer langen Stange und eine Camera obscura. Es waren notwendige Anschaffungen. Das moderne Publikum will Maschinen, keine Menschen: eher etwas wie eine Daguerreotypie.
Agnes sieht den Reiz nicht. Eine Kupferplatte, ein bisschen Quecksilber, und das soll Kunst sein? Sie gehört einer aussterbenden Gattung an, die eine Zeichnung mit weichen Stiften oder etwas mit dem Pinsel liebevoll Gemaltes vorzieht.
So erging es auch Mr. Boyle. Aber er wird sein Bild inzwischen verewigt haben. Polizisten scheinen heutzutage Tatorte immer zu fotografieren. Sie schluckt den Schmerz in ihrer Kehle hinunter und versucht, sich Mr. Boyle nicht in chemischen Schattierungen in Silbergrau vorzustellen, sein Blut als tiefschwarze Lache.
Sie stellt die Kerze auf ihren abgenutzten Schreibtisch.
Sie schiebt mit Farbe gefüllte Blasen beiseite und bewegt Papierstapel, um schließlich den gesuchten Gegenstand zu finden: ein in Leder gebundenes Buch, so groß wie die Familienbibel. Ihr Buch der Duplikate mit Kopien aller Schattenrisse, die sie je erstellt hat.
Sie beginnt nicht am Anfang, wo ihre frühen Arbeiten liegen. Es ist ihr peinlich, auf diese stumpfen Schnitte von Constance zu schauen und sie als ihre eigenen anzuerkennen. Stattdessen blättert sie weit nach hinten. Sie dreht eine Seite nach der anderen um. Die kleinen schwarzen Figuren blitzen vor ihren Augen auf und scheinen sich zu bewegen. Endlich findet sie ein Stück Papier, das sie hastig ins Buch geschoben hatte: den Kopf und die Schultern von Mr. Boyle.
Sie hält das Profil gegen das Licht.
Sie war nicht sorgfältig genug, als sie es in das Buch gelegt hat. Das Gewicht der Seiten hat ihre Arbeit zerdrückt. Mr. Boyle ist zerknittert. Zerknüllt. Die Umrisse seines Gesichts sind verzogen, fast so, als ob …
Ihre Hand beginnt zu zittern.
Es ist viel zu grausam. Ein barbarischer Zufall. Die Linien von Mr. Boyle, seine Stirn und seine Nase, sind überhaupt nicht erhalten. Sein Schattenriss hat dasselbe Schicksal erlitten wie seine sterbliche Physiognomie.
Er sieht exakt so aus, als wäre er mit einem Holzhammer erschlagen worden.
2
Es ist Pearls erstes Mal.
Wie immer sitzt sie im Schrank hinter dem schwarzen Damastvorhang, aber sie fühlt sich bereits, als wäre sie jemand anderes. Heute Abend trägt sie nicht den bodenlangen Schleier über dem Gesicht, und die Haut ist nicht mit Asche beschmiert. Diesmal spielt sie keinen Geistführer: Sie ist die Hauptattraktion.
Sie macht sich Gedanken, wie es sich anfühlen wird, wenn die Geister von ihr Besitz ergreifen. Myrtle hatte immer das Gesicht verzogen und mit den Augen gerollt – aber das war alles nur Schau. Myrtle gibt es offen zu.
»Ich bin ein Medium«, erzählte sie Pearl. »Ich höre die Stimmen. Aber das ist den Damen und Herren nicht genug. Sie wollen den Nervenkitzel. Wackelnde Tische. Materialisation.«
Die Geister haben Myrtle inzwischen zugeflüstert, dass ihre eigentliche Kraft darin liegt, Auren zu manipulieren und die universelle Kraft zu beherrschen: Myrtle ist eine Mesmeristin.
Pearl hingegen besitzt die Gabe, mit dem Jenseits Kontakt aufnehmen zu können: Es ist ihre Bestimmung.
Sie schließt die Augen und atmet den vertrauten Duft der Lilien ein – wächsern wie die schwarzen Kerzen, die daneben im Salon stehen. Nicht dass es ihre Nerven beruhigen würde.
Myrtles Stimme hallt in einer sympathischen Tonlage durch den Flur. Eine Frau antwortet ihr. Pearl schnappt so viel wie möglich auf – sie hat die Angewohnheit, professionell zu lauschen – und erfährt, dass zwei Frauen hereinkommen: Mrs. Boyle und Mrs. Parker. Beide haben einen Mann verloren.
Waren es Ehemann und Vater? Sohn und Bruder? Wie auch immer, die Bande scheinen eng zu sein. Sie hofft, sie zufriedenstellen zu können. Es wäre furchtbar, die Trauernden zu enttäuschen. Aber wenn es ihr gelingen würde …
Ein Mann wird von ihr Besitz ergreifen. Er wird durch ihren Mund sprechen und durch ihre Augen sehen. Was, wenn er nicht wieder weggeht? Er könnte sie für den Rest ihres Lebens in Beschlag nehmen, sie wie eine teuflische Marionette benutzen.
Pearl schluckt ihre Angst herunter.
Sie sollte die Toten nicht fürchten. Sie hat vom Tod gekostet, wie Myrtle ihr immer wieder vor Augen führt. »Du hast das Sterben bereits miterlebt, bevor du geboren wurdest«, sagt sie. Aber Pearl erinnert sich nicht daran, genauso wenig wie an ihre Mutter, die ums Leben kam, als sie geboren wurde.
Schritte ertönen im Salon, gefolgt vom Verrücken der Stühle. Pearl traut sich, die Augen zu öffnen. Myrtle hat die Lampen heruntergedreht. Sie muss nicht mehr wegen des schmerzvollen Lichts blinzeln.
»Mrs. Boyle, Mrs. Parker. Ich muss Sie bitten, Platz zu nehmen und sich ganz still zu verhalten. Sie wird gleich zu uns kommen.«
Es ist diese gehauchte Art zu sprechen, die Myrtle perfektioniert hat. Sie sollte auf einer Bühne stehen.
»Aber wie …?«
»Sie wird es schon wissen. Lassen Sie den Handschuh auf dem Tisch liegen. Wenn sie noch etwas von Ihnen braucht, wird sie danach fragen.«
Die Polstermöbel knarren, als sie sich setzen. Es stellt sich ein kleines Rascheln ein. Die Kerzen werden inzwischen angezündet sein, ihre glühenden Augen werden sich in der Kristallkugel widerspiegeln.
Trotzdem ist es noch nicht an der Zeit hinauszugehen.
Pearl holt tief Luft. Am liebsten würde sie aus der kleinen Kammer flüchten und nie mehr zurückkehren. Aber sie ist jetzt elf, kein Kind mehr. Sie muss für die Familie arbeiten wie alle anderen auch. Sie ballt ihre Hände zu Fäusten. Wartet, bis die Stille zu knistern beginnt. Jetzt.
Sie läutet das Glöckchen. Es durchschneidet die Stille wie ein Blitz.
»Meine Damen!« Myrtle verkündet: »Die Weiße Sylphe tritt ein.«
Langsam, ganz langsam, schiebt Pearl den Vorhang beiseite und tritt in die Dunkelheit hinaus.
Es gibt immer diesen kleinen Schock, das Einatmen, wenn die Trauernden sie sehen. Aber heute mischt sich Respekt mit der Ehrfurcht. Sie besitzt die Macht – sie können sehen, wie sie in Wellen aus ihr strömt. Neben ihr wirken sie trostlos: Verhärmt und verheult verschmelzen ihre Kleider mit der trügerischen Nacht im Wohnzimmer.
Sie nimmt ihren Platz ein. Niemand kann sehen, wie ihre Knie unter dem Tischtuch zittern.
»Reicht euch bitte die Hände!« Pearl spricht mit der sanften, flötenden Stimme, die sie mit Myrtle eingeübt hat. Schon hat sie einen Teil von sich selbst aufgegeben. Sie schluckt noch mehr und versucht, nicht daran zu denken, was als Nächstes geschehen wird.
Zögernd strecken die Frauen ihre Finger aus und umklammern die ihren.
»Wir beginnen mit einer Hymne«, säuselt Myrtle leise wie ein verliebtes Mädchen.
Myrtle besteht darauf. Sie sagt, Hymnen würden helfen, die Leute davon zu überzeugen, dass sie nicht an etwas Frevelhaftem teilnehmen. Sie öffnet den bogenförmigen Mund und beginnt:
O seht, ein Fremder an der Tür!
Er klopft und war zuvor schon hier,
Mrs. Boyle und Mrs. Parker singen mit schwacher Altstimme mit:
Hat lang gewartet, unaufhörlich:
Ihr seid sonst nie so ungebührlich.
Pearl stimmt nicht ein, sondern sitzt da und starrt in die Kristallkugel. Sie fand es schon immer grausam, Trauernde zum Singen zu bewegen. Wenn sie etwas über Trauer weiß, dann, wie sie einen erstickt: wie die Finger des Todes den Lebenden die Kehle zudrücken.
Endlich endet die Hymne. Die Atmosphäre wirkt angespannt.
Was nun?
Pearl erinnert sich an Myrtles Anweisungen und lässt die Hände der Trauernden los. Sie nimmt den Herrenhandschuh, den man für sie auf den Tisch gelegt hat. Er ist aus Ziegenleder; warm vom Kerzenlicht, leicht fleckig an der Handfläche. Ist das ein Riss am Ringfinger? Schwer zu erkennen. Ihre Sicht trübt sich, als würde sie durch Nebel blicken.
Sie öffnet den Mund und atmet aus. Ein leuchtendes Band strömt heraus und entlockt ihr ein Röcheln. Ihr Puls rast. Das hat es noch nie gegeben.
Die Geister kommen. Pearls Arme glühen, ihr Atem leuchtet. Sie wird verschlungen.
Myrtle sagt: »Er ist hier.«
Etwas flüstert leise in ihr Ohr. Dann berühren sie kühle, federleichte Hände: Dutzende von ihnen streichen ihr übers Haar, tätscheln ihre Arme. Sie will schreien, aber ein Summen in ihrem Kiefer hält ihn verschlossen.
Eine Gestalt erhebt sich aus dem Nebel. Der Mann zieht ein Gewand hinter sich her und hat Kerzenflammen als Augen. Kann auch Myrtle ihn sehen? Sie weiß es nicht; die anderen sind für sie unsichtbar, und sie ist allein in der Dunkelheit mit diesem … Wesen.
Der Geist öffnet den Mund und enthüllt eine große Leere.
Pearl kann nicht mehr.
Ihr Verstand schaltet sich ab.
Als sie aufwacht, sind die Lampen wieder an. Zwei schwarze Kerzenständer stehen rauchend vor ihr auf dem Tisch.
Die jüngere Trauernde hat den Arm um die Schultern der Älteren gelegt. Beide schluchzen.
»Er hat daran gedacht!« Die alte Dame weint. »Er hat immer daran gedacht.«
Myrtle summt fast vor Freude. »Hm. Die Nachricht ist für Sie von Bedeutung?«
»Ja! Heute ist unser Hochzeitstag.«
Erneute Trauer.
Pearl fühlt sich angeschlagen, hohl, als hätten die Geister sie aufgehoben und aus großer Höhe fallen lassen. Sie verschränkt die Arme auf dem Tisch und stützt den Kopf darauf ab.
Was ist passiert? Was hat sie gesagt?
»Aber wenn das Papa war«, überlegt die jüngere Frau stirnrunzelnd, »wenn er es wirklich war … hätte er es uns doch gesagt, oder? Deshalb sind wir doch hergekommen.«
Myrtle beruhigt sie. »Meine Damen, bitte seien Sie leise. Es gibt keinen Grund sich zu streiten. Die Sprache der Geister ist genauso wenig unter unserer Kontrolle wie die Stimme eines Sterblichen. Man kann zwar im selben Raum mit einer Person sein, aber man kann sie nicht zwingen, mit einem zu sprechen. Und wenn sie spricht, kann man sie nicht dazu zwingen, die Wahrheit zu sagen. Die Geister haben ihre eigenen Geheimnisse.«
»Zweifle nicht, Harriet«, tadelt die ältere Dame ihre Begleiterin. »Wie kannst du es infrage stellen? Sieh dir an, wie die Sylphe leuchtet!«
»Das ist das Ektoplasma«, sagt Myrtle weise. »Geistmaterie.«
»Ein Wunder. Wahrlich ein Wunder.«
Leise schließt sich die Tür.
Die Münzen klirren. Pearl hört die Verabschiedungen, hört durch das Fenster Mrs. Boyle und Mrs. Parker sprechen, als sie zur Walcot Street gehen.
»Sie hätte sich über die Hochzeit kundig machen können«, sagt Mrs. Parker auf dem Bürgersteig. »Und der Mord stand in den Zeitungen.«
»Ich weiß, du glaubst es nicht, Harriet, aber mich tröstet es. Ich habe ihn gespürt, da bin ich mir sicher. Bitte tu es nicht so verächtlich ab.«
»Ich will damit nur sagen, dass sie das Verbrechen nicht aufklären konnte, nicht wahr? Ist das nicht recht praktisch? Papa würde es nicht versäumen, uns zu sagen, wer ihn getötet hat. Er würde laut nach Gerechtigkeit rufen.«
Die Schritte verstummen.
Bei Pearl bleibt nur ein Wort zurück. Mord.
Ihr Mund ist trocken. Er fühlt sich beschmutzt an, unrein, als wäre er ohne ihre Zustimmung benutzt worden.
Myrtle kehrt zurück und dreht die Lampen wieder auf ein angenehmes Dämmerlicht herunter. »Also gut. Was zu essen?« Der vornehme Akzent, den sie für die Kundinnen angenommen hat, gleitet so leicht von ihr ab wie ein Umhang, den sie fallen lässt. »Du musst bei Kräften bleiben, weißt du? Diese Geister zehren an dir.«
Ein Becher mit Whisky und Wasser wird ihr vor die Nase gestellt, gefolgt von einer Scheibe Brot mit schwarzer Johannisbeerkonfitüre. Die Gegenstände flackern, verdoppeln sich. Pearl blinzelt.
»Danke«, schafft sie gerade noch. »Was … Was ist passiert?«
Myrtle setzt sich und zupft an einer Lilie in der Vase. »Du hast es geschafft. Hab’s dir ja gesagt. Ein echtes Medium. Hast den Geist von Mr. Boyle heraufbeschworen.«
Pearls Magen krampft sich zusammen. »Er war hier? Er hat durch mich gesprochen?«
»Aber natürlich.«
Es wäre weniger verstörend, wenn sie sich an diesen Mr. Boyle erinnern würde, wenn sie das Gefühl hätte, ihm begegnet zu sein. Aber jetzt hat sie nur den Eindruck, dass etwas Schreckliches geschehen ist und sie es als Einzige nicht gesehen hat.
»Glaubst du, es ist wahr, was die Damen gesagt haben, Myrtle? Dass der Mann, der durch mich gesprochen hat, ermordet wurde?«
»Ich weiß, es ist wahr. Ich hab’s in der Zeitung gelesen.«
»Aber mir hast du es nicht erzählt!«
Myrtle zuckt mit den Schultern. »Ich hielt es nicht für nötig. Die Toten sprechen doch zu dir, nicht wahr?«
»Durch mich«, murmelt Pearl. »Nicht zu mir. Ich habe nie einen Ton gehört.«
»Das wirst du. Jetzt, wo du anfängst, jeden Monat zu bluten, wird deine Kraft zunehmen. Du wirst sie dir zunutze machen.«
Pearl atmet tief durch. Ihre Ohren kribbeln, die einzigen Stellen an ihr, die noch unberührt sind.
»Werde ich sie hören?«, fragt sie leise.
Myrtle redet nicht gern von Mutter. Sie zieht eine schmerzverzerrte Miene und schürzt die Lippen. »Ich habe sie nicht gehört. Du vielleicht schon.«
Das wäre es wert. Es wäre dieses schreckliche, schmutzige Gefühl wert, Mutter noch einmal zu hören.
Sie zwingt sich, aufrecht zu sitzen und am Brot zu knabbern. »Und es wurde niemand verhaftet? Für den Mord an diesem Mr. Boyle?«
»Nein. Die Blauen haben noch nicht mal einen Verdächtigen.«
Sie zittert. »Das heißt also … es läuft ein Mörder frei herum, hier in Bath.«
»Ja.« Myrtle tätschelt ihre Hand und zwinkert ihr zu. »Das ist gut fürs Geschäft, nicht wahr?«
3
Eine schlaflose Nacht und den halben nächsten Morgen lang überlegt Agnes hin und her, ob sie Mr. Boyles Silhouette auf die Polizeiwache bringen soll. So absurd es auch klingt, sie hätte ein schlechtes Gewissen, wenn sie die Entdeckung für sich behalten würde. Als würde sie Beweise unterschlagen. Beim Blick in den Spiegel, um ihr Haar zu richten, sieht sie das gequälte Gesicht einer Verbrecherin, die Beihilfe zum Mord geleistet hat.
Selbstverständlich wird man ihr sagen, es sei ein Zufall. Sie kann Mr. Boyles Tod nicht verursacht haben, indem sie seinen Schattenriss zerknittert hat. Aber ist es nicht unheimlich? Jedenfalls sprengt es den Rahmen des Alltäglichen. Noch nie hat sie eine Arbeit zerknüllt, und noch nie ist ein Kunde gestorben. Beides hängt auf unheilvolle Weise zusammen.
Wenn schon nicht die Polizei, dann sollte sie wenigstens Mrs. Boyle aufsuchen, ihr die fertige Malerei vorlegen und den zerstörten Schattenriss beifügen. Soll die Witwe eine Verbindung herstellen und, wenn möglich, die Bedeutung erkennen. Ja, vielleicht ist das die beste Vorgehensweise.
Sie legt sich einen Spitzenkragen um und befestigt ihn mit einer Brosche. Es ist schon so viel Zeit vergangen, seit sie jemandem einen privaten Besuch abgestattet hat, dass sie solche Gepflogenheiten wie die passende Uhrzeit vergessen hat. Doch Mrs. Boyle wird vermutlich zu sehr in ihre Trauer versunken sein, um es zu bemerken, falls Agnes irgendwelche Feinheiten nicht beachten sollte. Bestimmt stehen alle Uhren im Haus still.
Im Atelier schlägt Agnes das Glasoval und den zerknüllten Schattenriss in braunes Papier ein und umwickelt es mit einer Schnur.
Bevor sie die Treppe hinuntergeht, überprüft sie ein letztes Mal die Adresse in ihrem Auftragsbuch.
Die Großvateruhr tickt. Mama döst mit einer auf den Knien ausgebreiteten Decke in der Stube. Während Agnes oben war, hat sie wieder Öl ins Feuer gegossen und die spärlichen Reserven verschwendet. Die Asche fällt auf den Rost, als wollte man sie ärgern und ihr zeigen, wie schnell alles vergeht.
Aber da ist noch ein anderes Geräusch, das sich über das der Flammen erhebt. Ein jämmerliches Fiepen. Es wirkt so verloren, dass sich ihr Herz zusammenzieht.
Misstrauisch öffnet sie die Haustür.
»Cedric? Da bist du ja! Ich habe dich beim Frühstück vermisst.«
Ihr Neffe kniet unter dem Portikus, sein Atem bildet Nebel in der Luft. In der Hand hält er den Stock, den er benutzt, um den Spielreifen anzutreiben. Doch der Reifen ist nirgendwo zu sehen. Stattdessen stupst er zaghaft eine Elster an.
»Was machst du da? Sei ein braver Junge und lass das eklige Ding in Ruhe!«
Er stochert unbeirrt weiter. »Tante Aggie, sie hat ein Baby! Schau mal!«
Sie bückt sich zu ihm hinunter und schreckt sofort zurück.
Ein rosafarbener, flaumiger Klumpen wälzt sich auf dem Boden, die Stummel seiner Flügel kreisen wild.
Die Augen sind verschlossene bläuliche Beulen, nur der Schnabel klafft weit auf.
Agnes blickt zur Elster und erkennt, dass sie nicht die Mutter des Kükens sein kann. Sie hat das Nest einer Ringeltaube geplündert.
»Oh! Das solltest du besser sein lassen. Komm bitte herein, lieber Cedric.«
»Aber ich will …«
»Jetzt, junger Mann!« Ihr Schimpfen klingt selten überzeugend. Kein Wunder, dass er sie meistens ignoriert.
Ein vorbeischlenderndes Pärchen blickt in ihre Richtung. Agnes lächelt bemüht, um den Anschein zu erwecken, sie hätte die Situation unter Kontrolle.
»Tu, was man dir sagt, und sei ein braver Junge.«
Nun bewegt sich die Elster, sie tritt das Küken und bringt es zum Schreien.
»Warum tut sie das?«
Sie ergreift seinen Arm. »Ich muss dir etwas zeigen, Cedric.«
»Nein, lass mich!«
Bevor er sie abwehren kann, zieht sie ihn ins Haus. Der Stock, den er in der Hand hält, hinterlässt einen schmutzigen Kratzer entlang der Flurwand.
Gerade noch rechtzeitig stößt sie die Haustür mit dem Ellbogen zu. Das nächste Geräusch von draußen ist ein schreckliches Quietschen.
Obwohl sie den Kannibalismus der Elstern nicht zum ersten Mal erlebt, erschreckt es sie jedes Mal aufs Neue. Cedric kann gern seine Monstergeschichten lesen, aber er soll nicht sehen, wie ein Vogel die eigene Art angreift und ohne Reue für seine Gräueltaten die Jungen und Schwachen umbringt.
»Tante Aggie, du tust mir weh!«
Sie lässt sofort seinen Arm los. »Verzeih mir, Ced. Aber ich müsste dich nicht wegzerren, wenn du auf mich hören würdest, wenn ich mit dir spreche. Diese Vögel können alle möglichen Krankheiten verbreiten, und ich will, dass du dich von ihnen fernhältst. Es ist nur zu deinem Besten, Liebling.«
Er neigt sein hübsches Köpfchen, um darüber nachzudenken. Vielleicht horcht er aber auch auf die beunruhigenden, feuchten Geräusche, die durch die Tür dringen.
»Bekommt das kleine Küken sein Frühstück?«, fragt er.
»Ja«, sagt sie eilig. »Ja, es frisst. Jetzt musst du in die Küche gehen und ebenfalls frühstücken. Ich habe dein Lieblingsgericht zubereitet: Eierpfannkuchen. Hopp, hopp!« Sie scheucht ihn mit den Händen.
Seufzend stapft Cedric zum hinteren Teil des Hauses und schleift seinen Stock auf dem Boden hinter sich her, als würde sie ihm ein unvergleichliches Vergnügen vorenthalten. Ein großer Knoten aus Liebe und Verzweiflung zieht sich in ihrer Brust zusammen.
So gern sie ihn auch spielen sieht, er sollte längst darüber hinaus sein. Mit zwölf Jahren werden Jungen in die Marine aufgenommen, und es wäre undenkbar, dass einer der kleinen Fähnriche einen Befehl missachtet oder mit Stock und Reifen umherläuft. Es ist zum Teil auch ihre Schuld. Sie hat ihn verwöhnt und ihm Groschenhefte gekauft, anstatt ihn zur Arbeit hinauszuschicken, wie es andere Familien tun. Aber sie dachte, sein Vater hätte inzwischen etwas für ihn geplant.
Cedric sollte eine Erziehung erhalten, eine Ausbildung. Daraus wird vermutlich nichts, es sei denn, die verwitwete Mrs. Boyle würde ein paar Münzen herausrücken.
Sie nimmt ihr Päckchen, öffnet einen Spalt weit die Haustür und zwängt sich hindurch, darauf bedacht, sie gleich wieder hinter sich zu schließen, damit Cedric das grausame Werk der Elster nicht zu sehen bekommt.
Der gestrige Schauer hat Pfützen auf den Straßen hinterlassen. An diesem Morgen hat es noch nicht geregnet, aber die schmutzigen Wolkenfetzen, die über den Himmel ziehen, drohen sich bald zu entleeren. Die Uhr der Abteikirche schlägt zehn. Die Krankenschwestern rollen bereits Krüppel und Gebrechliche in die Trinkhalle. Ein glatzköpfiger Mann lässt seinen leeren Blick in Agnes’ Richtung schweifen, und sie empfindet Mitgefühl für seine Einschränkung. Derart gefangen zu sein, unfähig zu gehen, wohin man möchte. Es erinnert sie an die Tage, als sie mit einer Lungenentzündung darniederlag, und sie geht etwas schneller, nur um sich zu beweisen, dass sie es noch kann.
In der Union Street bereut sie es schon. Ihre Lunge protestiert mit einem Krampf, und ihr Herz schlägt so heftig, wie es oft einem Ohnmachtsanfall vorausgeht. Zur Einsicht gebracht, fällt sie wieder in ihre gewohnte Trägheit zurück und wendet sich von den Geschäften der Milsom Street und der Bond Street ab. Ein Karren hat einen Teil seines Gemüses auf die Straße geschüttet, wo es verrottet: ein Haufen knolliger Formen, die so schmutzig sind, dass Agnes sie nicht bestimmen kann. Das Gleiche gilt für alles um sie herum. Trüb, hoffnungslos trüb. Düstere Asche hängt in der Luft. Vögel kreisen wie verkohlte Fetzen über einem Feuer.
Wie kann ein aufgeweckter Junge wie Cedric an einem Ort wie diesem eine Zukunft finden?
Unter ihrem Handschuh dreht sie den Ring an ihrem Finger. Nur so kann sie glauben, dass Montague jemals durch diese Straßen gegangen ist. Montague, dieser Mann mit den lebhaften und unmöglichen Farben. Er trug etwas von den Orten in sich, die er gesehen hatte: eine gewisse Würze, die von den Karibischen Inseln oder gar von Afrika berichtete. Er erzählte ihr von einem Ozean, der so klar war, dass man die Fische auf dem Grund schwimmen sehen konnte. Von Felsen, wo an der Wasserlinie orange- und rosafarbene Korallen gedeihen. Wundersame Dinge, die sie aus einem anderen Mund kaum glauben würde, doch es gibt sie tatsächlich und sie sind immer noch irgendwo da draußen. Für sie unerreichbar, denn Montague hat sie in ihrer farblosen Welt im Stich gelassen.
Am Queen Square ist es ruhig. Ein paar gequält aussehende Eichen stehen im Garten in der Mitte. Der Wind hat sie bereits leer geweht und die Wurzeln im braunen Kompost der eigenen Blätter begraben. Ein Eichhörnchen beobachtet sie so regungslos von einem nackten Ast aus, dass es ein präpariertes Tier sein könnte.
Agnes findet das Haus der Boyles auf Anhieb. Das verräterische Stroh liegt davor ausgebreitet, um das Rattern der Räder zu dämpfen, und die Fenster sind fest verschlossen. Sie justiert ihren Griff um das Päckchen. Vielleicht war es doch keine so kluge Idee.
Schwarzer Stoff umhüllt den Messingklopfer. Er gibt ein gedämpftes, armseliges Geräusch von sich, als sie ihn fallen lässt. Einige Augenblicke später öffnet sich die Tür wie eine tiefe Wunde. Dahinter steht eine untersetzte Frau in Trauerkleidung, deren Miene jedoch eher gehetzt als betrübt wirkt. Ihre Hände sind rau und rot – offensichtlich ist Mrs. Boyle wohlhabend genug, um eine Dienstmagd zu beschäftigen.
»Ich bin gekommen, um Ihrer Herrin mein Beileid auszusprechen.« Agnes steckt ihre Visitenkarte durch die schmale Öffnung, bevor die Dienstmagd widersprechen kann. »Sie wird meinen Namen nicht kennen, aber ich war mit ihrem verstorbenen Ehemann bekannt.«
Die Frau runzelt die Stirn, als würden ihr die Buchstaben nichts sagen, aber die dicke Qualität der Karte scheint Eindruck zu machen, denn sie bittet Agnes einzutreten.
»Ich weiß nicht, ob sie bereit ist, Sie zu empfangen«, warnt sie. »Ich schaue nach.«
Noch immer auf Agnes’ Karte starrend, geht sie durch eine Innentür und schließt sie hinter sich. Agnes kann die trampelnden Schritte der Dienstmagd und das Grollen der Stimmen im Gespräch hören.
All das hatte sie vergessen: die muffige, bedrückende Atmosphäre, die einem Todesfall folgt. Ungelüftete Räume, mit schwarzem Stoff verhangene Spiegel. An der Wand hängt eine Uhr, deren Stundenzeiger auf der Zehn stehen geblieben ist, und sie fragt sich, warum gerade diese Uhrzeit. Mrs. Boyle kann nicht wissen, in welcher Minute ihr Mann seinen letzten Atemzug getan hat. Ist es die Stunde, in der man die Leiche entdeckte, oder die, in der sie die Nachricht erhielt?
Es war eine verrückte, unausgegorene Idee herzukommen. Was hat sie hier verloren, warum drängt sie sich ungebeten in die Trauer einer Fremden? Sie ist versucht, sich wieder hinauszuschleichen, als die Dienstmagd zurückkehrt, diesmal ohne die Karte.
»Sie wird Sie empfangen. Hier entlang.«
Der Queen Square ist schon seit vielen Jahren keine vornehme Adresse mehr. Niemand würde die Boyles für wohlhabend halten, aber sie strahlen Seriosität aus. Agnes betrachtet die verhüllten Gemälde und die Noppen an den zugezogenen Gardinen und spürt den Kontrast zu ihrem eigenen Zuhause. Das war nicht immer so. Als ihr Vater noch lebte … Aber vielleicht wird Mrs. Boyle von einem ähnlichen Ansturm von Kürzungen und Einsparungen überrollt. Vielleicht sind die Tage dieser plumpen Dienstmagd schon gezählt.
Die Witwe sitzt im Schein einer Walratkerze. Was würde sie für ein Profil abgeben mit der Höckernase und dem Doppelkinn! Aber sie verdeckt es schnell, indem sie ihren Schleier herunterzieht, bevor sie aufsteht, um wie Agnes einen höflichen Knicks zu machen.
»Miss Darken, wie nett von Ihnen, dass Sie vorbeikommen.« Rote Wangen glühen unter dem Schleier; Mrs. Boyle hat offensichtlich geweint.
»Verzeihen Sie mein Eindringen, ich …« Agnes blickt hilflos zur Dienstmagd, deren Augen auf den Boden gerichtet sind.
»Lass uns allein, Mary.«
Mary knickst und trottet davon.
Die erzwungene Dunkelheit ist zermürbend. Mrs. Boyle streckt eine schwarz behandschuhte Hand aus und deutet auf einen Stuhl auf der anderen Seite des Tisches. Einen Moment lang sieht sie aus, als wäre eine von Agnes’ Ganzkörpersilhouetten zum Leben erwacht.
Ängstlich setzt sich Agnes auf die Stuhlkante. Das Päckchen füllt ihren Schoß aus und sie nestelt mit den Fingern an der Schnur herum. »Danke, Mrs. Boyle. Ich will Sie nicht lange aufhalten. Ich habe gehört, was geschehen ist, und ich …« Sie befeuchtet ihre Lippen. Was kann sie sagen? Was kann irgendjemand sagen, um so etwas wiedergutzumachen? »Es tut mir so furchtbar leid«, sagt sie matt.
Die Witwe nimmt ihr gegenüber langsam und schwerfällig Platz. »Ich danke Ihnen. Sind Sie selbst in Trauer?«
Verwirrt blickt Agnes kurz auf ihr schwarzes Kleid hinab. Sie hat schon so lange kein farbiges Kleidungsstück mehr getragen, dass sie vergessen hat, wie es auf andere wirken muss. Aber Mrs. Boyle wird die stets schwelende Melancholie, die sie dazu veranlasst, dunkle Kleidung zu bevorzugen, wohl kaum nachvollziehen können. »Ein entfernter Verwandter«, schmückt sie aus. »Gott habe ihn selig.«
Der Schleier schwebt, als Mrs. Boyle nickt. Sie hat sich nicht lumpen lassen – sie muss Corboulds Trauerbekleidungsgeschäft leer geräumt haben. Quasten, Gagat-Knöpfe, ein Ring, der bereits mit dem grauen Haar ihres Mannes besetzt ist. Aber wer würde es nicht genauso tun? Es handelt sich nicht nur um einen schmerzlichen Verlust, sondern um einen Mord, eine Qual, die nach einem noch tieferen Schwarz ruft, als ein Warenhaus bieten kann.
»Ich habe bisher keine Besucher empfangen«, gibt Frau Boyle zu. »Ich verabscheue ihr Mitleid und ihre … Fragen.« Sie legt eine Hand auf die Brust, als wollte sie ihre Gefühle ordnen, bevor sie fortfährt. »Aber ich habe Ihren Namen aus dem Terminkalender erkannt. Sie … Sie haben ihn an dem Tag gesehen, nicht wahr?«
Die Schnur schnippt von Agnes’ Fingerspitzen. Sie weiß es.
Natürlich weiß sie es. Wie dumm von Agnes, dass sie nicht daran gedacht hat. Die Polizisten würden doch nicht den Terminkalender beschlagnahmen, ohne Mrs. Boyle über ihre Ermittlungen in Kenntnis zu setzen.
Anstelle einer Antwort schiebt sie das Päckchen über den Tisch.
Mrs. Boyle faltet das Papier mit schmerzhafter Akribie auseinander. Dieses schwache Kerzenlicht ist die perfekte Beleuchtung für Agnes’ Kunst. Die kleinen Bronzedetails schimmern – das Haar, der Mantelkragen, die Ohrmuschel. Mrs. Boyle holt tief Luft.
»Es war eine zweite Sitzung vorgesehen. Die Abholung. Leider …«
Der zerknitterte Scherenschnitt liegt ebenfalls im Schoß der Witwe. Sie beachtet ihn nicht. Stattdessen streicht sie über das Glas und hinterlässt Schmierflecken.
Gemalt wirken die Gesichtszüge weicher. Diese schwarz-goldene Darstellung von Mr. Boyle hat etwas Engelhaftes. Es passt gut zur Schattenbraut hinter ihrem Schleier.
»Danke«, krächzt Mrs. Boyle. »Vielen Dank, Miss Darken. Was für ein Segen. Er sagte, es werde eine Überraschung geben. Das war so seine Art.«
»Zum Hochzeitstag von …«
»Ja.«
Ohne das Paket wirken Agnes’ Hände aufdringlich, zu groß. Sie könnte es dabei belassen, sich zurückziehen und die arme Witwe ihren Erinnerungen überlassen.
Aber dieser zerquetschte Scherenschnitt ist wie ein kariöser Zahn: Sie kann nicht anders, als sich darüber Gedanken zu machen. Sie muss den schwarzen Kringel aus dem Augenwinkel betrachten und das Grausen über diesen Zufall mit jemandem teilen.
»Ich habe den vorläufigen Scherenschnitt beigelegt, Madam. Sie finden ihn dort lose im Päckchen. Ich fürchte, er wurde etwas beschädigt, aber …« Sie stockt, als Mrs. Boyle den Schattenriss aufhebt und ihn glättet.
Agnes schaut aufmerksam zu und kann weder den Mund schließen noch atmen, bis die Witwe spricht.
»Ja. Danke.«
Das ist alles.
Die Enttäuschung ist so groß, dass sie die Schultern hängen lässt. Kann Mrs. Boyle es nicht erkennen?
»Er sagte mir, ich solle mit einer Überraschung rechnen«, wiederholt Mrs. Boyle. »Er muss gewusst haben, dass Sie vorbeikommen würden.«
»Ich verstehe nicht.«
Der Gesichtsausdruck der Witwe ist durch den Schleier schwer zu deuten. »Ich habe mit ihm gesprochen, Miss Darken. Über die Kluft hinweg. Was heutzutage alles möglich ist. Wenn ich an meine Jugend zurückdenke, hätte ich solche Entdeckungen nicht für möglich gehalten. Eisenbahnen, Telegrafen, spirituelle Medien wie die Weiße Sylphe … Man hielt schon die Abschaffung des Sklavenhandels für radikal!«
Agnes zittert. Es ist nicht das erste Mal, dass sie von Spiritualisten hört, obwohl sie sich normalerweise von solchem Gerede fernhält, indem sie sagt, dass sie nicht daran glaubt. Eine ehrlichere Aussage wäre, dass sie nicht daran glauben will. Sie möchte, dass die Toten sicher im Himmel oder in der Hölle verwahrt sind und nicht umherwandern und sie durch die trüben Augen einer Leiche anstarren. Aber ein kleiner Teil von ihr gibt zu, dass es wahr sein könnte. Es fühlt sich wahr an, wenn Mrs. Boyle es ausspricht.
»Und der … Geist …« Agnes schluckt. »Hat er keinen Hinweis darauf gegeben, wer sein irdisches Leben beendet hat?«
Mrs. Boyle schüttelt den Kopf. »Er hat solche Belange hinter sich gelassen. Er ruft nicht nach Gerechtigkeit oder Rache. Er hat seinen Frieden gefunden, und das sollte ich wohl auch. Ich werde mich darum bemühen. Aber es ist nicht leicht. Wie kann ich solchen Unmenschen verzeihen?« Ein plötzlicher Windstoß bringt Mrs. Boyles Gelassenheit ins Wanken. Das Papier auf ihrem Schoß raschelt. »Der Himmel stehe mir bei! War es nicht genug, ihm die Kehle durchzuschneiden und sein kostbares Leben zu nehmen? Warum müssen sie so grausam sein und auch noch sein liebes Gesicht zerstören?«
Agnes kommt nicht umhin, bei dieser neuen Information aufzuhorchen. Der Sergeant hat nichts von einem Schnitt durch die Kehle erwähnt. Wenn das die Verletzung war, an der Mr. Boyle gestorben ist … nun, das rückt ihr Kunstwerk in ein weniger düsteres Licht. Dort gibt es keinen Einschnitt. Straßenräuber haben Mr. Boyle die Kehle aufgeschlitzt und sein Gesicht aus Bosheit verunstaltet. Oder, wie der Sergeant vermutete, um die Identifizierung der Leiche zu verzögern. Sie muss neben sich gestanden haben, wenn sie etwas anderes gedacht hat. Das war ein dummes Unterfangen.
»Ich habe Sie in Ihrer Trauer über Gebühr in Anspruch genommen«, setzt sie an.
Mrs. Boyle fordert sie mit einer Handbewegung auf, sitzen zu bleiben. »Nein, nein, ich bitte um Verzeihung. Ich hätte mich nicht aufregen dürfen.«
Agnes würde das erdrückende Zimmer lieber verlassen, aber vielleicht ist die Witwe einsam.
»Es wird Ihnen doch an nichts fehlen, Mrs. Boyle?«, fragt sie sanft. »Sie haben Familie?«
»Unsere Tochter ist mit einem vortrefflichen Mann verheiratet. Meine Enkelkinder werden mich zweifelsohne beschäftigt halten. Ich werde es so angenehm haben, wie es jemand nur haben kann, dessen Quelle der Lebensfreude versiegt ist.«
Agnes schluckt. »Das freut mich zu hören. Sie haben Glück. Als mein Vater starb …« Sie nickt zur Silhouette in Mrs. Boyles Schoß. »Nun, Sie sehen es ja. Mein Zeitvertreib musste zum Beruf werden.«
Mrs. Boyle raschelt unbehaglich mit dem Packpapier. Sie blickt von dem Profil zu Agnes und wieder zurück, als wäre es ihr nicht in den Sinn gekommen, dass Frauen ihrer Gesellschaftsschicht in Not geraten könnten. Mama hatte es auch nicht bedacht. Wäre Agnes nicht über sich hinausgewachsen und wäre Simon nicht so freundlich gewesen, hätten alle drei Darken-Frauen im Armenhaus landen können.
Mrs. Boyle räuspert sich und greift in ihre Rockfalten. Als sie wieder spricht, ist ihr Ton förmlicher. »Und Sie sind äußerst begabt, Miss Darken. Erlauben Sie mir, eine Kleinigkeit für Ihre Mühe beizusteuern.«
Agnes streckt ihre Hand aus, und ein silberner Schilling fällt hinein. Das schmutzverkrustete Profil der Königin starrt gleichgültig vor sich hin. Ein Schilling für so viel Kummer. Normalerweise würde das Bronzieren mehr kosten, aber Agnes würde nicht im Traum daran denken, es zu erwähnen.
»Danke, Madam.«
Mrs. Boyle schnieft. »Mary wird Sie hinausbegleiten.«
Sie schließt die Finger um die Münze. War ihre Andeutung so taktlos? Sicherlich hat sie nichts falsch gemacht. Es ist ihr wichtig, sie ist nicht nur wegen des Geldes gekommen, aber sie braucht es. Sie will unabhängig sein, will nicht auf Simons Wohltätigkeit angewiesen sein.