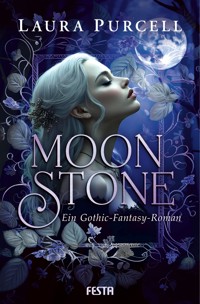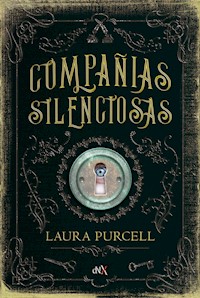7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Festa Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein Haus voller Geheimnisse, Angst und Wahnsinn. Die Schwindsucht raubte Dr. Pinecroft mehrere Kinder und die Frau. Nur seine Tochter Louise ist ihm geblieben. Erfüllt von Trauer zieht er mit ihr in ein weitläufiges Anwesen am Meer, das einsam über den Klippen von Cornwall steht. Aber Dr. Pinecroft hat Pläne: Überzeugt, dass eine Heilung möglich ist, lässt der Arzt einige an Schwindsucht leidende Gefangene in die Höhlen unter Morvoren House bringen. Was dort geschieht hat Folgen, die über die Jahrzehnte hinweg nachhallen. 40 Jahre später trifft Hester Why ein, um die inzwischen teilweise gelähmte und stumme Miss Louise zu pflegen. Doch in ihrem neuen Zuhause lauert das Unheil ... Laura Purcell hat mit ihren Romanen eine ganz eigene Art von düsterer, geradezu beängstigender Lektüre geschaffen, die den Leser in einen Hauch von Horror und Unheimlichkeit hüllt. Ist Übernatürliches am Werk oder Wahnsinn? Guardian: »Purcell hat ein sicheres Gespür fürs Erzählen, für Atmosphäre und ein scharfes Auge für die wichtigen Details der Sozialgeschichte. Oh, und sie wartet mit einigen angemessen makabren letzten Enthüllungen auf.« Sunday Express: »Eine viktorianische Geschichte voller Laudanum, Tuberkulose und möglicherweise Feen. Eine kluge, gruselige Lektüre.« Diese Ausgabe erscheint mit bedrucktem Farbschnitt und Leseband.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 477
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Aus dem Englischen von Eva Brunner
Impressum
Die englische Originalausgabe Bone China
erschien 2019 im Verlag Raven Books.
Copyright © 2019 by Laura Purcell
Copyright © dieser Ausgabe 2023 by Festa Verlag GmbH, Leipzig
Lektorat: Bernhard Kempen
Titelbild: Kim Isaak
Alle Rechte vorbehalten
eISBN 978-3-98676-082-3
www.Festa-Verlag.de
Kein göttliches Wort dämpfte das Unwetter,
Nirgends leuchtete ein gnädiger Schein;
Als, fern von jeglichem Retter,
Wir starben, jeder für sich allein:
Doch unter einem raueren Meer
Stürzte ich in tiefere Klüfte als er.
Aus Der Schiffbrüchige
von William Cowper, 1799
Die handelnden Personen
MORVOREN HOUSE
Esther Stevens / Hester Why – Kammerzofe, die unter einem falschen Namen arbeitet
Mrs. Quinn – Haushälterin
Merryn – Küchenmädchen
Lowena – Dienstmädchen
Mrs. Bawden – Köchin
Gerren Tyack – Kutscher und Stallmeister
Creeda Tyack – dienstältestes Mitglied des Personals
Miss Louise Pinecroft – Hausherrin
Miss Rosewyn Pinecroft – ihre Schutzbefohlene
Mr. Trengrouse – Hilfspfarrer der Gemeindekirche
Dr. Bligh – Vikar derselben
MORVOREN HOUSE – VOR 40 JAHREN
Dr. Ernest Pinecroft – Arzt
Miss Louise Pinecroft – seine älteste Tochter
Mrs. Louisa ›Mopsy‹ Pinecroft – seine verstorbene Frau
Miss Kitty Pinecroft – seine verstorbene Tochter
Master Francis Pinecroft – sein verstorbener Sohn
Pompey – der Familienhund
Creeda Nancarrow – Hausmädchen und ehemalige Porzellanmalerin
Gerren Tyack – Stallbursche
Seth
Michael
Harry
Tim
Chao – Schwindsüchtige aus dem Gefängnis von Bodmin
HANOVER SQUARE
Sir Arthur Windrop – Hausherr
Lady Rose Windrop – seine Frau
Mrs. Windrop – seine verwitwete Mutter
Esther Stevens – Kammerzofe von Lady Rose
Mrs. Glover – Haushälterin
Burns – Hausmädchen von Mrs. Windrop
Mrs. Friar – Krankenschwester und Assistentin des Geburtshelfers
TEIL EINS
HESTER WHY
1
Die Liebe ist fragil, sagte meine Mutter einmal. Sie kann zerbrechen.
Für manche Menschen mag das wahr sein, aber nicht für mich. Meine Liebe ist etwas, das Besitz ergreift. Eine Ranke, von der ich mich nicht befreien kann und die mich hinunter in die Tiefe zieht.
Sie schleppt mich bis nach Cornwall, in eine Grafschaft, in die ich nie zuvor einen Fuß gesetzt habe. Hätte ich diesen kalten Nebel gespürt, hätte ich es mir vielleicht noch einmal überlegt, ob ich mich auf die Anzeige als Krankenschwester und Kammerzofe bewerben soll.
Aber habe ich wirklich eine Wahl? Ich kann nie mehr nach London zurückkehren. Ich muss die Postkutsche nach Irgendwo nehmen, und es scheint angemessen, ans Ende des Landes zu flüchten, an einen Ort, der am Rande der Landkarte liegt.
Es ist der bitterste Winter, solange ich mich erinnern kann. Selbst für Schnee ist es zu kalt. Eine in weißer Unschuld gewaschene Welt soll mir Trost spenden, aber nein – das hier ist die Jahreszeit von Schneeregen und metallblauem Himmel. Alles ist grau und kalt. Wie im Eiskeller, wie in meinem Herzen.
Gefrorene Äste kratzen wie mit Fingern über das Dach, während wir mit schlitternden Rädern über die Straße rasen. Nicht einmal der saure Atem und der Körpergeruch meiner Mitreisenden erwärmen die Luft in der Kutsche. Eine ältere Frau, die nach Nachttopf riecht, drückt sich dicht an mich; mir gegenüber spreizt ein brutales Ungetüm von Mann die Beine. Offiziell bietet die Postkutsche innen Platz für vier Fahrgäste, doch dieser Fahrer hat sechs von uns hineingezwängt. Meine Arme sind an die Seiten geklemmt, ohne Gefühl. Dabei sind wir die Glückspilze, die drinnen sitzen und nicht auf dem Dach.
Die Fenster klappern ununterbrochen in ihren Rahmen; der Schneeregen prasselt unaufhörlich. Schatten kriechen über die Gesichter der Fahrgäste mir gegenüber, breiten sich wie Flecken aus. Nur ihre Augen bleiben hell und glänzen hin und wieder mit einer nagetierhaften Hinterlist.
Es scheint eine Ewigkeit her zu sein, dass wir die armen Pferde das letzte Mal gefüttert haben. Meine trockenen Lippen beginnen zu zucken. Den ganzen Tag bin ich schon unterwegs ohne jegliche Linderung.
Gekleidet wie ich bin, in ihren ausrangierten Sachen, mache ich einen seriösen Eindruck. Es wäre unpassend, jetzt mein Taschenfläschchen hervorzuholen und die Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Das wäre unschicklich. Rücksichtslos. Und dennoch …
Meine Lippen sind sehr trocken.
Ich könnte es wagen.
Ich muss es wagen.
Gegen meine Begleiter ankämpfend, manövriere ich meinen am Handgelenk hängenden Pompadour auf den Schoß meines Kleides. Das Zinnfläschchen darin schlägt gegen meinen Oberschenkel. Mit geübten Händen richte ich den Hals zur Kordelöffnung meines Pompadours aus und ziehe den Pfropfen heraus. Die anderen Reisenden werden zwar sehen, wie ich die Tasche zum Mund führe, aber nicht, was sie enthält.
Nur einen Schluck – schnell und flüchtig wie die Berührung der Lippen eines Liebhabers. Das genügt. Als Arznei.
Ich senke den Pompadour, füge den Pfropfen wieder ein. Niemand bemerkt es.
Aber auch ohne ihre Blicke spüre ich einen Anflug von Scham. Ein inneres Bewusstsein, dass ich mich in letzter Zeit etwas zu sehr auf Spirituosen verlassen habe. Aber Alkohol reinigt Wunden, nicht wahr?
Wasser rinnt über die Scheiben. Trüber Nebel kriecht durch die Ritzen der Türen, ein ungebetener Gast. Im Moment scheint mir, dass dies die Hölle sein muss: keine Feuergrube, sondern auslaugende Kälte und die Sehnsucht nach Ruhe, die nie gewährt wird. Das tote Fleisch, die Marmorstatuen, die über den Gräbern stehen: Beide sind kalt.
Endlich ertönt der Ruf vom Dach: »New London Inn, Exeter!«
Unser Ziel, doch das wilde Tempo wird nicht gedrosselt. Stattdessen ertönt ein schreckliches, hohes Kreischen.
Mit einem Mal dreht sich die Kutsche. Wir werden gegeneinander geschleudert. Die alte Frau neben mir schreit. Zum ersten Mal bin ich froh, zwischen ihr und dem großen Mann eingezwängt zu sein. Ihre Masse hält mich an meinem Platz.
Andere haben weniger Glück.
Als wir ruckartig zum Stehen kommen, höre ich ein Knacken, spüre ein Kribbeln in meinen Backenzähnen. Die folgende Stille ist ohrenbetäubend.
Der Mann neben mir räuspert sich. »Wahrscheinlich ein Postsack«, sagt er wenig überzeugend.
Ich weiß, dass es das nicht ist.
Schreie von draußen. Die anderen fünf Passagiere starren sich an. Nur ich lehne mich nach vorn und höre, wie der Kutscher oben auf dem Kasten flucht.
Seine Worte klingen wie eine Beschwörung und wecken etwas, das ich schon lange für tot gehalten habe.
Das alte Gefühl, gebraucht zu werden.
»Lassen Sie mich hinaus«, rufe ich. »Bewegen Sie sich! Um Himmels willen, bewegen Sie sich!«
Der grobschlächtige Mann rührt sich kaum. Ich muss über seine Beine klettern und die Tür aufreißen. Kalte Luft strömt herein und brennt mir auf den Wangen. Ich springe aus der Kutsche.
Ich lande schwer auf meinen Knien, die ich mir aufschürfe, und verfehle nur knapp einen Misthaufen. Der enge Knoten meines Pompadours reibt gegen mein Handgelenk. Obwohl es erst später Nachmittag ist, ist es auf dem Hof beängstigend dunkel. Alles riecht nach Rauch und Stroh.
Unsere Kutsche steht fast völlig verkehrt herum, mit der Hinterseite zum Hofeingang. Dicke schwarze Linien auf dem reifbedeckten Kopfsteinpflaster zeigen die Spuren, die die Räder hinterlassen haben, als sie zu schnell auf dem Eis aufschlugen. Es ist die Schuld des Kutschers, der nicht rechtzeitig die Ketten anlegte. Die Kutschenlampen beleuchten die von den Pferden aufsteigenden Dampfschwaden und weiter hinten tiefrote Blutflecken auf dem Kopfsteinpflaster.
»Ein Wundarzt!«, ruft jemand.
Wie ich vermutet habe, ist ein Passagier vom Dach gestürzt.
Er kommt wieder zu Bewusstsein. Die Augenlider zucken und die Lippen spucken ihren Schmerz aus. Doch niemand nähert sich ihm. Ein paar Stallburschen stehen im Halbkreis und betrachten ihn, als wäre er ansteckend.
Ich sollte es ihnen gleichtun. Es dabei belassen, bis ein Wundarzt eintrifft, um dem Verletzten zu helfen. Aber ich habe mit meinem Vorsatz, mich unauffällig zu verhalten, bereits gebrochen, als ich aus der Kutsche sprang.
Er stößt ein herzzerreißendes Stöhnen aus, und ich weiß, dass ich nicht länger zögern kann.
Ich dränge mich an den Stallburschen vorbei und gehe neben dem Patienten in die Knie. Der Anblick ist nicht schön. Sein Kopf ist am Haaransatz aufgeplatzt und eine fleischartige, korallenrote Substanz säumt die Wunde. Wenn ich nicht eingreife, wird er mit Sicherheit sterben. Mit einer behandschuhten Hand drücke ich den Riss zu und spreche Worte des Trostes, die ich auswendig gelernt habe. Kupfernes Blut mischt sich unter den Gestank von Pferden und Holzrauch.
»Still jetzt. Ich werde Ihnen helfen.«
Er stöhnt.
Nur ein Bruch kann den Winkel seines rechten Beins erklären. Ich bete, dass es kein offener ist, denn dann würde er die Gliedmaße ganz und gar verlieren. Falls er die Amputation letztlich überlebt.
Als ich aufschaue, sehe ich, dass der Schaffner und der Kutscher abgestiegen sind. Drei der Passagiere aus dem Innenraum haben sich ebenfalls hinausgewagt, um zu gaffen, aber die Reisenden auf dem Dach sitzen wie versteinert da. Ich kann es ihnen nicht verdenken. Hätte ich diesen Mann hinabstürzen sehen, hätte ich Angst, selbst zu fallen und sein Schicksal zu teilen.
Ich erkenne den korpulenten Mann, der neben mir in der Kutsche so viel Platz einnahm.
»Sie da!«, dröhnt meine Stimme gebieterisch. »Kommen Sie her. Leihen Sie mir Ihren Stock.«
Er stolpert vorwärts, lässt seinen Gehstock mit dem Bernsteinknauf fallen und will sich zurückziehen, aber ich – vielleicht von einem unwürdigen Rachegefühl getrieben – brülle: »Jetzt die Bänder vom Gepäck. Schnur, Kordel, irgendetwas Starkes. Bringen Sie es mir. Beeilen Sie sich!«
Die beiden anderen Fahrgäste eilen ihm zu Hilfe. Ihre Gestalten bewegen sich vor dem schattigen Rumpf der Kutsche hin und her. Trotz allem spüre ich ein Hochgefühl. So lebendig habe ich mich seit vielen Wochen nicht gefühlt.
Die Muskeln in meinen Händen sind weniger erfreut; sie beginnen zu klagen. Das Blut des Patienten pulsiert unter meinen Fingern im Takt meines eigenen Herzschlags.
Ich wende mich an den Schaffner neben mir. »Sir, bitte legen Sie Ihre Hände hierhin, wo meine sind.«
Er starrt mich an, als ob ich den Verstand verloren hätte. »Sie hinlegen …?«
»Zu beiden Seiten der Wunde, und drücken Sie fest zu. Sie haben doch Kraft, nicht wahr?« Es ist eine unnötige Frage: Ich habe schon Zugpferde gesehen, die weniger Muskeln besaßen.
Sein Gesicht verzieht sich. »Wirklich, Miss, für so was werde ich nicht bezahlt.«
»Großer Gott! Was sind Sie nur für ein Mann?«, rufe ich. »Die Geschichte wird in den Herbergen die Runde machen: wie Sie es mit den Ketten vermasselten und dann eine um Hilfe schreiende Frau im Stich ließen, weil Sie kein Blut sehen können!«
Das kommt bei ihm an. Er gehorcht, wenn auch widerwillig, und beäugt mich, als wäre ich ein Hund, der ihn angreift. Ich vermute, dass er mich bis jetzt für eine Dame hielt. Das ist eine Illusion, die ich nicht länger aufrechterhalten kann.
Ich hole das Taschenfläschchen aus meinem Pompadour und schütte den Gin in den klaffenden Mund des Patienten. Keine Chance diesmal, dass meine Begleiter es für Wasser halten. Der Geruch steigt auf wie Schamröte, um mich zu verurteilen. Es sorgt für Stirnrunzeln, aber ich kann mein Tun nicht bereuen. Bei den Verletzungen dieses armen Mannes bedauere ich nur, dass ich ihm nicht etwas Stärkeres verabreichen kann.
Er rührt sich. Jede Spur von Farbe ist aus seinem Gesicht gewichen. Seine Augen starren, aber sie sind glasig, und ich bezweifle, dass sie mich oder irgendetwas anderes außer dem Schmerz wahrnehmen.
Zaghaft berühre ich sein Bein. Kniehosen und Wollstrümpfe sind zerrissen und offenbaren grausame Schürfwunden, aber mein Gebet wurde erhört: Es gibt keine Löcher, keine ekelerregenden Knochen, die sich durch die Haut bohren. Der Bruch ist sauber.
Ich nehme selbst einen Schluck Gin, um Mut zu schöpfen für das, was ich als Nächstes tun muss. Es ist, als würde ich Eissplitter trinken. Ein paar tiefe Schlucke beflügeln meine Sinne und schärfen meine Sicht.
Ich lege meine Hände auf das Bein, leite Willenskraft in meine Finger.
Ziehe.
Es gibt ein schreckliches, nasses Knacken.
Mein Patient brüllt. Die Pferde bäumen sich in ihren Geschirren auf. Selbst der Schaffner sieht aus, als würde er in Ohnmacht fallen.
»Sie werden es mir noch danken«, rufe ich über den Tumult hinweg. Der Verletzte hört es nicht. Er ist in Ohnmacht gefallen.
Ich lege den Stock an sein Schienbein und binde ihn mit der stibitzten Schnur fest. Eine erbärmliche Schiene, aber besser als nichts. Ich habe das Ergebnis von Brüchen gesehen, die im falschen Winkel zusammenwuchsen: ein Leben lang Missbildungen und Schmerzen.
Aber das Bein dieses Mannes sieht gut aus – gerade.
Wie lange ist es her, dass ich diesen sanften Triumph gespürt habe, dieses warme Kribbeln, das sich bis in die Fingerspitzen ausbreitet? Nicht einmal Gin kann ein solches Gefühl erzeugen. Ich habe repariert, was zerbrochen war. Vielleicht, vielleicht, wenn ich auf diesem Weg so weitergehen könnte …
Eine schwere Hand legt sich auf meine Schulter.
Die Gestalt eines ganz in Schwarz gekleideten Mannes zeichnet sich im Schein der Laterne ab. Er trägt eine gepuderte Perücke und einen hochmütigen Gesichtsausdruck. In der freien Hand hält er einen Handkoffer – aus Ochsenleder, anders als der ramponierte meines Vaters, aber er ist kleiner, und ich bezweifle, dass er viel Brauchbares enthält.
Ich erkenne einen Quacksalber, wenn ich einen sehe.
»Das genügt, Madam. Ich werde von jetzt an übernehmen. Wer von euch Burschen wird diesen Mann in die Herberge tragen?«
Es kommt Bewegung in die Sache. Hufe klappern, eine weitere Kutsche nähert sich dem Hof. Die Schaulustigen, die meinen Anweisungen so zögerlich gefolgt sind, beeilen sich, dem Fremden zu helfen.
»Aber ich … Bitte warten Sie, ich habe noch nicht …«
Meine Worte sind sinnlos, ich bin unsichtbar. Sie schnappen sich den Patienten, der mir Sinn und Zweck gab, und tragen ihn fort.
»Ich bin mir sicher, Sie haben nach bestem Wissen und Gewissen geholfen«, spottet der Quacksalber. »Sie müssen jetzt einem echten Arzt erlauben, ihn zu behandeln.«
»Könnte ich Ihnen nicht helfen?«, flehe ich ihn an.
»Das ist nicht nötig.« Er winkt lässig mit der Hand ab und schlendert davon. Als wäre ich so unbedeutend, dass er mich nicht weiter beachten muss.
Ich bleibe allein zurück.
Der Atem keucht aus meinem Mund, wird zu Nebel.
Großer Gott, was habe ich getan?
Sie werden sich jetzt an mich erinnern. Daran gibt es keinen Zweifel. Niemand, der die Postkutsche von Salisbury nach Exeter nahm, wird mein Gesicht vergessen, mein Verhalten, als ich dem Verletzten geholfen habe. Sie werden sich an beides erinnern, wenn sie danach gefragt werden.
Wie kalt es ist. Kälter, als ich es bei meinen Bemühungen empfunden habe: ein strafender, beißender Wind.
Ich wünschte, ich hätte Zeit gehabt, meinen Mantel einzupacken, bevor ich fortlief.
Ich stampfe mit den Füßen, versuche, meine Beine zu spüren. Lieber Gott, lieber Gott! Warum habe ich diesem Mann geholfen? Es hat nichts genützt. Unter der Obhut dieses hochmütigen Quacksalbers wird er wahrscheinlich ohnehin sterben.
Aber die Erinnerung an mein Tun wird bleiben.
Das ist meine Schwäche. Ich handle aus einem Impuls heraus, ohne auf die Folgen zu achten. Ich habe nichts dazugelernt. Nach all den schrecklichen Nachwirkungen meiner Torheit habe ich immer noch nichts gelernt.
Meine gefrorenen Hände stechen, als wären sie mit Nadeln gespickt. Ich reibe sie aneinander. Schnaufe.
Blut tränkt meine Ziegenlederhandschuhe. Auch auf meinem Reisekleid sind Spritzer zu sehen, zusammen mit Strohfetzen und einem Fleck, der wohl Pferdemist ist. Aber das Schlimmste sind die Handschuhe.
Blut an meinen Händen.
Am liebsten würde ich sie mir herunterreißen und mit den Füßen zertreten, aber ich widerstehe, denn ich weiß, dass der Fleck auf meiner Haut sein wird, eingefärbt in die Ritzen meiner Handflächen.
Ein paar Stallburschen führen frische Pferde hinaus. Die Tiere scheuen vor mir und rollen mit den Augen, als wäre ich eine Bedrohung. Die Fenster der Herberge sind voller Gesichter. Sie starren mich an. Sie fragen sich, wer und was ich bin.
Wie konnte ich nur so eine Närrin sein?
Mein kleiner, ramponierter Reisekoffer liegt in einer Pfütze aus gefrorenem Schlamm, in die der große Mann ihn geworfen haben muss, als er nach Schnüren suchte. Ich rette ihn und drücke ihn an mich. Letzten Endes ist dies das einzige Zuhause, das ich noch habe. Alles, was ich schätze, ist in diesem Koffer enthalten, und jetzt mache ich mir Sorgen, dass er unsanft behandelt wurde; vielleicht ist etwas kaputt gegangen.
Ich bin versucht, mich zu vergewissern, aber ich habe keine Zeit. Die Kutsche der Old Exeter Mail wartet auf niemanden und hat ihren zehnminütigen Aufenthalt bereits beendet. Unsere neuen Pferde kauen an den Trensen, während der Kutscher seinen Sitz wieder einnimmt und die vielen Patten seines Wintermantels flattern lässt.
Eine weitere beschwerliche Reise liegt vor uns, und ich bin schon jetzt todmüde. In der kurzen Zeit zwischen den Etappen hatte ich mir vorgenommen, wenigstens meine Blase zu entleeren. Aber jeder Augenblick meiner Auszeit war dem verletzten Mann gewidmet. Jetzt muss ich meinen Koffer in den Korb packen und zurück in die Kutsche neben die stinkende alte Frau klettern.
Diesmal drückt sie sich nicht dicht an mich heran.
Alle Fahrgäste halten Abstand.
2
Ich habe nicht erwartet, dass ich diese Stelle antreten würde, ohne mich an meinen Arbeitsbeginn am Hanover Square zu erinnern. Sosehr ich ihn auch zu vergessen versuche, hat sich dieser Tag dennoch in mein Gedächtnis eingebrannt. Es war klar, dass ich Vergleiche anstellen würde. Aber auf einen so starken Kontrast war ich nicht vorbereitet.
Es ist fast vier Uhr morgens. In der Herberge der Poststation von Falmouth stinkt es nach schalem Bier und Zahnfäule. Die griesgrämige Wirtin erlaubt mir nicht, eine Kammer zu benutzen, es sei denn, ich bezahle für die ganze Nacht, also kauere ich mich neben das Gebüsch und versuche mich im Schutz des kargen Lichts umzuziehen.
Ich bin wirklich tief gesunken. Es schmerzt mich, wenn ich daran denke, wie glücklich ich war, als ich die Stelle der Zofe von Lady Rose bekam. Ich hatte so sehr gehofft, dass ich diesmal Glück haben würde. Mutter und ich hatten ein neues Kleid genäht, das ich vorsichtig anlegte. Ich stand steif da, damit der Stoff nicht knitterte.
»Ruiniere es nicht!«, sagte Mutter.
Damit meinte sie nicht nur das Kleid.
Jetzt knülle ich ein blutverschmiertes Kleid und Handschuhe zu einem Bündel zusammen und schiebe es so weit wie möglich unter meine anderen Sachen. Das meiste Blut ist getrocknet, auch an meinen Handflächen. Ich spucke darauf und reibe sie aneinander, bevor ich mir frische Handschuhe anziehe.
Das Leinenbündel oben im Koffer ist immer noch fest verschnürt. Behutsam schüttele ich es. Es folgt kein ekelhaftes Klirren von zerbrochenem Porzellan. Die Erleichterung treibt mir Tränen in die Augen. Ich dachte, es könnte nicht noch trostloser werden, aber jetzt wird mir klar, wie es wäre, wenn ich das hier verlieren würde …
Meine Lippen sind sehr trocken.
Ich schließe den Koffer und verriegle ihn. Ich kämpfe mich aus dem Gebüsch, schüttele Staub ab und suche mir einen Platz neben der Herberge, wo ich mich mit meinem neuen Arbeitgeber verabredet habe. Die Nacht ist pechschwarz und ich bin froh über die Dunkelheit. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mein Kleid richtig zugeknöpft habe und ob womöglich Zweige aus meinem Haar ragen.
Was für ein miserabler Anfang! Der Wind salzt meine Lippen. Die Möwen erwachen und rufen vom Hafen her, aber es ist nicht der angenehme Klang, den ich erwartet hatte: Ihre Stimmen sind schrill, feindselig.
Ich hatte gehofft … Doch das waren die Gedanken eines naiven Mädchens. Ich denke ständig, ich könnte die Vergangenheit auslöschen.
Ich habe es nicht verdient, hier glücklich zu sein.
Nur eines kann mir helfen. Ich setze den kalten Rand des Taschenfläschchens an meine Lippen und sauge.
Es ist leer.
Wie kann es denn schon leer sein?
Natürlich – der Mann, der vom Dach gefallen ist. Noch einmal sehe ich seinen klaffenden Mund, sein schmerzverzerrtes Gesicht. Und so gemein es auch ist, ich missgönne ihm jeden Tropfen. Er wird ohnehin bald sterben. Mein Schnaps dürfte ihm nicht geholfen haben. Ich hätte ihn für mich behalten sollen.
Auf einmal spüre ich die Angst in meiner Brust und die üblen Gerüche, die der Wind mit sich bringt: Teer, altes Seil, toter Fisch.
Ohne Gin werden die Erinnerungen an die Oberfläche gespült.
Ich darf nicht in Panik geraten. Bin ich nicht bei einer Herberge? Drinnen warten ganze Fässer und Flaschen mit Spirituosen. Ich muss in den Schankraum eilen und den Wirt bitten, mein Fläschchen aufzufüllen.
Ich mache mich auf den Weg, doch dann bimmelt rechts von mir Pferdegeschirr. Ein Ponywagen schält sich aus der Dunkelheit, gefahren von einem alten Mann.
»Miss Why?«
Die Enttäuschung trifft mich so sehr, dass ich vergesse, auf meinen angenommenen Namen zu reagieren.
»Hester Why?«, wiederholt er.
»Ja.« Zu laut, zu schnell.
»Ich bin gekommen, um Sie zum Morvoren House zu bringen.«
Er ist tief über die Zügel gebeugt. Das Pony stammt aus einer mittelmäßigen Zucht. Es wirft den Kopf hoch und schnaubt, als würde es auch nicht viel von mir halten.
»Ich habe einen Koffer.«
Der alte Mann steigt nicht ab, um mir zu helfen. Sein Gesicht ist verwittert und hart. Zwei Augen lugen aus schmalen Schlitzen unter der Stirn hervor. Womöglich ist er halb blind.
Das empfiehlt ihn zwar nicht als Fahrer, aber wenigstens sieht er nicht, wie schlampig ich gekleidet bin.
Meine müden Arme schaffen es gerade noch, meinen Koffer hochzuhieven. Ich folge ihm ohne ein Mindestmaß an Eleganz. Ganz anders als am Hanover Square. Dort wurden Lady Rose und ich von einer Kutsche mit gelben Brokatstäben, passenden Vorhängen und livrierten Lakaien über so kurze Strecken befördert. Ich kann froh sein, dass der Wind so heftig ist; ich brauche keine Entschuldigung für meine tränenden Augen.
»Und wie ist Ihr Name?«, erkundige ich mich.
»Gerren.«
Das Pony hebt den Schwanz und gibt einen Klumpen dampfenden Kots frei.
Gerren schnalzt mit der Zunge. Er lenkt den Wagen weg vom Hof und von meiner letzten Chance auf kostbaren Gin hinaus ins Weite.
Schon bald lassen wir die Lichter und das geschäftige Treiben in der Postherberge von Falmouth hinter uns. In meinen Augen scheint die Dunkelheit vollkommen zu sein. Unsere Lampen sind jämmerlich schwach und beleuchten lediglich den Rücken unseres Ponys, das dahintrottet. Jeder Hufschlag hallt in meinen Hüften wider. Fast so sehr, dass ich die Federung der Postkutsche vermisse.
Meile folgt auf Meile. Das Kopfsteinpflaster weicht einem zerfurchten Feldweg. Unser Wagen ist allen Winden ausgeliefert, wird hin und her gerüttelt. Der Schneeregen prasselt auf meine Wangen, jeder Tropfen ist ein kalter Nadelstich. Ich ziehe die Knie aneinander, verschränke die Arme und versuche mir vorzustellen, ich sei weit weg.
Es scheinen Stunden zu vergehen.
Schließlich stößt das Rad in ein Schlagloch und reißt mich aus dem Dämmerschlaf. Ist das die See, die ich höre, die vor sich hin murmelt? So ein seltsames Geräusch: unruhig und lauter als erwartet. Ich beuge mich vor, gespannt auf den ersten Blick. Doch was ich sehe, lässt mich erschaudern.
Links von mir gähnt ein steiler Abhang, vielleicht sechs Meter tief, der in einem kurzen Streifen Sand und schwarzem Wasser endet. In Träume versunken habe ich nicht bemerkt, dass unser klappriger Ponywagen eine Klippe erklommen hat.
Mein Magen ist so aufgewühlt wie das Wasser unter mir. Eine der wenigen Tröstungen, die ich mir von dieser Nacht erhofft hatte, war, endlich den Ozean zu erblicken. Ich hatte ihn mir blau und heiter vorgestellt. Was unter mir brodelt, ist dunkel, beängstigend mächtig: ein Kessel voller Dämonen.
Steine rutschen unter den Hufen des Ponys. Ich halte mich verzweifelt fest und sehne mich nach nur einem Schlückchen Gin, um meine Nerven zu beruhigen. Es kommt mir so vor, als wäre ich schon ewig unterwegs, ohne dass ein Ende abzusehen wäre.
Nach einiger Zeit streift die Morgendämmerung den Horizont. Die Wolken sind zu schwer, als dass man sie sehen könnte; es entfalten sich nur ganz schwache pfirsich- und zitronenfarbene Bänder. Dennoch besteht Hoffnung auf Licht, und allmählich kehrt Farbe in die Landschaft zurück. Links von mir besänftigt sich das Meer und wird kieselgrau. Möwen tauchen auf, deren weiße Bäuche über uns kreisen. Sie singen traurig und ahnungsvoll ein Klagelied zur aufgehenden Sonne und fordern mich auf umzukehren.
»Wir sind jetzt auf Morvorenland«, krächzt Gerren. Es erschreckt mich, seine Stimme zu hören.
»Mir ist nicht aufgefallen, dass wir irgendwelche Tore passiert haben«, bemerke ich.
Die meisten Landbesitzer schützen ihr Wild eifrig vor Wilderern, aber hier oben gibt es dafür wenig Anlass. Das Land ist nicht kultivierbar, sondern struppig, mit Büscheln von Disteln und Heidekraut. Hasen ertragen diese exponierte Lage nicht. Die einzigen Vögel haben graue Federn.
»Da. Sehen Sie es?«
Nach der albtraumhaften Fahrt und dem schrulligen Fahrer erwarte ich fast, ein düsteres Schloss zu sehen, das unmittelbar aus Mrs. Radcliffes Romanen stammt. Aber das Morvoren House steht wachend hoch über der Klippe und trotzt den Elementen mit ernstem Gleichmut. Es ist breit und gedrungen, zwei Stockwerke hoch und mit grauem Mörtel verputzt, aus dem kleine Steine herausragen – Rauputz, so wird es genannt, glaube ich. Schornsteine krönen das graue Schieferdach. Einer von ihnen raucht.
Es gibt keinen Innenhof. Keine Springbrunnen, keine Baumallee auf der Rückseite des Hauses. Ein Stallgebäude und ein paar Eschen bereichern als einzige Elemente die Landschaft.
Es besteht keine Gefahr, dass es mich an den Hanover Square erinnern wird. Ich schließe für einen Moment die Augen, erleichtert und enttäuscht zugleich.
Warum sollte sich jemand ausgerechnet hier oben niederlassen und nicht in den Tälern? Ich habe gehört, dass Fischer ihre Hütten in die Klippen gebaut haben, aber es sind keine zu sehen. Tatsächlich gibt es kaum einen Hinweis auf Gesellschaft, abgesehen von dieser einen unpassenden Wohnstätte, die nahe am Abgrund steht.
Unser Pony hält neben der Eingangstür an. Etwas knirscht unter unseren Rädern. Vielleicht war es einmal eine Schotterpiste. Jetzt gibt es hier nur noch Gras und Steine.
Alle Fensterläden bleiben geschlossen. Das Haus scheint blind, aber unbesorgt zu sein. Ja, das ist der vorherrschende Eindruck, den Morvoren auf mich macht: Es strahlt eine stoische Ruhe aus. Als wäre es schon immer hier gewesen und würde immer bleiben, trotz der aufgewühlten See darunter.
Ich steige vom Wagen ab und nehme den Reisekoffer wieder zu mir. Meine Glieder sind steifer und weit weniger willig als beim Hinaufklettern. Schwindel übermannt mich. Ich muss mich mit einer Hand auf dem Rumpf des Ponys abstützen und warten, bis das Trudeln aufhört. Sollte ich stürzen, würde Gerren mir wohl kaum zu Hilfe kommen.
Wenigstens ist die Fahrt im Wagen eine Entschuldigung für mein zerzaustes Haar und mein derangiertes Kleid. Im grauen Morgenlicht wirkt meine Schnürung nur leicht verrutscht; ein Wunder, wenn man bedenkt, dass ich mich im Dunkeln umgezogen habe.
Zumindest bin ich nicht voller Blut.
Die Eingangstür ist ein altes Stück Holz, das nicht besonders dick zu sein scheint. Licht pulsiert um die Ritzen an den Kanten – eine Kerze, die sich dahinter bewegt. Ein Riegel verschiebt sich.
Ich schlucke schwer.
Jetzt ist der Moment, der Höhepunkt meiner Reise. Die vage, schattenhafte Zukunft, die ich mir ausgemalt habe, wird Wirklichkeit.
Ohne mein Taschenfläschchen fühle ich mich unfähig, ihr entgegenzutreten.
Die Tür geht krachend auf.
Ein etwa 16 Jahre altes Mädchen erscheint, einen Wollschal um Hals und Schultern gewickelt. Sie hält eine Kerze in der Hand, aber der Wind löscht die Flamme in Sekundenschnelle aus.
»Kommen Sie herein!«, ruft sie mir über den Wind hinweg zu.
Sie schlurft zurück, so weit hinein, wie es ihr möglich ist, während sie die Tür mit dem Fuß aufhält. Ich rieche Teig und etwas wie Zimt.
Meine Beine können mich und meinen Koffer nicht schnell genug befördern.
Das Mädchen schlägt die Tür mit einem erleichterten Laut hinter uns zu. Sie erwähnt Gerren nicht, der immer noch draußen steht, und ich bin nicht geneigt, ihn ihr ins Gedächtnis zu rufen.
Mit der freien Hand reibt sie meine Schulter, als will sie mich damit wärmen.
»Sehen Sie sich an, Sie Arme! Völlig durchnässt und blass wie der Mond. Ich bin Merryn«, fügt sie lächelnd hinzu. Sie hat eine gewinnende Art und ein sympathisches Gesicht, trotz des großen Muttermals, das eine Wange sprenkelt. »Immer vor allen anderen auf den Beinen.«
»Miss Why«, stelle ich mich vor. Diesmal habe ich mich erinnert.
»Oh, als ob ich das nicht wüsste! Die ganze Woche nichts als ›Miss Why dies‹ und ›Miss Why das‹. Kommen Sie weiter. Wir bringen Sie schnell in die Wärme.«
Von allen Begrüßungen, die ich mir vorstellen konnte, habe ich so was am wenigsten erwartet. In London würde sich ein Küchenmädchen nicht trauen, eine höhere Bedienstete anzusprechen, geschweige denn eine Frau, die mehr als zehn Jahre älter ist als sie.
»Sorgen Sie sich nicht wegen Ihrer Stiefel auf dem Boden. Ich werde ihn nachher sowieso schrubben.«
Ihre Worte regen mich dazu an, einen Blick auf die Umgebung zu werfen.
Wir stehen in einer großen Eingangshalle, die nicht zum Äußeren des Hauses passt. Alles ist aus Stuck und klassisch, ohne eine Spur von Farbe. An der Decke sind Weinreben eingearbeitet, und von einem Giebel über dem Kamin blicken griechische Götter herab. Es erinnert mich an die Auslagen in den Schaufenstern der Konditoreien: Formen, die ganz aus Baiser bestehen.
Es hat aber auch gar nichts vom Glanz von Kristall und Siena-Marmor am Hanover Square.
Merryn führt mich durch eine grün bespannte Friestür, hinter der sich die Bedienstetenzimmer verbergen. Die von Kaffee geröstete Luft entlockt meinem Magen ein Knurren. Wir betreten eine lange, schmale Küche, in der ein Feuer knistert, dessen orangefarbene Lichter sich in den kupfernen Töpfen spiegeln, die an der Wand hängen.
Die einzige Person, die sich hier aufhält, ist eine stämmige Frau mittleren Alters mit rundem Gesicht und einem Lächeln, während sie ein Brot aus Leinentüchern auswickelt.
»Miss Why! Sie sind schon da. Sie müssen erschöpft sein. Setzen Sie sich. – Merryn, nimm ihren Schal und hänge ihn zum Trocknen auf. Kommen Sie näher ans Feuer. So ist es gut. Ich schneide Ihnen eine Scheibe von diesem Brot ab, und Merryn kann uns einen Tee zubereiten.«
Meine Haut kann wieder Empfindungen wahrnehmen, was anfangs schmerzt. Meine Kleider dampfen in der Hitze. Ich muss mich beherrschen, um mich nicht auf die vor mir ausgebreiteten Speisen zu stürzen und sie zu verschlingen. Ich sollte einen guten Eindruck machen.
»Du meine Güte, wie Ihre Hände zittern!«, ruft Merryn, als sie mir den Tee einschenkt. »Passen Sie auf, dass Sie sich nicht erkälten.«
Ja. Sie soll gern glauben, es sei die Kälte.
»Normalerweise brechen wir unser Fasten im Bedienstetensaal«, teilt mir die ältere Frau mit. »Aber das ist erst in etwa einer Stunde. Ich dachte, Sie würden lieber hier etwas zu sich nehmen, und dann werde ich Ihnen das Haus zeigen. Später ist genug Zeit für ein Treffen mit den anderen.«
»Ich danke Ihnen, Mrs. …?«
»Quinn.« Sie lächelt wieder. Einer ihrer Frontzähne fehlt. »Sie kennen mich nur durch die Post.«
»Mrs. Quinn!«, rufe ich. »Dann habe ich mit Ihnen korrespondiert! Verzeihen Sie mir, ich hatte ja keine Ahnung.«
Diese Frau ist also die Haushälterin! Ich hatte jemanden erwartet, der strenger ist. Sie hat weder ein herrisches Gehabe noch ist sie feiner gekleidet als Merryn; beide tragen ein gestreiftes Baumwollkleid und eine Leinenschürze.
Der einzige Unterschied besteht in ihrer Haube, die mit einem rosafarbenen Band versehen ist, während Merryns keines hat.
»Wir sind nur wenig Personal und haben viel zu tun. Ich helfe gern in der Küche aus.« Sie spricht mit einem leisen Stolz. »Stellen Sie sich vor, wie erfreut ich war, eine Zofe mit Ihren Fähigkeiten als Krankenschwester zu finden! So etwas ist wirklich selten.«
Ich kaue an einem Stück Brot, damit ich nicht sofort antworten muss. Merryn sieht mich mit einem mädchenhaften, bewundernden Grinsen an.
»Das ist gar nicht so außergewöhnlich. Mein Vater war Knochensäger bei der Armee, meine Mutter Hebamme. Es blieb nicht aus, dass ich von ihnen lernte.«
»Wir schätzen uns jedenfalls glücklich, dass wir Sie haben.« Obwohl ihre Stimme freundlich ist, sieht sie mich fragend an, und ich konzentriere mich auf das Essen, um nicht zu erröten. Ich weiß, was sie denkt, denn ich höre es selbst: der Akzent, den ich mir am Hanover Square angeeignet habe. Meine Ausdrucksweise passt nicht zu der Erziehung, die ich beschrieben habe. »Ihre Empfehlungsschreiben waren sehr schön«, fügt sie hinzu.
Das sind Fälschungen immer.
Merryn holt einen Topf und macht sich daran, Trinkschokolade zu raspeln. Ich nehme an, das wird meine Aufgabe sein, sobald ich mich eingelebt habe. Sie gießt etwas Milch dazu, schneidet den Zucker aus dem Zuckerhut und gibt eine Handvoll Gewürze hinzu. Zimt – das habe ich schon von der Tür aus gerochen – sowie Nelken und Muskat.
Ohne Kardamom. So mochte es Lady Rose.
Rechts von Merryn steht ein quadratischer Backsteinbau in der Ecke. Dampf drückt an den Rändern den runden Holzdeckel nach oben. In den Boden ist ein Ofen eingebaut. Vermutlich können sie damit große Mengen an Wasser kochen. Das wird sich als nützlich erweisen.
Mrs. Quinn kümmert sich um das Hauptfeuer. Es ist ein widerspenstiges Biest, das zischt und flackert, wenn das Wetter durch den Schornstein kriecht. Im Ofenrohr klappert es.
Merryn hält inne und lauscht. »Sind es wieder die Kobolde, Mrs. Quinn?«, lacht sie. »Bringen sie etwa das Haus zum Einsturz?«
Die Haushälterin macht ein zischendes Geräusch, damit sie schweigt, aber in ihren Augen funkelt der Schalk. »Wenn dich Creeda hört!« Sie bemerkt meinen verwirrten Blick und wischt sich die Hände an der Schürze ab. »Verzeihen Sie, Miss Why, es ist eine kleine Belustigung unter den Hausmädchen. Hier gibt es eine ältere Dienerin. Eine aus der Familie, die schon sehr lange in Morvoren ist. Es wäre grausam, ihr zu widersprechen oder sie zu verärgern, aber sie ist ein bisschen … sie kann …«
»Tartig sein«, sagt Merryn. Das muss ein lokales Wort sein. Ich habe keine Ahnung, was es bedeutet, aber so wie sich Mrs. Quinns Wangen verfärben, vermute ich, dass die Übersetzung unhöflich ist.
»Fantasiereich«, sagt Mrs. Quinn. »Die Leute hier in der Gegend haben Bräuche, die Ihnen vielleicht seltsam vorkommen, Miss Why. Unsere Familien haben uns immer gelehrt, das kleine Volk zu respektieren.«
»Das kleine Volk?«, wiederhole ich verwirrt.
»Feen.« Sie versucht, den Augenkontakt zu halten, was ihr jedoch nicht ganz gelingt. »Nun, ich kann nicht sagen, ob ich daran glaube oder nicht. Es ist unwahrscheinlich, dass sie existieren, aber Bekannten von mir sind seltsame Dinge passiert, die ich mir nicht erklären kann. Die meisten von uns stellen bereitwillig ein Glas Sahne für sie raus oder etwas in der Art. Aber Creeda … Creeda glaubt fest daran.«
»Creeda ist abergläubischer als mein Vater«, piepst Merryn, während sie die Schokolade mit einem Molinet schaumig schlägt. »Und er ist Fischer!«
Was soll ich darauf antworten?
Ich starre auf meinen Teller, der jetzt leer und mit Krümeln übersät ist. Vielleicht ist es ein Glück, dass mir das Lachen längst vergangen ist.
»Die Hausmädchen machen ab und zu einen kleinen Scherz darüber«, fügt Mrs. Quinn hastig hinzu. »Unter sich. Aber natürlich würden sie es ihr gegenüber nie aussprechen. Und ich darf nicht zulassen, dass dummes Gerede die Herrin erreicht.«
Ach, das ist ihre Sorge.
»Ich kann Ihnen versprechen, dass sie nichts dergleichen von mir hören wird, Mrs. Quinn.«
»Gut. Haben Sie jetzt genug gegessen? Wollen Sie sich ausruhen, während die anderen ihr Fasten brechen?«
Am liebsten würde ich mich für immer ausruhen. Die Erfrischung hat meine Lethargie nur noch verstärkt. Meine Schläfen pochen, ob aus Mangel an Schlaf oder aus Mangel an Gin, kann ich nicht sagen.
»Wenn es Ihnen nichts ausmacht.« Ich wische mir die Hände ab und stehe auf. »Es gibt ein paar Kleider, die ich gern in meinem Zimmer auspacken würde.«
»Sie teilen es mit Merryn.«
Das Stuhlbein scharrt über den Boden. Es ist mir unmöglich, meine Bestürzung zu verbergen, aber ich versuche es trotzdem. »Oh.«
»Das Haus ist nicht groß«, erklärt Mrs. Quinn. Sie beobachtet mich genau. »Es gibt keine Gästebetten. Das werden Sie sehen, wenn ich Sie herumführe.«
Ich nicke nur.
Eine Kammerzofe, also eine höhere Angestellte, teilt sich ein Bett! Das ist an sich schon eine Beleidigung, aber mit einem kleinen Küchenmädchen zusammengelegt zu werden … Am Hanover Square hatte ich ein eigenes Zimmer, während Dienstmädchen wie Merryn in den Küchen auf Stroh schlafen mussten.
Ich nehme meinen Koffer und werfe über die Schulter einen Blick auf Merryn, als wir gehen. Sie lächelt fröhlich. Es geht nicht gegen sie. Sie scheint ein liebenswertes Mädchen zu sein. Aber selbst kornische Bedienstete müssten doch verstehen, wie ungewöhnlich das ist. Was für ein Affront es gegen meinen Stolz sein muss.
Ein Kopfschmerz zieht seine Klauen um mein Schädeldach zusammen. Die Sicht wird an den Rändern weicher. Ich folge Mrs. Quinn, ohne auf die Umgebung zu achten. Sie hat mir für später eine Führung versprochen – dann werde ich mich um das Haus kümmern. Vorläufig muss ich nur noch diese Treppe bezwingen, die wie eine Miniaturklippe wirkt. Das eiserne Geländer gibt mir etwas Halt, aber es ist mit Kälte geladen und verbrennt meine Handfläche.
»Sie sind schon eine ganze Weile unterwegs«, sagt Mrs. Quinn. »Es sind 23 Stunden von Salisbury nach Falmouth.«
»Ungefähr. Danke, dass Sie mir einen Platz im Innern reserviert haben. Die Kosten …«
Sie gluckst, um meine Dankesbekundungen zu unterdrücken. »Auf dem Dach würde man erfrieren! Trotzdem sehen Sie blass aus.«
»Ein wenig Ruhe ist alles, was ich brauche.«
»Vielleicht mache ich etwas Wein warm, wenn ich Sie nach dem Frühstück abhole. Das bringt die Farbe zurück in Ihre Wangen.«
Wenn sie es nicht tut, werde ich wohl weinen.
Wir kommen zu einem Korridor mit Fenstern auf der einen und Holztüren auf der anderen Seite. Die weiße Farbe ist abgeplatzt, darum glaube ich nicht, dass sie von der Familie benutzt werden. Mrs. Quinn dreht den Messingknauf der zweiten Tür und sagt fröhlich: »Da wären wir.«
An den Wänden hängen blassgrüne Tapeten. Das ist ein Komfort, den ich nicht erwartet habe. Es ist auch so ziemlich der einzige.
Holzlatten auf dem Boden. Kein Kamin. Das Bettgestell scheint aus Eichenholz zu sein und hat schon bessere Tage gesehen; den Spuren nach zu urteilen wurde es mehr als einmal gegen Ungeziefer behandelt. Darüber ist ein Fenster mit groben, nicht dazu passenden Vorhängen. Es zeigt einen Blick auf das Meer. Die Anwesenheit des Ozeans beunruhigt mich immer noch wie zuvor, als unser Wagen die Klippe erklomm. Er ist so viel größer und mächtiger, als ich es mir vorgestellt habe. Sein Anblick inspiriert mich nicht so, wie ich gehofft hatte. Er lässt mich frösteln.
Links vom Bett steht eine Presse für unsere Wäsche, rechts stehen ein Waschtisch und ein Wasserkrug. Jeweils einer. Ich hatte mehr Platz, als ich mit meiner Schwester Meg das Zimmer teilte.
»Danke«, sage ich. »Ich bin mir sicher, dass ich mich hier sehr wohlfühlen werde.«
Aber das werde ich natürlich nicht. Bei jeder Bewegung werde ich mit Merryn zusammenstoßen. Ihre hellen, scharfen Augen werden all meine Geheimnisse erforschen.
Ich stelle meinen Koffer neben die Presse, nehme meine Haube ab und lege sie darauf. Schon jetzt fühle ich mich eingeengt.
Mrs. Quinn wartet an der Tür. »Möchten Sie etwas heißes Wasser, Miss Why?«
Ich möchte, dass sie weggeht.
»Im Moment nicht, danke.« Ein Gähnen entweicht mir, und ich mache das Beste daraus und strecke mich theatralisch. »Ich glaube, ich werde einfach die Augen zumachen.«
»Das ist ein vernünftiger Gedanke.« Aber sie rührt sich nicht von der Stelle. Sorgenfalten liegen auf ihrer rundlichen Stirn. »Sie sehen wirklich unpässlich aus. Ruhen Sie sich aus. Ich werde dann und wann nach Ihnen sehen.« Endlich zieht sie sich zurück. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der ein Zimmer so langsam verlässt. Sie schließt die Tür so leise, dass ich mir nicht sicher bin, ob sie ganz geschlossen ist.
Ich halte einen Moment inne und horche. Mrs. Quinn tut das Gleiche. Es scheint, dass meine Geduld die größere ist, denn in diesem Moment höre ich, wie draußen die Dielen knarren und ihre schweren Schritte verklingen.
Ich atme tief durch und drücke gegen die Tür, um mich zu vergewissern, dass sie wirklich fest verschlossen ist. Dann kommen mir die Tränen.
Früher habe ich beim Weinen ein Geräusch gemacht. Ich erinnere mich, wie ich mich schluchzend an Mutters Brust drückte, wie ich an Megs Schulter schniefte. Jetzt nicht mehr. Die Tränen fließen über mein Gesicht wie Wasserperlen an einem Flaschenhals. Es gibt keine rasenden Atemzüge, keine Ausbrüche von Leidenschaft. Weinen scheint mein gewohnter Zustand zu sein.
Ich lasse mich auf das Bett fallen und rolle mich instinktiv auf die rechte Seite. Aber das ist nicht unbedingt mein Platz hier. Welches dieser Kissen Merryn gehört, kann ich nicht sagen; beide sind ähnlich flach und riechen nach Teig.
Jetzt sind beide auch noch nass.
Ich verliere wertvolle Zeit. Wer weiß, wann ich das nächste Mal einen Moment für mich allein haben werde? Obwohl mir der Kopf schmerzt, zwinge ich mich aufzustehen und wische mir mit den Handballen über die Augen.
Ich muss in meinem Koffer nachsehen.
Meine Finger zittern, als ich den Schlüssel ins Schloss stecke und den Deckel an den Scharnieren zurückschiebe. Das kostbare Paket fällt mir in die Hände, als hätte es nur darauf gewartet.
Ich packe das Leinen aus, Schicht für Schicht. Ein kurzer Blick auf Rosenblütenrosa. Gold glitzert. Es fühlt sich kalt an, erwärmt sich aber schnell durch die Wärme meines Körpers.
Endlich liegt die Schnupftabakdose in meiner Hand.
Porzellan, Goldverzierungen und der verweilende Geist von Violet Strasbourg sind meine einzigen Überbleibsel eines früheren Lebens. Und es wird mich das Leben kosten, wenn ich mit dieser Dose ertappt werde.
Sir Arthur, mein früherer Herr, ist kein nachsichtiger Mann. Er besitzt so viel. Er sollte mir dieses eine Schmuckstück gönnen. Aber ich sah seine Anzeige in der Zeitung. Ich riss sie heraus und steckte sie in meinen Koffer, damit niemand die vernichtenden Worte lesen konnte.
Esther Stevens, Dienstmädchen des Inserenten, hat sich am 17. Dezember letzten Jahres vom Hanover Square in London entfernt und verschiedene persönliche Gegenstände ihres Arbeitgebers entwendet, unter anderem eine Schnupftabakdose aus rosafarbenem, goldverziertem Porzellan. Sie ist etwa 1,60 Meter groß, hat ein volles Gesicht, aber eine schlanke Figur, hellbraunes Haar. Sie trug ein graues Kleid und einen schwarzen Schal. Es wird angenommen, dass sie nach Westen gereist ist. Wer diese Verbrecherin ergreift, wird dankbar belohnt werden. Wer ihr Unterschlupf gewährt, wird nach dem Gesetz verfolgt.
3
»Miss Why? Darf ich eintreten?«
Obwohl die Hand sanft gegen das Holz klopft, hallt das Geräusch in meinem Schädel wider.
Eine Tür knarrt.
Meine Augen sind wie verklebt. Ich reibe sie hastig und sehe alles nur verschwommen. Eine große Dame kommt auf mich zu. Sie macht die Luft schwer mit einem luxuriösen Duft, den ich noch nicht einordnen kann.
»Schön, dass Sie geschlafen haben. Sie werden sich jetzt besser fühlen.«
Der Schlaf verharscht meine Gedanken. Instinktiv richte ich mich auf und strecke die Hände aus, um das Gefäß zu empfangen, das sie mir reicht.
Jetzt erkenne ich das Aroma: Wein. Das bringt mich zu mir zurück.
»Mrs. Quinn. Verzeihen Sie mir, ich habe noch nicht all meine fünf Sinne beisammen.«
Sie nickt. »Das war zu erwarten. Sie werden in der Kutsche nicht viel Ruhe gehabt haben.«
Das ist wahr, aber ich habe nicht erwartet, dass eine Haushälterin dafür Verständnis aufbringt. Mrs. Glover vom Hanover Square würde keine Untergebenen bemitleiden, es sei denn, ihr wäre der Arm abgefallen, und selbst dann würde sie es nur widerwillig tun.
»Wie gut, dass Sie an den Wein gedacht haben.«
»Sie brauchen etwas, um die Kälte zu vertreiben. Ich habe Lowena – das ist mein anderes Dienstmädchen – losgeschickt, um die Eier zu holen. Das arme Kind kam stocksteif zurück! Sie sagte, auf den Felsen sei überall Frost. Es würde mich nicht wundern, wenn wir bald Schnee bekämen, was uns auf die Probe stellen würde. Sie können sich vorstellen, Miss Why, wie schwierig es ist, hier oben zu sitzen, wenn die Straßen unpassierbar sind.«
Gierig schütte ich mir den Wein in den Mund. Er ist warm und gewürzt. Mrs. Quinn macht keine Bemerkung über die Schnelligkeit, mit der ich trinke; sie scheint zufrieden vor sich hin zu plappern.
»Ich weiß, dass Sie London schon lange verlassen haben, aber haben Sie die Londoner Zeitungen gelesen? Dr. Bligh – das ist unser Vikar – bekommt sie ab und zu. Er hat mir erzählt, dass die Themse zugefroren ist! Ist das zu fassen?«
Ihre Worte bilden Eiskristalle in mir. Unbeirrt schlucke ich den letzten Rest Wein hinunter. »Allein die Vorstellung lässt mich frösteln.«
Mrs. Quinn glaubt, ich hätte die Hauptstadt nur verlassen, um mich um meine sterbende Mutter zu kümmern. In Wirklichkeit war Salisbury einfach das weiteste Ziel, das ich mit dem Geld, das mir meine Schwester gegeben hatte, erreichen konnte. Meine leiblichen Eltern, die noch am Leben sind, werden ebenso frieren wie die übrige Londoner Bevölkerung. Sie werden ihre Scham nähren und sich fragen, was aus mir geworden ist.
Mrs. Quinn schenkt mir ein Lächeln mitsamt Zahnlücke. »Sind Sie bereit, dass ich Sie herumführe? Ich dachte, ich stelle Sie erst der Herrin vor. Das ist das Wichtigste.«
Ich streiche mir mit der Hand über den Kopf und stelle fest, dass mein Haar durch das Liegen auf einem Kissen nicht besser geworden ist. »Gewiss. Lassen Sie mich erst eine Haube aufsetzen, dann bin ich bereit.«
Ich reiche Mrs. Quinn den Becher und hoffe inständig, dass sie sich entschließt, ihn nach unten zu bringen, während ich mich zurechtmache. Aber sie tut nichts dergleichen.
Sie wird im Zimmer sein, wenn ich meinen Koffer öffne; das lässt sich nicht vermeiden. Ich denke an die blutbefleckte Kleidung und die Schnupftabakdose.
»Erzählen Sie mir von Miss Pinecroft.« Es ist der hellste Tonfall, den ich den ganzen Tag benutzt habe, und er klingt falsch. Ich stehe vom Bett auf, knie neben meinem Reisekoffer nieder und stecke den Schlüssel ins Schloss. »Ich glaube, Sie haben geschrieben, dass sie 60 Jahre alt geworden ist.«
»Das habe ich. Aber ich wage zu behaupten, dass sie Ihnen viel älter vorkommen wird. Vor etwa einem Jahrzehnt hatte sie den letzten Schlaganfall und ist seitdem nicht mehr dieselbe.«
Ich schiebe den Deckel meines Koffers einen Spalt auf, greife hinein und suche nach einer einfachen Haube.
»Miss Pinecroft kann sprechen, aber sie tut es nur ungern. Wir haben alles versucht, um sie aufzumuntern. Sie scheint es nicht zu wollen. Sie zieht es vor …« Mrs. Quinn macht eine vage Geste in die Luft. »… einfach dazusitzen. Ich hatte mir immer vorgestellt, sie würde all ihre schönen Erinnerungen Revue passieren lassen, aber das scheint sie nicht aufzumuntern.«
Dem Himmel sei Dank, ich habe eine. Schnell ziehe ich die Haube heraus und schließe den Koffer wieder. Mrs. Quinn schreckt bei diesem Geräusch auf.
Ihr Blick verweilt auf meinem Gepäck, und ich habe das Gefühl, dass sie wie in den Seiten eines Buches in mir blättert.
»Ich glaube, die Muskeln könnten betroffen sein«, sage ich schnell und ziehe die Haube über mein Haar. »Sie haben erwähnt, dass eine Seite ihres Mundes gelähmt ist, nicht wahr? Es kann sein, dass ihr Gesicht einfach nicht mehr ihre Stimmung ausdrücken kann.«
Ich stehe vor ihr und lächle ein wenig zu breit.
»Ja«, antwortet sie mit leichtem Zögern. »Vielleicht haben Sie recht. Gehen wir hinunter, und Sie können mir sagen, was Sie denken.«
Es ist eine Erleichterung, den engen Raum zu verlassen. Das fahle Tageslicht dringt durch die Fenster im Korridor und wirft Muster auf die Steinplatten. Der weiße Anstrich vermittelt zumindest den Eindruck von Weite. Draußen schleicht der Wind an den Mauern entlang. Er klingt wie eine Frau, die ihrem Geliebten leise Geheimnisse ins Ohr flüstert.
Meine Fähigkeit, mich zu konzentrieren, scheint zurückgekehrt zu sein, und das nicht zu früh. Ich muss den Grundriss dieses Hauses auswendig lernen für den Fall, dass ich mich ein anderes Mal weniger gut zurechtfinde. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es so kommen wird. Zumal die Herberge weit entfernt und mein Taschenfläschchen leer ist … Ich darf jetzt nicht dabei verweilen. Ich werde mir etwas einfallen lassen, so wie immer.
Mrs. Quinn bringt mich ans obere Ende der Treppe, die in die Stuckhalle hinunterführt. Jetzt ist mein Geist klarer, weiß die Kunstfertigkeit zu schätzen. Es ist wirklich ein Meisterwerk; die Gravuren sind so rein wie frisch gefallener Schnee. Ich frage mich, wie Merryn und Lowena es schaffen, sie sauber zu halten.
Mrs. Quinn bleibt mit ihrem klirrenden Schlüsselbund stehen. »Nein. Ich zeige Ihnen das Schlafgemach der Herrin, bevor ich Sie hinunterbringe.«
Sie geht weiter den Korridor entlang, weg von dem Zimmer, in dem ich geschlafen habe. Jetzt sehe ich, dass der Treppenabsatz und die Treppe die beiden Flügel voneinander trennen: Der östliche gehört den Bediensteten, der westliche der Familie.
Der Westflügel ist in dem Stil eingerichtet, den ich gewohnt bin. Die Böden sind mit edlem Mahagoni ausgelegt. Die Wände sind kobaltblau tapeziert und hier und da von Messingwandhaltern für Kerzen unterbrochen. Rosmarin verströmt einen scharfen, zitronigen Duft. Meine neue Herrin wird wohl sehr viele Kleider lagern.
Die Geräusche sind auf dieser Seite des Hauses, die näher an der Klippe liegt, intensiver. Der Wind schimpft, und das Meer antwortet mit einem abwehrenden Gemurmel.
Doch das ist nicht alles, was ich höre. Da ist etwas, das tief unter uns schwingt.
Ich neige den Kopf. Ja, dort.
Trotz seiner Tiefe ist es süß. Es hat etwas Musikalisches. Etwas Betörendes, das durch mich hindurchsummt.
Doch dann klimpert Mrs. Quinn mit ihren Schlüsseln, und die Wirkung ist dahin.
»Der hier. Sie bekommen Ihren eigenen Schlüssel, erinnern Sie mich daran, Ihnen später einen zu geben.«
Das Schloss an dieser Tür ist etwas Besonderes. Es besteht aus Messing und ist anstelle eines Einsteckmechanismus auf die alte Art und Weise am Holz befestigt. Ein eingravierter English Pointer streckt die Pfote in Richtung einer Nummernscheibe aus. Als Mrs. Quinn ihren Schlüssel dreht, bewegt sich diese, und die Hundepfote zeigt die Zahl 66 an. Ein Schloss, das erkennt, wie oft ein Raum betreten wird. Wer würde so etwas wollen? Es deutet auf Misstrauen hin.
Die Tür öffnet sich geräuschlos. Ich halte den Atem an und bin erstaunt über das, was ich dahinter erblicke.
»Ja«, sagt Mrs. Quinn, »es ist sehr hübsch.«
Toile-de-Jouy beherrscht den Raum. Ein sich wiederholendes Muster aus blauen Hirtenfiguren auf weißem Grund. Nicht nur auf der Tapete und dem Bettbehang, sondern auch auf dem Paravent, dem Sessel und den Kacheln um den Kamin. Das Ergebnis ist überwältigend. Wohin mein Blick auch fällt, trifft er auf blau gezeichnete Objekte: Meist Hirten und ihre Liebsten, aber auch Pferde und Bäume sind zu sehen.
»Es wundert mich, dass Miss Pinecroft in so einem Zimmer schlafen kann«, stelle ich fest. »Ich hätte das Gefühl, ich würde beobachtet!«
Das kleine Volk. War das nicht der Ausdruck, den Merryn und Mrs. Quinn benutzten? Hier sind sie nun mit ihren Stäben und Strohhüten. Vielleicht hat ihr dieses Zimmer solche Fantasien in den Kopf gesetzt.
»Die Herrin schläft nicht allzu viel«, antwortet sie traurig und bleibt auf der Schwelle stehen. »Es gelingt uns nicht immer, sie ins Bett zu bringen. Ich habe schon erlebt, dass sie die Nacht unten verbrachte, aber ich rate ihr davon ab, so gut ich kann, denn es ist nicht gut für ihre Gesundheit.«
»Nein, wirklich nicht.«
Es gibt keinen Spiegel, soweit ich sehen kann. In der Ecke steht ein Kleiderschrank, und ich scheine recht zu haben mit den Kleidern, die dort aufbewahrt werden, denn es duftet so stark nach Rosmarin wie in einem Küchengarten.
»Sie badet nicht gern, wenn sie es vermeiden kann«, erklärt Mrs. Quinn. »Wasser macht sie wunderlich.«
Der Blick, den wir austauschen, verrät mir, dass Mrs. Quinn sich der Ironie bewusst ist. Warum eine Frau, die kein Wasser mag, ausgerechnet an der Landspitze zum Ozean lebt, weiß nur der Himmel.
»Wenn die Herrin zu Bett geht«, fährt sie fort, »ist es leider notwendig, die Tür abzusperren. Sie neigt sonst dazu umherzuirren. Ich kann nicht zulassen, dass sie im Dunkeln versucht, die steile Treppe hinunterzukommen. Sie braucht eine Brille, aber sie will sie nicht tragen. Wenn wir nicht aufpassen, stürzt sie und bricht sich das Genick.«
Das ist natürlich eine vernünftige Vorsichtsmaßnahme, aber es ist mir nicht ganz geheuer. Es wundert mich nicht, dass sich Miss Pinecroft nur ungern ins Bett zurückzieht, wenn sie weiß, dass sie wie eine Gefangene eingesperrt wird.
»Ich verstehe, Mrs. Quinn. Ich werde dafür sorgen, dass die Tür abgeschlossen wird.« Ich nicke, um meine Worte zu bekräftigen. Meine Kopfschmerzen sind zurück. »Jetzt würde ich gern Miss Pinecroft persönlich kennenlernen.«
Sie tritt zur Seite, damit ich zurück in den Korridor kann. Dann schließt sie die Kammer ab und verriegelt sie. Die Messingnummernscheibe dreht sich auf 67.
Ich frage mich, weshalb sie sie abschließt.
Nachdem wir zur Treppe zurückgekehrt sind, steigen wir gemächlich hinunter, und ich bewundere den Stuck. Für ein Haus, das nicht sonderlich groß ist, wirkt es sehr pompös.
In einer Nische steht die Statue eines Mannes. Ich vermute, dass es sich um Poseidon handelt, mit dem zerzausten Bart und dem kunstvoll arrangierten Seetang, der ihm etwas Sittsamkeit verleiht. Als ich vorbeigehe, starrt er mich mit leeren Gipsaugen an.
»Kennen Sie die Geschichte dieser Halle?«, frage ich Mrs. Quinn. »Sie scheint direkt aus einem Herzogspalast zu stammen.«
Sie kichert und errötet – keine Haushälterin lässt eine kleine Schmeichelei kalt. »Nur was Creeda mir erzählt hat. Sie wurde eingerichtet, kurz bevor die Herrin einzog, von einem Mann mit hochfliegenden Plänen. Sie waren nicht mehr so großartig, als sein Geld knapp wurde. Denn sein Vermögen ging auf See verloren.«
Ich stelle mir vor, wie die Wellen ihn wegen seines Scheiterns verhöhnen. Auch Sir Arthur war das, was man in der Hautevolee einen »Neureichen« nennt: Sein Reichtum, ebenso wie sein Ritterschlag, beruhte auf Erfolg im Handel. Aber er hatte etwas mehr Geschäftssinn als der Mann, der dieses Haus baute.
Sir Arthur kannte jeden Gegenstand in seinem Haus und dessen Wert.
Meine Zunge fühlt sich langsam trocken an.
Als ich den Steinboden erreiche, sehe ich, dass Merryn Wort gehalten und meine Fußspuren weggewischt hat. Diesmal wenden wir uns in die andere Richtung, entfernen uns von den verlockenden Gerüchen der Küche hinter der Friestür.
In diesem Korridor gibt es nichts Bemerkenswertes; die üblichen kleinen Konsolentische und Drucke, die den Geschmack einer Dame erkennen lassen. Mehrere Türen stehen offen, die, wie ich vermute, zu einem Esszimmer und einem Salon führen, aber wir bleiben dort nicht stehen. Mrs. Quinn führt mich bis zum Ende des Flügels.
Auch diese Tür ist teilweise geöffnet, doch es fällt kein Licht durch den Spalt. Eine düstere Welt erwartet uns darin, still und ruhig.
»Da wären wir«, flüstert Mrs. Quinn leise.
Mein erster Gedanke ist, dass wir hier etwas Heiliges stören. Der Raum wirkt wie eine verlassene Kirche, es herrscht dieselbe übernatürliche Ruhe. Schwere, mit Quasten besetzte Vorhänge versperren den Blick aus dem Fenster, aber sie vermögen das Meeresrauschen nicht zu dämpfen.
Ich habe noch nie einen so kalten Ort betreten. Er saugt mir den Atem aus. Es gibt weder einen Teppich noch ein Feuer, um auch nur einen Hauch von Wärme zu erzeugen.
Die Wände sind mit dunklem Mahagoni verkleidet, doch das ist nur der Hintergrund. Das Holz wird von einem ganzen Arsenal an Porzellan verdeckt.
Teller, Zuckerdosen, große, frei stehende Krüge zu beiden Seiten des mit Asche überhäuften Kamins. Der Sims besteht aus einer Reihe von Regalen, auf denen Schalen, Figurinen und Teekannen stehen. Mehr Porzellan, als ich je in meinem Leben gesehen habe. Es gibt ein Regal voller Urnen mit passenden Deckeln sowie eine Anordnung eleganter Tassen, die zu fein sind, um daraus zu trinken.
Wir gehen genau darauf zu, nahe genug, um sie zu berühren. Jedes Stück ist blau und weiß. Kein Glas schützt die Sammlung.
»Guten Morgen, Miss Pinecroft«, sagt Mrs. Quinn sanft, als könnte eine zu laute Stimme der Auslage etwas anhaben. »Ich habe jemanden mitgebracht, der Sie sehen möchte.«
Sie sitzt so ruhig und still da, dass ich sie beim Vorbeigehen nicht bemerkt habe. Hinter uns in der Mitte des Raumes steht ein Ohrensessel, in dem die zerbrechliche Gestalt einer Frau sitzt – oder besser gesagt, von ihm verschluckt wird.
Mrs. Quinn hatte recht, sie wirkt viel älter als ihre 60 Jahre. Ihr Haar ist nicht grau, sondern schneeweiß. Ihr Gesicht ist von Falten bedeckt, die so fein sind, als wären sie mit einer spitzen Nadel gezeichnet worden.
Die Lähmung hat ihr ein schiefes Aussehen beschert. Unsichtbare Fäden scheinen an ihren Mundwinkeln und dem rechten Augenlid zu zerren.
In Anbetracht ihres Leidens ist sie in einer salbeigrünen Polonaise mit einem schwarzen Gürtel um die Taille einigermaßen gut gekleidet. Es ist zwar aus der Mode, aber es wirkt adrett. Ich frage mich flüchtig, ob sie dieses Kleid aus ihrer Jugendzeit aufgehoben hat.
»Das ist Miss Why«, erklärt Mrs. Quinn. »Erinnern Sie sich, dass ich Ihnen erzählt habe, dass ich sie als Ihre Krankenschwester und Kammerzofe eingestellt habe?«
Ich verbeuge mich mit einem Knicks. Die Fischaugen meiner Herrin blinzeln nicht.
Mrs. Quinn gibt mir ein Zeichen, dass ich mich erheben soll, anstatt auf ein Signal von Miss Pinecroft zu warten.
»Sehr erfreut, Sie kennenzulernen, Madam«, wage ich zu sagen. Normalerweise wäre es nicht angemessen zu sprechen, bevor sie das Wort an mich richtet, aber ich spüre, dass diese Formalität hier nicht eingehalten werden muss. »Ihr Haushalt ist wunderschön. Es ist mir eine Ehre, ein Teil davon zu sein.«
Ihr Kopf neigt sich, wenn auch nur ganz leicht. Sie hört zu, aber ihre Augen bewegen sich nicht vom Porzellan weg.
In ihrer Blütezeit müssen sie schön gewesen sein, Augen blau wie ein Sommerhimmel. Das Alter hat sie verwässert und ihren Blick verschwimmen lassen. Mit dem leicht geöffneten Mund entsteht der Eindruck eines Wasserlebewesens. Die arme Frau. Es tut mir im Herzen weh für sie.
»Es ist sehr kalt hier drinnen«, sage ich leise und trete einen Schritt vor. »Hätten Sie nicht gern ein Feuer?«
»Nein.«
Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie etwas sagt, und kämpfe gegen den Drang an, vor dem Klang ihrer Stimme zurückzuschrecken. Sie ist so tief und heiser, als käme sie von unter der Erde.
»Miss Pinecroft hat normalerweise kein Feuer an«, teilt Mrs. Quinn mir mit.