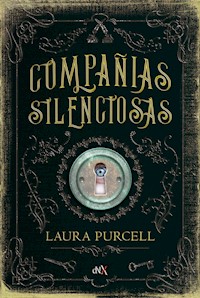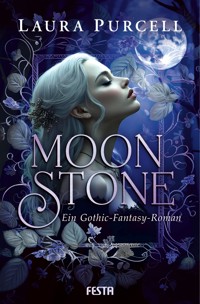
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Festa Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Benimm dich anständig. Hüte dich vor dem Mond. Und verlass NIEMALS das Haus bei Nacht. Camille wird zu ihrer Patentante und deren Tochter Lucy geschickt, die in einem kleinen Haus im Wald wohnen. Weit weg vom Komfort der Stadt muss sie sich nun den strengen Regeln ihrer Tante fügen. Camille hat noch nie zuvor jemanden wie Lucy getroffen, ein blasses, kränkliches Mädchen, das von Sternen träumt, aber den Wald nie verlassen hat. Als sich die beiden anfreunden, häufen sich unheimliche Ereignisse: Mysteriöse Tode, Kratzspuren an den Türen und in den Nächten hallt das schreckliche Heulen einer unbekannten Kreatur durch den Wald. Sollte Camille mehr Angst vor dem haben, was sich in der Dunkelheit verbirgt – oder vor sich selbst? Die bewegende Dark-Fantasy-Liebesgeschichte mit Biss von der preisgekrönten »Queen of Gothic Fiction« Laura Purcell, Autorin der Bestseller Die stillen Gefährten und Das Korsett. The Times: »Eine düstere viktorianische Gothic-Story, gruselig und fesselnd.« Times Literary Supplement: »Ein wahrer Pageturner ... und alle paar Seiten eine schauerliche Offenbarung.« Die erste Auflage von MOONSTONE erscheint mit Motiv-Farbschnitt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 444
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Aus dem Englischen von Manfred Sanders
Impressum
Die englische Originalausgabe Moonstone
erschien 2024 im Verlag Magpie.
Copyright © 2024 by Laura Purcell
Copyright © dieser Ausgabe 2025 by
Festa Verlag GmbH
Justus-von-Liebig-Straße 10
04451 Borsdorf
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung:
Titelbild: Aaniyah.ahmed@99design
Alle Rechte vorbehalten
eISBN 978-3-98676-218-6
www.Festa-Verlag.de
1
In der Nacht träume ich, ich wäre nach Einbruch der Dunkelheit tief im Wald von Felwood. Zweige knacken und in den Büschen raschelt es. Ich habe keine Angst. Dies ist nicht der Schauplatz des Grauens, dem ich entflohen bin, sondern ein Ort des Zaubers. Die Sterne sind wie Salzkörner über den indigoblauen Himmel verstreut, der Mond hängt als schmale Sichel über den Bäumen. In seinem Perlmuttlicht verblassen alle Farben, aber ich brauche sie nicht.
Ich kann die Farne riechen, von denen es nach dem Regenschauer grün tropft, die violetten Knospen des Heidekrauts, die bald aufbrechen werden. Die Luft schmeckt schwer nach feuchter Erde. Ich verspüre einen tiefen inneren Frieden.
Und dann erwache ich und die Folter beginnt.
Ich hätte nie gedacht, dass es solche Schmerzen geben kann. Mein eigener Körper hat mich verraten. Als ich klein war, hatte ich Angst vor einer Invasion Napoleons oder dem Geist der Cock Lane – jetzt weiß ich, dass wahre Gefahr von innen kommt.
Tausend Insekten krabbeln unter meiner Haut. Der Juckreiz sitzt tief, er geht bis hinab in mein Innerstes, wo er sich in Hunger verwandelt – in ein Verlangen, das ich nicht stillen kann.
Unruhig wälze ich mich unter der Decke. Während meiner ganzen Zeit in Felwood Lodge habe ich mich nach meinem Bett gesehnt, nach der gesteppten Tagesdecke, den Kissen aus weichen Eiderdaunen. Das Ironische daran ist, dass ich es dort auf meiner schmalen Pritsche bequemer hatte. Die Wände von Felwood Lodge brachten mich immer mit dem Ächzen ihrer Balken um den Schlaf; hier kommt das Knarren nicht von Holzbrettern oder von totem Efeu, der im Wind raschelt – es kommt von mir. Meine Knochen verändern sich, sie zerbrechen ohne Einwirkung von außen, um sich in einer neuen und entsetzlichen Gestalt wieder zusammenzufügen.
Wie lange kann ich es verbergen? Wie lange wird es dauern, bis der Arzt erkennt, dass ich an keiner gewöhnlichen Krankheit leide?
Ich taste nach dem Anhänger um meinen Hals, dem einzigen Gegenstand, der mir Trost spendet. Ein Mondstein schmiegt sich kühl und glatt in meine heiße Handfläche. Seit Beginn meiner Krankheit sehe ich die Welt um mich herum in Grautönen, aber den blauen Schimmer auf der Oberfläche dieses Steins kann ich noch erkennen. Er ist wie ein Licht der Hoffnung in der Finsternis. Während mich der Mond am Himmel in die eine grauenvolle Richtung zerrt, zieht der Stein, der seinen Namen trägt, mich sanft, ganz sanft zurück.
Aber er ist nicht stark genug. Was kann schon ein einziger kleiner Anhänger gegen einen ganzen Himmelskörper ausrichten? Der Mondstein mag meinen Verfall verlangsamen, aber er kann mich nicht retten. Er kann die Schmerzen nicht beenden.
Ein Jaulen löst sich aus meiner Kehle.
»Camille?« Jemand kommt – ich höre Schritte auf dem Holzboden. Marie betritt das Zimmer, sie sieht nervös aus. Früher habe ich meine ältere Schwester an ihrem mahagonifarbenen Haar und den Sommersprossen um ihre Nase erkannt; jetzt ist das Erste, was mir an ihr auffällt, ihr Geruch. Ein Hauch von buttriger Milch und frisch gebackenem Brot. »Camille, was ist denn?«
Marie schwebt auf mich zu. Sie hat ihre Haare am Hinterkopf zu einem Knoten hochgesteckt und trägt ein fein gemustertes Musselinkleid mit einer Schärpe um die Taille. »Warte, ich helfe dir.« Sie beugt sich über das Bett und löst meine verkrampften Finger vom Mondstein. Ich schäme mich für meine Fingernägel, meine rauen Handflächen. »Ruhig, ruhig«, gurrt sie. »Mr. Leiston wird bald hier sein.«
Unser Arzt mag vielleicht Gicht heilen können oder einen gebrochenen Arm richten, aber mir kann er nicht helfen.
»Ich bin so hungrig«, keuche ich.
Sie zögert. »Ich hole dir etwas Brühe, bevor er kommt.«
Jahrzehnte scheinen zu vergehen, bis Marie mit einem Tablett zurückkehrt. Ich bin so ausgehungert, dass ich fast aus dem Bett springe und ihr das Essen aus der Hand reiße, aber ich zwinge mich zu warten. Sie zieht den Stuhl heran, füllt einen Löffel mit Brühe – was für ein winziges, armseliges Häppchen. Meine Schwester verzieht das Gesicht, während sie mich füttert. Es widert sie an, wie ich sabbere, wie ich mit der Zunge schlappe, was ich dabei für Geräusche mache.
»Camille«, flüstert Marie. »Was ist nur mit dir passiert? Kannst du es mir denn nicht sagen?«
Nur ein Wimmern kommt über meine Lippen. Marie seufzt und füttert mich weiter. Sie sollte sich nicht so erniedrigen. Sie sollte sich auf ihre Hochzeit vorbereiten und mich nicht vorn und hinten bedienen.
Erschütternd schnell versiegt die Suppe. Ich habe sie so hastig gegessen, dass ich kaum ihren Geschmack registriert habe, und bin weit davon entfernt, gesättigt zu sein. Sie hat meinen Appetit nur noch mehr angeregt.
Marie starrt auf den leeren Teller. Ein zartes Weidenmuster ist durch die dünne Haut zu erkennen, die von der Suppe zurückgeblieben ist. »Das ist alles meine Schuld«, murmelt meine Schwester.
»Nein!« Meine raue, heisere Stimme lässt sie zusammenzucken. »Warum sagst du das?«
»Weil … ich der Grund bin, weshalb du fortgeschickt wurdest! Wäre ich nicht gewesen, hätte Papa dich nie nach Felwood Lodge gebracht und du wärst nie krank geworden.«
Ja, ich hatte zugestimmt, Marie zuliebe nach Felwood Lodge zu gehen, aber es war nicht ihre Idee gewesen. Unsere Eltern hatten den Plan ausgeheckt, zusammen mit unserem Bruder Pierre. »Ich habe dir doch nie Vorwürfe gemacht! Keine einzige Sekunde lang! Vielleicht habe ich dir gegrollt, dich beneidet – aber ich habe dir nie vorgeworfen, dass du mich von hier forthaben wolltest.«
Sie wischt sich die Tränen ab. »Aber wer sollte denn sonst schuld daran sein? Ich war es doch, die geschmollt hat und gejammert, du hättest einen Skandal verursacht.«
»Aber das habe ich doch auch. Es war meine eigene Schuld. Mein eigenes Verhalten hat mir das alles eingebrockt.«
»Ich wünschte, nichts davon wäre je geschehen!«, sagt Marie heftig. »Ich wünschte, der König wäre nie gekrönt worden. Ich würde alles zurücknehmen, sogar meine Verlobung mit Adam aufgeben, wenn ich dadurch alles wieder so machen könnte, wie es war.«
Ich bin mir nicht sicher, ob ich es auch tun würde. Die Erinnerung an jenen Abend ist jetzt ein kostbares Kleinod, eine Oase, die am Horizont meines Krankenbettes schimmert, voller Musik und Farben, zu denen ich nie wieder zurückkehren kann.
Ich war zuvor noch nie in Vauxhall Gardens gewesen, bevor wir den Maskenball anlässlich der Krönung von König George IV. besuchten. Ich trug mein neues Ballkleid aus purpurner Seide und eine weiße Dominomaske. Es war aufregend, mein Gesicht zu verstecken, mich als jemand anderes auszugeben und endlich einmal aus meiner eigenen langweiligen Persönlichkeit auszubrechen. Schon mein ganzes Leben lang maßen meine Eltern mich an Marie. Ich verstand, warum: Sie war älter, hübscher und kultivierter. Sie konnte ein Menuett tanzen oder das Pianoforte spielen, ohne sich dabei auch nur annähernd so unbeholfen anzustellen wie ich. Aber an jenem Abend, als wir über die Vauxhall Bridge zu den Gärten eilten, hätte man uns zwei kaum auseinanderhalten können.
»Bleibt bei mir, Mädchen«, zischte Mama. »Streunt nicht herum.«
Ich konnte gar nicht anders, als vom Weg abzukommen. Als wir die Tore der Lustgärten durchschritten, betraten wir eine andere Welt. Gläserne Laternen hingen zwischen den Bäumen; es sah aus, als wären Sterne vom Himmel gefallen und hätten sich in den Zweigen eingenistet. Ich verdrehte meinen Hals, um sie besser zu sehen, und keuchte beim Anblick eines Seiltänzers, der über meinem Kopf balancierte.
»Pass auf, wo du hingehst!« Papa zerrte mich gerade noch rechtzeitig zur Seite. Ein Jongleur ging so nahe an uns vorbei, dass ich die Hitze seiner brennenden Fackeln auf meinen Wangen spürte.
»Wie schafft er es, sie so aufzufangen?«, staunte ich.
»Mit großer Mühe. Komm, meine Liebe, setzen wir uns hin und sehen uns das Puppentheater an. Dort stehen wir niemandem im Weg.«
Obwohl die Marionetten mich eine Weile amüsierten, war es mir unmöglich, mich auf die Vorstellung zu konzentrieren. Fetzen von God Save the King wehten von dem achteckigen Orchesterpavillon herüber, vor dem maskierte Feiernde tanzten. Gelegentlich untermalte ein Ploppen die Musik und ein Feuerwerk erhellte den Himmel.
Das Abendessen nahmen wir in einer der wunderschön bemalten Lauben ein. Mein Bauch war so voller Aufregung, dass kein Raum für Essen blieb; stattdessen trank ich Wein. Pierre plapperte ununterbrochen über seine Pferde und darüber, wie dünn der Schinken geschnitten war. Während ich so tat, als würde ich ihm zuhören, achtete ich kaum auf Adam Ibbotsons Aufmerksamkeiten gegenüber Marie. Es musste meinen Eltern schwerfallen, ein Lächeln zu unterdrücken. Wahrscheinlich nickten sie einander über den Tisch zu, überzeugt davon, dass dies der Abend war, an dem er ihr endlich einen Antrag machen würde, aber ich bekam nichts davon mit. Über die Schulter meines Bruders beobachtete ich die Menschen: eine vor Diamanten funkelnde Witwe, ein kicherndes junges Mädchen, einen Gentleman mit einer altmodischen Perücke, begleitet von Dienern.
Nach ein paar kurzen Worten mit dem Servierer drehte sich Papa wieder zum Tisch um. »Dieser Bursche erzählt mir gerade, dass ein großes Transparentbild des Königs in seinen Krönungsgewändern gezeigt werden soll! Über sieben Meter hoch!«
»Oh! Das müssen wir sehen!« Mama empfand keine wirkliche Zuneigung zum neuen König – wie überhaupt kaum jemand. Aber als Familie mit französischen Wurzeln mussten wir patriotischer erscheinen als jeder andere, damit kein Verdacht aufkam, wir würden mit der Nation sympathisieren, die so lange gegen das Vereinigte Königreich Krieg geführt hatte.
Ich verließ die Laube zusammen mit den anderen. Marie hing an Adams Ellbogen, Papa ging mit Mama ein paar Schritte voraus und Pierre bot mir seinen Arm. Wir fielen zurück, denn ich war ein bisschen unsicher auf den Beinen, und Pierre schaute immer wieder zu einer Gruppe junger Männer, die als Harlekine verkleidet waren und Steinchen über das Wasser eines der Zierteiche hüpfen ließen.
»Den Kerl kenne ich!«, platzte er schließlich heraus und löste sich von mir. »Er schuldet mir noch Geld wegen einer Wette. Warte hier!« Und er schritt davon. »He, Bradshaw!«, rief er.
Ich war nicht besonders traurig über Pierres Verschwinden. Er war zu laut und beanspruchte zu viel Raum, und immer störte er mich bei meinen Träumereien. Aber jetzt war ich frei. Eine Motte flatterte in der Sommerbrise an mir vorbei. Ich folgte ihr aus dem Getümmel auf einen dunklen, lieblich duftenden Pfad.
Der Weg war wundervoll abgeschieden. Hier hörte man den Lärm kaum; in der Ferne schimmerten Grotten. Ich war berauscht, nicht nur vom Wein, sondern auch von dem Gefühl, endlich wirklich lebendig zu sein. Träge lehnte ich mich mit meinem schmerzenden Rücken an einen Baum und verharrte so eine ganze Weile, rundum zufrieden. Der Alkohol übte seine einschläfernde Wirkung aus und ich fühlte mich, als könnte ich für alle Zeit glücklich hier stehen und die Lichter aus der Ferne beobachten.
In dem Moment nahm er meine Hand. Die Berührung ließ mich zusammenzucken, aber ich hatte keine Angst. Ich spürte seine Wärme, seine Hitze, so willkommen wie ein Feuer in einer kalten Nacht.
»Endlich die Gelegenheit, ungestört zu reden.«
Ich drehte mich zu ihm um. Schatten tanzten über eine Halbmaske und die untere Gesichtshälfte eines jungen Mannes. Er war groß, athletisch gebaut und hatte sich für den Maskenball als Soldat mit roter Uniformjacke verkleidet.
»Sir?« Meine Zunge war zu dick für meinen Mund. »Kenne … ich Sie?« Natürlich kannte ich ihn, wenn auch nur aus einem Traum. Diese Vision war mir nur zu vertraut. Hatte ich denn nicht meine Nächte damit verbracht, einen Verehrer mit genau solchen üppigen schwarzen Locken heraufzubeschwören?
»Sagen Sie nicht, Sie hätten mich vergessen!«
Braune Augen sahen mich flehend durch die Augenlöcher der Maske an. Schokoladenfarbene Iriden mit kleinen goldenen Tupfern. Von irgendwoher vertraut, genau wie der Klang seiner Stimme.
»Mr. Randall«, flüsterte ich und errötete. »Sind Sie es wirklich?«
Ich konnte es kaum glauben. Er war größer geworden, seit ich ihn das letzte Mal gesehen hatte, er war jetzt ein richtiger Mann und nicht mehr der Student, der das gleiche College in Oxford besuchte wie Pierre. Nach ihrem Streit hatte ich nicht mehr zu hoffen gewagt, den faszinierenden Mr. Randall noch einmal zu treffen. Dabei hatte ich nie genau erfahren, was ihre Freundschaft zerrüttet hatte – irgendetwas mit einem Pferderennen, und dann war Pierre für ein Semester vom College verwiesen worden und schwor, nie wieder ein Wort mit Colin Randall zu wechseln, solange er lebte.
Aber für mich hatte Pierres abschätzige Meinung kein großes Gewicht. Was immer zwischen den beiden vorgefallen war, ich war mir sicher, dass die Schuld bei meinem Bruder zu suchen war. Er schaffte es nie, sein Temperament zu zügeln, und Mr. Randall war immer so liebenswürdig gewesen.
Ein schiefes Lächeln erblühte langsam auf seinem Gesicht und er ließ eine Reihe strahlend weißer Zähne aufblitzen. »Ja! Ich wusste, Ihre Güte würde es nicht zulassen, mich gänzlich aus Ihren Erinnerungen zu verbannen. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie sehr Sie die meinen heimgesucht habt, Miss Garnier! Jene begnadete Woche, die ich in Martingale Hall verbrachte, scheint eine Ewigkeit her zu sein. Aber ich erinnere mich an jedes Detail!«
Mein Herz machte einen Satz. Pierres Freunde erinnerten sich für gewöhnlich an Marie, die ältere, heiratsfähige Tochter, deren Alter näher an ihrem lag. Als Mr. Randall zu Besuch weilte, schien er meine Existenz kaum zur Kenntnis genommen zu haben, obwohl ich den größten Teil meiner Zeit damit verbracht hatte, ihm heimlich nachzuspionieren. Aber es konnte kein Zweifel bestehen, dass heute Abend sein Blick einzig mir galt.
»Sie müssen sich zu uns gesellen!«, rief ich. »Alle werden hocherfreut sein, Sie zu sehen.«
Er streckte die Hand aus und zwirbelte eine meiner Locken um seinen Zeigefinger. Mein Atem drohte auszusetzen. »Ich wünschte, das könnte ich. Wie oft habe ich mich danach gesehnt, zu einem erneuten Besuch nach Martingale Hall zu reisen!«
»Tatsächlich? Warum haben Sie es nicht getan?«
Ich hatte geweint, als er abgereist war – alberne mädchenhafte Tränen, für die Marie mich gerügt hatte. Aber als ich Mr. Randall jetzt vor mir sah, konnte ich mir meine Tränen nicht mehr verübeln. Welche Frau hätte denn nicht geweint, wenn ihr ein solcher Mann vor der Nase fortgerissen wurde?
»Ich fürchte, Ihr Bruder ist dieser Tage nicht sehr gut auf mich zu sprechen.« Er runzelte die Stirn. »Er hat Ihnen doch sicher von unserem Zerwürfnis erzählt? Nicht einmal auf 100 Meter würde er mich an sein Haus heranlassen. Wenn er wüsste, dass ich mit seiner Schwester rede, wäre er außer sich.«
Ein wohliger Schauder durchfuhr mich. Der Gedanke an Pierres Wut machte die Begegnung mit Mr. Randall umso erregender. Wie gern hätte ich ihn gefragt, warum sie sich zerstritten hatten, wo Mr. Randall lebte, was für Menschen seine Eltern, seine Familie waren. Aber ich starrte ihn nur stumm an, benommen von seinem köstlichen Duft nach Sandelholz.
»Wir haben nur diesen kurzen Moment, Miss Garnier. Wer weiß, ob wir uns je wiedersehen.« Die Schulterklappen seiner Uniformjacke wippten leicht, als er näher zu mir trat. »Ich habe bereits so viel von Ihrem Leben verpasst. Sehen Sie sich nur an! Sie sind zu einer perfekten jungen Dame erblüht. Die Verehrer werden bald vor Ihrem Haus Schlange stehen und Sie werden keinen Gedanken mehr für mich haben.«
»Das ist nicht wahr!«, protestierte ich. Mama klagte immer, ich sei zu linkisch, um je das Interesse eines Verehrers auf mich zu ziehen. Aber vielleicht irrte sie sich, vielleicht konnte ich heute Abend alles sein, was Mr. Randall mit diesen wunderschönen Augen in mir sah. Eine erwachsene Frau. Begehrenswert.
Er seufzte und spielte wieder mit meinem Haar. Die Intimität dieser Berührung ließ mich erzittern. Nur Marie oder die Zofe berührte sonst meine Haare, und bei ihnen fühlte es sich ganz und gar nicht so an. »Gäbe es nur eine Möglichkeit, die Zeit anzuhalten, Miss Garnier – diese kurze Begegnung eine Ewigkeit dauern zu lassen.« Er sah mir in die Augen. »Aber das können wir leider nicht. Also, wie wollen wir ihn verbringen – unseren einen kostbaren gemeinsamen Moment?«
Mein Kinn hob sich fast wie von selbst. Ich konnte nicht anders – verzaubert von der Nacht, verhext vom Wein, ermutigt von der Maske, die er trug. Das Ganze hatte etwas Traumartiges und es war der tiefe, unbewusste Teil meines Ichs, der es wagte, ihm meine Lippen darzubieten.
Der Mund, der sich forsch auf meinen presste, war so köstlich wie ein guter Wein. Ich war noch nie zuvor geküsst worden. Mein Körper reagierte augenblicklich. Irgendwo tief in meinem Inneren öffnete sich eine Kammer und verriet mir Geheimnisse, die ich schon immer gewusst hatte.
Ich wünschte, wir hätten wirklich den Augenblick einfrieren und seine Süße bewahren können. Aber die Stimme meiner Mutter, die kreischend meinen Namen rief, schreckte mich auf und brach den Zauber. Sofort fiel mir wieder ein, was meine Eltern über die berüchtigten dunklen Wege von Vauxhall Gardens gesagt hatten, die keine respektable Dame unbegleitet betreten sollte. Ich öffnete die Augen; meine Berauschtheit wich greller Nüchternheit. Mr. Randall fluchte leise, bevor er genauso schnell in den Schatten verschwand, wie er aufgetaucht war.
Vor Entsetzen erstarrt stand meine Mutter ein Stück entfernt. Ihr Schrei hatte andere angelockt. Mr. Ibbotson ließ Maries Arm los. Fremde schnalzten missbilligend mit der Zunge, hoben neugierig ihre Monokel, kicherten anzüglich. Ein alter, korpulenter Mann sagte: »Wenn das meine Tochter wäre, würde ich sie die Pferdepeitsche schmecken lassen.«
Steif und gerade wie ein Schürhaken trat mein Bruder aus der Gruppe seiner Freunde. Er packte meinen Arm so fest, dass ich vor Schmerzen aufschrie. »Ich hab dir gesagt, du sollst auf mich warten!«, blaffte er mich an. »Was zum Teufel hast du getan?«
Ich war mir nicht sicher. Aber als ich sein Gesicht anstarrte, das im Licht der Laternen so scharf und furchterregend aussah, da verwandelte sich alle Magie des Abends in meinem Mund zu Asche.
2
Über Nacht war ich von einer gewöhnlichen jungen Dame zu einer Aussätzigen geworden. Auch die Menschen veränderten sich mir gegenüber – alle außer meinem kleinen Brüderchen Jean. Dieser eine kleine Verstoß gegen die Schicklichkeit reichte aus, um mich als liederlich und zügellos zu brandmarken. Ich hatte Gelüste an den Tag gelegt, die keine wohlerzogene junge Dame hegen sollte.
Trotz der eindringlichen Nachfragen meiner Eltern wagte ich es nicht, ihnen zu sagen, dass es Mr. Randall gewesen war, der mich geküsst hatte. Niemand hatte ihn mit der Maske erkannt und ich hielt es für besser, Pierres Zorn nicht noch mehr anzuheizen. Sein Stolz hatte auch so schon genug gelitten.
»Du hast mich vor meinen Bekannten gedemütigt!«, tobte er, als wir wieder zu Hause waren. »Die Familienehre besudelt!«
Mein Fehltritt hätte kaum zu einem ungünstigeren Zeitpunkt erfolgen können. Mr. Adam Ibbotson war kurz davor gewesen, in Vauxhall Gardens um Maries Hand anzuhalten, aber meine Tat hatte Zweifel in ihm geweckt, ob unsere Familie der geeignete Umgang für ihn sei. Wie oft hörten wir in den nächsten Tagen Hufgetrappel auf der Straße, und Marie rannte jedes Mal ganz die Treppe hinauf, um hinauszuschauen. »Er ist es!«, rief sie dann. »Das ist sein Pferd.« Aber Mr. Ibbotson ritt achtlos an Martingale Hall vorbei. Enttäuscht und mit Tränen in den Augen kehrte Marie zu ihrer Näharbeit zurück. Und ich konnte nichts anderes tun, als den kleinen Jean noch fester an mich zu drücken und zu wissen, dass wenigstens er mich nicht verurteilte. Etwas im weisen Ausdruck seines Babygesichts sagte mir, dass es irgendwann besser werden würde.
Aber für den Rest meiner Familie wurde es nicht schnell genug besser. Keine zwei Monate später rumpelte ich in unserer Familienkutsche über die Mautstraßen des Landes, auf dem Dach die Koffer mit meinen Habseligkeiten. Die Welt glitt an meinem Fenster vorbei: gestreifte Felder, Heu- und Strohschober, Männer in bäuerlicher Kleidung, braun gebrannt von einem Sommer der Landarbeit. Normalerweise genoss ich jedes neue Panorama, aber jetzt war der Ausblick eher bittersüß. Ich machte keine Reise – ich wurde fortgeschafft.
Meine Eltern hatten arrangiert, dass ich ein ganzes Jahr lang im tiefsten Yorkshire bei einer Patentante leben sollte, der ich nie begegnet war. Zwölf lange Monate des Exils erschienen mir ein hoher Preis für einen kurzen Augenblick der Schwäche – als würde man ein Bonbon essen und wegen Völlerei ins Gefängnis wandern. Aber es stand außer Frage, dass ich fortmusste, zumindest so lange, bis der Klatsch der Nachbarschaft mich vergaß und Maries Verehrer zur Vernunft kam. Falls er das überhaupt jemals tat. Ich würde zurückkehren, entweder um meiner Schwester als Brautjungfer zu dienen, oder in dem niederschmetternden Wissen, dass ich ihr Glück für alle Zeit zerstört hatte.
Papa saß mir in der Kutsche gegenüber. Er hatte kaum ein Wort gesprochen, seit wir am Vortag von unserem Haus in der Nähe von Stamford aufgebrochen waren. Zum ersten Mal spürte ich, dass er sich für mich schämte. Mein Mangel an Eleganz mochte ihm in der Vergangenheit schon öfter peinlich gewesen sein, aber das hier war etwas anderes – eine Zähigkeit in der Luft zwischen uns, die Unfähigkeit, mir in die Augen zu sehen.
Ich seufzte und lehnte meinen Kopf an das Kutschenfenster.
Die Landschaft draußen veränderte sich, wurde schroffer. Zu Hause war ich an flache Ebenen und den riesigen Himmel gewöhnt, aber weiter im Norden war das Land hügeliger. Bäume wuchsen in wilden Dickichten, vom Wind in merkwürdige Formen gekrümmt.
»Bist du sicher, dass ich bei Rowena willkommen bin, Papa?«, fragte ich schließlich. »Sie scheint mich als Patenkind nicht sonderlich hoch zu schätzen. Sie hat uns kein einziges Mal besucht.«
Mein Vater rutschte unbehaglich auf seinem Sitz herum. »Nach ihrer Heirat stand es nicht in Rowenas Macht, nach Lincolnshire zurückzukehren.«
»Warum? Ist sie so arm, dass sie nicht reisen kann, nicht einmal um ihre Freunde zu besuchen?«
»Geld ist ein Grund«, gab er zu. »Ein weiterer ist die angegriffene Gesundheit ihrer Tochter Lucy.«
Seine Worte zeichneten ein düsteres Bild vom Ziel meiner Reise. Ein Haushalt voller Armut. Eine Kranke als Gesellschaft. Es würde kein Abenteuer werden, keine Expedition ins Unbekannte. Wieder einmal würde ich wohl nur in meine Bücher flüchten können.
Ich holte Ovids Metamorphosen aus der Tasche. Wie von selbst öffneten sich die Seiten bei der Geschichte von Daphne. Eine gedruckte Gravur zeigte die Frau, die sich in einen Lorbeerbaum verwandelt hatte, um dem lüsternen Gott Apollon zu entfliehen. Baumrinde schloss sich über ihren Brüsten, Blätter sprossen aus ihren Fingerspitzen. Hätte ich mich so in Vauxhall Gardens verhalten sollen? Aufhören, eine Frau zu sein, und mich stattdessen in gefühlloses Holz verwandeln? Die öffentliche Bücherei mochte Geschichten über Romanzen verleihen, die in Tälern und auf Waldlichtungen ihren Anfang nahmen, aber im wahren Leben schrieb ein strenger Verhaltenskodex vor, wie man einer jungen Dame den Hof machen durfte. Respektvoll und aus der Ferne. So wie Mr. Adam Ibbotson Marie den Hof gemacht hatte.
Kopfschüttelnd blätterte ich zu einer anderen Geschichte. Ich war keine Daphne. Wenn ich mich an Mr. Randalls Kuss erinnerte, an die Energie, die mich durchströmt hatte, dann wusste ich, dass ich in jenem Augenblick intensiver gelebt hatte als in all meinen bisherigen 16 Jahren. Meinen Fehltritt selbst konnte ich nicht bedauern; nur dass er meiner Familie Kummer bereitet hatte.
Ich las, bis mir der Kopf schmerzte, dann döste ich vor mich hin, während die Kutschenräder wie ein fernes Unwetter grummelten.
Plötzlich berührte Papa mich am Arm. Wir hatten angehalten. Ich öffnete die Augen in einer Welt ohne Licht und Wärme. Nebel war aufgezogen und hatte die Fenster mit Feuchtigkeit beschlagen.
»Wo sind wir? Müssen wieder die Pferde gewechselt werden?«
»Nein. Wir sind am Ziel.«
Unser Diener öffnete die Tür und klappte den Tritt herunter. Wir stiegen neben einem Gasthaus aus tristem grauen Stein aus, das etwas zurückgesetzt von der Straße stand und drei Seiten eines gepflasterten Hofes umschloss. Kerzen brannten hinter den durch Mittelpfosten unterteilten Fenstern, aber das schmutzige Glas schwächte das Licht. Auf dem Schild, das über der Tür knarrte, stand The Grey Lady. Ein paar Männer gingen auf dem Hof umher und rauchten Pfeife. Die Farben ihrer schlichten Kleidung verschmolzen mit der Umgebung: Schattierungen von Salbei, Lehm und Rost.
»Wie spät ist es?«, fragte ich.
»Kurz nach sechs Uhr. Es wird noch eine Weile dauern, bis Rowena sich mit uns trifft.«
Schaum tropfte von den Lippen der Pferde, die erschöpft die Köpfe hängen ließen, während die Diener im verblassenden Licht mein Gepäck abluden. Ein riesiger Wald wucherte bis an den Rand der Straße. Die Bäume standen so dicht, dass ich dahinter nichts erkennen konnte, nur den Nebel, der sich gespenstisch zwischen den Stämmen vortastete. Noch waren die meisten Blätter grün, aber ein paar hatten sich schon zu Bronze verfärbt und segelten langsam zu Boden.
»Komm. Du wirst bestimmt durstig sein.« Papa bot mir seinen Arm und ich hakte mich mit plötzlicher Beklommenheit bei ihm ein. Die Vorstellung, ohne ihn an diesem verlassenen Ort zurückzubleiben, krampfte mir den Magen zusammen.
Wir mussten den Kopf einziehen, um den niedrigen Gasthof mit seinem Gewirr aus Holzbalken zu betreten. Sofort tauchte die Wirtin mit rosigem und strahlendem Gesicht auf. »Ah! Mr. Garnier, nehme ich an.«
»Ja.«
»Guten Abend, Sir. Nur herein!« Sie ließ ihren Blick über mich wandern. »Die junge Dame sieht schrecklich blass aus. Ich werde sofort etwas Tee bringen lassen.«
Ein großer gemauerter Kamin beherrschte den Raum. Toby-Krüge grinsten vom Kaminsims herab, die Lippen zu groteskem Grinsen verzerrt, während an den Wänden Pferdeplaketten schimmerten. Wir setzten uns auf ein abgewetztes, knarrendes Sofa.
Ein Kellner eilte herbei. Er trug ein Tablett mit dem versprochenen Tee, daneben lag eine schon sehr abgegriffene Ausgabe der örtlichen Zeitung. Mit zitternden Händen goss ich meinem Vater eine Tasse ein. Das Porzellan klang wie klappernde Zähne.
Papas Gesicht wurde im Schein des Kaminfeuers sanfter. »Du musst keine Angst haben, Camille. Rowena ist eine sehr alte Freundin von uns. Bei ihr wirst du sicher sein.«
Um mein Wohlergehen machte ich mir keine Sorgen. Ich hatte vielmehr Angst vor Einsamkeit und Langeweile – und dass ich, wenn ich nach einem Jahr zurückkehrte, für meine Familie vielleicht zu einer Fremden geworden war. Oft hatte ich mich danach gesehnt, der Eintönigkeit von Martingale Hall zu entfliehen, aber nicht so.
»Bist du sicher, Papa? Wird sie wirklich nett zu mir sein? Ich habe nie auch nur einen Brief von ihr bekommen.«
Er befeuchtete seine Lippen. »Es hat schon seinen Grund, dass wir Rowena gebeten haben, sich in dieser Zeit um dich zu kümmern. Sie hat ein gewisses … Verständnis für deine missliche Lage. Deine Patentante weiß, was es heißt, wenn der eigene … Ruf in Zweifel gezogen wird.«
Ich starrte ihn an. »Was meinst du damit?«, flüsterte ich. »Welchen gesellschaftlichen Fauxpas hat meine Patentante begangen?«
Mein Vater beugte sich vor und trank einen Schluck Tee. »Du musst verstehen, dass es nicht Rowenas Schuld war. Was deiner Patentante widerfahren ist, war ein Ungemach, ein Umstand, den man am besten verschweigt – und wir haben ihn dir verschwiegen. Wir haben immer gesagt, deine Patentante sei Witwe, aber …« Ein weiterer Schluck. »… das ist nicht ganz richtig.«
»Nicht?«
Er schüttelte ernst den Kopf. »Nein. Ich fürchte, ich muss dir sagen, dass Rowenas Ehemann noch am Leben ist.«
Fast hätte ich meine Tasse fallen lassen. Das war ein noch schlimmerer Skandal als meiner. »Rowena lebt von ihrem Mann getrennt? Also deshalb besucht Mama sie nie? Sie fürchtet um ihren eigenen Ruf?«
»Nein, nein, es ist komplizierter als das.« Er bedeutete mir mit einer Handbewegung, meine Stimme zu senken, und warf verstohlene Blicke durch den Schankraum. »Der Mann, den deine Patentante geheiratet hat, ist … gefährlich. Er neigt sehr zur Gewalt. Sie floh vor ihm, kurz bevor Lucy geboren wurde. Wir konnten sie eine Weile in Martingale Hall verstecken; dort brachte sie Lucy zur Welt.«
Meine Augen wurden groß. Ich musste mir in Erinnerung rufen, dass dies nicht die aufregende Handlung eines Romans war, sondern etwas Tragisches, das einem realen Menschen widerfahren war. »Rowenas eigener Ehemann hat sie geschlagen? Das ist ja furchtbar!«
»In der Tat. Er hat sie schwer verletzt …« Papa räusperte sich. Unter seinem ruhigen Äußeren brodelte die Wut. Er hatte bis zu seinem 14. Lebensjahr in Frankreich gelebt, und wenn ihn etwas erzürnte, wurde sein Akzent ausgeprägter. »Was für ein feiger Schuft vergreift sich an einer Dame? An einer Dame, die seinen eigenen Sprössling unter dem Herzen trägt? So verhält sich kein Gentleman, niemals! Die arme Rowena und ihre Lucy verstecken sich jetzt seit 16 Jahren vor ihm.«
»Warum?«, hauchte ich. »Was würde er tun, wenn er sie findet?«
»Nun, zunächst einmal hätte er das gesetzliche Recht, Lucy zu sich zu nehmen.«
Ich keuchte. »Würden die Gerichte denn wirklich zu seinen Gunsten entscheiden, Papa? Obwohl er so ein brutaler Mann ist?«
Papa zuckte mit den Schultern. »Er ist ein Baronet. Seine Familie hat Geld und Einfluss. Außer Rowenas Wort gibt es keinen Beweis, dass er sie misshandelt hat. Und das ist auch der Grund, weshalb wir Abstand wahren – nicht weil wir uns für Rowena schämen, sondern weil wir sie schützen wollen. Je weniger Besuche, je weniger Aufmerksamkeit, desto besser.«
»Es ist furchtbar«, wiederholte ich. Ich wusste nicht, was ich sonst sagen sollte. Verunsichert trank ich einen Schluck Tee. Wie töricht musste ich dieser Frau doch erscheinen! Sie hatte wahre Not kennengelernt, und ich … Ich war nur ein dummes Mädchen, das sich von einem Rotrock den Kopf verdrehen ließ.
Nach dem Tee setzten wir uns in zwei Ohrensessel am Fenster des Schankraums und sahen zu, wie sich draußen die Dunkelheit vertiefte und über den Himmel ausbreitete wie ein Tintenfleck über ein Blatt Papier. Ein knochenweißer Mond ging auf, überzog die Baumwipfel mit weißer Glasur und ließ den Nebel am Boden aufleuchten. Die anderen Gäste des Wirtshauses bestiegen die Postkutsche nach London; wir blieben allein zurück. Eine Reiseuhr schlug neun.
»Warum kommt Rowena so spät?«
»Sie wird bald hier sein«, erwiderte Papa hinter seiner Zeitung. »Wie ich schon sagte, sie führt ein sehr zurückgezogenes Leben. Es hat seinen Grund, dass wir uns zu einer so ruhigen Stunde hier verabredet haben. Rowena tut alles, um der Aufmerksamkeit anderer zu entgehen.«
Ich konnte mir gar nicht vorstellen, was es bedeutete, so im Verborgenen zu leben und die Welt immer nur durch ein kleines Fenster zu sehen. Wie anstrengend das sein musste. Hatte meine Patentante denn nicht manchmal das Gefühl, dass sie einfach aufhörte zu existieren? Ich war nur gezwungen, ein Jahr im Exil zu verbringen, während Rowena sich ihr ganzes Leben lang verstecken musste wie eine Ratte. Und weswegen? Sie hatte nichts Falsches getan.
Papa las weiter seine Zeitung. Nach einer Weile bemerkte ich ein Licht, das sich unstet im gegenüberliegenden Wald bewegte und die Nebelschleier teilte. Ich beobachtete es und fragte mich, wer sich wohl um diese Zeit im Wald herumtrieb. Ein Wilderer vielleicht? Aber als die Gestalt näher kam, entpuppte sie sich als eine Frau mit einem Schal um den Kopf und einer Laterne in der Hand. Die Laterne fing den Nebel ein und hüllte sie in eine gelbliche Korona.
»Wer kann das sein?«
Papa faltete die Zeitung zusammen und stand von seinem Sessel auf. »Es ist Rowena. Sie ist zu Fuß gekommen.«
Ich hatte erwartet, sie auf der Straße zu sehen und nicht wie ein Irrlicht zwischen den Bäumen. Nie wäre ich auf die Idee gekommen, dass eine Dame im Dunkeln allein zu Fuß unterwegs sein könnte. Aber Rowena war ganz offensichtlich eine Frau von großer Entschlossenheit. Statt zu warten, dass ein Bediensteter des Gasthauses sie an der Tür begrüßte, stellte sie ihre Laterne draußen ab und betrat unverzüglich den Schankraum, als wäre sie hier die Herrin.
Eingeschüchtert von ihrer Erscheinung machte ich einen höflichen Knicks. Papa verbeugte sich.
Rowena nickte nur. »Emmanuel. Camille. Wie schön, euch zu sehen. Ich bin froh, dass ihr gut angekommen seid.«
Ihr hoheitsvolles Auftreten stand im Gegensatz zu ihrer Kleidung, einem Gewand aus schmuckloser Wolle. Sie wickelte ihren Schal ab, unter dem ein fester Zopf aus eisengrauem Haar zum Vorschein kam. Ich wusste, dass sie etwa im gleichen Alter wie meine Mutter war, aber es fiel mir schwer, es zu glauben. Der Kummer hatte ihr Gesicht gebleicht. Vier tiefe Furchen zogen sich über ihr rechtes Auge und die Wange. War das die Verletzung, die Papa erwähnt hatte, verursacht von ihrem eigenen Ehemann? Was immer ihr widerfahren war, hatte sie halb blind gemacht; ihre Pupille bewegte sich trübe und milchig zwischen den Narben.
Um nicht beim Starren ertappt zu werden, wandte ich rasch den Blick ab. »Darf ich dir eine Tasse Tee anbieten, Patentante?«
»Nein, vielen Dank. Wir können uns nicht lange hier aufhalten. Ich habe Lucy zu Bett gebracht, aber ich lasse sie nicht gern allein.«
Arme Lucy, jetzt schon im Bett! Sie musste wirklich krank sein.
Papa nickte verständnisvoll. »Das arme Kind. Bitte übermittle Lucy meine Grüße. Ich sehe sie immer noch als das winzige Frühchen vor mir, das die Augen nicht öffnen wollte … Ich wünschte, ich könnte sie einmal als junge Frau sehen.«
»Es ist wahrscheinlich besser, dass ihr euch nicht begegnet. Lucys Nerven wären dem möglicherweise nicht gewachsen. Zu viele neue Gesichter auf einmal würden sie überfordern.«
»Ist deine Tochter so sehr krank, Patentante?«
Rowena fixierte mich mit ihren blauen, forschenden Augen. Fast wäre ich einen Schritt zurückgetreten. Sie war beeindruckend, Respekt einflößend und so groß! »Ich habe dir viel über Lucys Zustand zu erklären. Wie ich deinen Eltern schon geschrieben habe, ist es von größter Wichtigkeit, dass du immer meine Anweisungen befolgst. Es ist eine Frage von Leben und Tod.« Ich erstarrte vor Schreck und sofort wurde ihr Gesichtsausdruck sanfter. »Aber mehr dazu später«, sagte sie in wärmerem Ton. »Zuerst … ein Geschenk.«
Ich blinzelte. »Für mich?«
Sie nickte und holte ein kleines Kästchen aus Chagrinleder aus ihrer Tasche. »Ja. Ein Geschenk ist wohl mehr als überfällig, meinst du nicht? Ich habe dein ganzes Leben verpasst. Viele Geburtstage und Weihnachtsfeste sind in diesem Geschenk zusammengefasst.«
Ich hatte ein etwas schlechtes Gewissen, als ich das Kästchen entgegennahm. Rowena war zu arm, um zu reisen, sogar zu arm, um sich wie eine Dame von Stand zu kleiden, und doch hatte sie Geld für mich ausgegeben. »Vielen Dank.«
Ich öffnete den Deckel und sah einen ungewöhnlichen runden Anhänger an einem Silberkettchen. Mondstein aus Indien stand auf einem kleinen Kärtchen. Davon hatte ich noch nie gehört. Ein matter, milchiger Stein … Aber als ich ihn in meiner Hand bewegte, fing der Stein den Feuerschein ein und eine bläulich weiße Wolke schien aus seiner Tiefe aufzusteigen. Die Brillanz von Diamanten und das warme Leuchten von Rubinen verblassten im Vergleich dazu. Dieses Schimmern war wie Magie.
»Er gefällt dir.« Rowena beobachtete mich lächelnd.
Ich war hingerissen. Dieser Mondstein vermittelte mir das gleiche Gefühl wie die Laternen in Vauxhall Gardens: Verzauberung. »Er ist wunderschön!«
»Leg ihn gleich an«, drängte sie.
Eine seltsame Bitte, aber ich hatte nichts dagegen, ihr den Gefallen zu tun. Papa half mir, die Kette in meinem Nacken zu schließen. Sofort fühlte ich mich strahlender, als hätte ich einen Talisman um meinen Hals gebunden.
Meine Patentante sah lächelnd zu. »Wie groß Camille geworden ist«, meinte sie zu Papa. »Ich war mir sicher, dass sie das Erwachsenenalter erreichen würde. Habe ich es euch nicht bei ihrer Taufe gesagt? Sie ist unter einem Glücksstern geboren.«
Papa erwiderte etwas verkrampft ihr Lächeln. »Ich würde nicht sagen, dass Camille in letzter Zeit besonders vom Glück begünstigt war. Die letzten Wochen waren sehr aufreibend für uns alle. Susannah ist noch immer ganz aufgelöst.«
Rowena schnaubte spöttisch. »Susannah sollte mehr Nachsicht mit den Jugendsünden ihrer Tochter haben. Sie vergisst, dass ich sie schon lange vor ihrer Heirat kannte, und zu ihrer Zeit war sie selbst nicht der Inbegriff der Unschuld, das kann ich euch sagen.«
Papa errötete. Ich verkniff mir ein Lachen. Meine Mutter eine Kokette! Ich konnte es nicht glauben. Was würde meine Patentante mir noch für Geschichten zu erzählen haben? Vielleicht wurde dieses Exil ja doch nicht so langweilig.
»Ich hoffe doch, dass es meiner teuren Freundin gut geht«, fuhr Rowena fort. »Den kleinen Jean hat sie … im Mai bekommen, glaube ich. Ist er wohlauf?«
Mein Vater zögerte, bevor er antwortete. Meine letzten beiden Geschwister waren zu früh zur Welt gekommen und noch als Wickelkinder gestorben. Und obwohl Jean molliger und kräftiger war als sie, hegten wir alle die heimliche Furcht, dass er das gleiche Schicksal erleiden könnte. »Susannah ist bei bester Gesundheit, vielen Dank. Und bislang scheint Jean gut zu gedeihen.«
Rowena blickte in das flackernde Feuer. »Das freut mich zu hören. Möge Gott immer seine schützende Hand über ihn halten. Es gibt nichts Schlimmeres für Eltern, als ihr Kind leiden zu sehen.« Etwas veränderte sich in ihrem Gesicht. Sie richtete sich auf und verschränkte entschlossen die Hände. »Also, Camille, wie wäre es, wenn du dein Gepäck holst? Es wird Zeit, dass wir zu Lucy zurückgehen.«
Ich dachte, ich hätte nur leicht gepackt – dafür, dass ich ein ganzes Jahr lang fort sein würde –, aber als ich meine diversen Koffer, Hutschachteln und Taschen zusammensuchte, zog Rowena die Augenbrauen hoch.
»Meine Güte. Ich bezweifle, dass wir das alles tragen können, Kind, es sei denn, du bist sehr viel stärker, als du aussiehst.«
»Warum sollten wir es tragen?«
Ihr Mund zuckte. In ihrem Blick war keine Bosheit, und doch gab er mir das Gefühl, nur einen halben Meter groß zu sein – ein kleines Kind, das eine dumme Frage gestellt hatte.
»Ich habe keine Diener in Felwood Lodge und auch keine eigene Kutsche. Wir müssen so zurückkehren, wie ich gekommen bin – zu Fuß.«
»Wir werden nach Felwood Lodge gehen? Im Dunkeln?«
Rowena nickte. »Fürchte dich nicht. Ich passe auf dich auf. Heute Nacht ist Vollmond, wir werden genug sehen.«
Ich starrte sie bestürzt an.
Papa räusperte sich und wühlte in seinen Taschen, dann reichte er mir ein kleines, klappbares Taschenmesser, hübsch in Silber gearbeitet. »Nimm das mit dir, mein Liebes. Es ist nicht viel, ich weiß, aber ich würde mich besser fühlen, wenn du es bei dir trägst. Etwas, womit du dich verteidigen kannst. Natürlich ist es in Wirklichkeit unnötig, es ist nur die Laune eines besorgten Vaters. Ich weiß, dass Rowena ausgezeichnet auf dich achtgeben wird.«
»Ich werde gut auf Camille aufpassen, aber es ist für jede Frau eine kluge Vorsichtsmaßnahme, eine Waffe bei sich zu führen.« Sie wechselte einen Blick mit Papa. »Eine Klinge wie die hat mir einmal das Leben gerettet.«
Ich schluckte und steckte das Klappmesser, das noch warm war von der Hand meines Vaters, in meine Tasche. Wieder spürte ich, wie fremd mir dieser neue Ort war, wie vollkommen unvorbereitet ich war. »Meine ganzen Koffer …«
»Du musst zurücklassen, was du nicht tragen kannst. Ich werde es wieder mit nach Hause nehmen«, sagte Papa.
Meine Sachen zurücklassen? Reichte es denn nicht, dass ich mein Zuhause verlassen musste, meine Familie? Ich schaute von Koffer zu Koffer und versuchte, mich zu erinnern, was sich in jedem befand.
Papa sah wohl, wie meine Augen feucht wurden, denn er zog mich in eine unbeholfene Umarmung. »Es wird schon alles gut werden. Du hast doch immer reisen wollen, nicht wahr? Betrachte es als eine gute Gelegenheit. Und jetzt sei artig zu deiner Patentante. Tu genau, was sie dir sagt. Ich werde dir bald schreiben.«
Er hatte recht: Ich hatte mich nach Abenteuern gesehnt. Jetzt hingegen erschien mir die Vorstellung verlockender, den Rest des Abends mit Papa am Kaminfeuer zu verbringen. Aber was sollte ich machen – ich hatte mir die Suppe eingebrockt, indem ich Mr. Randall geküsst hatte, nun musste ich sie auslöffeln. Ich klemmte mir eine Hutschachtel unter den einen Arm und schleifte mit dem anderen eine Reisetasche hinter mir her. Mehr schaffte ich nicht.
Rowena hob meinen schwersten Koffer an, als wäre er leicht wie eine Feder. »Bereit?«
Ich war alles andere als bereit, aber mir blieb nichts anderes übrig, als mein Gepäck über die Schwelle des Gasthauses zu schleppen, hinaus in die Nacht.
Draußen war alles kühl, ruhig und dunkel. Der Wind trug Feuchtigkeit heran, so klebrig wie die Zunge eines Hundes.
Rowena schritt vor mir her und ließ das Licht ihrer Laterne auf den Wald fallen, der auf der anderen Straßenseite lauerte. Wie dicht er doch war und voller Schatten. Ich sah Moos, das über Baumstümpfe wucherte, Efeu, der die Überreste einer Eiche erdrosselte – eine hämische Parodie auf die wunderschönen Grotten von Vauxhall Gardens.
»Zumindest werden wir deine Muskeln in diesem Jahr etwas aufbauen«, sagte Rowena, um mich zu ermutigen. »Bei deiner Rückkehr nach Martingale Hall wirst du stark wie ein Ochse sein.«
Ich hielt es für wahrscheinlicher, dass ich mir eine Schulter ausrenkte. Man hatte mich doch hierhergeschickt, um meinen Ruf wiederherzustellen, und nicht damit ich noch wilder wurde. Das hier war kein Benehmen für eine Dame. Eine Dame sollte keine Muskeln haben oder nach Sonnenuntergang umherstromern … Ich konnte mir nicht vorstellen, was meine Mutter sagen würde, sähe sie mich jetzt.
Hufe klapperten in der Ferne, als wir die Straße überquerten. Ich drehte den Kopf und sah die Laternen einer Kutsche am nebligen Horizont – jemand war sogar noch später als wir unterwegs.
»Camille! Spute dich!« Rowenas Lampe leuchtete auf einen Pfad, der in den Wald führte. »Komm schnell, damit man dich von der Straße aus nicht sieht!«
Aber ich zögerte. Das dichte Blätterdach, das das Mondlicht auszulöschen drohte, behagte mir nicht. »Warum gehst du dort entlang? Ist dein Haus im Wald?«
»Ursprünglich war es eine Jagdhaus«, erwiderte Rowena, ohne sich umzudrehen. »Es hat der Familie meiner Mutter gehört. Komm jetzt, trödle nicht.«
Und doch tat ich es. Ich sah zu, wie die Kutsche mit ihren beiden schwarzen Pferden in den Hof des Gasthauses bog. Eine so edle Equipage hatte ich noch nie gesehen, so gut gefedert, mit Brokatvorhängen an den Fenstern und einem Wappen an der Seite. Sie vermittelte eine Aura solchen Reichtums, solch dekadenten Stils, dass ich den sehnlichen Wunsch verspürte, einen Blick auf den Besitzer zu werfen. Wer würde aus einem solchen Gefährt steigen? Ich strengte meine Augen an, meinte ein Schimmern durch das Fenster zu erblicken … War es ein Paar Augen, die dort im dunklen Kutscheninneren leuchteten?
Ich fand es nicht heraus. Rowena war umgekehrt, packte meinen Arm und zerrte mich in die Tiefen des Waldes. »Was habe ich dir gesagt? Du musst auf mich hören und meine Anweisungen befolgen! Hier entlang.«
Früher am Tag musste es geregnet haben, denn die Erde war weich und klebte an meinen Reiseschuhen, als ich vorwärtsstolperte. Rowena bewegte sich so sicheren Fußes wie eine Katze, aber mich wollte der Wald nicht passieren lassen. Stechpalmen zupften an meinem Kleid, um mich aufzuhalten. Meine Reisetasche verhakte sich an einer Wurzel, die über den Weg ragte. Jedes Stück Laub gab mir zu verstehen, dass ich nicht willkommen war.
»Komm her, Camille, gib mir deine Hutschachtel. Ich kann sie am Band halten. Ist es so besser?«
Selbst mit weniger Gewicht erschien mir der Fußweg endlos, wie ein Albtraum, in dem ich rannte und rannte, ohne einen Schritt vorwärtszukommen. Verbissen konzentrierte ich mich auf meine Schritte. Ich bemerkte nicht, dass der Wald um uns herum dichter wurde und sich dann wieder lichtete, und ich sah auch nicht den Turm, der aus der Dunkelheit auftauchte und den Mondschein einfing. Erst als ich kurz stehen blieb, um Atem zu holen, schaute ich auf, und dort vor mir stand Felwood Lodge, still und lautlos, durch hohe Eichen dem Blick der Menschen entzogen.
Ein Netz aus Efeu erstreckte sich über die zwei Stockwerke aus Granitsteinen und hätte das Haus perfekt getarnt, wären da nicht die Zinnen entlang des Daches gewesen und der Turm, der hinauf zu den Sternen zeigte. Hatte Rowena dies als ein Jagdhaus bezeichnet? Es sah mehr wie das Lustschloss eines exzentrischen Adligen aus.
»Das ist dein Haus?«, flüsterte ich ungläubig. »Du lebst ja in einem von Mrs. Radcliffes Schauerromanen!«
Rowena stieß ein leises Brummen aus. »Mehr als du dir vorstellen kannst.«
Sie holte einen Ring mit Schlüsseln unter ihrem Schal hervor. Gespannt folgte ich ihr zur Vordertür, die sich quietschend zu einer kleinen, verqualmten Küche öffnete. Fässer standen in den Ecken und von der Decke hingen Kräuterbüschel. Eine Frau mittleren Alters mit grobschlächtigem Gesicht hakte gerade einen Kessel über die Feuerstelle.
Rowena nickte ihr zu. »Das ist Bridget. Sie wird dir Tee machen, wenn du welchen möchtest. Setz dich, Kind, du siehst aus, als würdest du gleich umfallen.«
In der Küche stand ein grob gezimmerter Tisch mit einigen Stühlen. Ich schleppte mein Gepäck ins Haus und setzte mich dankbar hin. Schnell schloss Rowena hinter uns die Tür und sperrte sie mit ihrem rasselnden Schlüsselring ab.
Ich hatte nichts von der Existenz einer Person wie Bridget gewusst. War sie hier das Dienstmädchen? Meine Patentante hatte gesagt, sie habe keine Diener, aber ich konnte mir keine andere Funktion für diese Frau denken, die jetzt zwei dampfende Becher auf den Tisch stellte.
»Bitte sehr, junge Dame«, sagte sie. »Schön, dich kennenzulernen.«
Ich dankte ihr und nahm einen Becher in die Hände. Der Tee roch nach Kräutern, ganz anders als der schwarze Bohea-Tee bei uns zu Hause. Ich wollte ihn nicht trinken, deshalb blies ich nur kleine Vertiefungen in die heiße Oberfläche.
Rowena setzte sich neben mich. »So«, sagte sie und nahm sich den anderen Becher. »Du hast also einen Soldaten geküsst und deiner Familie Unehre gemacht.«
»Ja, aber …«, stotterte ich. »Ich wollte nicht … Ich wusste nicht …«
Da sah ich, dass sie mich angrinste. »Beruhige dich, Kind. Hier wird dich niemand verurteilen. Gott weiß, dass sowohl Bridget als auch ich wegen der Liebe zu Männern auf einige unglückliche Wege geraten sind. Vertrau mir, wenn ich dir sage, dass sie den Kummer nicht wert sind.« Sie trank einen Schluck Tee, und als sie den Becher wieder absetzte, lag keine Spur von Belustigung mehr auf ihren Lippen. »Deine Eltern haben dir meine Situation erklärt?«
Ich wusste nicht recht, was ich erwidern sollte. »Mein Vater sagte, dass du und dein Mann … dass ihr getrennt lebt. Dass er nach dir sucht.«
Sie wechselte einen Blick mit Bridget, die ein paar Schritte entfernt am Spülstein stand. »Ja. Wir führen hier draußen ein Leben, das sich sehr von dem unterscheidet, das du gewohnt bist, Camille. Es wird häusliche Pflichten geben, die du erfüllen musst. Regeln, die einzuhalten sind.«
Ungute Ahnungen stiegen in mir auf. »Was für Regeln?«
»Die meisten haben etwas mit Lucys Krankheit zu tun. Wie ich schon sagte, geht es meiner Tochter nicht besonders gut. Allein schon dadurch, dass wir dich herkommen lassen, setzen wir ihre Gesundheit aufs Spiel. Vergelte mir mein Entgegenkommen nicht durch Unartigkeit.«
»Das werde ich nicht! So bin ich nicht! Im Allgemeinen bin ich ganz brav«, versicherte ich ihr und im Großen und Ganzen stimmte das auch. Meine Fehltritte spielten sich größtenteils in meinem Kopf ab, wo sie niemandem Leid zufügen konnten außer mir.
»Freut mich zu hören«, sagte sie ernst. »Gut, pass auf. Dies ist deine erste Lektion.« Sie stellte ihren Becher ab, holte ein kleines Buch aus ihrer Tasche und schlug es auf einer Seite auf, die jeden Tag dieses Monats – September – auflistete sowie die ungefähre Länge der Tage. Oben auf der Seite waren vier Kreise abgebildet, die in unterschiedlichem Maße schattiert waren: Neumond, Erstes Viertel, Vollmond, Drittes Viertel.
»Das ist ein Almanach«, sagte ich.
»Genau, und er ist sehr nützlich für mich, denn er sagt recht zuverlässig voraus, wann der Mond aufgehen wird. Vielleicht hast du schon einmal von außergewöhnlichen medizinischen Fällen gelesen, bei denen Menschen das Licht der Sonne nicht ertragen können? Es bereitet ihrer Haut Schmerzen, macht sie krank. In seltenen Fällen kann es sie töten.«
Ich schüttelte den Kopf. »Ich wusste nicht, dass es so etwas gibt! Grundgütiger, ist das die Krankheit, an der deine Tochter leidet?«
»Nein. Lucy ist ein noch ungewöhnlicherer Fall. Sie fürchtet nicht das Licht der Sonne, sondern die Nacht. Mondlicht verschlimmert ihren Zustand.«
»Das … ist das Seltsamste, was ich je gehört habe. Ein medizinisches Phänomen!«
»In der Tat. Das ist meine Tochter ganz sicher.«
Bridget trat an Rowenas Seite und legte ihr eine Hand auf die Schulter. »Wir schicken Lucy immer früh zu Bett«, sagte sie. »Nachts ist es schwieriger, mit ihren Symptomen umzugehen. Vor allem wenn der Mond voll ist. Deshalb haben wir deinen Vater gebeten, dich heute Abend hierherzubringen, wenn das Schlimmste vorüber ist. Ab morgen Nacht nimmt der Mond wieder ab.«
»Also … wird es Lucy wieder besser gehen?«
»Ein wenig. Ihr Zustand kann sich zu jeder Stunde, jederzeit während des Monats verschlechtern, aber wir haben festgestellt, dass hier …« Sie legte ihren Finger auf das Symbol des Neumondes. »… ihr Gesundheitszustand im Allgemeinen akzeptabel ist. Vorausgesetzt, wir bewahren sie vor zu viel Aufregung. Deshalb musst du genau das tun, was Rowena sagt. Mach keine Dummheiten und reg Lucy nicht auf. Lass kein Mondlicht ins Haus oder schleiche nachts herum, wenn sie sich nicht wohlfühlt. Bleibe nach Einbruch der Dunkelheit in deinem Zimmer und verhalte dich ruhig.«
Ich konnte kaum glauben, was ich da hörte. Nie wäre ich auf die Idee gekommen, dass eine solche Krankheit überhaupt möglich war. »Ich möchte nicht neugierig sein, aber … was genau ist Lucys Krankheit?«
Rowena atmete tief ein. Ihr Gesicht lag im Schatten, sodass ich den Ausdruck nicht erkennen konnte. »Sie wurde damit geboren. Eine Erbkrankheit, die im Blut steckt. Ihr Vater und jedes Mitglied seiner Familie leidet daran. Soweit ich weiß, gibt es keine vollständige Heilung. Aber ich kann keinen Arzt konsultieren. Mein Mann könnte davon erfahren. Die Alaunts sind ebenso einflussreich, wie sie gewalttätig sind. Sie haben viele Spione.«
Ich erschauderte. »Wie furchtbar für euch.«
»Ich kann nur mein Bestes tun, um Lucy von den Faktoren fernzuhalten, die immer Sir Marcus’ Symptome ausgelöst haben.«
»Bist du sicher, dass es keine … Spezialisten für Lucys Leiden gibt? Keine gelehrten Männer aus London, die du unter größter Geheimhaltung konsultieren könntest?«
Rowena schlug den Almanach zu. »Nein«, sagte sie fest. »Ich habe es doch schon gesagt. Es gibt keinen Arzt, der ihr helfen kann.«
Aus Angst, zu weit zu gehen, hielt ich lieber den Mund. Es war ganz offensichtlich ein heikles Thema. Nervös spielte ich mit dem Anhänger um meinen Hals. Mondstein. War es nicht seltsam, dass Rowena mir gerade diesen Stein schenkte, der den Namen der Nemesis ihrer Tochter trug?
»Du musst das immer tragen!«, sagte meine Patentante und riss mich aus meinen Gedanken.
»Muss ich?«
Sie griff mit der Hand an den hohen Kragen ihres Kleides und zog einen identischen Anhänger heraus. Als ich einen Blick zu Bridget warf, sah ich, dass sie ebenfalls einen trug. Ich bekam eine Gänsehaut. Etwas Seltsames war hier im Gange, etwas, das ich nicht in Worte fassen konnte. Die drei Steine blinzelten einander im Schein des Feuers zu, als würden sie in einer mystischen, stummen Sprache kommunizieren. »Ja. Nimm ihn niemals ab.«
»Aber … warum?«
»Mondstein gilt in Indien als heilig. Er bringt einer in Aufruhr geratenen Seele die Ruhe zurück.« Das war keine Antwort auf meine Frage. Aber jetzt stand Rowena auf und signalisierte damit, dass unsere Unterhaltung beendet war. »Möchtest du dich nun auf dein Zimmer zurückziehen?«
Das wollte ich wirklich gern. Die lange Reise forderte ihren Tribut, außerdem war Rowena so seltsam geworden. Sie hatte sich verändert, als sie über Lucys Krankheit sprach, fast als wäre eine Wolke über ihr Gesicht gezogen.
»Ja, bitte, ich muss gestehen, dass ich sehr müde bin. Würdet ihr mir mit meinem Gepäck helfen?«
Bridget nahm einen Kerzenhalter und zündete die Kerze am Feuer an. Sie beleuchtete unseren Weg, während Rowena meine Habseligkeiten aus der Küche durch einen schmalen Flur zu einer Treppe trug. Ein Knarren begleitete uns bei jeder Stufe und auf den Treppenabsätzen. Nirgends sah ich Bilder oder andere Dekorationen. Die Wände waren bis in Hüfthöhe mit Eschenholz vertäfelt, darüber war nur nackter, farbloser Putz. Aus dem gleichen Holz bestanden die Bodendielen und die Treppenstufen. Es sah trist aus, aber wenigstens war es sauber.
»Dort ist dein Zimmer.« Rowena zeigte den Flur entlang auf die linke Seite. »Lucy schläft im Turm. Hinter der Tür am Ende des Gangs ist die Treppe nach oben.«
Ein Schlafgemach im Turm und ein Mädchen, das nicht den Mond ansehen durfte – es klang, als wäre Lucy eine Prinzessin aus einem Buch. Es juckte mich in den Fingern, sie kennenzulernen und das Jagdhaus weiter zu erkunden, aber Bridget öffnete die Tür zu meinem Zimmer und leuchtete mit der Kerze hinein. »Hier ist der Raum, den wir für dich vorbereitet haben. Ich hoffe, es gefällt dir.«
Entgeistert starrte ich in das Zimmer und bemühte mich, mir meine Bestürzung nicht anmerken zu lassen. Wenn ich von Abenteuern geträumt hatte, hatte ich mir Umgebungen vorgestellt, die noch schöner waren als alles, was ich aus Martingale Hall kannte, aber mir war nie in den Sinn gekommen, wie verwöhnt mein normales Leben eigentlich war. Die Kammer in Felwood Lodge war kahl und schlicht, es gab keinen Teppich und nicht einmal eine Feuerstelle. Ein Bett, schmal wie eine Krippe, beanspruchte den Großteil des Platzes. Daneben stand ein Nachttopf auf einem abgewetzten Fußabtreter, die Requisiten einer Klosterzelle.
»Oh. Vielen Dank«, sagte ich wenig überzeugend.
Mein Gepäck passte kaum in das Zimmer. Da es nichts anderes gab, setzte ich mich aufs Bett. Es quietschte bedenklich. Bridget gab mir den Kerzenhalter. »Hier, den kannst du haben.«
»Schlaf gut.« Meine Patentante lächelte. »Sei gewarnt – wir sind Frühaufsteher. Ich werde dir gleich morgen früh etwas heißes Wasser bringen.«
»Gute Nacht, Miss Garnier.«
Ich war so niedergeschlagen, dass ich kein Wort sagte, als sie die Tür schlossen und wieder die Treppe hinabgingen. Ich fühlte mich, als wäre ich in eine Gruft gesperrt worden. Meine freie Hand strich über das Bettzeug unter mir; es war kratzig und roch leicht muffig.
Ich wollte nach Hause. Ich wollte meine Schwester, wollte, dass sie neben mir schlief, wie sie es immer tat, in unserem lieblichen Zimmer mit der zitronengelben Tapete. Einem Zimmer, das ich während der Nacht verlassen durfte.