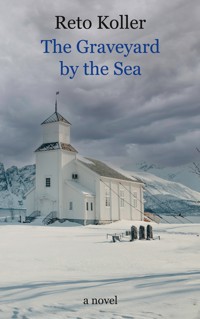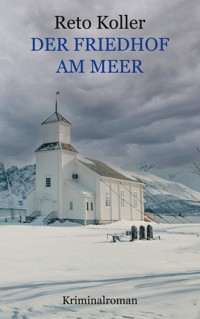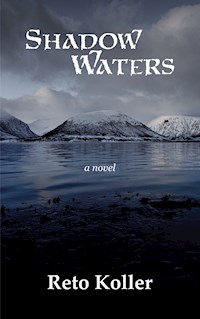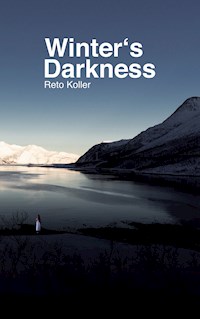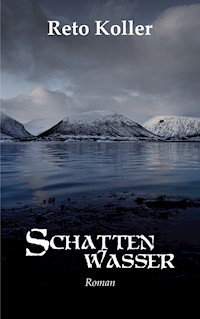Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Für William Larsen aus Tromsø in Norwegen sollte die Reise zu seinem Großvater in die Schweiz die ersehnte Zuflucht werden, eine Chance, sich von den Schatten der Vergangenheit zu lösen. Alkohol- und Drogeneskapaden hatten ihn in eine Spirale des Verfalls gezogen, an deren Tiefpunkt er nicht nur sich selbst, sondern auch einen guten Freund verlor. Als er den Nachbarn seines Großvaters kennenlernt, stößt er auf eine Geschichte, die ihn nicht mehr loslässt: Vor Jahrzehnten soll sich auf dessen Grundstück eine Frau erhängt haben. Fasziniert beginnt William zu recherchieren und merkt bald, dass der alte Mann nicht der Einzige ist, der Geheimnisse hütet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 437
Veröffentlichungsjahr: 2026
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Vorwort
Sämtliche Charaktere in diesem Buch sind vom Autor frei erfunden.
Prolog
Karibisches Meer, August 1960
Der Sturm entfaltete seine ganze Kraft in den frühen Morgenstunden des 8. Septembers 1960. Am Abend zuvor, als die sechs Passagiere des Segelschiffes Sea Turtle zu Bett gingen, ahnte keiner, dass in nur wenigen Stunden die Leben von vier Gästen und drei Besatzungsmitgliedern ausgelöscht sein würden.
Als die Sea Turtle um vier Uhr fünfzehn in der Früh bei voller Fahrt auf ein Unterwasserriff auflief, waren der Kapitän und sein Offizier bereits mit dem Segeleinholen beschäftigt gewesen. Der orkanartige Wind versetzte die Sea Turtle jedoch innert Minuten in eine starke Krängung und die beiden Seeleute mussten ihr Vorhaben abbrechen.
Bis zu diesem Augenblick hatte das frisch vermählte Ehepaar in Kabine Nummer 3 von dem Sturm nichts mitbekommen, was unter anderem den zwei Flaschen Rotwein zum Abendessen geschuldet sein dürfte. Jetzt aber purzelten sie aus ihren Betten und wussten im ersten Moment nicht, was passiert war. Der Mann, der außer seiner Unterhose nichts am Körper trug, zündete die Nachttischlampe an und sah seine Frau, die sich mit ängstlichem Blick am Metallgestell des Etagenbettes festhielt. Die ganze Kabine war in Schieflage. Dann bemerkte er das Tosen des Sturms.
«Was ist hier los?», schrie seine Frau plötzlich und schob den Reisekoffer weg, welcher sich gelöst hatte und jetzt durch die Kabine rutschte.
«Wir müssen in einen Sturm geraten sein», erwiderte ihr Mann und rieb sich den schmerzenden Kopf. Eine dicke Beule formte sich oberhalb seines rechten Ohrs und aus einer Wunde an der Stirn tropfte Blut.
In dem Moment sah er, dass Wasser unter der Tür hindurch in die Kabine drang und sich an der Außenwand sammelte.
«Wir sinken …, wir sinken!», rief die Frau hysterisch und versuchte sich an ihrem Mann festzuklammern.
«Wir müssen hier sofort raus», schrie der Mann zurück und rappelte sich auf, griff nach ihrer Hand und zog sie auf die Beine. «Los, komm. Wir können nicht hierbleiben.»
Die Kabine neigte sich immer weiter zur Seite, wodurch der Fußboden sich vor ihnen aufstellte und die Kabinentür sich jetzt über ihren Köpfen befand.
«Ich klettere am Bettgestell nach oben und ziehe dich dann zu mir hoch», rief der Mann seiner Frau zu. «Wenn wir uns auf das Fußende stellen, sollten wir die Tür ohne weiteres erreichen können.»
Sie nickte, aber es sah mehr wie ein unkontrolliertes Zittern aus.
Der Mann stand auf, kletterte am Bettgestell nach oben und stand wenig später auf der Rückseite des Bettes und benutzte die Gitterstäbe als Standplatz. Von dort versuchte er die Türklinke zu erreichen, was ihm auch gelang. Die Tür öffnete er allerdings nicht, er befürchtete, dass sich die Kabine sonst augenblicklich mit Wasser füllen würde.
Er schaute zurück zu seiner Frau, die wimmernd neben dem Bett an der Außenwand kauerte und zu ihm hochblickte. «Gib mir deine Hand, schnell!» Er streckte seinen Arm nach ihr aus, doch seine Frau zögerte.
«Komm schon, wir haben keine Zeit.»
Nur langsam stand sie auf, reckte sich nach oben, konnte seine Hand jedoch nicht erreichen.
«Du musst hochklettern, ich kann dich sonst nicht nach oben ziehen.»
«Ich kann das nicht, ich kann das nicht.»
«Natürlich kannst du das. Sieh mich an. Du schaffst das.»
Sie stieß ein kehliges Wimmern aus, tat aber, was ihr Mann von ihr verlangte, und kletterte über das Bett zu ihm nach oben. Als sie neben ihm kniete, warf sie sich ihm an den Hals und heulte los.
«Wir haben keine Zeit mehr, wir müssen hier so schnell wie möglich raus», sagte er ihr und versicherte sich, dass sie einen festen Stand hatte. Danach öffnete er die Tür und wie vermutet, wurden sie von einem Wasserfall übergossen.
Hilferufe von den anderen Passagieren drangen zu ihnen in die Kabine. Sie konnten eine Frau hören, deren Schreie immer wieder unterbrochen wurden, so als wäre sie gerade am Ertrinken. Lautes Klopfen gesellte sich zu den Todesschreien und plötzlich konnten sie die schrille Stimme des Kapitäns hören, die alle aufforderte, sich unverzüglich an Deck zu begeben.
Der Mann nahm den Kopf seiner Frau zwischen seine Hände und schaute sie durchdringend an. «Hör mir jetzt zu; wir kommen hier raus. Ich zieh mich jetzt zur Tür hoch und von dort ziehe ich dich hinterher. Danach klettern wir über die Treppe an Deck und von dort in ein Rettungsboot. Hast du mich verstanden?»
Sie nickte apathisch.
«Also schön. Halt dich hier am Bettpfosten fest», sagte er, stieß sich vom Bettgestell ab und zog sich am Türrahmen nach oben. Weitere Schreie hallten durch das Schiff und als er endlich auf der Wand im Schiffsflur stand, lag das Boot bereits in einem 90-Grad Winkel zur Wasseroberfläche.
«Schnell jetzt!», schrie der Mann in die Kabine, griff nach unten und gerade als er die Hand seiner Frau zu fassen kriegte, neigte sich das Boot weiter zur Seite und sie verlor den Halt. Mit weit aufgerissenen Augen fiel sie in die Kabine zurück und schlug mit dem Kopf an der Außenwand des Schiffes auf. Blut verteilte sich über die Wand und im Wasser, sie regte sich nicht mehr.
«NEIIIIN!», schrie der Mann und wollte zurück in die Kabine klettern. Im selben Moment rauschte eine Wasserwand durch den Flur und bevor er reagieren konnte, wurde er weggerissen, schlug an mehreren Stellen hart auf, bevor er gegen die Treppenstufen gedrückt wurde. Er stieß einen Schmerzensschrei aus, Salzwasser lief ihm in Nase und Mund und er hustete, bis er sich übergeben musste. Nach Atem ringend suchte er die Tür zu seiner Kabine, doch der Flur war bis unter die Decke mit Wasser gefüllt. Im nächsten Augenblick ging das Licht aus und er sah nicht mal mehr die Hand vor Augen.
«ANNAAAAA!», schrie er in die Finsternis hinaus, aber es kam keine Antwort.
Plötzlich schlug über ihm eine Tür auf und weiteres Wasser strömte hinein. Er spürte die Treppenstufen unter seinem Körper und versuchte halb schwimmend, halb kriechend an Deck zu gelangen.
«Kommen Sie hoch, sofort», schrie jemand und er erkannte den Kapitän, wie er neben dem Ausgang kniete und die Hand nach ihm ausstreckte.
«Meine Frau ist noch in der Kabine.»
«Das Schiff geht gleich unter, es bleibt keine Zeit mehr. Da unten ist alles unter Wasser. Sie müssen vom Boot runter, sonst sterben Sie auch.»
«Ich kann nicht …, ich kann sie nicht zurücklassen.»
«Das müssen Sie. Sie hätte nicht gewollt, dass Sie auch sterben. Jetzt kommen Sie schon.»
«Ich geh zurück.»
«NEIN!»
Der Mann wollte gerade umkehren, als er einen Klammergriff am Arm spürte und mit Gewalt nach oben gezerrt wurde. Der Kapitän zog ihn an Deck und stellte ihn auf die Beine. «Wo ist Ihre Rettungsweste?»
Aber der Mann hörte ihn gar nicht. Der tosende Wind und die Gewissheit, dass seine Frau unter Deck gefangen war, ließen ihm die Sinne vernebeln. Verloren schaute er sich in der Dunkelheit um, die Luft war von der Gischt geschwängert, und das Einzige, was er erkennen konnte, waren die weißen, halbeingerollten Segel, die sich deutlich von der schwarzen Wasseroberfläche abhoben.
«Los, wir müssen springen», schrie der Kapitän und zerrte ihn von der Tür weg. Bevor der Mann wusste, was geschah, verlor er den Boden unter den Füssen und einen Herzschlag später fand er sich unter Wasser wieder. Als er auftauchte, spürte er die Gischt wie tausend Nadelstiche im Gesicht, den Kapitän sah er nicht mehr.
«Hierheeeer!», hörte er eine Stimme rufen. «Hierheeer!» Einige Meter entfernt entdeckte er das kleine Rettungsboot, wie es von den Wellen hin und her geworfen wurde. Ein Crewmitglied und Mr Hobbs aus Australien saßen in dem Boot.
Der Mann begann zu schwimmen und erreichte wenig später das rettende Holzboot. Mit Hilfe der beiden Männer wurde er an Bord gezogen, wo er sich prustend und schwer atmend hinkniete. Erst jetzt bemerkte er den Kapitän, der sich gleich hinter ihm ins Boot hievte. Kaum war er drinnen, wühlte er in einer Kiste herum und förderte eine Taschenlampe zu Tage. Er schaltete sie ein und ließ den Lichtkegel über die Wasseroberfläche gleiten. Die vier Bootsinsassen folgten mit ihren Blicken dem Licht und hofften, dass noch weitere Passagiere es an die Oberfläche geschafft hatten, doch alles, was sie sahen, waren Schiffsgegenstände, die von den Wellen hin und her geworfen wurden. Von der Sea Turtle selbst war weit und breit nichts mehr zu sehen.
Kapitel 1
Tromsø, Norwegen, September 2019
Im Herbst 2018 starb mein bester Freund Kristan Haugland. Sein Tod erschien mir damals wie ein schlechter Traum, den ich nicht abschütteln oder verdrängen konnte. Wochenlang redete ich mir ein, dass das alles gar nicht passiert sei, dass Kristan wieder in Erscheinung treten und alles so sein würde, wie bis anhin. Aber natürlich passierte nichts dergleichen. Als ich diese Tatsache endlich akzeptiert hatte, musste ich feststellen, dass sein Tod viele Aspekte meines Lebens in ein anderes Licht gerückt hatte. Dachte ich mit vierzehn Jahren noch, dass der Laufpass von meiner damaligen Freundin, Alma, das Ende der Welt bedeutete, so weiß ich heute, dass es noch schlimmer kommen kann.
In Filmen hört man oft die Worte: Sein Tod war nicht umsonst gewesen. Ich hatte mit dieser Aussage immer gehadert, aber wie das Leben manchmal so spielt, trafen diese Worte den Nagel auf den Kopf. Vielleicht tönt das egoistisch, aber Kristans Tod hat tatsächlich mein Leben gerettet. Oder um es etwas weniger dramatisch zu formulieren; es hat mich auf eine Weise verändert, dass nicht auch mich Kristans Schicksal ereilt.
Aber vielleicht sollte ich etwas weiter ausholen. Zum Beispiel bei der Entzugsklinik. Das war so eine Sache, auf die ich heute nicht übermäßig stolz bin – oder präziser gesagt, ich war auf den Grund, weshalb ich dort landete, nicht stolz.
Alles hatte vor zwei Jahren begonnen. Damals war ich zwanzig Jahre alt und studierte an der Hochschule Ingenieurstechnik, als ich mit dem Trinken anfing. Wir trafen uns immer bei meinen Kumpels und tranken um die Wette Bier. Meistens endeten die Abende damit, dass sich einer übergeben musste oder ein anderer mit dem Kopf in ein Möbelstück krachte. Mit der Zeit wurde uns das Bier zu langweilig und so stiegen wir auf Whisky um, und als auch das nicht mehr genügte, zogen wir uns Kokain in die Nase. Von den Alkoholeskapaden kriegten meine Eltern nur so viel mit, als dass ich einmal mein Zimmer vollgekotzt hatte und mein Vater mich zwei weitere Male sturzbetrunken bei Kristan abholen musste. Die eine oder andere Standpauke handelte ich mir daraufhin selbstverständlich ein, aber schwerwiegende Folgen hatten unsere Trinkgelage nie. Das änderte sich allerdings in der Nacht vom 4. auf den 5. März 2018. Kristan, Lars, Iwan und ich hatten den ganzen Abend um die Wette getrunken und fuhren kurz nach Mitternacht in Richtung Innenstadt, weil wir im Club Midnattsol weiterfeiern wollten. Das Problem bei der Sache bestand darin, dass wir nicht nur wegen des Alkoholpegels nicht hätten fahren dürfen, sondern auch deshalb, weil Lars, der sich als Fahrer zur Verfügung stellte und zudem am wenigstens getrunken hatte, noch gar keinen Führerschein besaß. Dieser Umstand hielt uns jedoch nicht von unserem Vorhaben ab, weshalb wir Lars’ Vater die Autoschlüssel entwendeten und mit seinem Auto lospreschten. Lars wohnte damals in Tromsdalen, also mussten wir erst die Brücke queren, was Lars gerade noch so schaffte. Weil aber an jenem Abend frischer Schnee gefallen war und Lars in der Kurve nach der Brücke die Kontrolle über den Wagen verlor, fuhr er gerade aus weiter, überfuhr dabei einen Passanten auf dem Gehsteig und krachte danach ins Schaufenster eines Möbelgeschäftes. Der Passant erlitt schwerste Verletzungen an Kopf und Rücken, Lars hatte eine Platzwunde am Kopf, Kristan, Iwan und ich kamen ohne einen Kratzer davon. Die Konsequenzen für unser rücksichtsloses Verhalten spürten wir aber in den darauffolgenden Wochen und Monaten.
Nun könnte man meinen, dass wir aus unseren Fehlern gelernt hätten. Leider kann ich dies nicht bestätigen. Anstatt zu reflektieren und den gut gemeinten Ratschlägen unseren Eltern Folge zu leisten, fingen wir stattdessen wieder mit dem Koksen an. Eine Weile ging das gut, danach zeigten sich ersten Auswirkungen der Drogen. Unsere Leistungen bei der Arbeit oder an der Uni ließen zu wünschen übrig, wir wurden unruhig, nervös und übellaunig, wenn wir an keinen Stoff herankamen. Ich lebte noch zuhause und natürlich merkten meine Eltern, dass mit mir etwas nicht stimmte, aber alle Moralpredigten halfen nichts. Wir machten einfach weiter. Jedenfalls bis zum 15. Oktober 2018, als Kristan betrunken und mit Kokain zugedröhnt in der Nähe des Hafens in den Sund fiel und ertrank. Die Autopsie seines toten Körpers offenbarte den Drogenkonsum und da dauerte es nicht lange, bis auch Lars, Iwan und ich auf Drogen untersucht wurden. Tja, und die Testergebnisse logen nicht.
Zwei Wochen später wurde ich in eine Entzugsklinik am Südende der Insel eingewiesen, wo ich ein schönes Zimmer mit Blick auf die südlichen Alpen erhielt. In den ersten Tagen versuchte ich mich über Wasser zu halten, indem ich Bücher las oder mich mit Filmen gucken ablenkte. Ich sprach mit Betreuungspersonen oder anderen Suchtkranken. Letzteres jedoch verleidete mir schnell, denn die negative Stimmung der Bewohner übertrug sich auch auf mich und ich wollte nicht noch tiefer in diese Negativspirale hineingezogen werden.
Der Alkohol und das Kokain fehlten mir - das Kokain sogar noch mehr, und gleichzeitig wusste ich, dass keine Möglichkeit bestand, an den Stoff heranzukommen. Der einzige Aufsteller in diesen Momenten waren die leeren Blicke der anderen Bewohner, die genauso nach etwas lechzten, was in unerreichbarer Ferne lag.
Die Nächte in der Klinik waren lang und einsam. Oft hatte ich mit Kopfschmerzen und Albträumen zu kämpfen. Kristans Gesicht wollte einfach nicht aus meinen Gedanken weichen. Es war da, wenn ich die Augen schloss, es war da, wenn ich träumte, und es war da, wenn ich morgens noch im Bett lag und an die Decke starrte. In diesen Momenten wünschte ich mir, ich könnte mir ein paar Whiskys gönnen, um die Schmerzen und die Schuldgefühle abzutöten, oder wenigstens so zu lindern, dass sie nicht mein Leben bestimmten.
Aber das war natürlich keine Option. Nicht in einer Entzugsklinik. Um zu lernen, mit seinen eigenen Gefühlen umzugehen, waren die Psychiater für uns da. Die Gespräche halfen mir tatsächlich, auch wenn ich mich anfangs dagegen sträubte. Arvid, so hieß mein Betreuer, war sehr einfühlsam, ging auf meine Ängste und Zukunftssorgen ein, zeigte mir Wege und Alternativen auf, aber er gab mir auch klar zu verstehen, dass ich mein Leben jetzt – und das Jetzt betonte er sehr laut – in die Hände nehmen und eine Entscheidung treffen müsse. Ich könne entweder so enden wie Kristan, oder auf eine Zukunft setzen, für die es sich zu leben lohne.
Rückblickend ist natürlich Letzteres der einzig richtige Weg, aber zu dieser Erkenntnis muss man als alkohol- oder drogenabhängiger Teenager erstmal kommen.
Nach ein paar Wochen stellte sich bei mir aber tatsächlich eine gewisse Ruhe ein. Ich konnte wieder besser schlafen, dachte nicht mehr so oft an Alkohol oder Drogen, aß wieder regelmäßiger und vor allem sah ich nicht ständig Kristan vor meinem inneren Auge; wenn er auch nicht ganz aus meinen Gedanken verschwand. Allerdings war mir bewusst, dass das wohl nie der Fall sein würde, und vielleicht war das auch gut so.
Glücklicherweise fand der Psychiater acht Wochen nach meiner Einlieferung, dass ich bereit sei, mein Leben außerhalb der Klinik weiterzuleben.
Am letzten Tag kam Arvid auf mein Zimmer, verabschiedete sich, wünschte mir alles Gute und als er schon fast zur Tür hinaus war, drehte er sich nochmals um und sagte mit einem Augenzwinkern: «Hoffentlich sehe ich dich in diesen vier Wänden nicht nochmal.»
Mein Vater holte mich ab und zum ersten Mal seit meiner Kindheit, nahm er mich in eine feste Umarmung. Er wollte gar nicht mehr loslassen und schließlich weinten wir beide. In dem Moment hatte ich das Gefühl, dass eine schwere Last von mir abfiel, und ich war mir sicher, dass es meinem Papa genauso erging.
Als er mich aus seiner Umarmung entließ, schaute er mir eine Weile in die Augen und ich wusste nicht, ob er mir etwas sagen oder mich einfach nur anschauen wollte. Vielleicht suchte er in mir den Jungen, den er großgezogen hatte, den Jungen, der ihn auf seinen Angelausflügen oder mehrtägigen Wanderungen begleitet hatte, den Jungen, der ihm beim Geschichtenerzählen zugehört hatte und hinterher immer noch mehr hören wollte.
Ich wusste nicht, ob dieser Junge noch hier war, oder für immer aus seinem Leben verschwunden war.
Ich wünschte mir, dass er noch hier war, und ich nahm mir vor, nach ihm zu suchen.
Eine Woche später ging ich an die Uni zurück und Normalität kehrte ein. Jedenfalls bis zum Anruf meines Großvaters aus der Schweiz.
Kapitel 2
Opas Anruf erreichte uns an einem Sonntagvormittag während des Frühstücks. Meine Mutter eilte ins Wohnzimmer und hob den Hörer ab. Darauf folgte ein paar Sekunden Stille, bis sie mit freudiger Erregung rief: «Das ist ja eine Überraschung! Hallo Robert.»
Ich muss hier noch erwähnen, dass sie besagten Robert auf Deutsch begrüßte, nicht auf Norwegisch, weshalb ich gleich wusste, wer sich am anderen Ende der Leitung befand: Mein Großvater aus der Schweiz.
Warum das eine Überraschung war?
Nun, mein Großvater und sein Sohn, der mein Vater ist, hatten seit über zehn Jahren kein Wort mehr miteinander gesprochen. Wie es dazu kam, werde ich im Verlaufe meiner Geschichte noch erzählen.
Mein Vater blickte mich in diesem Moment an, als hätte er sich an einem Stück Käse verschluckt, meine zwei Jahre jüngere Schwester Ida blickte Richtung Wohnzimmer und keiner von uns aß weiter. Mutter erschien einen Augenblick später in der Küche, das Telefon in der einen Hand, ihr Gesichtsausdruck eine Mischung aus Ungläubigkeit und Freude. Freude deshalb, weil immer sie es gewesen war, die meinen Papa zu überzeugen versuchte, sich mit seinem Vater zu versöhnen.
Nun rief der entfremdete Vater also an, und keiner am Tisch wusste, wie man damit umgehen sollte.
Mutter presste die Hand an die Sprechmuschel und flüsterte: «Es ist dein Vater, Schatz.» Sie zuckte mit den Schultern, versuchte aus der Miene ihres Ehemannes herauszulesen, ob er den Anruf entgegennehmen wollte oder nicht. Er aber saß nur da, den Mund voll mit Frühstückscerealien, und hob hilflos die Schultern. Dann schluckte er – nein, würgte – die Flocken hinunter, spülte einen Schluck Kaffee nach und griff nach dem Telefon. Mit dem Hörer in der Hand verließ er die Küche und ging ins Wohnzimmer. Ich wollte gleich hinterher, aber meine Mutter hielt mich zurück und befahl mir mit Zeichensprache, mich wieder auf meinen Hintern zu setzen.
Ich blieb widerwillig sitzen und versuchte, etwas von der Konversation zwischen Papa und meinem Großvater mitzukriegen, was leider durch das Schließen der Wohnzimmertür verunmöglicht wurde. Meine Mutter, Ida und ich schauten uns verunsichert an, keiner aß weiter. Ich schob den Teller von mir weg und lehnte mich zurück.
«Bist du schon fertig?», fragte Mutter flüsternd.
Ich nickte.
«Du musst essen.»
«Ich habe aber keinen Hunger.»
«Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.»
Hätte ich für diesen Kommentar jedes Mal zehn Kronen erhalten, wäre ich jetzt reich. Natürlich hatte sie recht, und eigentlich wünschte ich mir, dass ich morgens etwas hungriger wäre. Aber so war es nun mal nicht. Nicht mal in der Entzugsklinik hatte sich das verändert.
Das Gespräch zwischen Papa und meinem Großvater dauerte fast dreißig Minuten. Ich war gerade dabei, das Geschirr in die Spüle zu stellen, Ida blätterte in einer Zeitschrift und Mutter strickte, als Papa zurück in die Küche kam, sich ächzend hinsetzte und uns der Reihe nach anschaute.
«Das hätte ich jetzt am allerwenigstens erwartet», sagte er, Müdigkeit in seinem Blick.
Der Anruf hatte ihn wohl etwas mitgenommen, dachte ich.
Er nahm einen Schluck seines inzwischen kalt gewordenen Kaffees.
«Ich auch nicht», pflichtete ihm meine Mutter bei. «Was wollte er denn?»
Er zuckte mit den Schultern. «Tja, er sagte, dass er in letzter Zeit sehr viel über die Vergangenheit nachgedacht habe und Reue empfinde, für das, was alles passiert sei. Er werde nicht jünger und wolle nicht sterben, ohne sich mit mir versöhnt und Zeit mit den Enkelkindern verbracht zu haben.»
Mama zog die Augenbrauen hoch, erwiderte aber nichts darauf.
«Ich finde das eine prima Idee», warf Ida ein. «Die Familie sollte endlich wieder zusammenfinden, dann könnten wir alle gemeinsam Weihnachten feiern. Das wünsche ich mir schon lange.»
Weihnachten bedeutete meiner Schwester alles. Ihr Zimmer sah in der Weihnachtszeit aus, als beherberge sie die Werkstatt des Nikolauses.
Papa nickte, lehnte sich nach vorne und formte mit seinen Händen einen Trichter vor dem Gesicht. Mama, Ida und ich sahen uns an.
«Sein Anruf hat mich jetzt etwas durcheinandergebracht», murmelte Papa leise.
Mama legte ihm die Hand auf den Arm. «Was hat er denn noch gesagt?»
Papa lehnte sich wieder zurück und verschränkte die Arme vor der Brust. «Nun, Opa erkundigte sich vor allem über euch beide. Er wollte wissen, wie es euch geht und was ihr tut.»
Er warf mir einen verlegenen Seitenblick zu und ich wusste, dass er Opa von meinen Ausrutschern erzählt hat.
Ich nickte etwas betreten, wusste aber gleichzeitig, dass diese unrühmliche Vergangenheit von nun an zu meinem Leben dazugehörte und es würde auch nicht das letzte Mal sein, wo diese Vergangenheit zur Sprache kommen würde. Ich konnte das entweder akzeptieren oder mich jedes Mal darüber ärgern. Letzteres war allerdings für mich keine Option. «Schon okay», erwiderte ich, «er darf es ruhig wissen.»
Papa tätschelte mir den Arm. «Opa meinte, dass du ihn in der Schweiz besuchen solltest. Er brauche Hilfe mit dem Haus und seinen Tieren.»
Ich machte große Augen. «Meinst du das ernst?»
Er nickte.
«Und ich?», rief Ida dazwischen.
«Du natürlich auch», antwortete Papa. «Aber es wäre in zwei Wochen und du hast Schule. William könnte nach den Herbstferien der Uni noch eine Woche fernbleiben.»
Ida machte ein enttäuschtes Gesicht.
«Du wirst auch gehen können, in deinen Ferien, ich verspreche es dir», sagte Papa und wandte sich wieder an mich. «Was meinst du? Wäre das was?»
Ich zögerte mit der Antwort. Das kam alles ein bisschen plötzlich. Ich kannte Opa nicht einmal, und jetzt sollte ich zu ihm in die Ferien fahren?
Ich war zwar schon in der Schweiz in den Ferien gewesen, aber da war ich gerade mal sechs Jahre alt und konnte mich an nichts mehr erinnern. Ich wusste also nicht, was mich dort erwarten würde. Mein Vater hatte uns nie viel über Opa erzählt, weder wo er wohnte noch wie es dort aussah. Ich hatte also kein Bild vor mir, ich konnte es mir nur in meiner Fantasie ausmalen.
Zudem fragte ich mich, ob mir eine solche Reise zum jetzigen Zeitpunkt guttun würde. Ich war jetzt eigentlich bereit, zurück an die Uni zu gehen, hatte mich auch schon darauf eingestellt, und jetzt würde sich dieser Plan ändern. Und das war etwas, was mir der Psychologe in der Entzugsklinik immer wieder nahegelegt hat; ich müsse einen Plan haben und mich danach richten.
Also, was würde ich verpassen? Eine Woche Uni. Das kann ich nachholen. Auch wenn ich schon einiges verpasst habe, ich war zuversichtlich, dass ich es auf die Reihe bringen werde.
«William?» Papa wedelte mit der Hand vor meinem Gesicht herum. «Bist du noch da?»
«Ja, entschuldige. Ich habe nur über Opas Vorschlag nachgedacht.»
«Und?»
Ich ließ nochmals ein paar Sekunden verstreichen, dann sagte ich: «Ich denke, dass ich Opas Einladung annehme.»
Kapitel 3
Schweiz, Oktober 2019
Der Flug von Tromsø nach Zürich, mit Umsteigen in Oslo, dauerte fast den ganzen Tag. Der Flieger aus Tromsø hatte Verspätung, weshalb ich den Anschlussflug nach Zürich verpasste und auf eine spätere Verbindung warten musste. Und als wäre das nicht schon mühsam genug, saß auf dem Flug von Oslo nach Zürich eine junge Asiatin neben mir, die nichts Besseres wusste, als mitten im Flug Dörrfisch auszupacken und den Flieger in einen Fischladen zu verwandeln.
Ja, es mag jetzt komisch klingen, aber es gibt tatsächlich Norweger, die keinen Fisch essen.
Ich bin einer von ihnen.
Als ich in Zürich aus dem Flugzeug stieg, hatte ich das Gefühl, ich müsse in den nächsten Kleiderladen rennen und mir neue Kleidung besorgen. Ständig hatte ich diesen penetranten Fischgeruch in der Nase und ich wusste nicht, ob er von den Kleidern herrührte, oder ob er sich in meinen Nasenhärchen festgesetzt hatte. Ich setzte auf Letzteres.
Mein Opa wartete nicht in Zürich auf mich. Am Telefon sagte er: «Ich will nicht durch diesen ganzen verdammten Verkehr fahren, das sei eine verfluchte Tortur und es würde immer schlimmer werden auf den Schweizer Straßen.»
Also nahm ich den Zug, was für mich in etwa so exotisch war, wie Strandferien für Inuits. Ich war noch nie in meinem Leben in einem Zug gesessen. Es gab zwar Züge in Norwegen, nicht aber bei uns oben. Der nächste Bahnhof befand sich in Narvik und das war mindestens drei Autostunden von Tromsø entfernt.
Die Fahrt vom Flughafen nach Solothurn dauerte etwas mehr als eine Stunde. Um mir die Zeit zu vertreiben, las ich in meinem Detektivroman, den ich extra für die Reise gekauft hatte. Das Lesen war in den letzten Jahren etwas zu kurz gekommen. Bevor ich meine pubertierenden Ausschweifungen gestartet hatte, las ich fast täglich. Meistens Detektivgeschichten oder Kriminalromane, hin und wieder auch einen historischen Roman. Kriminalromane sagten mir jedoch mehr zu, ich fand die Ermittlungen in den Todesfällen immer äußerst interessant und ich machte mir beim Lesen sogar Notizen, um noch vor dem Ende des Buches den Mörder unter den Verdächtigen herauszufinden. Allerdings muss man dazu sagen, dass die Autoren wohl die entscheidenden Indizien oft absichtlich nicht erwähnten, damit niemand von sich aus auf die Lösung kommen konnte.
Es gab eine Zeit – ich glaube, ich war damals um die dreizehn Jahre alt –, da wollte ich Polizist werden. Ich hatte mich bei meinem Lehrer bereits erkundigt, was es dafür alles brauche und er arrangierte daraufhin tatsächlich einen Besuch auf der Wache in Tromsø. Möglich war dies aber nur, weil der Bruder seiner Ehefrau als Kriminalbeamter dort tätig war. Die paar Stunden auf der Wache hatten mir imponiert und mich in meinem Bestreben, diesen Beruf in Zukunft ausüben zu wollen, bestärkt. Aber wie das Leben oft spielt, ändern sich Pläne manchmal über Nacht. Und so war es auch bei mir gewesen. Da mein Vater als Ingenieur gutes Geld verdiente, dachte ich, dass dies wohl die bessere Berufswahl wäre, zumal auch die Arbeitszeiten geregelter wären und ich an den Wochenenden meistens in den Bergen unterwegs war, und darauf wollte ich nicht verzichten.
Nach einer halben Stunde ließ meine Konzentration nach und ich wurde müde. Ich legte die Lektüre beiseite und schaute aus dem Zugsfenster. In Gedanken rief ich mir Großvaters Bild vor Augen. Ich konnte mich an sein Aussehen nicht mehr so richtig erinnern. Ich hatte ihn zuhause auf ein paar Fotos gesehen, aber erstens waren es ältere Aufnahmen und zweitens hatte ich ihn noch nie persönlich getroffen. Glücklicherweise hatte mein Vater mit uns immer nur Deutsch gesprochen, so konnte ich mich wenigstens mit Opa unterhalten. Er hingegen sprach kein Wort Norwegisch – warum auch.
Mit dreiundzwanzig Jahren war mein Vater auf einer Norwegenreise meiner Mutter begegnet und nach einem Jahr Fernbeziehung zu ihr nach Tromsø gezogen. Warum mein Vater zu meinem Opa keine Beziehung mehr pflegte, wusste ich nicht – oder nicht genau, um präziser zu sein. Vater hatte nie darüber sprechen wollen und meine Mutter sagte mir und meiner Schwester immer, wir sollen ihn nicht danach fragen. Und daran hielten wir uns auch heute noch.
Was ich noch erwähnen sollte, ist, dass meine Mutter nicht meine leibliche Mutter ist. Diese hatte sich, als ich gerade mal sechs Jahre alt war, das Leben genommen. Sie war von einer Brücke ins Meer gesprungen. Zuhause fand mein Vater einen Abschiedsbrief, den ich aber nie zu Gesicht bekommen habe. Ida und ich wussten nur, dass unsere Mutter an einer schweren Depression gelitten und sich nie davon erholt hat. Ida konnte sich nicht mal mehr an sie erinnern, sie war bei ihrem Tode noch viel zu klein gewesen. Auch ich hatte nur noch bruchstückhafte Bilder in meinen Kopf, die, wenn ich sie aufrufen wollte, nur wie verblassende Traumfetzen vor meinem inneren Auge erschienen.
Etwas mehr als zwei Jahre nach Mutters Tod, brachte Vater eine neue Frau in unser Leben. Ingrid heißt sie, und sie übernahm die Rolle unserer Mutter. Für meine Schwester war sie immer wie die leibliche Mutter gewesen, für mich mehrheitlich auch, dennoch spürte ich immer, dass da noch etwas anderes in meinem Herzen war, ein leerer Platz, den ich nicht zu füllen vermag.
In der Ferne tauchte eine langgezogene, dunkelblau schimmernde Bergkette auf. Die Flanken waren dicht bewaldet, hin und wieder entdeckte ich ein Haus oder eine kleine Siedlung, und je weiter wir gegen Westen fuhren, desto höher wurden die Gipfel der Bergkette. Wenig später verkündete eine blecherne Stimme, dass wir uns dem Ort Solothurn näherten. Ich spürte eine Anspannung in mir aufsteigen, der Herzschlag wurde schneller, ebenso die Atmung. Ich war nervös und wusste nicht so recht, was mich erwarten würde. Mein Vater hatte mir zwar nach dem Telefongespräch die eine oder andere Geschichte über Opa erzählt, aber das war auch schon alles, was mich mit ihm in Verbindung brachte. Ich konnte ihn mir nicht vorstellen, wusste nicht, was für ein Mensch er war. War er grob, einsilbig und zurückhaltend, oder war er freundlich, offen und zuvorkommend. Am Telefon machte er auf mich einen sehr sympathischen Eindruck, aber wir hatten nur kurz miteinander gesprochen und es war schwierig, sich nach so kurzer Zeit schon ein Bild zu machen.
Jedenfalls wollte er, dass ich ihm beim Bau eines neuen Hühnerhauses helfe. Er habe auch einen kleinen Eierhandel, was hieße, dass wir frühmorgens aufstehen müssen, um die Eier einzusammeln und in dem dafür vorgesehenen, kleinen Verkaufsstand zu deponieren.
Ich war nicht sonderlich erpicht darauf, jeden Tag in aller Herrgottsfrühe aufzustehen, aber es blieb mir wohl nichts anderes übrig. Das gehörte wohl zu meiner Rehabilitierung dazu, Struktur und dessen konsequente Einhaltung. Auch das hatte mir der Psychologe gesteckt.
Als der Zug im Bahnhof von Solothurn zum Stillstand kam, sammelte ich mein Gepäck zusammen, ging zum Ausgang und trat auf den Bahnsteig hinaus. Kühle Luft schlug mir entgegen und ich freute mich darüber. Seit heute Morgen atmete ich nur gesiebte Luft ein. Ich nahm einen tiefen Atemzug und schaute mich nach einem bekannten Gesicht um, konnte aber niemanden erkennen. Ich wartete einen Moment, bis die meisten Passagiere verschwunden waren und der Zug den Bahnhof verließ. Als der letzte Wagen an mir vorbeirauschte, fand ich mich allein auf dem Bahnsteig wieder.
Na toll, und was jetzt?
Ich nahm meinen Koffer und zog ihn zu einer Rampe, die in den Untergrund führte. Am Ende der Rampe entdeckte ich einen älteren Mann, der sich hilflos nach allen Seiten umsah. Er hatte schütteres, graues Haar, einen leichten Bart, trug eine braune Jacke und schwarze Hosen. Er beobachtete die vorbeigehenden Zugpassagiere, tippte dabei unablässig mit dem Zeigefinger an die Lippe und wirkte irgendwie nervös.
War er das?
Ich versuchte sein Bild aus dem Fotoalbum heraufzubeschwören und war mir danach ziemlich sicher, dass er es sein musste. Zögernd ging ich auf ihn zu und da schien auch er mich wahrzunehmen.
«William?» fragte er vorsichtig.
Lächelnd blieb ich vor ihm stehen und stellte meinen Koffer ab. Auf dem Weg hierher hatte ich die Begegnung mit ihm immer und immer wieder im Kopf durchgespielt. Ich hatte keine Ahnung, wie ich ihn begrüßen sollte. Schüttelte ich ihm die Hand, umarmte ich ihn, oder tat ich gar nichts?
Bevor ich etwas in die Tat umsetzen konnte, umarmte Opa mich. Ich erwiderte die herzliche Begrüßung und versuchte dabei das Gefühl, als würde ich einen fremden Menschen umarmen, zu verdrängen. In Wahrheit war er kein fremder Mensch, er war in meinem Kopf immer präsent gewesen, jedoch viel mehr wie ein Geist aus einem wiederkehrenden Traum als eine richtige Person. Jemanden, den man weder anfassen noch sehen konnte. Ich wusste von ihm eigentlich nur, dass er Robert Hartmann hieß, allein mit ein paar Hühnern lebte und neunundsechzig Jahre alt war.
«Du bist ja gleich groß wie ich», sagte er mit kratziger Stimme und schickte einen kleinen Hustenanfall hinterher. Ich nahm Zigarettengeruch bei ihm wahr, was die heisere Stimme und den Husten erklärte.
«Hattest du eine angenehme Reise?», erkundigte er sich.
«Danke, ja. Etwas Verspätung in Oslo, aber ansonsten hat alles geklappt. Ich gehe davon aus, dass Papa dich über die Verspätung informiert hat?»
«Hat er, hat er. Ich kanns kaum glauben, dass du hier bist, mein Junge.»
«Geht mir genau so, Opa.»
«Na komm, lass uns zum Wagen gehen und nach Hause fahren.»
Er nahm meinen Koffer und ging voraus, über eine weitere Rampe, vorbei an einem Lebensmittelladen. Dahinter tauchte ein großer Parkplatz auf. Vor einem grauen, alt aussehenden Renault blieb er stehen. Er steckte den Schlüssel ins Türschloss und öffnete die Zentralverriegelung. Ich musste schmunzeln. Ich hatte schon lange kein Auto mehr gesehen, bei dem die Verriegelung noch mittels Türschloss funktionierte.
«Steig ein», forderte Opa mich auf und ich nahm auf dem Beifahrersitz Platz. Als er sich mit einem lauten Ächzen hinter dem Steuer fallen ließ, blickte ich ihn von der Seite an. Er setzte eine dunkelbraune Brille auf, startete den Motor und fuhr rückwärts aus dem Parkplatz heraus. Ich versuchte sein jetziges Aussehen mit demjenigen aus dem Fotoalbum zu vergleichen. Er war definitiv älter geworden, was sich aber nicht an den Falten im Gesicht zeigte, sondern eher an seinem Blick. Seine Augen wirkten müde und lagen tief in ihren Höhlen. Er hatte ein schwaches Lächeln im Gesicht, gleichzeitig schien er angespannt, was ich ihm nachempfinden konnte, mir erging es schließlich nicht anders.
Ein paar Minuten später fuhren wir über eine Brücke, die über einen dunklen Fluss führte, dessen Ufer von Bäumen gesäumt war. Auf der linken Seite ragte ein großer Kirchturm mit grünem Dach in den Himmel. Auf der Spitze glänzte eine goldene Kugel.
Mir fielen noch drei weitere Brücken auf und ich wunderte mich, warum es auf so kurzer Distanz so viele Brücken gab.
«Das ist meine Stadt», sagte Opa plötzlich und zeigte auf die Häuser, die sich rings um den Kirchturm aufreihten.
Mein Vater hatte uns Bilder von seiner Geburtsstadt gezeigt. Aber wie es sich mit allen Fotos verhält, werden sie den tatsächlichen Gegebenheiten nie gerecht. Die Architektur hier unterschied sich wesentlich von dem, was ich aus Norwegen gewohnt war. Die Häuser hier sahen richtig alt aus. Nicht auf alt gemacht, sondern wirklich alt. Aus der Ferne war es schwierig, Details erkennen zu können, aber ich war sicher, dass Opa mir während meines Aufenthaltes das eine oder andere zeigen würde.
Inzwischen war es siebzehn Uhr und die Dämmerung setzte ein. Wir passierten einen merkwürdigen Kreisverkehr. Merkwürdig deshalb, weil mitten hindurch Eisenbahnschienen führten. So etwas hatte ich noch nie gesehen und fragte mich, ob es hier nie zu Kollisionen zwischen Zug und Autos kam. Aber gut; andere Länder, andere Sitten.
Etwas später fuhren wir einer langen Mauer entlang, was dahinter lag, entzog sich meiner Kenntnis, weshalb ich mich bei Opa danach erkundigte.
«Ein Kloster», antwortete er. «Davon haben wir in unserer Stadt einige zu bieten. Die haben wunderschöne Gärten und Parks hinter ihren dicken Mauern. Die kriegt aber kaum jemand zu Gesicht. Eine Schande, wenn du mich fragst.»
«Warum sieht die niemand?»
«Die wollen für sich sein, die Mönche und die Nonnen. Man könnte meinen, die hätten etwas zu verbergen.»
«So was haben wir bei uns oben nicht.», fügte ich an.
«Aber Kirchen habt ihr?»
«Die schon. Aber die sehen auch anders aus als eure.»
Nach der Klostermauer bogen wir rechts ab, bis Opa einige hundert Meter weiter seinen Wagen in eine schmale Schotterstraße lenkte und vor einem kleinen Haus anhielt.
«So, da wären wir», sagte er und stieg aus.
Ich öffnete die Tür und noch bevor ich mir Opas Haus anschaute, fiel mir die Villa auf dem Nachbarsgrundstück auf. Sie war riesig, wodurch Opas Haus wie ein Spielzeughaus wirkte. Die Villa hatte auf allen Seiten unzählige Fenster in verschiedenen Größen, auch runde und ovale, Fenster mit Sprossen und solche die vergittert waren. Auf der uns zugewandten Seite verfügte das Haus über ein Türmchen mit grauem Kegeldach, auf dessen Spitze eine Eisenstange in den Himmel ragte. Am höchsten Punkt befand sich die Imitation eines großen schwarzen Vogels.
Das Haus hatte drei Balkone und eine große Terrasse, die einen weitauslaufenden Garten überragte. Die Fassade der Villa war an vielen Stellen von Efeuranken überwuchert, und dort wo sie nicht hinreichten, blätterte teilweise die Farbe ab. Auf dem Dach fielen mir ein paar Krähen ins Auge. Licht brannte nur in einem der Zimmer, die restlichen lagen in völliger Dunkelheit. Im Dämmerlicht wirkte das Haus wie aus einem Gruselfilm.
«Was für eine Villa», sagte ich, mehr zu mir selbst als zu Opa.
Opa kam um den Wagen herum und blieb neben mir stehen. «Gehört einem reichen Industriellen. Hat mit Metall seinen Reichtum erwirtschaftet. Komische Leute.»
Ich schaute ihn an. «Wieso komisch?»
«Erzähle ich dir später. Komm, wir gehen rein.»
Opas Haus war aus Holz gefertigt, so wie ich es von zuhause gewohnt war, nur war es nicht farbig, sondern naturbraun. Die Fenster waren weiß, überall blätterte die Farbe ab, so dass an vielen Stellen das braune Holz zum Vorschein kam. An den grünlichen Fensterläden fehlten viele der Sprossen, einige waren abgebrochen und nicht ersetzt worden. Auch die Holzfassade hätte dringend einen neuen Anstrich nötig, allerdings passte sie so perfekt zum Rest des Hauses.
Ich hatte ein wenig Bedenken, wie es drinnen aussehen würde. Arvid, mein Betreuer in der Entzugsklinik, hatte mir an einem Abend, als wir draußen auf einer Bank saßen und über das Leben philosophierten, gesagt: «Beurteile den Menschen nie anhand seiner Fassade».
Ein Spruch, den ich damals nicht zum ersten Mal gehört hatte, aber auf viele Menschen, die ich in meinem bisherigen Leben getroffen hatte, vollends zutraf.
Opas Garten war groß und hätte eigentlich ein schönes Bild abgeben können, hätte sich ein Gärtner dem Unkraut gewidmet und Büsche und Bäume getrimmt. So aber sah es aus, als würde Opa der Natur freien Lauf lassen. Vielleicht war das ja auch gut so. Ich hatte von Gärten sowieso keine Ahnung. Gartenarbeit war bei uns im Norden kein großes Thema. Die meiste Zeit war es zu kalt, um schöne Blumen wachsen zu lassen.
Auf der linken Seite des Gartens gab es ein abgestuftes Steinbord, auch dort wucherte Unkraut. In der Mitte führte ein mit Steinen ausgelegtes Bachbett von ganz oben bis in einen ausgetrockneten Teich, welcher kaum noch als solcher zu erkennen war. Gleich dahinter stand ein baufälliger Hühnerstall. Das Dach war auf der einen Seite eingebrochen und wartete wohl auf eine Reparatur. In der Einfahrt stand ein Schuppen, an dessen Außenwand ein Schild mit den Worten: Eier -.60 Rappen das Stück, befestigt war.
«Mein Vorgänger hatte sich hier eine Gartenoase geschaffen», sagte Opa und betrachtete seinen Garten. «Der hätte es mit Versailles aufnehmen können. Als ich das Haus übernahm, war davon jedoch nichts mehr zu erkennen. Von der Besichtigung bis zum Einzug verging ein halbes Jahr, in dem er alles hatte überwuchern lassen. Ich dachte, mich trifft der Schlag, als ich in die Einfahrt fuhr, um den Schlüssel entgegenzunehmen. Der Verkäufer verlor jedoch kein Wort über diese Wildnis und ich hatte mich nicht dafür, ihn darauf anzusprechen.»
«Wolltest du denn den Garten nicht wieder in seinen ursprünglichen Prunk zurückführen?»
Er schüttelte den Kopf. «Wollen und Können sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Für ein solches Projekt braucht es einen Gärtner und der kostet ein Vermögen. Also habe ich es der Natur überlassen. Die weiß schon, was sie tut.»
«Sieht nach einem Haufen Arbeit aus», bestätigte ich.
Opa zuckte mit den Achseln, schnappte sich meinen Koffer und führte mich zur Eingangstür. «Komm rein», sagte er und ließ mich eintreten. Vor mir erstreckte sich ein langer Flur, auf dessen linker Seite zwei Türen in andere Räume führten. Am Ende des Flurs erkannte ich die Küche.
«Du hast bestimmt Durst», meinte Opa und ging voraus. Ich folgte ihm in eine spartanisch eingerichtete Küche. Es gab einen grünen Holztisch, zwei Stühle, eine Anrichte, eine Kochnische und einen Kühlschrank. Ein paar Bilder hingen an den Wänden, auf einem entdeckte ich meinen Vater in jüngeren Jahren auf einem anderen waren Ida und ich als Babys. Nebst den Familienfotos gab es aber auch Bilder – oder besser gesagt Zeichnungen von einer altertümlichen Stadt, die ich als Solothurn wiedererkannte. Ähnliche Bilder waren mir auch im Flur aufgefallen. Opa schien eine Unmenge davon zu besitzen.
«Gefallen sie dir?», fragte er.
Ich nickte.
«Das sind Stiche, wie man sie hier nennt. Alte Zeichnungen unserer schönen Stadt, als die Moderne noch nicht Einzug gehalten hat und die Menschen noch einen Verstand besaßen.»
Ich schaute ihn stirnrunzelnd an, weil ich nicht wusste, was er damit meinte.
«Schau hier, zum Beispiel: Das ist der Blick auf die Stadt aus südlicher Richtung. Siehst du die Kutschen, die Pferde, die Wiesen und die Bäume? Heute stehen dort architektonische Sünden aus Metall und Glas, Flachdachbauten und künstlerische Skulpturen, bei denen niemand weiß, was sie darstellen sollen.» Er schüttelte den Kopf. «Und schau dir mal die Leute an: elegant gekleidet, die Frauen mit langen Röcken und Hüten, die Männer mit Gehstock und Hut. Das hatte noch Klasse. Heute ziehen sich Männer wie Frauen an und umgekehrt. Es ist eine Schande. Aber vielleicht bin ich einfach zu alt, um eure Generation zu verstehen.»
Ich musste lachen, konnte ihm aber nicht widersprechen.
«Ich zeige dir jetzt dein Zimmer, dann kannst du dich häuslich einrichten und ausruhen. Währenddessen koch ich uns was. Hört sich das gut an?»
«Fantastisch», antworte ich und folgte ihm zurück in den Flur. In der Mitte führte eine Holztreppe in den oberen Stock.
«Geh nach oben, zweite Tür links. Ich bringe dir deinen Koffer.»
«Lass doch, Opa, den kann ich selbst hinauftragen.»
«Nichts da. Ich bin zwar alt, aber Kraft habe ich noch. Nun geh schon.»
Etwas widerstrebend stieg ich die knarrenden Stufen nach oben und schaute mich um. Es gab drei Zimmer. Bis auf eines waren sämtliche Türen geschlossen. Ich folgte Opas Anweisung und betrat das zweite Zimmer auf der linken Seite. Es bestand aus einem Bett, einer verschnörkelten Kommode, einem braunen, alten Holzschrank und einem kleinen Schreibtisch. Es roch muffig und ich öffnete als erstes das Fenster. Das Zimmer war gegen den Garten hin ausgerichtet. Gleich dahinter befand sich die Straße und noch etwas weiter hinten führte eine von Bäumen gesäumte Allee in südliche Richtung.
Ich warf einen Blick auf den Nachbarsgarten. Allzu viel konnte man nicht erkennen. Eine große Eiche in der Mitte des Anwesens überdeckte einen Großteil des Rasens. Ich konnte jedoch einige Skulpturen ausmachen, die von kleinen Scheinwerfern beleuchtet wurden und jetzt, im immer mehr schwindenden Tageslicht unheimlich wirkten. Aus der Ferne war es schwer zu sagen, was genau sie darstellen sollten. Einige sahen aus wie Menschen, allerdings waren teilweise die Gesichter abgebröckelt, so dass sie eine schon fast dämonische Ausdrucksweise erhielten. Manche waren von Efeu überzogen auch dort erkannte man die genaue Bestimmung der Skulptur nur noch vage. Auf einer Steinbank in der Nähe der Eiche saß eine Krähe, den Kopf starr in Richtung Haus gerichtet.
Das ganze Anwesen machte auf mich einen traurigen, vergessenen Eindruck. Eine Herrschaftsvilla aus längst vergangenen Zeiten, die mit der Moderne nicht mehr mithalten konnte.
In dem Moment nahm ich eine Bewegung im Garten wahr. Ein alter Mann mit weißem, wallendem Haar, fuhr in einem Rollstuhl über einen gepflasterten Pfad auf die Eiche zu. Unmittelbar vor dem Baum hielt er an, betätigte die Bremse und blickte nach oben in die Baumkrone. Einen Moment verharrte er in dieser Position und dann vernahm ich ein leises Murmeln. Ich konnte nicht verstehen, was er sagte, aber es hörte sich an, als würde er zu jemandem sprechen. Ich suchte den Garten nach anderen Personen ab, konnte aber niemanden entdecken.
Ob das der Industrielle war, von dem Opa erzählt hatte?
Eine Krähe flog wild flatternd und mit lautem Gekrächze auf einen Ast in der Eiche und blickte auf den Mann herunter. Eine Weile beobachtete ich die skurrile Szene und überlegte schon, ob ich es mit meinem Handy filmen sollte, ließ es aber bleiben.
Eine zweite Krähe kam angeflogen, setzte sich auf einen anderen Ast und blickte ebenfalls zu dem Mann im Rollstuhl. Dieser murmelte weiter vor sich hin, senkte dann aber den Kopf und verstummte. Die Sekunden verstrichen, in denen ich wie gebannt in diesen verwunschenen Garten starrte und nicht deuten konnte, was ich da soeben beobachtete. Ich hielt sogar den Atem an, warum, wusste ich auch nicht. Der Alte konnte mich hier oben sowieso nicht atmen hören.
Die Sekunden verstrichen, und auf einmal drehte der Mann seinen Kopf und blickte mir direkt in die Augen. Ich erschrak dermaßen, dass ich einen Satz auf die Seite machte und mich hinter dem Vorhang versteckte.
Was zum Teufel tat ich hier überhaupt?
Ich kam mir plötzlich äußerst lächerlich vor. Ich wartete einen Moment, beugte mich dann ein wenig nach vorne und schaute aus dem Fenster.
Der Mann war verschwunden.
Kapitel 4
Eine Stunde später, nachdem ich meinen Koffer ausgepackt, eine Dusche genommen und dabei geflucht hatte, weil der Duschkopf kaputt war und nur noch ein Rinnsal daraus hervorrieselte, begab ich mich nach unten in die Küche. Der Duft von Essen stieg mir in die Nase und ich merkte, wie hungrig ich war. Ich hatte seit Stunden nichts mehr gegessen.
«Ach, da bist du ja. Na, wie war die Dusche?», fragte Opa und hantierte mit einer Pfanne herum.
«Herrlich. Aber der Duschkopf ist nicht mehr der neuste, oder?»
«Ich weiß, tut mir leid. Ich wollte schon lange einen Neuen kaufen, vergesse es aber immer wieder. Wenn du willst, kannst du diese Aufgabe übernehmen.»
«Gerne.»
«Hast du Hunger?»
«Und wie.»
«Wunderbar. Setz dich.»
Ich nahm auf einem der beiden Stühle Platz und beobachtete Opa, wie er das Essen zubereitete. Ich musterte seine Kleidung und musste schmunzeln. Er war amüsant gekleidet; trug jetzt braune Manchesterhosen, dazu eine hellgelbe, gestrickte Weste und darunter einen grasgrünen Pullover. Auf seinem Kopf befanden sich fast keine Haare mehr, nur auf den Seiten und hintenrum, und er hatte auffällig große Ohren. Vielleicht wirkten sie aber auch nur groß, weil sein Schädel fast kahl war. Ich suchte nach Ähnlichkeiten mit Papa. Die Nase war an deren Ende etwas nach oben gebogen, genau wie bei Papa auch die eher rundliche Gesichtsform passte. Opa war allerdings kleiner als Papa, ob er geschrumpft war oder schon immer kleiner gewesen war, wusste ich nicht.
«So, wir können essen!», rief Opa plötzlich, drehte sich um und kam mit einer Pfanne an den Tisch. «Rösti mit Kalbsbratwurst. Das kriegst du bei euch oben nicht serviert, was?»
«Mein Vater kochte uns das mal, ist aber schon eine Weile her.»
«Dann wird’s höchste Zeit. Schließlich musst du wissen, wo deine Wurzeln liegen, und das hier ist ein typisch schweizerisches Gericht.»
Ich konnte es kaum abwarten und schlang das Essen regelrecht in mich hinein. Ich erinnerte mich vage an den Geschmack vom letzten Mal, Opas Zubereitung fand ich allerdings besser.
Opa schien ebenfalls hungrig zu sein, er aß, als gäbe es kein morgen. In den ersten Minuten sprachen wir kein Wort. Ob das daran lag, dass wir die Mäuler voll hatten oder weil wir beide gerade nicht wussten, über was wir als nächstes reden sollten, konnte ich nicht sagen. Nach einer Weile jedoch lehnte Opa sich mit einem veritablen Rülpser nach hinten und hielt sich den Bauch. Er betrachtete mich einen Moment lang, dann wollte er wissen, wie es mir in dem Kühlschrank, den ich Heimat nennen würde, denn so erginge.
Ich wusste, dass mein Vater ihm von meinen Eskapaden erzählt hatte, aber ich war nicht sicher, wieviel Opa tatsächlich wusste. Also fragte ich ihn, wieviel Papa ihm anvertraut hatte.
Er gab mir nicht gleich eine Antwort, sondern schaute mich einige Sekunden nachdenklich an. Dabei buhlte er mit der Zunge Essensreste aus den Zähnen. Dann beugte er sich nach vorne und meinte: «Es spielt keine Rolle, was ich weiß und was nicht. Ich will es von dir hören.»
Ich legte Messer und Gabel nieder und putzte mir mit einer Serviette den Mund ab. «Nun ja, ich weiß nicht so recht, wo ich anfangen soll.»
Opa zuckte mit den Schultern. «Egal. Erzähl einfach aus deinem Leben.»
Ich nickte, schluckte den letzten Bissen des Nachtessens herunter und folgte Opas Aufforderung. Ich erzählte ihm, dass ich mich nach der Schule fürs Ingenieurwesen interessierte, nicht zuletzt, weil Papa auch Ingenieur war, und deshalb an der Uni in diesem Bereich zu studieren begann. Ich erzählte ihm, dass meine Freunde mir leider nicht an die Uni folgten, sondern Berufslehren starteten, dabei mit dem Trinken anfingen und mich dummerweise mit hineingezogen haben. Ich sei blöd genug gewesen und habe mitgemacht. Eine Weile sei alles gut gegangen, dann aber hätten zwei Ereignisse mich noch mehr aus der Bahn geworfen und mich schliesslich in eine Entzugsklinik geführt.
Opa hatte während meiner Erzählung kein Wort gesagt, nur zugehört, hin und wieder genickt, und als ich fertig war, lehnte er sich zurück und fragte: «Waren die Wochen in der Klinik hart für dich?»
«Am Anfang schon. Ich fühlte mich dort nicht wohl. Ich meine, ich hatte zuvor zwar Drogen genommen, aber in der Klinik gab es Leute, die aussahen, als wären sie kurz vor dem Tod. Blass und abgemagert, depressiv und schlecht gelaunt. Ich passte nicht dort hin, ich fühlte mich nicht wie einer von ihnen. Und doch war ich dort, also musste ich einer von ihnen sein. Das war schwer zu akzeptieren.»
Opa nickte. «Kann ich mir vorstellen. Aber es hat dir geholfen ...»
«Ja, das hat es.»
«Und wie geht es dir jetzt?»
Ich zuckte mit den Schultern. «Ganz gut, glaube ich.»
Er zog die Augenbrauen hoch. «Glaubst du? Oder weißt du es.»
Ich dachte einen Moment nach, bevor ich antwortete. «Ich weiß es.»
Er genehmigte sich einen Schluck Wein, und bevor er das Glas zurück auf den Tisch stellte, wurden seine Augen auf einmal groß und er verschluckte sich. Nach dem Hustenanfall schaute er mich mit hochrotem Kopf an und sagte: «Ich bin ein verdammter Vollidiot. Wir reden über deine Entziehungskur und ich trinke hier genüsslich meinen Wein. Bitte entschuldige.» Er stand auf und leerte den Wein in die Spüle.
«Ach lass doch, Opa. Erstens mag ich keinen Wein und zweitens kann ich von meinem Umfeld nicht verlangen, dass es auf Alkohol verzichtet, nur weil ich mal davon abhängig war.»
«Trotzdem, das war unüberlegt und ich entschuldige mich dafür.»
Ich winkte ab.
Er setzte sich wieder hin und ich wechselte das Thema. «Ich habe vorhin deinen Nachbarn im Garten gesehen.»
«Adalbert?»
Ich zuckte mit den Schultern. «Der alte Mann in dieser Prunkvilla da drüben.»
«Graue, halblange Haare?»
«Genau.»
«Das ist Adalbert. Adalbert Rothenburg. Der Besitzer der Villa. Das Haus hat sogar einen Namen. Krähenhaus nennen sie es.»
«Krähenhaus», wiederholte ich. «Das passt ja. Da flogen überall Krähen herum.»
«Das tun sie immer. Komischerweise sind sie nur auf deren Grundstück. Zu mir oder zu den anderen verirrt sich nie eine. Ganz schön merkwürdig, wenn du mich fragst.»
«Wie lange sitzt Adalbert schon im Rollstuhl?»
Opa dachte einen Moment nach. «Ungefähr drei Jahre, glaube ich.»
«Wohnt er allein in dieser Villa?»
«Nein. Seine Cousine wohnt auch da. Sie heißt Ophelia und ist um einiges jünger als er. Eine sehr unfreundliche Frau. Die grüßt kaum, auch nach all den Jahren nicht, in denen wir nun schon Nachbarn sind. Jedes Mal, wenn ich sie sehe, macht sie ein Gesicht wie sieben Tage Regenwetter. Die muss ständig schlecht gelaunt sein, weiß der Kuckuck warum. Ich habe sie noch nie lachend gesehen, im Gegenteil; ihre Miene lässt vermuten, dass sie das schwerste Leben führen muss. Ein paar Mal versuchte ich mit ihr ins Gespräch zu kommen. Aber sie lässt einen gar nicht heran. Sie läuft einfach davon, so als wäre man Luft.»
«Charmante Persönlichkeit», kommentierte ich.
Opa schmunzelte. «Naja. Wahrscheinlich hat sie kein leichtes Leben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Zusammenleben mit Adalbert einfach ist.»
«Ach ja?»