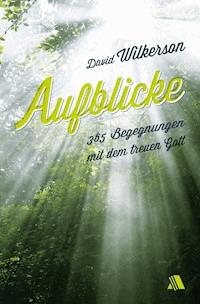Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ASAPH
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
mehr als 30 Millionen Auflage in über 40 Sprachen! Deutsche Auflage über 550.000! Immer noch brisant! Immer noch lesenswert! Bandenkriege, Messerstechereien, Drogenkonsum - mitten in die Szene Brooklyns tritt ein Mann, erzählt leidenschaftlich und unkonventionell von der Liebe Gottes, riskiert dabei sein Leben und löst eine Erweckung unter den jugendlichen Banden aus. Sein Name ist David Wilkerson. Schon 1958 erkannte Wilkerson die Not unter den jugendlichen Rauschgiftsüchtigen und begann ohne fremde Hilfe ein Hilfswerk, das aus bescheidenen Anfängen zu einer weltumspannenden Organisation wurde. Der seinerzeit jugendliche Bandenführer von Brooklyn, "Lord" Nicky Cruz, dessen dramatischer Ausstieg aus der Szene und Hinwendung zu Gott in diesem Buch geschildert wird, [.] Dieses Buch ist eine Herausforderung, eingefahrene Bahnen zu verlassen und im Vertrauen auf die Hilfe Gottes das Neue, das Unmögliche zu wagen, um auf jede Weise die Verlorenen zu retten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 296
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eigentümerhinweis
<##benutzerinformation##>
Impressum
© Copyright 1963 by David Wilkerson. All rights reserved.
© Copyright der deutschen Ausgabe 2014 by Asaph-Verlag
38., leicht korrigierte Auflage 2015
Titel der amerikanischen Originalausgabe: The Cross and the Switchblade
Aus dem Englischen übersetzt von Hildegard Zornow
Umschlaggestaltung: joussenkarliczek, D-Schorndorf (unter Verwendung eines Fotos von: © 35007/istockphoto.com).
Satz/DTP: Jens Wirth
Druck: cpibooks
Printed in the EU
eBook: ISBN 978-3-95459-517-4 (Best.-Nr. 148517)
Print: ISBN 978-3-940188-47-2 (Best.-Nr. 147447)
Für kostenlose Informationen über unser umfangreiches Lieferprogramm
an christlicher Literatur, Musik und vielem mehr wenden Sie sich bitte an:
Asaph, Postfach 2889, D-58478 Lüdenscheid
[email protected] – www.asaph.de
Kapitel 1
Das ganze so seltsame Abenteuer begann zu einer späten Nachtstunde, als ich in meinem Arbeitszimmer saß und eine Seite der Zeitschrift Life umblätterte.
Auf den ersten Blick schien die Seite nichts zu enthalten, was mich interessieren konnte. Sie zeigte eine Zeichnung von einem Prozess, der in New York geführt wurde, 350 Meilen von mir entfernt [560 Kilometer]. Ich war nie in New York gewesen und hatte auch kein Verlangen, je dorthin zu gehen, und wenn schon, dann höchstens, um die Freiheitsstatue zu sehen. Ich begann, die Seite zu überfliegen. Dabei wurde meine Aufmerksamkeit von den Augen einer der Personen in der Zeichnung gefesselt. Ein Junge. Einer von sieben Jungen, die wegen Mordes vor Gericht standen. Der Zeichner hatte den Ausdruck von Bestürzung, Hass und Verzweiflung in seinen Zügen so meisterhaft eingefangen, dass ich die Zeitschrift noch einmal ganz aufschlug, um mir das Bild genauer anzusehen. Und indem ich es tat, fing ich an zu weinen.
„Was ist nur mit mir los!“, sagte ich laut und wischte unwirsch eine Träne weg. Ich betrachtete das Bild noch eingehender. Die Jungen waren alle Teenager. Sie waren Mitglieder einer Bande, die sich die Dragons nannte. Unter der Zeichnung stand die Geschichte, die berichtete, wie sie in den Highbridge-Park in New York gegangen waren und einen fünfzehnjährigen Poliogelähmten namens Michael Farmer brutal angegriffen und getötet hatten. Die sieben Jungen hatten Michael mit ihren Messern siebenmal in den Rücken gestochen und ihm dann mit Armee-Koppeln über den Kopf geschlagen. Beim Weggehen hatten sie sich mit den blutbeschmierten Fingern durchs Haar gestrichen und gesagt: „Den haben wir tüchtig fertiggemacht!“
Die Geschichte widerte mich an. Sie drehte mir den Magen um. In unserem kleinen Bergstädtchen schienen solche Dinge zum Glück unglaublich. Darum war ich sprachlos, als mir plötzlich der Gedanke in den Kopf sprang – so kristallklar wie von anderswo hergekommen: Geh nach New York und hilf diesen Jungen!
Ich lachte schallend auf. „Ich? Nach New York gehen? Ein Landprediger soll sich in eine Angelegenheit hineinwagen, von der er weniger als nichts versteht?“
Geh nach New York und hilf diesen Jungen! Der Gedanke war noch immer da – so lebhaft wie im ersten Augenblick und offenbar von meinen Gefühlen und Ideen völlig unabhängig.
„Ich wäre ein Narr. Ich verstehe nichts von solchen Burschen. Ich will von ihnen nichts wissen!“
Es hatte keinen Zweck. Der Gedanke wollte nicht weichen. Ich sollte nach New York gehen, und überdies sollte ich es sofort tun, solange der Prozess noch im Gange war.
Um verstehen zu können, wie völlig abwegig solch ein Gedanke mir erschien, muss man wissen, dass mein Leben, bis ich jene Seite umwandte, im Voraus festgelegt war – festgelegt, aber zufriedenstellend. Doch ich war ruhelos geworden. Ich fing an, eine Art geistliche Unzufriedenheit zu verspüren, die sich durch einen Blick auf unser neues Kirchengebäude in Philipsburg, Pennsylvania, mit seinen fünf Morgen hoch gelegenem Land, auf die anschwellende Missionskasse oder auf das Gedränge in den Kirchenbänken nicht stillen ließ. Wie man wichtiger Daten im Leben gedenkt, so erinnere ich mich haargenau an den Abend, an dem ich es erkannt hatte. Es war der 9. Februar 1958. An jenem Abend beschloss ich, mein Fernsehgerät zu verkaufen.
Es war spät, Gwen und die Kinder schliefen schon. Ich saß vor dem Gerät und schaute die Spätvorstellung an. Irgendwie gehörte zu der Geschichte die übliche Tanzerei mit einer Menge Ballettgirls, die in gerade noch sichtbaren Kostümen umhermarschierten. Ich erinnere mich, dass mir plötzlich der Gedanke kam, wie geistlos das alles ist.
„Du wirst alt, David“, sagte ich mir zur Warnung.
Doch so sehr ich mich auch bemühte, ich konnte meine Gedanken nicht mehr zurückbringen auf die abgedroschene Geschichte und das Mädchen – welches war es doch wieder?, dessen Bühnenschicksal Anspruch erhob, jedem Zuschauer Spannung bis zum Herzklopfen abzugewinnen.
Ich stand auf, drehte den Knopf und sah die jungen Mädchen in der Mitte des Bildschirms in einem kleinen Fleck verschwinden. Dann ging ich vom Wohnzimmer in mein Arbeitszimmer hinüber und setzte mich auf den braunledernen Drehstuhl.
„Wie viel Zeit verbringe ich eigentlich jeden Abend vor dem Bildschirm?“, fragte ich mich. „Wenigstens zwei Stunden. Was würde geschehen, Herr, wenn ich das Fernsehgerät verkaufte und diese Zeit – im Gebet zubrächte?“ Ich war ohnehin der einzige in der Familie, der fernsah.
Was würde geschehen, wenn ich Abend für Abend zwei Stunden im Gebet zubrächte? Der Gedanke war erheiternd: Ersetze Fernsehen durch Gebet und sieh zu, was geschieht!
Sofort kamen mir Gedanken, die sich dieser Idee widersetzten. Ich war abends müde. Ich brauchte die Entspannung und den Wechsel im Tempo. Fernsehen gehörte zu unserer Kultur; es war für einen Geistlichen nicht gut, wenn er nicht wusste, was die Leute sahen und worüber sie sprachen.
Ich stand vom Stuhl auf, drehte das Licht aus und stellte mich ans Fenster, um über die mondhellen Berge zu schauen. Dann legte ich dem Herrn wieder ein Vlies vor, eines, das bestimmt war, mein Leben zu verändern. Ich machte es Gott ziemlich schwer, wie es mir schien, denn ich wollte das Fernsehen gar nicht wirklich aufgeben.
„Jesus“, sagte ich, „ich brauche Hilfe, um diese Sache zu entscheiden, darum bitte ich dich um dies: Ich werde wegen des Geräts eine Anzeige in die Zeitung setzen. Wenn du hinter dieser Idee steckst, dann lass sofort einen Käufer erscheinen. Lass ihn innerhalb einer Stunde kommen – nein, innerhalb einer halben Stunde –, nachdem die Zeitung auf der Straße erscheint.“
Als ich Gwen am anderen Morgen von meinem Beschluss erzählte, war sie gar nicht beeindruckt. „Eine halbe Stunde!“, sagte sie. „Das klingt mir, Dave Wilkerson, als ob du gar keine Lust hast, so viel zu beten!“
Gwen hatte den Kern der Sache getroffen, aber ich setzte die Anzeige trotzdem in die Zeitung. Es gab, nachdem die Zeitung erschienen war, in unserem Wohnzimmer eine komische Szene. Ich saß auf dem Sofa. Von der einen Seite sah mich das Fernsehgerät an, von der anderen Seite sahen mich Gwen und die Kinder an, und meine Augen starrten auf einen großen Wecker neben dem Telefon.
Neunundzwanzig Minuten liefen auf der Uhr ab.
„Nun, Gwen“, sagte ich, „es sieht so aus, als ob du recht hättest. Ich denke, ich brauche nicht …“
Das Telefon klingelte.
Ich nahm langsam den Hörer ab und sah dabei Gwen an.
„Sie haben ein Fernsehgerät zu verkaufen?“, fragte eine Männerstimme.
„Ja. Ein ,RCA‘ in gutem Zustand. Neunzehn-Zoll-Bildschirm, zwei Jahre alt.“
„Wie viel wollen Sie dafür haben?“
„Einhundert Dollar“, sagte ich schnell. Ich hatte bis zu dem Augenblick noch nicht darüber nachgedacht, was ich fordern wollte.
„Ich nehme es“, antwortete der Mann ohne Weiteres.
„Wollen Sie es nicht erst ansehen?“
„Nein. Halten Sie es in fünfzehn Minuten bereit. Ich bringe das Geld mit.“
Mein Leben war seitdem nicht mehr dasselbe gewesen. Jeden Abend war ich um Mitternacht, statt wie sonst einige Knöpfe zu drücken, in mein Arbeitszimmer gegangen, hatte die Tür geschlossen und zu beten begonnen. Zuerst war es mir so erschienen, als ob die Zeit nur dahinschlich, und ich war unruhig gewesen.
Doch dann hatte ich gelernt, planmäßiges Bibellesen zum Bestandteil meines Gebetslebens zu machen. Ich hatte bis dahin noch nie die ganze Bibel durchgelesen, einschließlich aller Geschlechtsregister. Und ich hatte gelernt, wie wichtig es ist, zwischen dem Bittgebet und dem Lobgebet Gleichgewicht zu halten. Wie wunderbar ist es doch, eine geschlagene Stunde mit nichts als Dankbarsein zu verbringen! Es rückt unser ganzes Leben in eine neue Sicht.
Während einer dieser späten Gebetsstunden nahm ich die Zeitschrift Life zur Hand.
Ich war schon den ganzen Abend seltsam ruhelos gewesen. Ich war allein im Haus; Gwen war mit den Kindern bei den Großeltern in Pittsburgh zu Besuch. Ich hatte eine lange Zeit im Gebet zugebracht. Ich fühlte mich in besonderer Weise Gott nahe, und doch empfand ich aus mir unverständlichen Gründen eine große, schwer lastende Traurigkeit. Sie kam ganz plötzlich über mich, und ich wunderte mich, was sie wohl bedeuten könnte. Ich stand auf und knipste im Arbeitszimmer die Lampen an. Ich hatte ein unbehagliches Gefühl, als ob ich Befehle empfangen hätte und doch nicht ausfindig machen könnte, was für welche.
„Was willst du mir sagen, Herr?“
Ich wanderte im Arbeitszimmer umher und versuchte zu verstehen, was mit mir geschah. Auf meinem Schreibtisch lag die Zeitschrift Life. Ich streckte die Hand danach aus und begann sie aufzunehmen, fing mich dann aber. Nein, in diese Falle wollte ich nicht treten: eine Zeitschrift zu lesen, wenn ich beten sollte.
Ich nahm meine Wanderung durch das Arbeitszimmer wieder auf, und jedes Mal, wenn ich an den Schreibtisch kam, wurde meine Aufmerksamkeit auf jene Zeitschrift gelenkt.
„Herr, ist darin etwas, was du mir zeigen willst?“, sagte ich laut, und meine Stimme dröhnte plötzlich in dem stillen Haus.
Ich setzte mich in meinen braunledernen Drehstuhl und schlug mit hart klopfendem Herzen, als ob ich dicht vor etwas stünde, was mein Begreifen überstieg, die Zeitschrift auf. Einen Augenblick später besah ich eine Federzeichnung, die sieben Jungen darstellte, und dabei strömten mir Tränen übers Gesicht.
Am nächsten Abend war in der Kirche die Mittwoch-Gebetsstunde. Ich beschloss, der Gemeinde von meinem Zwölf-bis-zwei-Gebetsexperiment zu erzählen und auch von der seltsamen Anregung, die daraus hervorgegangen war.
Der Mittwochabend erwies sich als ein kalter, verschneiter Mittwinterabend. Es kamen nicht viele Leute. Ich denke, die Farmer fürchteten, in der Stadt von einem Blizzard überrascht zu werden. Selbst die zwei Dutzend Stadtleute, die sich hinauswagten, tröpfelten spät herein und strebten den Sitzen im Hintergrund zu, was für den Prediger immer ein schlechtes Zeichen ist. Es bedeutet, dass er zu einer kalten Versammlung sprechen muss.
Ich versuchte an dem Abend nicht einmal, eine Predigt zu halten. Als ich auf der Kanzel stand, bat ich alle, zu mir nach vorn zu kommen. „Weil ich Ihnen etwas zu zeigen habe“, sagte ich. Dann schlug ich Life auf und hielt ihnen die Zeitschrift hinab, damit sie sie sehen konnten.
„Sehen Sie sich die Gesichter dieser Jungen genau an“, sagte ich. Und dann berichtete ich ihnen, wie ich in Tränen ausgebrochen war und die klare Weisung bekommen hatte, selber nach New York zu gehen und zu versuchen, jenen Jungen zu helfen. Meine Pfarrkinder blickten mich steinern an. Ich drang überhaupt nicht bis zu ihnen durch und ich konnte auch verstehen, warum nicht. Das natürliche Empfinden eines jeden Menschen für diese Jungen konnte nur Abscheu sein, aber kein Mitgefühl. Ich verstand meine Reaktion selber nicht.
Doch dann geschah etwas Erstaunliches. Ich sagte der Gemeinde, ich wolle nach New York gehen, hätte aber kein Geld. Obwohl so wenig anwesend waren und obwohl sie nicht einmal verstanden, was ich vorhatte, kamen meine Pfarrkinder an jenem Abend eines nach dem anderen schweigend nach vorn und legten ein Opfer auf den Abendmahlstisch. Das Opfer machte fünfundsiebzig Dollar aus, ungefähr genug, um mit dem Wagen nach New York und zurück zu fahren.
Am Donnerstag war ich zur Abfahrt fertig. Ich hatte Gwen angerufen und ihr – ich fürchte, ziemlich erfolglos – erklärt, was ich mir vorgenommen hatte.
„Und du fühlst wirklich, dass dies die Führung des Heiligen Geistes ist?“, fragte Gwen.
„Ja, Liebes!“
„Na, dann zieh wenigstens ein Paar warme Socken an.“
Am Donnerstag stieg ich frühmorgens mit Miles Hoover, dem Jugendleiter der Gemeinde, in meinen alten Wagen und fuhr ihn rückwärts die Einfahrt hinaus. Niemand war gekommen, uns „Gute Reise“ zu wünschen: wieder ein Zeichen ihres völligen Mangels an Begeisterung für dieses Unternehmen. Und dieser Mangel bestand nicht nur bei den anderen. Ich spürte ihn selber. Ich fragte mich immer wieder, was in aller Welt mich bewog, mit einem ausgerissenen Blatt der Zeitschrift Life in der Hand nach New York zu gehen. Ich fragte mich immer wieder, warum mir der Anblick jener Jungengesichter jedes Mal, wenn ich sie besah, und sogar in diesem Augenblick die Kehle zuschnürte.
„Ich habe Angst, Miles“, gestand ich endlich, als wir die Pennsylvania Turnpike entlangfuhren.
„Angst?“
„Ja, dass ich im Begriff sein könnte, irgendetwas Törichtes zu tun. Ich wünschte, es gäbe ein Mittel, Gewissheit zu erlangen, dass dies wirklich Gottes Führung ist und nicht etwa eine verrückte Idee von mir.“
Wir fuhren eine Zeitlang schweigend.
„Miles?“
„Hm, ja?“
Ich hielt den Blick starr geradeaus gerichtet, denn ich schämte mich, ihn anzusehen. „Ich möchte gern, dass du etwas versuchst. Nimm deine Bibel und schlag sie aufs Geratewohl auf und lies mir die Bibelstelle vor, auf die du den Finger legst.“
Miles sah mich an, als ob er mich anklagte, irgendeine Art abergläubischen Ritus auszuführen, doch er tat, worum ich ihn gebeten hatte. Er griff auf den Rücksitz nach seiner Bibel. Aus dem Augenwinkel beobachtete ich, wie er die Augen schloss, den Kopf rückwärts neigte, das Buch aufschlug und den Finger entschlossen auf eine Stelle der aufgeschlagenen Seite legte.
Dann las er für sich, und ich sah, wie er sich mir zuwandte und mich wortlos anblickte.
„Nun?“, fragte ich.
Die Bibelstelle war im 126. Psalm, der fünfte und sechste Vers.
„Die mit Tränen säen“, las Miles, „werden mit Jubel ernten. Wohl schreitet man weinend dahin, wenn man trägt den Samen zur Aussaat; doch jubelnd kehrt man mit Garben heim.“
Kapitel 2
Über die Fernstraße 46, die die New Jersey Turnpike mit der George-Washington-Brücke verbindet, kamen wir in die Außenbezirke von New York. Wieder einmal machte die Logik Schwierigkeiten. Was sollte ich tun, wenn ich auf der anderen Seite der Bücke war? Ich wusste es nicht. Wir brauchten Sprit, deshalb fuhren wir an eine Tankstelle, die kurz vor der Brücke lag. Während Miles beim Wagen blieb, nahm ich den Life-Artikel, ging in eine Telefonzelle und rief den Staatsanwalt an, dessen Name in dem Artikel stand. Als ich endlich das richtige Büro erreicht hatte, bemühte ich mich, wie ein würdiger Pastor in einer göttlichen Mission zu klingen. Die Mitarbeiter im Büro des Staatsanwaltsbüros waren nicht beeindruckt.
„Der Staatsanwalt duldet keinerlei Einmischung in diesen Fall. Guten Tag, mein Herr!“
Und damit brach die Verbindung ab.
Ich verließ die Telefonzelle. Einen Augenblick blieb ich neben einer Pyramide von Ölkanistern stehen und versuchte, das Gefühl wiederzuerlangen, dass ich in einer Mission unterwegs sei. Wir waren 350 Meilen von zu Hause weg, und es wurde dunkel. Müdigkeit, Mutlosigkeit und ein leichtes Angstgefühl grinsten mich an. Ich fühlte mich verlassen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!