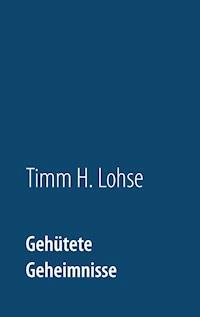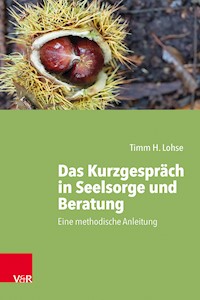
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
»Kann ich Sie kurz sprechen?« – Small Talk bestimmt in der beruflichen und privaten Kommunikation den Ton des Miteinanders und gehört auch zum Alltag in helfenden Berufen. Die Beiläufigkeit dieser meist zufälligen Gesprächssituationen lässt bewährte seelsorgliche und beraterische Gesprächstechniken oder Therapiemethoden kaum zur Anwendung kommen. Doch auch in kurzer Zeit kann ein Gespräch geführt werden, das dem Auftrag der Seelsorge entspricht, in einer spezifischen Lebens-, Krisen- oder Konfliktsituation christliche, befreiende Hilfe zur Lebensgestaltung zu leisten. Diese methodische Anleitung bietet eine an der Praxis orientierte und in Fortbildungskursen erprobte Alternative zu Seelsorgekonzepten, die Seelsorge überwiegend als Prozessgeschehen begreifen. Vor dem Hintergrund von systemischem Ansatz, Kommunikationstheorie und Semiotik werden die besonderen Gesetzmäßigkeiten, Möglichkeiten und Fallen des Kurzgesprächs erläutert. Zahlreiche praktische Gesprächsbeispiele, Tipps und Übungen für beratende Personen ermutigen dazu, Kurzgesprächen nicht mehr auszuweichen, sondern die besondere Chance zu nutzen, die ein solches Gespräch für Ratsuchende bietet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Timm H. Lohse
Das Kurzgespräch in Seelsorge und Beratung
Eine methodische Anleitung
Vom Clou des Kurzgesprächs
Mit 3 Abbildungen
5., überarbeitete und erweiterte Auflage
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
© 2020, 2003 Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Theaterstraße 13, D-37073 Göttingen
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Umschlagabbildung: © Lois GoBe/Adobe Stock
Satz: textformart, Göttingen EPUB-Produktion: Lumina Datamatics, Griesheim
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
ISBN 978-3-647-99951-7
Inhalt
Hinführung zum Kurzgespräch
1 Die Voraussetzungen des Kurzgesprächs
1.1 Kenntnisse
1.1.1 Sprachliche Aspekte
1.1.2 Systemische Aspekte
1.2 Fertigkeiten
1.2.1 Decodieren (wahrnehmen)
1.2.2 Encodieren (äußern)
2 Der Clou des Kurzgesprächs
2.1 Der andere Fokus
2.1.1 Jenseits des präsentierten Anliegens
2.1.2 Die potenzielle Komplexität
2.2 Der mäeutische Impuls
2.2.1 Der Schlüssel
2.2.2 Die Haltung der Mäeutik
2.3 Die Steuerungskompetenz
2.3.1 Die empathische Haltung
2.3.2 Die Begleitung
2.3.3 Anreize zur Kreativität
2.3.4 Das schlüssige Ende des Kurzgesprächs
3 Wozu das Kurzgespräch?
3.1 Vom Helfen
3.2 Von der Sorge um die Seele
4 Einblicke in die Praxis des Kurzgesprächs
4.1 Im Krankenhaus
4.2 Mit Kindern und Jugendlichen
4.3 In der seelsorglichen Arbeit mit Gruppen
4.4 Im Kontakt zu Menschen mit eingeschränkter Sprachfähigkeit
4.5 Im Rahmen pastoralpsychologischer Supervision
4.6 In der Geistlichen Begleitung
4.7 In der Telefonseelsorge
4.8 In der Schule
4.9 Mit Studierenden
4.10 Im Gemeindepfarramt
5 Das Kurzgespräch in der Alltagsseelsorge
Dr. Christoph Schneider-Harpprecht
5.1 Das Kurzgespräch als Methode der Alltagsseelsorge
5.2. Die Verwurzelung des seelsorglichen Kurzgesprächs im systemischen Denken
6 Anhang: Training im Kurzgespräch
6.1 Zur »günstigen Gelegenheit«
6.2 Zur Balance (UP / DOWN – IN / OUT)
6.3 Zum Konfliktkarussell
6.4 Zum Fragen
6.5 Zur Sprache
6.6 Zum mäeutischen Impuls
6.7 Schlussbemerkung
Literatur
Hinführung zum Kurzgespräch
Das Kurzgespräch ist aus dem menschlichen Miteinander nicht wegzudenken:
»Hast du mal eben Zeit …« oder:
»Vielleicht wissen Sie, was ich da machen soll …« oder:
»Ich würd’ gern deine Meinung dazu hören …«
Eltern, Freunde und Nachbarn, Richterinnen und Polizisten, Vorgesetzte und Chefs, Abteilungsleiterinnen und Ärzte, Krankenpflegerinnen und Anwälte, Busfahrerinnen und Schaffner, Pastorinnen und Küster, Apotheker und Verkäuferinnen und Lehrer – sie alle sind als Helfende gefragt oder gefordert und werden unversehens in kurze »Nebenbeigespräche« verwickelt, in denen es weniger um ihre Fachkenntnisse geht als vielmehr um die Hoffnung, dass sie ihrem Gegenüber einen Ausweg aus einer persönlichen, betrieblichen oder sonstigen »Sackgasse« weisen könnten. Die Bereitschaft, zu helfen, ist dann das eine, die Kunst, zu helfen, das andere.
Dieses Buch will zunächst Einblicke in die vorausgesetzten Kenntnisse und Fertigkeiten des Kurzgesprächs geben, um dann den »Clou« des Kurzgesprächs aufzuzeigen.
Personen aus helfenden Berufen stehen Kurzgesprächen meist ambivalent gegenüber. Einerseits fühlen sie sich sicher, Gespräche führen zu können, wenn diese gemäß den Regeln ihrer Aus- und Fortbildung ablaufen. Beim Kurzgespräch sind die Gegebenheiten jedoch anders:
–Der Zufall bestimmt Ort und Zeit des Gesprächs.
–Die Beiläufigkeit scheint dem Ernst des Anliegens zuwiderzulaufen.
–Die Einmaligkeit lässt viele Gesprächstechniken und Therapiemethoden ins Leere laufen.
Und so werden die Angesprochenen unsicher. Auch wenn es niemand gern zugibt, jetzt häufen sich die gröbsten Fehler der Gesprächsführung, die ein Scheitern des Gesprächs fast unausweichlich werden lassen:
–Man kommt vom Hundertsten ins Tausendste.
–Ein Vorschlag folgt dem andern und wird doch wieder als untauglich verworfen.
–Schließlich werden Scheinargumente1 ins Feld geführt, mit deren Hilfe das eigentlich »ungewollte« Gespräch zu Ende gebracht, spitzer: abgebrochen werden soll.
Eine postkommunikative Depression ist die unangenehme Folge. Der felsenfeste Entschluss, sich nie wieder auf solch ein Gespräch einzulassen, soll das Selbstwertgefühl dann wieder aufrichten. Zugegeben, das ist ein wenig bissig formuliert. Ernsthaft betrachtet weiß aber wohl jede beratende Person, dass sie sehr wohl in der Lage ist, im vertrauten Setting gute Gespräche zu führen. Die zufällig sich ergebenden oder einmalig verabredeten Gespräche laufen jedoch irgendwie nach anderen geheimnisvollen Regeln ab, deren Kenntnis ein Scheitern möglicherweise verhindern könnte.
Dieses Buch will Einblicke in den besonderen Charakter solcher Gespräche geben. Angesprochene Personen könnten sich dann ermutigt fühlen, solchen Gesprächen nicht mehr auszuweichen, sondern die besondere Chance zu nutzen, die ein »Kurzgespräch« für Ratsuchende bietet. Ich bin davon überzeugt, dass diese Form der Interaktion sehr wohl auch als »Beratung« bzw. »Seelsorge« begriffen und ergriffen werden kann.
Der Begriff »Kurzgespräch« weckt zunächst und vor allem das Missverständnis, dass es sich um ein zeitlich kurzes Gespräch handelt, und das wirft zugleich die Frage auf: Ja, wie lange denn? – 5 Minuten, 10 Minuten oder wie lange? An dieses Missverständnis hängen sich weitere an:
–Beim Kurzgespräch muss alles ganz schnell gehen.
–Beim Kurzgespräch wird Wesentliches weggelassen.
–Beim Kurzgespräch darf man sich auf keine tiefere Beziehung einlassen.
–Beim Kurzgespräch sollte man nicht Emotionen thematisieren.
Das Wort »Kurzgespräch« provoziert dieses Missverstehen, legt es vielleicht geradezu nahe, denn mit »kurz« und »Gespräch« assoziieren viele intuitiv eben etwas zeitlich Begrenztes.
Zu dem zeitlichen Missverständnis gesellt sich beim Wort »Kurzgespräch« ein weiteres, nämlich die (inhaltlich falsche) Vorstellung, es ginge in diesem Gespräch um kurz und knapp, also: Kurz geht doch nur, wenn man etwas verkürzt. Schärfer formuliert heißt das dann: Im Kurzgespräch wird die ratsuchende Person kurz abgefertigt. »Lästige« Anfragen »kurz erledigen« zu können, mag für angesprochene Personen irgendwie reizvoll sein, da sie dem Dilemma des Zwischen-Tür-und-Angel-(oder zu anderer unpassender Gelegenheit)-Angesprochen-Werdens gern etwas Abwehrendes und zugleich doch noch für die ratsuchende Person Hilfreiches entgegensetzen möchten. Das Kurzgespräch gleichsam als ein Patentrezept für eine kurze und knappe, aber doch galante »Abfertigung«.
Und noch ein drittes Missverständnis: Im »Kurzgespräch« geht es darum, kurz und bündig das »In-Unordnung-Geratene« im Leben des ratsuchenden Menschen wieder auf Linie zu bringen. Die Übersetzung des Kurzgespräch-Buches ins Niederländische trägt den Titel »Het bondige gesprek«. Bündig – dieses Wort »bedeutet zunächst ›festgebunden, in einem Bund‹ und bekommt dann in der Handwerkersprache die Bedeutung auf gleicher Höhe abschließend (wie etwa Stäbe in einem Bund)« (Kluge 2002, S. 160). Auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren, gehört zur Grundhaltung im Kurzgespräch. Die Assoziationen jedoch, die dieses (handwerkliche) Verständnis des Wortes »bündig« weckt, sind aus meiner Sicht nicht hilfreich, da sie unzutreffend ein mechanistisches, handwerkliches Agieren im Kurzgespräch nahelegen. Im übertragenen Sinn meint »bündig« im Deutschen etwa: Da ist etwas stimmig, alles Wesentliche ist erfasst, alles Unwesentliche beseitigt. Das trifft zwar auf das Kurzgespräch zu, und doch führt dieses Attribut nicht zu einem hilfreichen Verständnis des Begriffs »Kurzgespräch«, da es ein Ergebnis beschreibt und nicht den inhaltlichen Prozess.
Die Konzentration auf die Wesensmerkmale des Kurzgesprächs2 eröffnet einen anderen Zugang zum Begriff »Kurzgespräch«. Es sind vier Wesensmerkmale, die das Kurzgespräch charakterisieren:
1.Sprache
Geschult in der Verbalisierung von Gemütszuständen der ratsuchenden Person stellte ich beim Einsatz dieser Methode im Gespräch mit ungewollt schwangeren Frauen fest, dass meine Verbalisierungsangebote eher Unwillen und Widerstände erregten, als dass sie die Frau einluden, sich zu öffnen. Was blieb mir dann zu sagen? Ich wusste erstmal nichts.
Deshalb versuchte ich einen anderen Weg: Ich benutzte ausschließlich Wörter aus dem »Gesprochenen« der vor mir sitzenden Frau und bildete aus diesen mein Antworten. Zu meiner Überraschung kam auf diesem Wege ein Gespräch zustande – anders vermutlich, als die Frau und auch ich erwartet hatten: Ich war verwundert, wie und worüber wir nun ins Gespräch kamen. Mein Gegenüber gab den Ton und die inhaltliche Ausrichtung an, auf die ich mich einließ. Es war ein Gespräch auf Augenhöhe und stets würdig zweier erwachsener Menschen.
Diesen Ansatz erweiterte und verfeinerte ich. Der Grundgedanke jedoch blieb gleich: Jeder Mensch hat sein Idiom3, seine sprachliche Eigentümlichkeit, geprägt durch seine Lebensgeschichte. Gelingt es mir, mich seines Idioms zu bedienen, fühlt sich der Mensch unmittelbar angesprochen. Er wird offen und bereit, sich in seinem Wesenskern zu entdecken und zu offenbaren. Es entsteht eine besondere Nähe, ja Intimität, weil ich seinen Code, seine »Geheim- sprache« benutze.
2. Anerkennung der Person
Das Gefühl, anerkannt zu werden, ergibt sich daraus, dass der Mensch seine Sprache sprechen darf und kann und nicht auf die Verbalisierung des Gegenübers reagieren muss. Diese Anerkennung der Person wird verstärkt, wenn der Mensch nicht auf seinen Konflikt angesprochen und auf diesen reduziert wird oder darauf, diesen möglichst so zu präsentieren, dass ihm »geholfen« werden muss. Den Konflikt aufzugreifen, läuft stets die Gefahr, die Kommunikation auf das präsentierte Anliegen einzuschränken und die Ganzheit der Person aus den Augen zu verlieren. Rückt jedoch die Person und nicht das Anliegen in den Mittelpunkt der Kommunikation, erhält die ratsuchende Person die Freiheit (Autonomie), das an- und auszusprechen, was ihr jetzt und hier wichtig ist. Die in dieser Person steckenden Möglichkeiten freizusetzen, gelingt durch die Aufnahme der Sprache dieser Person jenseits des vorgetragenen Anliegens. Diese Anerkennung seiner gesamten Person erlebt der ratsuchende Mensch als eine empathische Stärkung seiner Autonomie: Er ist und kann mehr als das präsentierte Anliegen, das ihn vollends zu beherrschen scheint, und zugleich bestimmt er, worüber geredet/nachgedacht/entschieden wird.
3. Der mäeutische Impuls
Eine besondere Beförderung der Autonomie erfährt die ratsuchende Person durch mäeutische Impulse von der angesprochenen Person. Der Kronzeuge für die Mäeutik ist der griechische Philosoph Sokrates: Mit seinen mäeutischen Impulsen will Sokrates die in der Meinung des Gegenübers enthaltene »Wahrheit« seiner Sicht der Weltwirklichkeit ans Licht der Welt bringen.
Im Kurzgespräch wird versucht, mit einem mäeutischen Impuls den festgefahrenen inneren Dialog des Gegenübers wieder in Gang zu bringen, offensichtliche oder verdeckte Widersprüche zu hinterfragen und so die Selbstkongruenz des Gegenübers zu befördern, die es ihm möglich macht, sein Leben selbstständig und mit gutem Gefühl zu führen.
4. Seelsorge
Die seelsorgliche Haltung in einem Kurzgespräch ist nicht an die Profession eines Menschen gebunden (pfarramtlicher oder diakonischer Dienst), sie ergibt sich vielmehr für jeden Menschen aus der Wachsamkeit für das seelische Befinden eines Mitmenschen, das irgendwie gestört und in Schieflage geraten ist. Sein seelisches Gleichgewicht ist in der Tiefe gestört oder auch erschüttert, sodass der Eindruck in ihm Oberhand gewinnt, ein inautonomes Mängelwesen zu sein, das ohne fremde Hilfe nicht mehr weiterkommt. Die Sorge um seine Seele richtet sich darauf, die Autonomie der ratsuchenden Person so zu stärken, dass dieser Mensch sein Leben (mit seinen Defiziten) wieder aus sich heraus gestalten kann. Die ratsuchende Person spürt, dass ihr Gegenüber ihr das zutraut, und besinnt sich auf die in ihr schlummernde Vielfältigkeit, die ihr neue Türen und Wege aufzeigt. Die seelsorgende Haltung ist eine zentrale christliche Lebenseinstellung – gänzlich unabhängig von der Profession. Das »Kümmern um den Konflikt«, das aufseiten der angesprochenen Person meist von dem unangenehmen Empfinden der eigenen Insuffizienz begleitet ist, wird am Ende von der ratsuchenden Person als Enttäuschung (weil ergebnislos) erlebt. Die seelsorgliche Haltung dagegen wird als behütende Nähe empfunden.
Diese vier Wesensmerkmale des Kurzgesprächs sind miteinander verwoben und dienen zielgerichtet der ratsuchenden Person, sich auf sich selbst und die eigenen Möglichkeiten/Fähigkeiten zu besinnen und mit dem vorgetragenen defizitären Leben eigenständig fertig zu werden.
Die oben dargelegten vier Wesensmerkmale des Kurzgesprächs haben alle eine klare Richtung: Sie führen – jede für sich und alle gemeinsam
auf kurzem Wege zum Kern der ratsuchenden Person,
ohne sonderlichen Rekurs auf ihre soziale Vernetzung oder lebensgeschichtlichen Erfahrungen. Denn das ist das Ziel, dass die ratsuchende Person ihr Leben autonom führt. Deshalb sollte im Fokus des Kurzgesprächs der kürzeste Weg dorthin beschritten werden. Das ist der Clou des Kurzgesprächs.
Abb. 1: Die vier Wesensmerkmale des Kurzgesprächs
Die ratsuchende Person wird – jenseits ihres vorgetragenen Anliegens – wieder »lebendig«, findet also wieder Zugang zu ihrer »potentiellen Komplexität« (Foerster 1996, S. 49).
Wie das in einem Kurzgespräch erreicht werden kann, wird im 2. Kapitel dieses Buches dargelegt. Zunächst jedoch ist es unerlässlich, in einem vorgelagerten Kapitel (1) auf die vorausgesetzten Kenntnisse und Fertigkeiten für den Clou des Kurzgesprächs hinzuweisen. Anschließend wird in Kapitel 3 die Wirkung und Sinnhaftigkeit des Kurzgesprächs für die ratsuchende Person entfaltet. Die Beispiele für Kurzgespräche aus der Praxis in Kapitel 4 dienen der Veranschaulichung dieser Methode. Die Ausführungen von Prof. Dr. Schneider-Harpprecht ordnen diese Methode in die Arbeit der Praktischen Theologie und Seelsorge ein. Der Anhang bietet Absolventinnen und Absolventen einer Grundausbildung der AgK4 im Kurzgespräch Trainingsanleitungen für einige Grundfertigkeiten dieser Methode.
1Z. B.: »Habe leider keine Zeit mehr …«
2Siehe dazu auch www.timmlohse.de
4Arbeitsgemeinschaft Kurzgespräch e. V.: www.kurzgespraech.de
1 Die Voraussetzungen des Kurzgesprächs
Bevor der »Clou« des Kurzgesprächs aufgezeigt wird, lege ich zunächst dar, welche Kenntnisse im kommunikativen Verhalten unerlässlich sind; diese werden bei den Ausführungen des Clous als bekannt bzw. gekonnt vorausgesetzt.
Die sprachlichen und systemischen Kenntnisse werden in dem Rahmen und Umfang dargelegt, wie sie für die Praxis des Kurzgesprächs notwendig sind5. Diese Kenntnisse sollten im Kopf der angesprochenen Person präsent und abrufbar sein, damit sie sich bei der verbalen, non- und paraverbalen Kommunikation mit Bedacht und behutsam äußern kann.
1.1Kenntnisse
1.1.1 Sprachliche Aspekte
Wir bedienen uns im Gespräch wie selbstverständlich der für beide beteiligten Personen gewohnten Sprache, in der stillschweigenden Annahme, jede beteiligte Person »verstünde« den jeweiligen sprachlichen Ausdruck der anderen. Diese Annahme trügt jedoch.
Die Aussage »Ich liebe meinen Mann nicht mehr« scheint umgangssprachlich sofort verständlich, provoziert beim Gegenüber jedoch das Unbehagen: Wie ist »nicht mehr lieben« zu verstehen? Was genau will dieser Mensch mir damit eigentlich sagen?
Spracherwerb und Sprachgebrauch unterliegen einem absolut individuellen Lern- und Lebensprozess, eingebettet in die je eigene Familie, die ihrerseits vernetzt ist in ein ihr zugehöriges soziales Netzwerk, das einer größeren Sprachgemeinschaft zugehörig ist. Erst der erlernte Sprachkonsens innerhalb einer Familie, eines sozialen Netzwerkes, einer Sprachgemeinschaft ermöglicht eine »umgangssprachliche« Verständigung.
Deshalb ist es zunächst angezeigt, einen Einblick in die Entwicklung der menschlichen Sprache, der persönlichen Sprache, des Sprachausdrucks und des Verstehens von Sprache zu gewinnen.
Sprachentwicklung
Michael Tomasello (2009) erweitert in seiner vorgelegten Untersuchung über »Die Ursprünge der menschlichen Kommunikation« die Erkenntnisse hinsichtlich des persönlichen Spracherwerbs auf geschichtliche Prozesse der Sprachentwicklung. Die nichtsprachliche Infrastruktur des intentionalen Verstehens über Zeigegesten, Blickkontakt, gemeinsames Interesse und Handeln ermöglicht demnach überhaupt erst die Entwicklung eines sprachlichen Codes (Tomasello 2009, S. 168 ff.). Über Augenmerk, Mimik, Gestik kann rekursiv erkannt werden, dass zwischen den nichtsprachlich Kommunizierenden
–eine gemeinsame Aufmerksamkeit für die gegenwärtige Situation,
–ein gemeinsames Verständnis der gegenwärtigen Situation,
–ein gemeinsamer begrifflicher Hintergrund der unmittelbaren Wahrnehmungsumgebung
besteht. Aus dieser nichtsprachlichen Infrastruktur entwickelt sich – so Tomasello – dann Sprache auf der Basis arbiträrer Codes, d. h. beliebiger (und zufälliger) Zeichen der jeweiligen Sprache.
Um hilfreich und zu beider Nutzen kooperativ kommunizieren und handeln zu können, müssten die Beteiligten sich »einig« sein über das, wie sie beide denken und deuten und was sie beide wissen und was ihnen beiden wichtig ist. Dieser gemeinsame begriffliche Hintergrund wird in Sprechhandlungen innerhalb eines bekannten (vertrauten) sozialen Umfeldes stillschweigend vorausgesetzt. Die alltäglichen umgangssprachlichen Kommunikationsakte »funktionieren« weitgehend nach dem Muster: Ich gehe davon aus, dass du so »tickst« wie ich, dass wir im Prinzip dieselbe Sprache sprechen, also: »Ich denke, dass du denkst, dass ich denke …, also sprichst du so, wie ich spreche …, also können wir uns prima unterhalten.« Der je eigene »Bedeutungstiefengrund«6 wird dabei jedoch unterdrückt, entscheidend ist der konsensuelle Gebrauch von Sprache, wie er sich in der Konvention des vorherrschenden sozialen Gefüges entwickelt hat.
Erst aufkommendes Missverstehen bringt die laufenden Kommunikationsakte ins Stottern: »Du verstehst mich nicht! – Du verstehst nicht, was ich dir sagen will!« Die kooperative Kommunikation bricht zusammen, es kann ein offener Streit darüber ausbrechen, wer was wann wie gesagt und gemeint hat, das heißt: Die sprachlichen Aussagen werden im Nachhinein von einer Metaebene aus rekonstruiert, analysiert und »richtig« gestellt, und erst jetzt kann der (im besten Fall) Bedeutungstiefengrund beider Beteiligten ins Blickfeld kommen. Der begriffliche Hintergrund ist – trotz aller konsensuellen Konvention – nicht automatisch vorhanden, so nah man sich auch sein mag.
»Die Fähigkeit, einen gemeinsamen begrifflichen Hintergrund zu schaffen – gemeinsame Aufmerksamkeit, geteilte Erfahrung, gemeinsames kulturelles Wissen –, ist eine absolut entscheidende Dimension aller menschlichen Kommunikation, einschließlich der sprachlichen« (Tomasello 2009, S. 15).
In der Umgangssprache meint doch jeder Mensch, den begrifflichen Hintergrund von »lieben« zu kennen. Hinter den arbiträren Zeichen »l-i-e-b-e-n« verbirgt sich (davon gehen wir aus) ein konventioneller Konsens, der sprachgeschichtlich bis ins Sanskrit verfolgt werden kann, der jedoch bedeutungsgeschichtlich nachprüfbaren Wandlungen unterworfen ist: Zeige ich auf einen Mann und eine Frau oder auf zwei Frauen oder zwei Männer oder ein Kind und einen Erwachsenen, zwei Kinder usw. und benutze das Buchstabengefüge »lieben«, werden wir im Gespräch unseren begrifflichen Hintergrund zu klären haben: Worin stimmen wir überein, was ist uns wichtig, worauf wollen wir hinaus?
Unser Miteinander-Sprechen wird erst effektiv, wenn wir uns einigen, das Buchstabengefüge eines Wortes (z. B. l-i-e-b-e-n) auf dieselbe Weise zu verwenden. Und dieser Aufgabe werden wir uns stellen, sofern die entschiedene Absicht verfolgt wird, wir wollen etwas miteinander teilen, und mit dem »Teilen« helfen wir uns, zu kooperieren – in welcher Angelegenheit auch immer. Je solider der gemeinsame begriffliche Hintergrund ist, desto weniger Sprache ist notwendig; und umgekehrt: Je dürftiger der gemeinsame begriffliche Hintergrund ist, desto mehr muss gesprochen werden (Tomasello 2009, S. 320).
Es kommt also darauf an, dass und inwieweit die Kommunizierenden wechselseitig erkennen, ob und dass sie einen gemeinsamen begrifflichen Hintergrund haben, aus dem heraus sie eine für beide verständliche Sprache entwickeln.
Beispiel:
»Ich komme mit meiner Kollegin nicht klar. Ich durchschau sie nicht. Ich halte sie für ein Biest!«
Umgangssprachlich scheint diese Aussage ohne Mühe verständlich, auch wenn die Einzelheiten des »Problems« noch nicht offenbart worden sind.
Doch was »meint« die ratsuchende Person in ihrem begrifflichen Hintergrund mit: »nicht klarkommen« – »Kollegin« – »durchschauen« – »halten für« – »Biest«?
Wenn die angesprochene Person für alle diese arbiträren Codes ihren Bedeutungstiefengrund als gemeinsamen begrifflichen Hintergrund annimmt, gehört nicht viel dazu, ein »Aneinander-vorbei-Reden« und, daraus folgend, ein Missverstehen zu prognostizieren.
Andersherum: Wenn die angesprochene Person mit der ratsuchenden Person hilfreich zusammenwirken will, gilt es, zunächst in mindestens einem zentralen Buchstabengefüge dieser Aussage den gemeinsamen begrifflichen Hintergrund zu erarbeiten, um teilen und helfen zu können.
Erfolgreich mit einer anderen Person zu kommunizieren, setzt voraus, »dass wir beide gemeinsam wissen, dass wir eine Konvention auf dieselbe Weise verwenden« (Tomasello 2009, S. 120). Dieses Wissen bestimmt unseren alltäglichen Umgang mit Menschen.
Wird jedoch der Kommunikationsakt auf eine Entscheidungsfindungssituation verdichtet, wird der jenseits der konventionellen Sprache vorhandene Bedeutungstiefengrund zum hilfreichen Ansatzpunkt, um erfolgreich miteinander ins Gespräch zu kommen.
Beispiel:
»Mir ist nicht mehr zu helfen.«
Was (nicht: welches Problem) verbirgt sich hinter dieser umgangssprachlich üblichen Sprachformulierung für den Menschen, der sie ausspricht:
–der Appell: »Hilf mir!«?
–die Feststellung: »It’s all over now _«?
–der Hinweis: »Bitte (kein) Mitleid.«?
Das Bemühen um eine Entschlüsselung des gemeinten Hintergrunds dieser Aussage wird die Kommunizierenden vor weitreichenden Irr- und Umwegen bewahren. So sehr dabei die umgangssprachgeschichtliche Entwicklung etwa des Buchstabengefüges »h-e-l-f-e-n« mit zu bedenken ist, entscheidend wird in der Krisensituation sein, welche Weltsicht der ratsuchenden Person zu »h-e-l-f-e-n« vermittelt worden ist, die sie in ihrer Tiefenstruktur bewahrt. Denn neben der in der Evolution sich entwickelnden und verändernden Bedeutung von »h-e-l-f-e-n« hat jede Person zudem von klein auf ihre eigene Bedeutung dieses Wortes erworben.
»Sprechhandlungen sind gesellschaftliche Handlungen, die eine Person absichtlich an eine andere richtet (und hervorhebt, dass sie dies tut), um deren Aufmerksamkeit und Vorstellungskraft auf bestimmte Weise zu lenken, so dass sie das tut, weiß oder fühlt, was die erste Person von ihr will. Diese Handlungen funktionieren nur dann, wenn beide Beteiligten mit einer psychologischen Infrastruktur von Fertigkeiten und Motivationen geteilter Intentionalität ausgestattet sind, die sich zur Erleichterung von Interaktionen mit anderen bei gemeinschaftlichen Tätigkeiten entwickelt hat. Die Sprache, oder besser die sprachliche Kommunikation, ist daher nicht irgendeine Art von formalem oder sonstigem Gegenstand; vielmehr ist sie eine Form gesellschaftlichen Handelns, konstituiert durch gesellschaftliche Konventionen, um gesellschaftliche Zwecke zu erreichen, welche zumindest auf einem gewissen geteilten Verstehen und geteilten Zielen der Benutzer beruhen.« (Tomasello 2009, S. 363)
Spracherwerb7
Sprechen konstituiert menschliches Miteinander. Spreche ich mit einem oder mehreren Menschen, trete ich in Beziehung zu ihm/ihnen. Will ich mit einem Menschen etwas gemeinsam machen, werden wir miteinander reden und uns abstimmen, wie und wo und wann und was. Das funktioniert in bestimmten Situationen auch ohne Sprechen:
Ein Blickkontakt, eine kurze Kopfbewegung nach hinten oben rechts reichen, um meiner Frau zu signalisieren: »Komm, wir hauen ab!« Verständigung läuft über verbale, nonverbale und paraverbale Äußerungen.
Gehe ich ins Theater, werde ich anschließend mit meiner Frau reden, und sie wird wie ich das Erlebte (sprachlich) beurteilen; und sind wir unterschiedlicher Meinung, werden wir unser Urteilen wortgewandt begründen. Komme ich zu spät zu einem verabredeten Termin, werde ich meine Stimme erheben und mich mit Worten rechtfertigen. Dazu »benutzen« wir – ohne großes Nachdenken – unsere bis dahin erlernten Ausdrucksmöglichkeiten in Mimik, Gestik und Sprache. Dieses Sprechen haben wir von klein auf gelernt.
Meist sind es die Mutter und der Vater, die ihrem Kind das Sprechen »beibringen«; dazu kommen die Geschwister, Babysitter, Verwandte, Nachbarn: Ein-Wort-, Zwei-/Drei-Wort-»Sätze«, der erste »vollständige« Satz – welch ein Fortschritt! Bald kann man mit dem Kind schon »richtig« reden, eine gute Voraussetzung, wenn das Kind in die Kindertagesstätte kommt. Der Sprachschatz erweitert sich. »Das Sprechenlehren und das Sprechenlernen sind die fundamentalsten Kommunikationsakte. Die Lehr- und Lernsituation ist die Grundform des Dialogs« (Track 1977, S. 13).
Das Kind erlebt sich elementar in seiner dialogischen Existenz, zugleich jedoch erlernt es Sprache nur in einer vermittelten Form: Die Mutter zeigt auf den Ball und lautet/spricht: »Ball« – so oft, bis das Kind es ihr nachlautet/-spricht. So lernt das Kind nicht nur einen bestimmten Teil seiner umgebenden Wirklichkeit mit der willkürlichen Laut-(und später Buchstaben-)Kombination von »b-a-l-l« zu bezeichnen8/benennen, sondern weiterführend, dass es »bedeutsam«9 ist, dieses runde Ding sprachlich von der übrigen Weltwirklichkeit zu unterscheiden. Die Mutter vermittelt mit der Lautartikulation zugleich Bedeutung. Wie bedeutsam »Ball« für dieses Kind im weiteren Leben ist, wird von vielen weiteren individuellen und/oder gemeinschaftlichen Lernerfahrungen mit »Ball« entschieden. »Sprechen lernen bedeutet, bewerten lernen und etwas bedeutsam werden zu lassen« (Track 1977, S. 18).
Wenn dieses Kind als erwachsene Person sprachlich das Wort »Ball« benutzt, ist seinem Gegenüber dieser persönliche Bedeutungshintergrund nicht klar. Hinsichtlich des Wortes »Ball« scheint das wohl eher unerheblich. Wenn es jedoch um »Krieg« oder »Frieden« geht, um »lieben« oder »verzeihen«, »ärgern« oder »trinken« und um die damit je persönlich verbundenen, im »Tiefengrund«10 verankerten Weltansichten, ist das Konstituieren eines menschlichen Miteinanders sprachlich nicht »so eben mal« möglich.
»Der Sprechenlernende steht nicht am Nullpunkt, sondern hat seinen Ort innerhalb der Geschichte. Er ist hineingestellt in die Geschichte seiner Sprachgemeinschaft. Diese Sprachgeschichte ist die Basis, die ihm den Spielraum zu eigenem Sprechen ermöglicht« (Track 1977, S. 18).
Die Freiheit, diesen Spielraum je für sich zu haben und zu nutzen, wird beim unbedachten Sprechen, beim Erörtern, beim Diskutieren meist ignoriert und führt zwangsläufig zur Meinungsverschiedenheit, zum Streit über »wahr« und »falsch«, zum Abbruch des Gesprächs: »Du verstehst mich nicht!«
In der Diskrepanz zwischen den Wort-(Buchstaben-)Kreationen und deren Bedeutungstiefengrund der je neu aufkommenden Jugendsprache und der Sprache der Altvorderen und deren Bedeutungszuschreibungen macht das beispielhaft deutlich: »Geil« bedeutet für Oma und Opa etwas ganz anderes als für ihre 13-jährige Enkeltochter.11
Im Kurzgespräch spielt der Respekt vor dieser Differenz im persönlichen Bedeutungstiefengrund aller benutzten Wörter eine zentrale Rolle. Die individuellen Bedeutungszuschreibungen für sprachliche Begriffe zwischen Menschen gleichen Sprachidioms sind nicht deckungsgleich. Diese Differenzen gilt es zu beachten und, wenn möglich und für ein wirkliches Verstehen gewünscht, grenzüberschreitend zu akzeptieren bzw. sich ihnen anzunähern.
Sprachfindung12
»Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll. Mir fehlen die Worte.«
Auch die sprachgewandteste Person wird auf diese Erfahrung zugreifen können, dass die erlernte konventionelle Sprache kein Buchstabengefüge für das hat, was sie »sagen« möchte. Ein Blick in die sogenannte Jugendsprache offenbart, dass insbesondere Jugendliche sich mit dem, was »in ihnen ist«, nicht im vorgefundenen und erlernten Wortschatz der Vorgeneration wiederfinden. Sie werden überkommene Wörter in ihrem Sinne umdeuten oder sprachschöpferisch neue Wörter »erfinden«. Dass Menschen »ihre« Sprache zu finden suchen, begleitet die Menschheitsgeschichte. Denn Menschen wollen zu jeder Zeit sprachlich ausdrücken, was sie sehen, hören, riechen, fühlen oder schmecken und was sie innerlich dabei erleben und empfinden. Von Aristoteles wird überliefert:
»Es ist nun das, was in der stimmlichen Verlautbarung (sich begibt), ein Zeigen von dem, was es in der Seele an Erleidnissen gibt, und das Geschriebene ist ein Zeigen der stimmlichen Laute.« (zitiert nach Heidegger 1959, S. 96)
Die inneren Erlebnisse suchen und brauchen einen Weg, sich in Sprache umzusetzen. Über 2000 Jahre später schreibt Wilhelm von Humboldt:
»Man muss die Sprache nicht sowohl wie ein totes Erzeugtes, sondern weit mehr wie eine Erzeugung ansehen, mehr von demjenigen abstrahieren, was sie als Bezeichnung der Gegenstände und Vermittelung des Verständnisses wirkt, und dagegen sorgfältiger auf ihren mit der inneren Geistestätigkeit eng verwebten Ursprung und ihren gegenseitigen Einfluss darauf zurückgehen.« (zitiert nach Heidegger 1959, S. 98)
Sprechen ist eng verwoben mit dem, was im Inneren geistig bewegt wird. Wenn wir sprechen, wollen wir aus-drücken, was wir in uns mittels aller fünf Sinne wahrnehmen: Ich denke bei mir, ich höre auf meine innere Stimme, ich sehe mit meinem geistigen Auge, ich fühle eine innere Kraft oder Ohnmacht, ich rieche den Verrat, ich schmecke den Tod. Dieser innere Dialog oder Monolog, je nachdem, wie einig man mit sich ist, wird in einer inneren Sprache geführt. Mir sagt die innere Sprache etwas, worauf ich mit meinem inneren Ohr höre. Heidegger nennt das, was das innere Ohr vom inneren Dialog hört, »Sage« (Heidegger 1959, S. 104 ff), und folgert daraus, dass die »Sage« den Menschen zum Sprechen bringt. Der Mensch will zur Sprache bringen, was ihn innerlich geistig-seelisch bewegt. »Die Sage ist es, die uns, insofern wir auf sie hören, zum Sprechen der Sprache gelangen lässt.« (Heidegger 1959, S. 105)
Auf dem Weg von der »Sage« zur Sprache ist der Sprechende darauf angewiesen, was die ihn gelehrte und von ihm erlernte Sprache ihm »sagt«. Wir hören »auf die Sprache in der Weise, dass wir uns ihre Sage sagen lassen« (Heidegger 1959, S. 104).
Dieser Bedeutungstiefengrund einer Lautkonstellation wird uns vermittelt (s. o.); wir wachsen in eine Sprachgemeinschaft hinein, in der ein relativer gemeinsamer begrifflicher Verstehenshintergrund das Kommunizieren erfolgreich werden lassen kann.
Allerdings ereignet sich gelegentlich die (schmerzliche) Erfahrung, dass die »Sage« der gelehrten und erlernten Sprache nicht deckungsgleich ist mit unserer inneren »Sage«. Wir finden das passende Wort nicht, obwohl wir hineingewachsen sind in das Sprachgeschehen und wir uns die »Sage« der Sprache verinnerlicht haben. Wir können uns nicht in Sprache aus-drücken und uns nicht verständlich machen, und unser Schweigen ent-spricht unserem Unvermögen, die innerlich gehörte »Sage« in Worte zu kleiden.
Darüber hinaus ist die Korrespondenz13 zwischen der Tiefenstruktur einer Person und der Oberflächenstruktur ihres Ausdrucks nicht ständig gewährleistet:
Im Small Talk wird sie gegen null gefahren, im dichten engagierten Gespräch ist sie hoch aktiv. Es ist uns Menschen möglich, stundenlang zu reden, ohne etwas zu sagen. Gelegentlich befleißigen wir uns einer rauschenden Schwatzhaftigkeit, um nicht schweigen zu müssen und damit zum Aus-druck zu bringen, dass wir innerlich nicht beteiligt sind. Auch greifen wir mit fortschreitendem »Erwachsenwerden« zu erlernten Formelsprachen in der Meinung, so eher und besser verstanden zu werden, als wenn wir Kontakt mit unserer inneren Sage aufnehmen und die (geäußerte) Sprache wählen, deren Sage am dichtesten dazu passt. Der sogenannte Psychojargon, in den Menschen verfallen, wenn es eigentlich ans Eingemachte, an die innere geistig-seelische Störung/Verwerfung/Bewegtheit geht, gehört ebenso dazu wie die »Sprache politischer Korrektheit«, in der von gesellschaftlichen Verwerfungen in gestanzten Phrasen geschwafelt wird.
Beispiele:
–»Ich leide an depressiven Verstimmungen.« Was genau will diese Person aus ihrer »Sage« mit mir teilen?
–»Prekariat« oder »Migrationshintergrund«. Im politisch-gesellschaftlichen Diskurs begegnet uns solche nichts aussagende Kürzelsprache; für ein wechselseitiges Verstehen und eine Verständigung sind diese Sprachgeräusche jedoch nicht hilfreich.
Sprachmodulation14
Zu einem Menschen gehört unverwechselbar seine Stimme und auch seine Fähigkeit, die Stimme zu heben oder zu senken, laut oder leise zu reden, sie zittern zu lassen oder zu grölen, sanft oder hart, bestimmt oder verwaschen zu sprechen. Mit unserer Stimme stellen wir Vertrautheit her oder schaffen Distanz; mit ihr signalisieren wir Interesse oder Gleichgültigkeit. Fast unabhängig von den gesprochenen Buchstabenkombinationen »kriegen wir mit«, ob eine Person verstimmt ist, ob sie be-stimmt redet, ob sie sich mit mir ab-stimmen will, ob sie mir zu-stimmt. Der Ton macht eben die Musik:
»Ich hab dir doch gesagt, dass ich dich liebe!«
»Aber wie du das gesagt hast, glaube ich dir nicht!«